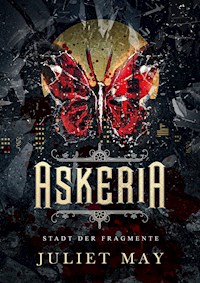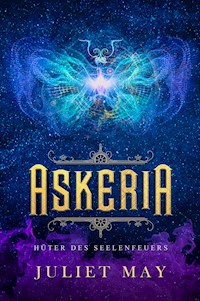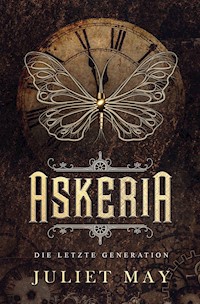
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Welt im Glanz der Sonne, voll Wohlstand, perfekt? Wer diesen Zustand hinterfragt, »dient nicht dem Schutze der Menschheit.« Doch hat nicht alles im Leben seinen Preis? »Suche nach Askeria und lass den Schmetterling vor ihren Augen fliegen.« Die Worte ihres Bruders Souta sind der jungen Piara ein Rätsel – doch davon gibt es in ihrem Leben bereits mehr als genug. Das Mädchen trägt das Zeichen eines verstoßenen Volkes, dessen Geschichte aus dieser scheinbar makellosen Welt längst verbannt wurde. Auf der Suche nach Antworten begibt sich Piara auf die Spuren ihrer Familie, die verbotenen Lehren folgte. Dabei gerät sie immer tiefer in einen Strudel aus Widersprüchen und alten Mythen, die ihr die Motive ihrer Brüder schmerzlich vor Augen führen. Denn um einander zu schützen, beschreiten sie zwei völlig verschiedene Wege, die Piara zu einer bitteren Erkenntnis zwingen: Manche Schicksale sind schlimmer als der Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Wüstenbeben
Juliet May
Die letzte Generation
Askeria – Band 1
Fantasy-Roman © 2019 Juliet May
Juliet May
Rogue Books I.Service
Carolin Veiland
Franz-Mehring-Str. 70
08058 Zwickau
https://julietmay.at
Social Media: @prinnycup
Für mein 15-jähriges Ich, weil du nie aufgehört hast, von dieser Welt zu träumen
Dieses Buch enthält Trigger-Hinweise unter:
https://julietmay.at/triggerwarnungen
»In den Ruinen der Torheit,
vom Hauch einer Chance,
entsteht Hoffnung in all dieser Finsternis.
Die Wahrheit vor unseren Augen,
verborgen und grausam.
Doch ist dir nicht klar,
dass jeder Wolke ein Silberstreif folgt?
Und solang wir hier verweilen,
lass mich dir vom Leben im Glanz erzählen.
In dieser Illusion harren wir aus,
bis das Blatt sich zum Guten wendet.
Denn glaub mir,
hinter jeder noch so dunklen Wolke wartet Licht.
Nenn mich nur einen Träumer,
der vergibt und verzeiht,
naiv und voll Hoffnung auf mehr.
Doch ich würd’ dafür sterben,
dass du wieder vertraust,
auf den Silberstreif,
das Licht und auf mich.
Darum sag mir, komm sag mir,
was für ein Idiot ich doch bin.«
Der Kontinent Mitaeria
Der Kontinent gliedert sich in acht Provinzen:
1. Acea Liore mit der Hauptstadt Ilyria: Sitz des Ordens von Corasil.
2. Vrin: Spezialisiert auf Azeth-Magie, liegt jenseits enger Gebirgsketten.
3. Iporaz: Sitz der Geisteswissenschaften. Regenreich und städtisch.
4. Sithrieta: Flüsse, tiefe Gewässer und weite Ebenen, eher ländlich.
5. Fayon: Dicht bewaldete und naturbelassene Region im Süden.
6. Saetam: Vielseitige Wüsten- und Steppenlandschaft im Süd-Westen.
7. Jedroya: Kalte Bergregion im Norden. Bekannt für seine Bodenschätze.
8. Mim’Atoll: Inselgruppe mit warmem Klima und vielfältiger Kultur.
Eine Landkarte findet ihr hier:
Das Wüstenbeben
1
Sand, Rauch und der Geruch von verbranntem Lehm und Fleisch lagen in der Luft. Ihre Beine waren taub und schwer, als sie über den harten Wüstenboden lief. Der Kopf frei, sie dachte nicht mehr nach. Sie rannte, ließ alles hinter sich: ihre Heimat, ihren Bruder und das Leben, das sie bis zu diesem Tag geführt hatte.
Alles nur Fassade, um sie zu schützen.
Alles eine Lüge, die sie in diesem Moment einholte.
Sie versuchte zu atmen und mit ihrem Bruder Souta Schritt zu halten, der ein Stück vor ihr lief. Souta. Immerhin ein Mensch, der noch bei ihr war. Keuchend wischte sie sich den Schweiß von der Stirn, damit er nicht weiter in ihre Augen lief und wie Feuer brannte. Sie musste laufen. Weiterlaufen. Bis sie in Sicherheit waren. Ohne Ziel, immer nur Souta nach, ihren anderen Bruder hinter sich lassend. Denn sie musste überleben. Selbst wenn dies für alle, die sie liebte, den Tod bedeutete.
»Piara, beeil’ dich! Du darfst nicht langsamer werden, hörst du?« Souta wandte sich besorgt zu seiner kleinen Schwester um, während er weiter nach vorn preschte.
Sie nickte, schloss ihre Augen und gab noch einmal alles, was sie an Energie übrig hatte, um zu ihm aufzuschließen. Piara konnte nicht sagen, wie lange sie in dieser Nacht tatsächlich gelaufen sind, doch als der Sand allmählich zu festerem Grund wurde, verlangsamten sie ihre Schritte und kamen zum Stehen. Mitten im Nichts, umgeben von Felsen.
Die plötzliche Stille und Finsternis, die die beiden umgab, wirkte bedrohlich und fremd. Doch Piara vernahm lediglich ihren eigenen schweren Atem, der bei jedem Zug in ein erschöpftes Rasseln überging. Sie spürte das heftige Pochen in ihrer Brust, als ob ihr Herz versuchte, Schlag für Schlag auszubrechen. Unter der quälenden Erschöpfung sank Piara auf die Knie und wollte die Welt um sich herum vergessen; einfach in der herrschenden Finsternis ihrer Umgebung versinken. Dazu ließ ihr Bruder ihr jedoch keinerlei Zeit. Stattdessen kletterte er auf einen der Felsen, reichte seiner Schwester die Hand und zog sie zu sich nach oben. Für einen Moment saßen die beiden einander nah gegenüber, vernahmen die blanke Panik, die sich in ihren Augen abzeichnete. Souta wollte sich erneut umdrehen, um hinter den Felsen Sichtschutz zu suchen, doch Piara packte ihn am Arm. Bevor er etwas entgegnen konnte, schnitt sie ihm das Wort ab.
»Was zum Donner ist da passiert, Souta? Wieso bleibst du nicht stehen? Sieh mich an und sprich mit mir!« Sie hielt inne, suchte seinen Blick, ehe sie ihre scharfen Worte zügelte. »Ich bin müde, ich will mich ausruhen, ich will zurück, ich will wissen, was da passiert ist. I-ich habe das Gefühl, dass das alles meine Schuld …« Piaras Stimme versagte und ließ sie im Stich.
Ein tiefer Atemzug, ehe Souta die Augen schloss. Erst jetzt bemerkte sie sein Zittern und überlegte, wie viel ihm die Flucht abverlangt haben musste. Nicht nur psychisch, sondern auch körperlich – immerhin hatte er sie ein ganzes Stück weit getragen. Auf seiner Stirn hatte sich ein rotes Rinnsal gebildet, das ihm über die Schläfe hinab lief. Sein dunkles Haar stand noch wilder in alle Richtungen als sonst und auch mehrere Schürfwunden waren in seinem Gesicht zu erkennen, wie Piara entsetzt feststellte. Sie fragte sich, wo er sich diese Verletzungen zugezogen hatte.
»Erst ziehen wir uns zurück. Ich muss sicher gehen, dass du außer Gefahr bist.« Mit diesen Worten stand Souta auf und zog seine kleine Schwester hinter sich her; ein wenig trotzig, da ihre müden Beine sie kaum noch tragen konnten. An einem Plateau, hinter einigen Felsspalten, machten die beiden kurz darauf endlich Halt.
Das Gestein um sie herum trat unter dem Mondlicht rötlich hervor und war angenehm kühl. Piara legte ihre Wange an die glatte Oberfläche der Felsen und ließ ihren Blick gedankenverloren über die Cograt Steppe schweifen, die sie bislang nur aus Erzählungen gekannt hatte. Doch so aufgeregt sie darüber normalerweise gewesen wäre, endlich einmal den Ansatz von etwas anderem als Sand, Palmen und vertrockneten Pflanzen zu sehen, brachte sie in ihrer gegenwärtigen Situation keinerlei Begeisterung dafür auf. Im Moment war ihr vielmehr nach einem heißen Bad. Nach ihrem Zuhause, ihrem Zimmer, ihrem weichen Bett, das direkt unter einem großen Dachfenster stand. Nach den Sternen, zu deren Leuchten sie jede Nacht in den Schlaf driftete. Sie sehnte sich nach den Geschichten ihrer Brüder, die von ihren zahlreichen Reisen handelten. Erzählungen aus der Welt jenseits der Wüste faszinierten Piara von klein auf und ließen sie voller Neugier und Abenteuerlust im Schlaf in andere Welten gleiten. Scheinbar hatte sie immer noch nicht realisiert, dass es dazu nie wieder kommen würde; der Gedanke daran trieb ihr erneut Tränen in die Augen, die sie tapfer herunterschluckte. Sie wusste, dass sie nun stark sein musste.
Das Brennen ihrer Füße, als sie die Stiefel von ihnen kickte und die Beine ausstreckte, nahm Piara nur entfernt wahr; denn sie konnte endlich sitzen und verschnaufen. Souta stand schweigend vor ihr, den Blick gen Himmel gewandt, als ob er nach etwas suchen würde. Die blauen Strähnen klebten blutverschmiert an seiner hohen Stirn.
»Hey, Souta.« Sie räusperte sich und kämpfte gegen das Brennen in ihrer Kehle an.
Ihr Bruder drehte sich um. Sein Anblick ließ erahnen, dass seine Verletzungen ihm Schmerzen bereiteten. Schnaubend legte er seinen Rucksack zu Boden. »Geht es dir gut? Du warst so stark, ich bin stolz auf dich«, murmelte er und ließ sich vorsichtig vor ihr nieder. Der Schrecken der letzten Stunden war ihm deutlich anzusehen, doch da war noch etwas anderes, das Piara nicht richtig deuten konnte. War es Schuld? Sorge? Die plötzliche Erkenntnis, dass es keinen Weg mehr zurück in ihr gewohntes Leben gab?
Souta musterte seine kleine Schwester unsicher, wartete auf eine Antwort. Ihre sonst so lebhaften Augen, die denselben smaragdgrünen Ton hatten wie die seinen, starrten reglos zu Boden; das Feuer, das in ihnen lag, war zu einer schwachen Flamme verglommen. Piara wirkte blasser als sonst. Ihr abgeschlagener Anblick rührte etwas in Souta, hielt ihm sein Versagen schmerzlich vor Augen. Seine Schwester, die mit ihrem runden Gesicht oft noch wie ein Kind auf ihn wirkte, er sollte sie doch beschützen. Und doch saß sie nun hier, verstört und beklommen, bebte sie am ganzen Körper.
»Piara, ich bin dir einiges an Erklärungen schuldig. Es tut mir so leid, dass du … dass das passiert ist.« Und dann drückte er sie fest an sich, umschloss sie mit seinen Armen. Endlich ein vertrautes Gefühl von Sicherheit, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick; denn die Fragen, die ihr auf der Seele brannten, bahnten sich ihren Weg über Piaras Lippen.
»Aber du bist hier. Du bist bei mir, du hast mich da rausgeholt. Dir muss nichts leidtun. Sag mir nur, was geschehen ist. Warum ist Ineas …« Die plötzliche Erkenntnis traf sie wie ein Stich ins Herz.
Ineas. Sie hatten ihren Bruder Ineas zurückgelassen. Da riss sie sich von Souta los und schluchzte unkontrolliert. »Warum ist das passiert? Warum haben sie ihm weh getan?« Piara vergrub ihr Gesicht in den Armen. Sie realisierte, dass sie Ineas nie wiedersehen würde. Er hatte sich geopfert, als sie unbedacht noch einmal zurückgelaufen war. Weil sie Soutas Anweisungen nicht Folge geleistet hatte. Denn das eigentliche Ziel des Angriffs, dessen war Piara sich sicher, war sie gewesen.
»Du solltest nicht bei mir sein. Lass mich hier, ich will nicht, dass dir auch etwas zustößt. Ich ziehe das Unheil an, denk doch mal nach! Ich …« Doch sie brachte keinen Ton mehr heraus. Also schluchzte sie leise vor sich hin, zitternd und aufgelöst, während sie versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. In all ihrem Schmerz vergraben schottete Piara sich vollkommen von der Außenwelt ab, bis sie eine warme Hand auf ihrer Schulter spürte. Sie sah auf und vernahm die Sorge in Soutas Augen.
»Beruhige dich ein wenig und hör mir zu. Unsere Mutter wollte, dass du alt genug bist, bevor wir dir von allem erzählen.«
»Und mit alt genug meinst du, bis ich einen von euch verliere? Ist das alt genug für dich? Oder liegt die magische Altersgrenze nur zufällig bei knapp vierzehn Jahren und zehn Monaten? Was bitte heißt alt genug? Ihr habt mich doch offensichtlich die ganze Zeit belogen!«
Auf Soutas Lippen zeigte sich der Ansatz eines verschmitzten Grinsens, was Piara angesichts ihrer Lage wütend schlucken ließ.
»Wie kannst du jetzt nur lachen?«, brüllte sie und packte ihren Bruder am Kragen. »Du Idiot! Nimm mich verdammt nochmal ernst!«
Souta schwieg, vollkommen überrumpelt von ihrer Reaktion, und rang sich zu einer halblauten Entschuldigung durch. »Das war nicht richtig, tut mir leid.« Er stieß einen Seufzer aus und verschränkte die Arme vor der Brust. »Natürlich nehme ich dich ernst. Ich bin einfach nur froh, dass du dir deinen Humor bewahrt hast. Das ist wichtig und zeigt, was für eine starke Person du geworden bist. Dass wir scheinbar doch alles richtig gemacht haben.«
Sie ließ von ihm ab und ignorierte seinen Kommentar. Die beiden saßen einander schweigend gegenüber, bis Piara endlich all jene Fragen aussprach, die sie seit Jahren quälten:
»Warum wart du und Ineas darauf vorbereitet, dass etwas Schlimmes passieren würde?« Sie zitterte, schluckte schwer bei dem Gedanken an die Worte, die sie gleich aussprechen würde und tat es dennoch: »Sieh mich an und sag mir die Wahrheit. Ist das alles nur deshalb?« Und mit diesen Worten löste sie die Haarklammern an ihren »Öhrchen«, wie ihre Brüder sie immer nannten. Doch in Wahrheit hielt sie unter diesen gekonnt gesteckten Haarknoten etwas verborgen: dunkle, spitze Hörner, die ihr im Alter von drei Jahren gewachsen waren. Knöchern und fest ragten sie etwa fünf Zentimeter aus ihrem Kopf, als Piara mit den Fingern jede einzelne Strähne von ihnen löste. »Wer oder was bin ich?«
Souta deutete ein Nicken an und schloss die Augen. »Ich werde dir erzählen, was ich weiß. Es ist nicht viel, aber alles, was unsere Mutter mir nach deiner Geburt erklärt hat.«
Und dann, zum ersten Mal in ihrem Leben, hatte Piara das Gefühl, dass ihr Bruder aufrichtig zu ihr war, sie nicht in eine Schutzblase steckte und jeder ihrer Fragen auswich. Auch, wenn sie sich anschließend wünschte, Soutas Worte für alle Ewigkeit aus ihrem Gedächtnis zu verbannen. Doch sie hatten sich eingebrannt und ein Feuer entfacht, das seit diesem Tag unaufhörlich in dem Mädchen loderte. Diese Flammen haben alles verbrannt, was sie bis dahin zu wissen und wer sie zu sein geglaubt hatte.
2
Vor ihm lag eine schier endlose Weite an Moos, feuchter Erde und Bäumen. Gras und nasses Laub raschelten unter seinen Füßen, als er sich behutsam fortbewegte und die frische Waldluft in sich aufsog. Er breitete seine Arme aus, schloss die Augen und ließ sich achtlos auf den Rücken fallen, seinen Bogen in der einen und den Köcher in der anderen Hand. Es war ein perfekter Tag zum Jagen. Und, um nachzudenken. Von oben aus betrachtet sah man einen jungen Mann, nicht ganz 20 Jahre alt, unbeschwert im dichten Gras liegen. Ein Bein über das andere geschlagen, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, wirkte er von außen vollkommen unbekümmert und entspannt. Sein brünettes Haar vermittelte den Eindruck, als wäre er gerade erst aufgestanden, doch in Wahrheit investierte er jeden Morgen viel Zeit darin, sich einen Teil seiner Strähnen aus der Stirn zu kämmen und zu einer mehr oder minder ordentlichen Frisur zu formen.
Der Himmel, der sich weit entfernt zwischen den Bäumen abzeichnete, war an diesem Tag wolkenlos und erstrahlte in sattem Blau. Zwischen den Baumkronen flogen Vogelschwärme, die sich zielstrebig fortbewegten, man hörte Eichhörnchen, die Nüsse sammelten und zwischen den Sträuchern hin- und her huschten, immer darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Der junge Mann liebte die Wälder und konnte sich keinen schöneren Platz auf dieser Welt vorstellen, um einen freien Nachmittag zu verbringen. allein im Wald, pure Idylle, frei von allen Verpflichtungen und Sorgen – zumindest für ein paar Stunden, bis die Sonne sich setzte und die Leute sich fragen würden, wo er schon wieder steckte.
Mit einem Satz schwang er sich zurück auf die Beine und sog die klare Waldluft tief in seine Lungen. Um ihn herum nichts weiter als das Zwitschern der Vögel und das Wehen des Windes. Und so schnallte er den Köcher um und bewegte sich schleichend fort, den Bogen immer fest gespannt im Griff. Auszeiten wie diese waren der perfekte Ausgleich von seinen sonstigen Verpflichtungen. Immerhin vermittelte ihm sowohl die Jagd nach wilden Tieren als auch gesuchten Verbrechern, das Gefühl, seinem Volk einen wichtigen Dienst zu erweisen. Er war einer der besten Leute, wie man ihm immer wieder versicherte: guter Spürsinn, blitzschnelle Reflexe und hohe Trefferquote. Dass er ein wenig rebellisch und verträumt war, wie sein Vater es gern nannte, hielt ihn nicht von dieser Aufgabe ab.
Nein, alles in allem war der junge Mann durchaus zufrieden mit seinem Leben. Natürlich gab es da diese eine lästige Sache, auf die er gern verzichtet hätte, aber von den Eltern frühzeitig arrangierte Ehen waren in den höheren Kreisen seines Volkes leider etwas, das man hinnehmen musste. Egal, wie gut man die Person kannte, der man versprochen wurde, ob sie überhaupt schon geboren war, geschweige denn, ob man sich mit ihr verstand und sein Leben mit ihr verbringen wollte. Aber das war wieder eine andere Geschichte; Traditionen waren da, um befolgt zu werden. Sie dienten der Erhaltung seines Volkes, wie er sich immer wieder sagte. Es hatte also keinen Sinn, sich ständig darüber den Kopf zu zerbrechen.
Er bewegte sich schleichend fort und vermied es dabei tunlichst, auf die herumliegenden Zweige zu treten. Mit einem gezielten Griff zog er seine Jagdbrille über die Augen und konzentrierte sich auf seine Umgebung. Nach und nach stieg sein Adrenalinspiegel, Aufregung und Konzentration wuchsen von Sekunde zu Sekunde, in denen er sich seiner potentiellen Beute näherte, die nichts von ihrem Glück, seinem Jagdtrieb zum Opfer zu fallen, ahnte.
Plötzlich vernahm er hinter sich ein leises Rascheln, von Menschenohren kaum wahrnehmbar, doch für einen geübten Schützen wie ihn deutlich genug. Präzise wandte er sich in die zugehörige Richtung, spannte den Pfeil an und bemerkte zu spät, wie sich das Geräusch bereits um einen gewissen Winkel verlagert hatte. Das Geschoss flog ins Nichts, als er einen schweren Körper auf sich spürte, der ihn aus der Balance brachte und zu Boden drückte. Überrascht und verunsichert riss er die Augen auf und blickte in das zierliche Gesicht eines Mädchens, das ihn überlegen angrinste.
»Senia. Was machst du hier?«
»Habe ich dich überrascht? Du bist zu langsam und zu unvorsichtig – leichte Beute!« Sie schloss die Augen und drückte dem Schützen einen Kuss auf die Stirn. Genervt zog er seine Beine unter ihr weg, stand auf und klopfte sich die Erde von den Knien. Mit einem tiefen Seufzer wandte er sich ab; sie hatte es schon wieder getan.
»Pah, von wegen! Wer rechnet denn bitte mitten im Wald damit, von jemandem aus dem Hinterhalt angesprungen zu werden?«, sagte er und wollte seinen Weg fortsetzen.
»Das kann man nie wissen. Du solltest mehr auf der Hut sein. Ich mache mir nur Sorgen um dich, Rigo.« Doch das waren Dinge, die er ständig von ihr hörte und mittlerweile mehr als satt hatte. In seiner freien Zeit zog er es vor, seine Pflichten zu vergessen. Und nicht einmal diese Zeit gönnte sie ihm, sondern stellte ihm regelmäßig nach.
Wie soll ich es auf Dauer nur mit ihr aushalten?
Es gab im Land sicher hunderte Männer, die ihn um Senia beneideten – und das auch zurecht. Sie war eine aufgeweckte und durchaus attraktive junge Frau. Feuerrotes langes Haar, großgewachsen und die Blicke, die sie einem aus ihren dunklen Augen zuwarf, ließen so manche Männerherzen höher schlagen. Nur seines nicht, damit hatte er sich bereits vor langer Zeit abgefunden. Unglücklicherweise fühlte Senia sich sehr zu Rigoras hingezogen und das schon, seit sie Kinder waren.
Um die beiden herum herrschte vollkommene Stille, selbst der Gesang der Vögel war verstummt. Wieder war es Senia, die diese Ruhe durchbrach.
»Versteh’ mich nicht falsch, aber manchmal frage ich mich wirklich, ob du deine Augen nur verschließt oder absolut naiv bist.«
Er biss sich auf die Lippen, atmete nochmals ein, um im Affekt nichts Falsches zu sagen, bis er schließlich zu einer Antwort ansetzte: »Weder noch. Manchmal möchte ich einfach nur ungestört sein. Mich regenerieren. Doch Corasil sei Dank habe ich ja dich, die mich unentwegt daran erinnert, dass das Leben nur aus Pflichten und Vorsicht besteht.«
Verdutzt und mit leicht gereiztem Blick schwieg die junge Frau. Es schien, als suchte sie krampfhaft nach den richtigen Worten, die ihr nicht einfallen wollten. Sie setzte mehrfach zum Sprechen an, blickte dann jedoch wieder betreten zu Boden.
»Komm schon, genieß’ die herrliche Luft und die wunderschöne Natur um dich herum. Wenigstens hin und wieder. Wir haben noch unser ganzes Leben, um uns mit den Dingen auseinanderzusetzen, die uns unsere Eltern aufhalsen. Das gehört nun mal dazu, ob wir es wollen oder nicht. Ein Appell an dich: Wir sind zu jung, um uns permanent zu sorgen und alles richtig zu machen.« Rigoras zwinkerte ihr halbironisch zu. »Und jetzt lass mich in Ruhe zu Ende jagen, wir sehen uns dann beim Abendessen.«
Mit diesen Worten ließ er seine zukünftige Braut zurück und setzte den Weg ins Dickicht fort, nicht gewillt, noch einen Gedanken an Senias Worte zu verschwenden. Das Leben konnte nicht nur aus Pflichten bestehen, auch wenn man der Sohn des obersten Clanführers war und genau wusste, worum sich das eigene Dasein später einmal drehen würde; und eigentlich, wenn Rigoras ehrlich zu sich selbst war, bereits jetzt schon primär drehen sollte. Aber nicht heute und nicht in diesem Moment.
3
»Nach Mamas Tod sind wir stärker zusammengewachsen und haben aufeinander aufgepasst. Aber als wir älter wurden, da hat Ineas sich immer mehr verschlossen.«
Die beiden saßen auf dem felsigen Plateau. Zu müde, um zu denken. Zu rastlos, um zu schlafen.
Souta seufzte und trommelte mit den Fingern auf seinem Knie herum; eines seiner kleinen Rituale, die ihm bei Anspannung oder Nervosität halfen. »Alles nur schleichend. Ineas konnte mit der Aufgabe, dich mit unserem Leben zu schützen, nicht umgehen. Ich glaube, dass ihm die Last zu viel war. Er hat ja gemeint, sich auch um mich kümmern zu müssen«, Souta schüttelte den Kopf und schnaubte, »dieser Idiot.«
Für Piara gab es in diesem Augenblick hingegen nichts, das gegen ihre Anspannung geholfen hätte. Sie saß einfach da und lauschte den zögerlichen Worten ihres Bruders.
»Du weißt doch, dass unsere Eltern Forscher waren.«
»Ja, Alchemist und Historikerin«, antwortete sie.
Souta nickte. »Sie arbeiteten an etwas, das dem Orden ganz und gar nicht gefiel. Als Ineas und ich klein waren, wurden Forscher bestimmter Wissenschaften immer häufiger von der Kirche bedroht, ihre Fachgebiete eingeschränkt.«
»Und irgendwann verboten, nicht wahr? Du hast gesagt, dass deine Ausbildung in Alchemie ganz anders war als die von Papa.«
Wieder nickte ihr Bruder. In all den Büchern, die sein Vater ihm hinterlassen hatte, befand sich so viel mehr als einfache Transmutationen und Naturgesetze; doch allein für ihren Besitz wäre Souta nach den Restriktionen des Ordens in große Schwierigkeiten geraten. »Astronomie wurde verboten und daher auch in meiner Ausbildung nicht mehr behandelt. Auch Lehre und Forschung in Geschichte und Archäologie fallen unter das Verbot. Völkerkunde obliegt seit Jahren allein dem Orden. Siehst du den Zusammenhang?«
Unsicher runzelte Piara die Stirn und begann, ihr Haar wieder festzustecken. Sie war mittlerweile so geübt darin, dass sie nicht einmal mehr einen Spiegel benötigte. »Ich weiß nicht. Menschen und Sterne? Aber was hat das denn mit mir zu tun?« Sie wollte verhindern, dass Souta ihren Fragen erneut auswich und warf ihm einen fordernden Blick zu.
»Bei der Forschung unserer Eltern ging es um den gesamten Planeten. Um uns Menschen, die Ceri und damit auch um dich.«
Piara schluckte, als ihr langsam dämmerte, worauf er hinauswollte. »Um meine Hörner?«
Soutas Blick wanderte ins Nichts. »Unsere Mutter hatte nie etwas in diese Richtung erwähnt, bevor sie starb. Als dir dann zwei Jahre später Hörner wuchsen, wussten Ineas und ich nicht weiter. Wir waren zehn oder elf und hatten große Angst, dass man dir etwas antun würde.« Souta verstummte. Er zog die Beine an und legte den Kopf auf die Knie. »Wir hatten davon gehört, dass es Mischwesen gab. Menschen mit Merkmalen der Ceri. Schimmernde Haut, schwarze Augen mit wechselnder Iris oder Hörner. Aber es ergab keinen Sinn. Du hast so viel von Papa, weißt du? Ich meine, sieh dich doch nur an.« Doch das wollte Piara nicht. Soutas Worte rissen ihr gerade den Boden unter den Füßen weg.
Mischwesen. Sicher hatte sie schon einmal von Menschen gehört, die mit den Ceri verkehrten und sogar Kinder zeugten; doch immer nur vom Orden Corasils, der einzig anerkannten Religion Mitaerias. Und dessen Urteil über derartige Lebewesen fiel eindeutig aus.
Souta tippte seine Schwester mit dem Fuß an, als er ihren ausdruckslosen Blick vernahm. »Hey, geh nicht gleich vom Schlimmsten aus. Wir haben den Gedanken schließlich schnell wieder verworfen.«
»Aber es macht Sinn. Darum waren all die Inquisitoren hier in Clay. Darum suchen sie mich. Denk doch mal nach.« Sie seufzte und setzte zu sprechen an, doch Souta kam ihren trüben Gedanken zuvor:
»Quatsch. Du bist ein Mensch und sonst gar nichts. Alle sagen doch, wie ähnlich wir uns sehen. In Wahrheit bist du eine kleinere Version unseres Vaters mit hellerem Haar. Und ohne Bart.«
»Souta, keine Witze mehr«, raunte Piara. Zum ersten Mal verstand sie Ineas, der sich immer wieder über den Humor seines Bruders beklagte.
Souta verzog das Gesicht; vermutlich mehr zum Schein, um ein wenig Mitleid von seiner Schwester zu erhaschen. Ihre Reaktion verunsicherte ihn sichtlich. »Komm schon. Das Thema ist so ernst. Ich will nicht, dass du dir noch mehr Sorgen machst.«
Piara schüttelte den Gedanken für einen Moment ab, als auch Souta wieder einen ernsteren Ton anschlug.
»Das ist jedenfalls alles, was ich dazu weiß. Und zu gegebener Zeit, das hat unsere Mutter uns versprochen, würden wir wissen, wo wir hingehen sollen, wenn wir in Gefahr sind.« Das waren Soutas abschließende Worte gewesen, die seine Schwester sich immerzu in Erinnerung rief.
In dieser Nacht lag Piara noch lange wach, obwohl sie vermutlich niemals zuvor so erschöpft gewesen war. Unweigerlich hielt sie sich ihre Situation vor Augen – heimatlos, auf einem Felsvorsprung verweilend, geplagt von Gewissensbissen und Trauer um Ineas, der sie gerettet hatte. Immer wieder zwängten sich diese dunklen Bilder vor ihr geistiges Auge, nicht mehr als zusammenhanglose Fetzen eines Szenarios, das Piara im Moment weder begreifen noch verarbeiten konnte. Doch so sehr sie diese Gedanken auch schmerzten, sie weigerte sich, in ihren Schuldgefühlen aufzugehen. Zwar war ihr und Souta die Flucht aus Clay im letzten Moment gelungen, doch in Sicherheit waren sie noch lange nicht.
Piara musste sich auf die nächsten Schritte konzentrieren, wie auch immer diese aussehen würden. Wenigstens hatte Souta, der tief atmend neben ihr lag, keine Schwierigkeiten gehabt, einzuschlafen. Zu sehen, wie er nach all den Strapazen ein wenig zur Ruhe kam, half Piara jedoch nicht im Geringsten dabei, selbst abzuschalten. Im Gegenteil: Die Antworten, die er ihr endlich gegeben hatte, spukten ihr ständig im Kopf herum. Obwohl Souta ihr so viel verheimlicht hatte, war sie ihm deswegen nicht mehr böse. Wie konnte sie auch? Wäre sie jünger gewesen als heute, hätte sie vieles von dem, das er ihr vor wenigen Stunden offenbart hatte, weder realisieren noch ertragen können. Ihre Brüder hatten sie großgezogen, als sie selbst noch kleine Kinder gewesen waren. Zwischen ihnen und Piara lagen gerade einmal etwas mehr als sieben Jahre Altersunterschied. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte jedoch jede gute Seele in Clay dafür Sorge getragen, die drei in diesem schweren Schicksal zu unterstützen. Und im Moment wusste Piara nicht einmal, ob all ihre Nachbarn und Freunde nach dem Angriff auf das Dorf überhaupt noch lebten – wieder ein Gedanke, den sie im Moment nicht weiterverfolgen konnte, ohne in Verzweiflung aufzugehen.
Souta und Ineas schienen immer alles im Griff gehabt zu haben und waren ein eingespieltes Team. Doch nun wurde Piara eine andere Wahrheit unterbreitet, die sich für sie noch so fremd anfühlte, dass sie sie nicht in ihre Welt lassen konnte.
Piara hatte ihre Brüder stets dafür bewundert, dass die beiden sie ganz allein großzogen, es jedoch nie hinterfragt – sie kannte nichts anderes. Auch, wenn sie bereits früh gemerkt hatte, dass es in den Familien ihrer Freunde anders aussah und viele Dinge nicht so abliefen, wie sie es gewohnt war. Kummer, Sorgen und auch Triumph teilte sie mit den beiden – sie hatten ihr alles beigebracht, was sie wusste. Und da Piara von jeher ohne Eltern aufgewachsen war, klammerte sie sich umso mehr an ihre Brüder. Angesichts dieser Umstände war es nur zu verständlich, dass die drei eine engere Beziehung zueinander hatten, als die meisten Geschwister.
Natürlich sehnte Piara sich manchmal nach ihren Eltern, beziehungsweise einfach nach irgendjemand Erwachsenem, der diese Rolle erfüllte. Sie hatte kein Konzept davon, was eine Mutter oder ein Vater waren; doch im Augenblick verspürte sie eine tiefe Sehnsucht nach ihnen.
Erleichtert über die Müdigkeit, die sie für eine Weile aus dieser schmerzhaften Realität holte, schloss sie die Augen. Piara wusste, dass sie ein wenig Erholung brauchte, um die nächsten Tage durchzustehen. Sie musste nach vorn blicken, so gut es ihr möglich war. Für Souta. Mit der Erschöpfung kam schließlich der Schlaf, der sie zurück in glücklichere Zeiten führte. Wie gern sie dort geblieben wäre.
4
Clay, ein kleines Dorf im Osten der Provinz Saetam
Wenige Monate zuvor lag Piara auf ihrem liebsten Teil der Dorfmauer und sah dem täglichen Treiben um sich herum zu. Es war kaum zu glauben, was die Leute alles taten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Der Abend war erstaunlich mild; der Übergang der Jahreszeiten1 würde vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Von hier oben genoss sie nicht nur eine hervorragende Aussicht über ihr Heimatdorf, sondern konnte auch in die Weiten der Wüste blicken, die sich zu jeder Seite hin erstreckten. An klaren Tagen war es Piara sogar möglich, die Umrisse der Klippen und Felsen zu erkennen, die im Osten die Grenze der Region andeuteten, aber das war nur selten der Fall. Dennoch malte sie sich hier liegend gern aus, was jenseits der Cograt Wüste noch im Verborgenen lag – zumindest für sie, denn es gab durchaus Menschen, die das Gebiet hin und wieder durchquerten und in die Hauptstadt pilgerten, beziehungsweise Clay den Rücken kehrten.
Viele ließen sich anderenorts ausbilden, manche arbeiteten als Händler oder Abenteurer. Doch es gab auch jene, die ihrem Leben einfach eine neue Richtung geben wollten und hinaus in die Welt zogen. Etwas, das Piara eines Tages ebenfalls anstrebte.
Ihre Brüder erzählten ihr oft von den Ländern jenseits ihrer Heimat, die sie früher mit ihren Eltern besucht hatten. Damals waren sie klein gewesen, doch fremde Welten und Kulturen blieben einem in Erinnerung, wie sie immer wieder meinten. Sie berichteten ihrer Schwester von der Hauptstadt des Kontinents, Ilyria, die inmitten saftiger Wiesen und endloser Grassteppen lag, umgeben von Flüssen, besiedelt von zahlreichen Tieren und Pflanzen, von denen sie noch nie gehört hatte. Grüne Laubbäume und gepflasterte Straßen mit geschmückten Laternenmasten, prunkvolle Springbrunnen, extravagante Marktstände und die imposanten Stadttore, alle Händler und Straßenkünstler sowie jene, die in der Hauptstadt lebten oder sie durchquerten, waren Bestandteil ihrer Erzählungen. Nicht selten beneidete Piara Souta und Ineas darum, dass sie schon so viel mehr von der Welt gesehen hatten. Ihr war jedoch bewusst, dass der Tag kommen würde, an dem sie sich ein eigenes Bild all dieser Beschreibungen machen konnte, die in ihrem Kopf schon feste Formen angenommen hatten.
Die drei sprachen auch über Orte, die sie selbst nur aus Erzählungen kannten oder von denen sie zusammen in Büchern gelesen hatten. Von Bergen, Meeren, Wäldern und eisigen Tälern, die Piaras Fernweh verstärkten und die sie sich geschworen hatte, später einmal selbst zu besuchen. Eines Tages, wenn sie alt genug war und einen passenden Beruf gewählt hatte, der sie durch ganz Mitaeria führte. Souta und Ineas waren nie sonderlich begeistert, wenn ihre kleine Schwester von ihren Plänen sprach. Sie begründeten ihre Skepsis damit, dass sie Angst um sie hatten. Das war für Piara nachvollziehbar, wenn sie daran dachte, wie sie ihre Eltern verloren hatten. Darum nahm sie sich fest vor, eines Tages mit ihnen gemeinsam in die Welt hinauszuziehen, sobald sie erwachsen war. So würden sie es machen, denn für immer wollte sie schließlich nicht in Clay bleiben.
Trotz der ständigen Wanderlust, von der Piara immer wieder gepackt wurde, wusste sie ihr Heimatdorf mit all seinem Charme zu schätzen. Viele Reisende und Händler, die es nach Clay verschlug, schwärmten von den schmalen Gassen, dem Duft der Dattelpalmen und Gewürze, die es an jeder Ecke zu kaufen gab und alle waren sich einer Sache absolut sicher: Nirgendwo war das Verschwinden der Sonne hinter dem Mond zu später Stunde so schön wie von den Dächern Clays aus betrachtet.
Die Häuser standen eng aneinandergereiht und in mehreren kleinen Siedlungen angeordnet. Die meisten Gebäude bestanden aus Stein und Lehm und da es in Clay ausgesprochen selten regnete, besaßen allesamt Flachdächer, um darauf Wäsche und Obst zu trocknen. In der Mitte des Dorfes befand sich etwas nördlich gelegen eine kleine Oase, zu deren Rechten der zentrale Dreh- und Angelpunkt, der Marktplatz, angesiedelt war. Händler von nah und fern boten dort ihre Waren an und plauderten mit den Dorfbewohnern, die sich gern die Geschichten der weltkundigen Reisenden anhörten.
Es gab eine Taverne unweit des Marktplatzes, die auch Gästezimmer anbot, und abgesehen davon lediglich eine große Schmiede und je ein Institut für Kräuterkunde, Alchemie und Erdwissenschaften, in denen Lehrlinge ausgebildet wurden. Aufgrund der besonderen Lage Clays war es im Laufe der letzten Jahrhunderte zum Zentrum für Geologie, Kartografie und Erdwissenschaften geworden: Heller Kalkstein erstreckte sich süd-westlich des Dorfes bis hinab an die Küste und bildete damit einen starken Kontrast zu dem feinen Quarzsand und Schutt, der im Herzen Clays zu finden war. Auch verschiedenste Arten von Ton und Gesteinsalz fanden sich in den Gebieten und Felsklippen, die den Ort umrahmten, ebenso wie mehrere Sedimentbecken. Daher wurden viele, die sich für diese Disziplinen interessierten, hier ausgebildet oder für weitere Studien an der Universität vorbereitet.
Zuvor galt es aber für alle Bewohner Mitaerias, die Grundausbildung zu absolvieren, womit Piara nun schon seit fast sieben Jahren beschäftigt war. Ihr Weg führe sie täglich in die Akademie unweit des Dorfes, die zwischen einigen Felsvorsprüngen errichtet worden war. Wenn man sich an den Geschichtsbüchern orientierte, war sie der Sitz des Königs von Saetam gewesen.
Die Sonne stand an diesem Abend bereits zur Hälfte hinter Azethaneris2 und tauchte die Wüste in einen intensiven Rotton. Dieser eigentlich malerische Anblick erinnerte Piara an etwas anderes: Sie war wieder einmal mehr als spät dran und sollte sich schleunigst auf den Heimweg machen.
Und so kletterte sie behutsam von der leicht zerbröckelten Mauer an der nordwestlichen Ecke, die nie jemand der Bewohner aufsuchte. Sie lag verborgen hinter Häusern und kleinen Schleichwegen. Ein letzter Sprung führte Piara zurück auf den festen Lehmboden. Die Sonne war bereits hinter dem großen blauen Mond verschwunden, als sie eilig durch die Gassen schritt. Zuhause angekommen wehte ihr beim Öffnen der Tür ein angenehmer Duft entgegen.
Piara legte ihre Jacke ab und ging dann zu Souta, der über der Feuerstelle stand und in einem Kessel rührte.
»Das riecht gut, kann ich dir bei etwas helfen?«, fragte sie, als er einen Arm um sie legte.
»Du kannst in Zukunft pünktlich sein, damit wäre mir sehr geholfen«, scherzte er und kniff ihr in den Arm.
Piara verdrehte die Augen, nickte ihm jedoch zu, während Ineas damit begann, den Tisch zu decken.
Die Küche der drei nahm den Großteil des Raumes ein. Beim Betreten des Hauses sah man die L-förmig angeordneten Schränke und Regale, an deren unterem Ende sich der Feuerplatz samt großem Kessel befand. Die Regale an der gegenüberliegenden Seite beinhalteten Teller, Krüge und Vorräte, während die Tür daneben auf ein überschaubares Ackerfeld führte. Souta und Piara bauten dort gemeinsam Gemüse an, denn die kleine Familie zählte zu den Glücklichen in Clay, die ihr eigenes Feld besaß und nicht auf den Gemeinschaftsfeldern arbeiten oder jeden Tag zum Markt musste, um frisches Gemüse zu erhalten. Da ihr Haus für mehrere Personen gedacht war, fiel auch ihre Erntefläche großzügig aus, was den dreien sehr gelegen kam.
Der zweite Teil des Raumes wurde als gemeinsamer Aufenthaltsbereich genutzt. Gemütliche Sitzkissen und volle Bücherregale luden zum Entspannen und gemeinsamen Sitzen ein. Die halbrunde Treppe, die nach oben zu den Schlafzimmern führte, besaß an der Innenseite eine perfekt gezimmerte Sitzbank aus Marmor, die vor vielen Jahren noch ihr Vater angefertigt hatte. Dort lag Piara abends am liebsten und las, was ihr gerade in die Hände fiel.
»Wie läuft es mit deinem Training, Piara? Machst du Fortschritte?« Ineas’ Worte rissen sie aus ihren Gedanken, als er sich ihr gegenüber auf seinem Stuhl niederließ.
Piara musste unweigerlich daran denken, wie sehr sich ihre beiden Brüder doch voneinander unterschieden, obwohl sie eigentlich Zwillinge waren. Zweieiige Zwillinge, um genau zu sein, doch trotzdem faszinierten sie ihre Unterschiede immer wieder. Beide waren von derselben Statur, wobei Ineas seinen um wenige Minuten jüngeren Bruder um fast einen halben Kopf überragte. Soutas dunkelblaue Haare standen in starkem Kontrast zu den silbrig schimmernden seines Bruders. Ineas’ Haare fielen ihm an der Stirn in sein kantiges Gesicht; er sah allgemein älter und ernster aus, was sich gut mit seinem Charakter deckte. Er war oftmals in sich gekehrt, eher ruhig und deswegen auch seltener zu Späßen aufgelegt als sein Bruder. Souta hingegen war nahezu dauerfröhlich, scherzte viel und war der heiterste Mensch, den Piara kannte. Sein Haar stand ein wenig ab, was es insgesamt voller und seine Erscheinung munter und frech wirken ließ.
Sie sah sich selbst in vielen Punkten als Balance zwischen den beiden: Ihre Haare waren von einem hellen Blau, ihre Augen tendierten mehr ins Grüne, waren jedoch ebenfalls von einem grauen Schleier durchzogen. Auch charakterlich fand sie, beiden ein wenig zu ähneln.
Obwohl sie eine etwas engere Beziehung zu Souta hatte, war Ineas auf seine eigene Art und Weise ein Mensch, zu dem sie aufsah und der sich bedingungslos um sie kümmerte. Als gelernter Alchemist, denen es seit einigen Jahren von der Kirche untersagt wurde, sich mit astronomischen Belangen zu beschäftigen, verbrachte Souta viel Zeit in seinem Zimmer, um in dicken Büchern zu versinken oder verschiedenste Stoffe und Tränke zu brauen. Er nahm Piara oft mit ins umliegende Gebirge, um Kräuter zu sammeln und zu klettern, was zu seinen liebsten Beschäftigungen zählte. Ineas hingegen, war ausgebildeter Geologe, der sich auf Roh- und Baustoffe in Saetam spezialisiert hatte und sehr viel Zeit im geologischen Institut der Stadt verbrachte. Die Tatsache, dass er nicht ebenfalls Alchemie gelernt hatte, war wohl eines der häufigsten Streitthemen ihrer beiden Brüder. Ursprünglich war es ihr Plan gewesen, gemeinsam die Studien ihres Vaters aufzugreifen. Als Ineas, sehr zur Überraschung aller, jedoch zwei Punkte weniger bei der Aufnahmeprüfung erreicht hatte als sein Bruder, musste er auf seinen Plan B zurückgreifen. Souta war nie ein guter Schüler gewesen, obwohl er außerordentlich klug war, wie Piara fand. Doch Tests machten ihn nervös; dass er seinem Bruder gerade bei dieser Prüfung voraus gewesen war und ihm so den Lehrplatz weggeschnappt hatte, verpackte Ineas bei jeder Gelegenheit in einen Vorwurf:
»Lieg nicht faul herum, sondern lerne – immerhin darfst du Alchemist werden« oder »Nimm deine Ausbildung ernster, wenn du sie dir schon aussuchen durftest.« Doch obwohl die beiden so verschieden waren und immer wieder ein wenig aneckten, steckte Piaras Meinung nach nie mehr als eine gesunde Portion brüderlichen Wettbewerbs dahinter.
Wenn Souta auf Reisen war, um seine Vorräte ausländischer Pflanzen und Mineralien aufzustocken, verbrachten Piara und Ineas oft ein bis zwei Wochen allein miteinander, die sie besonders genoss. Die Zeit mit den beiden war ihr ausgesprochen wichtig.
»Piara, das Training!« Ineas’ Worte rissen seine Schwester aus ihren weit abgedrifteten Gedanken. »Du träumst wohl schon wieder, hm? Du kleiner Hummelkopf.3«
Mittlerweile saßen ihr beide Brüder gegenüber. Ineas hatte die Ärmel seiner Jacke hochgerollt und blickte sie mit einer hochgezogenen Braue an.
»Bist du denn so erschöpft, dass du uns vor dem vollen Teller einnickst?«, warf er ihr grinsend entgegen und riss sich ein Stück Brot ab.
»Nein nein, ich war nur kurz in Gedanken. Das Training läuft gut, Rhilina meint, dass ich nächste Woche mit zwei Waffen üben kann.«
»Sieh an«, entgegnete Souta und begann den Eintopf vor ihm zu essen.
»Das hört man doch gern. In einigen Monaten hast du deine Grundausbildung endlich hinter dir. Hier in Clay gibt es ein paar interessante Ausbildungsmöglichkeiten.« Ineas’ Worte ließen Piara schlucken, noch bevor sie überhaupt den ersten Löffel genommen hatte. Sie verstand nicht, was an Felsen und Gestrüpp so interessant sein sollte.
»Ja.« Sie sah ihre Brüder verlegen an. »Was das betrifft. Eigentlich dachte ich daran, für eine Weile fortzugehen.«
Souta und Ineas warfen sich einen unsicheren Blick zu. Sie waren es gewohnt, mit Piaras Freiheitsdrang und ihrer Sehnsucht nach der Ferne umzugehen, doch damit hatten sie an diesem Abend wohl nicht gerechnet.
»Aber reizt es dich denn gar nicht, die Geologie und Pflanzen unserer Welt zu studieren, wie wir es tun, oder womöglich der Garde beizutreten? Du könntest auch die anderen Lehrmeister aufsuchen, die hier heimisch sind. Und wenn deine Ausbildung beendet ist, kommst du sowieso viel herum, genauso wie wir.«
Zögerlich schluckte Piara einen weiteren Bissen. »Nein. Eigentlich nicht. Die Welt hat mehr zu bieten als das, was es hier in Clay gibt. Versteht mich nicht falsch, ich möchte bei euch bleiben, aber was hält uns hier? Ich habe das Gefühl, dass das Dorf ausstirbt. Selbst die Händler verlassen Clay nach und nach.« Piara seufzte und schmiss ihren Löffel auf den Tisch; sie würde nicht schon wieder kleinbeigeben. »Außerdem haben wir hier doch keine Wurzeln mehr, sondern nur schlechte Erinnerungen.«
»Für uns sind sie nicht ausschließlich schlecht, Piara, vergiss das nicht«, erwiderte Ineas und suchte ihren Blick; die Gelassenheit in seinen Augen überraschte sie. »Wir werden sehen. Beende erst einmal deine Ausbildung und dann kannst du immer noch entscheiden, was dich interessiert. Du hast ja nicht ganz Unrecht – die Welt steht uns immerhin offen, findest du nicht auch?« Sein nächster Blick galt Souta, der gerade an einem großen Löffel voll Eintopf kaute und nicht so recht wusste, was er antworten sollte.
Er zuckte mit den Schultern und murmelte ein halb unverständliches »Wemm du ef sagft.«
Erleichtert ließ Piara sich zu einem Nicken hinreißen.
Souta machte der plötzliche Sinneswandel seines Bruders stutzig, doch ein Schlag auf den Kopf holte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Schluck doch erstmal, du Dummkopf!«
Souta schenkte ihm ein provokantes Grinsen und hatte bereits den nächsten Löffel im Mund. Bevor er jedoch etwas Weiteres sagen konnte, begann er zu husten; Ineas bedachte die Aktion mit einem Augenrollen.
»Das nennt man Karma. Je mehr du mir auf die Nerven gehst, desto härter schlägt es irgendwann zu!«, sagte er lachend und klopfte seinem Bruder kräftig auf den Rücken. Piara füllte Souta Wasser nach, konnte sich ein amüsiertes Grinsen jedoch ebenfalls nicht verkneifen. Sie liebte die Blödeleien zwischen den beiden.
»Für das Gesicht, das du immer ziehst, nehme ich gern schlechtes Karma in Kauf«, meinte Souta.
Was Piara von diesem Abend in Erinnerung blieb, war das Gefühl der Zuversicht. Sie würde ihre Grundausbildung erfolgreich beenden, auch wenn sie ein wenig ungeschickt war und gern einmal träumte.
Es waren Gefühle von Spannung, Frohsinn und Vorfreude auf das, was sie in den nächsten Monaten noch erwarten würde, die Piara an diesem Abend in den Schlaf geleiteten.
Doch sobald sie ihre Augen wieder öffnete, blickte sie in den Morgenhimmel einer ihr unbekannten Welt. Sie lag auf dem Boden eines Felsvorsprungs und realisierte, dass all ihre Träume von fernen Ländern und aufregenden Reisen nun wahr werden würden. Zu ihrer Verzweiflung konnte sie jedoch keine Freude mehr dafür aufbringen.
5
Ein altes Sprichwort der Provinz Saetam besagt:
»Der Ursprung einer Angst kommt niemals aus den Dingen selbst, viel mehr daher, wie du dich ihnen entgegenstellst.«
Als Mädchen hatte Piara oft mit Albträumen zu kämpfen gehabt, die sie selbst am Tag darauf noch verfolgten. Meist traute sie sich nicht einmal mehr, die Augen zu schließen. Ineas hatte ihrem Kummer dann mit dieser alten Weisheit ein Ende gesetzt, über dessen Bedeutung die beiden sich oft unterhielten. Seitdem bediente sie sich eines kleinen Rituals, wann immer sie Angst verspürte.
Aufrecht hinstellen, die Füße auf dem Boden fühlen, tief einatmen und sich auf die Umgebung fokussieren:
Wie viele Fenster kannst du zählen?
Oder wie viele Bäume, Wolken, Vögel?
Wie fühlt sich der Boden unter dir an?
Kannst du die Geräusche um dich herum wahrnehmen?
Konzentriere dich auf deinen Atem.
Deute den Geruch, der dir in die Nase weht.
Denk an deine Lieblingsfarbe.
Ist das, was dir Angst einflößt, gerade wirklich da?
Auch an diesem Morgen, als Piara auf dem kargen Felsboden erwachte, fühlte sie einen Anflug von Panik in sich aufwallen. Sie war völlig gerädert, als ob sie seit ihrer Flucht keine Sekunde geschlafen hätte. Schwer atmend setzte sie sich auf, um ihre Umgebung in Augenschein zu nehmen. Ihr Kopf schnellte von einer Seite zur anderen, als ihr bewusst wurde, dass erst wenige Stunden vergangen sein mussten. Die Sonne begann gerade damit, die wüste Gras- und Felslandschaft vor ihr in einen warmen Goldton zu tauchen. Unter anderen Umständen hätte Piara gern ein wenig auf den Klippen verweilt, um diesem wunderschönen Spektakel beizuwohnen, doch dann fiel ihr Blick auf Soutas Jacke, die auf ihrem Schoß lag; er musste sie irgendwann damit zugedeckt haben. Von ihm selbst fehlte aber jede Spur.
Schlaftrunken richtete Piara sich auf und lugte hinter den Felsen hervor. Die Steppe vor ihr lief ins Endlose. Im Westen, wo sie an die Wüste grenzte, war der Grund hell und trocken, teilweise sandig, an anderen Stellen zogen sich dunkle Furchen durch den kargen Boden. Sie fragte sich, wie tief diese Risse in die Erde reichten. Je weiter Piara in die andere Richtung blickte, desto saftiger und grüner wurde die Landschaft.
Struppige Büsche und vertrocknete Bäume erstreckten sich vor ihr, unter denen sie seltsam dürre Vögel entdeckte. Ihr waren die hiesigen Pflanzen und auch das Gelände völlig unbekannt, was sie ihre Umgebung fasziniert bewundern ließ. Piara versuchte, die Richtung des dünnen Flusses auszumachen und folgte ihm mit den Augen in die Ferne, als sie Souta am Ufer entdeckte. Erleichtert atmete sie auf und stieg von den Felsenklippen, um zu ihm aufzuschließen.
»Guten Morgen. Du bist früh auf«, begrüßte er sie und nahm seine Jacke entgegen. Soutas Hände waren nass und wunderbar kühl; das Gefühl weckte das Bedürfnis in Piara, ihr Gesicht mit dem Wasser im Fluss zu erfrischen, sich die Strapazen der letzten Nacht einfach abzuwaschen. »Hast du Hunger?«
»Ein wenig«, log sie, ohne näher darüber nachzudenken; sie wusste, dass ihre Vorräte nicht lange reichen würden. Außerdem hatte sie im Moment ganz andere Sorgen. »Was machen wir jetzt?«, fragte Piara zögerlich und hielt ihre Beine in den Fluss. Das kühle Wasser war die reinste Wohltat. Es floss langsam über ihre müden Füße, während sie erwartungsvoll zu ihrem Bruder aufsah.
»Ich weiß es nicht. Noch nicht. Aber wir werden es herausfinden.« Souta blickte zur Seite. »Für den Moment sollten wir nach Ascot gehen. Dort tummeln sich zahlreiche Händler und Reisende, daher bin ich mir sicher, dass wir keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen werden. Womöglich erfahren wir auch, wie die Lage in Clay gerade aussieht und ob eine Rückkehr infrage kommt. Wir wären dort jedenfalls fürs Erste in Sicherheit.« Er hielt inne und fuhr sich durchs Haar, rang sich zu einem matten Lächeln durch. »Das ist mir momentan das Wichtigste.«
Piara nickte und nahm einen Schluck aus der Feldflasche, die Souta ihr reichte. Ihre Kehle war immer noch trocken und für jeden Schluck dankbar, den sie nahm.
»Wir sollten essen und uns dann auf den Weg machen. Laut Karte müssen wir über die Hochebenen des Jonaugebirges, bis wir am Rande von Fayon an die Ostküste gelangen. Am besten gehen wir die Strecke zu Fuß und halten uns im Hintergrund.«
Während ihr Bruder ihr die geplante Route erklärte, schnitt er einen kleinen Brotlaib in zwei Hälften und reichte Piara die etwas größere davon. Das tat er immer, wohl wissend, dass seine Schwester sie fast nie allein aufessen konnte. Es war ein Zeichen seiner Fürsorge, weshalb sie ihre Hälfte mit einem leichten Lächeln entgegennahm.
»Tut dir dein Kopf noch weh?« Sie starrte auf die Bandagen, die sich über Nacht mit Blut vollgesogen hatten, als sie zu ihm hinüber rutschte. Vorsichtig löste Piara sie von seiner Stirn und Wange ab. Zwar sträubte Souta sich ein wenig, ließ seine Schwester jedoch gewähren. Sie nahm den Rucksack und suchte nach dem restlichen Verbandsmaterial.
»Sehr gut, wir haben sogar Vajape und Nesselkraut«, stellte sie zufrieden fest und griff nach einer Handvoll frischer Heilpflanzen. Souta winkte ab; sie sollten die Zutaten besser aufheben, seine Wunden würden schließlich auch so verheilen, doch Piara wusste ihn zu ignorieren. Sie fertigte eine Paste, indem sie die Blätter mit ein wenig Wasser und einem sauberen Stein zermahlte. Der Saft von Vajapen wirkte desinfizierend und konnte zusammen mit Nesselkraut als Wundkleber verwendet werden. Aus ihnen wurden zahlreiche Schmerzmittel und Medikamente hergestellt. »Vergiss es, du blutest immer noch«, war alles, das sie auf seinen Protest schließlich entgegnete.
Souta seufzte und tränkte ein kleines Stofftaschentuch mit kaltem Flusswasser. Behutsam versuchte er, die beiden Schürfwunden an Kinn und Wange sowie den tieferen Schnitt an seiner Stirn zu säubern, doch Piara nahm ihm das Tuch aus der Hand.
»Komm her. Du verteilst das Blut nur noch mehr in deinem Gesicht.« Sie verkniff sich den Anflug eines Grinsens, was ihrem Bruder jedoch nicht entging.
»Schön, dass dich das amüsiert.« Sein überzogen dramatischer Tonfall brachte sie immer zum Lachen; doch heute nicht. Souta biss sich auf die Lippen und zog scharf die Luft durch die Zähne. »Ich habe vergessen, wie sehr diese blöden Pflanzen brennen.«
»Das bedeutet nur, dass sie wirken.« Piara hob einen Mundwinkel. »Siehst du? Schon blutest du nicht mehr.«
»Zitier mich nicht!« Ihr Bruder verschränkte gespielt beleidigt die Arme. »Das hab ich früher immer zu dir gesagt.«
»Wenn ich mir die Knie aufgescheuert habe«, ergänzte sie. »Morgen sehe ich nochmal danach. Dann aber ohne Diskussion, du Schaf.« Sie schnippte Souta gegen die Stirn, als seine Wunden versorgt waren, und rang ihm damit ein Lächeln ab. »Wie ist das eigentlich passiert? Bist du gefallen?«
Er wandte seinen Blick ab und schwieg.
»Souta. Komm schon.«
Zögerlich setzte er zu sprechen an: »Ja, ich bin gefallen, als ich dich geholt habe. Aber ist doch egal. Es verheilt. Danke, Piwi.« Eigentlich konnte Piara diesen alten Spitznamen aus Kindertagen nicht ausstehen. Doch Souta hatte sich nie abgewöhnt, sie hin und wieder so zu nennen; und er war der Einzige, dem sie das noch erlaubte.
Als die beiden sich auf den Weg machten, um ihrer Heimat für unbestimmte Zeit den Rücken zu kehren, ließ Piara ihren Blick ein letztes Mal über Saetams Weiten schweifen. Sie hatte sich immer ausgemalt, dass ihre erste Reise unter anderen Umständen stattfinden würde. Die vor ihr liegende unendlich scheinende Graslandschaft versetzte sie nicht in Vorfreude auf das, was hinter ihr verborgen lag und weckte auch keinerlei Neugierde.
»Souta?« Piara starrte in die Ferne und fasste einen Entschluss. »Es soll nicht umsonst gewesen sein. Alles, was ihr für mich getan und aufgegeben habt. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie genau er aussehen wird. Aber du kannst dich auf mich verlassen.«
Souta nickte stumm. All die Ungewissheit der letzten Jahre, die ewige Frage wann und wie es passieren würde, hatten für ihn ein Ende. Er wusste genau, was er jetzt zu tun hatte.
6
Der Duft geschmorter Hirschkeulen, geräucherten Herings und gebratener Kartoffeln lag in der Luft des imposanten Speisesaals. Der Raum war von Gelächter und aufgeregten Stimmen erfüllt, als Rigoras sein Elternhaus betrat. In der Mitte stand ein Esstisch aus edelstem Holz, der mit allerlei Köstlichkeiten und festlichen Kerzenständern gedeckt war. Das tintenblaue Tischtuch aus Seide harmonierte mit den silbernen Kronleuchtern. Dunkle Vorhänge säumten die weitläufige Fensterfront; perfekt abgemessen, wie von einer der bedeutendsten Familien Mitaerias zu erwarten.
Frisches Brot aus dem Lehmofen, eingelegte Rüben, Wurzeln, Kraut und süßer Honigkuchen standen auf der festlich angerichteten Tafel. Yaria, die Köchin des Hauses, hatte sich wieder einmal selbst übertroffen und groß aufgetischt. Hattou Clansbow, der oberste Clanführer der Provinz Fayon, ließ den Tag gern mit einem üppigen Mahl ausklingen und liebte es, bei dem einen oder anderen Kelch Wein über Politik und aktuelles Weltgeschehen zu plaudern. Als Oberhaupt hatten er und sein Sohn oft Gäste zum Abendessen eingeladen und nicht selten war es Senias Familie, die ihnen dabei Gesellschaft leistete – wie auch heute.
Als der junge Mann den Raum betrat und zu seinem Platz ging, nickte er Senias Eltern zu und begrüßte sie.
»Rigoras! Schön, dich zu sehen«, empfing ihn Senias Vater Alban, der Clanführer der Takamori. Enge politische Beziehungen waren etwas, das Hattou schätzte und pflegte. Nicht zuletzt, da Fayon als segmentäre Gesellschaft galt, in der Familien-Clans regierten. Die Takamori stellten einen der stärksten und wichtigsten Verbündeten der Familie dar, was man bei Albans Anblick nicht unbedingt vermutete: Er war von kleiner und fester Statur mit ergrauten Schläfen. Sein Hemd ließ er achtlos aus der Hose hängen. In der Hand hielt er einen Kelch Rotwein, der nahezu geleert war und in seinem Rauschebart erkannte man Krümel. Alban erwiderte Rigoras’ Nicken, wandte sich dann aber wieder Hattou, zu, der an der Stirn des Tisches zu seiner Rechten saß. Senia hatte bereits den Platz neben Rigoras’ freiem Stuhl eingenommen und lächelte ihn unsicher an – ihr Gespräch von vorhin schien sie immer noch zu beschäftigen.
»Bitte entschuldigt meine Verspätung, ich habe beim Jagen die Zeit vergessen. Ich hoffe, ihr musstet nicht lange auf mich warten.«
»Jetzt bist du ja hier. Setz dich.« Sein Vater deutete auf den leeren Stuhl links von ihm. Sein brünettes Haar war zu einem hohen, kurzen Zopf gebunden, dessen Spitzen abstanden. Er räusperte sich. »Wir haben gerade von dir gesprochen, mein Junge.«
Rigo blickte seinen Vater an, der unbeirrt nach einer Hirschkeule griff und seinen Teller mit gestampften Kartoffeln und Kraut füllte.
»Vor wenigen Stunden hat der Orden um deine Dienste gebeten. Ich möchte daher, dass du ihren Auftrag erledigst, bevor eure Vermählung stattfindet.«
»Warte, Vermählung? So bald schon?«, stotterte Rigoras. »Aber es war doch abgemacht, dass wir erst in zwei Jahren heiraten müssen. Wenn Senia volljährig ist.«
Senia zuckte neben ihm zusammen, als Rigoras dieser Satz über die Lippen kam. Er hatte es wieder getan und ihre Hochzeit vor ihr als lästige Pflicht bezeichnet, gesagt, sie heiraten ‘zu müssen’. Er hatte die Tatsache, dass sie einander von klein auf versprochen wurden, immer akzeptiert, es als seine Aufgabe angesehen, dieses Szenario jedoch in weite Ferne geschoben. Als Sohn des obersten Clanführers, was in manch anderen Provinzen des Kontinents der Rolle eines Prinzen gleichkam, musste er früh lernen, die Bedürfnisse des Volkes über seine eigenen zu stellen. Seinen Vater so plötzlich über ihre Vermählung sprechen zu hören, als stünden die beiden fast schon vor dem Altar, holte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Wie ich vorhin bereits sagte: Vor wenigen Stunden war ein Botschafter des Ordens von Corasil hier und hat nach deinen Diensten verlangt.« Hattou nickte zufrieden und überging Rigos Widerworte. »Dein Talent hat sich bis in die Hauptstadt herumgesprochen, das ist eine anschauliche Leistung. Ich möchte, dass du diesem Auftrag nachgehst, während wir alle Vorbereitungen für eure Vermählung treffen.«
Der Orden von Corasil? Verwundert sah er seinem Vater dabei zu, wie er sich Wein nachschenkte und den Krug emporhob.
Doch Rigoras unterbrach ihn: »Vater, ich fühle mich geehrt, einen Auftrag für den Orden ausführen zu dürfen, doch ich verstehe die Eile angesichts der Hochzeit nicht ganz.«
»Nun, sagen wir so: Ich habe Alban vorgeschlagen, eure Vermählung früher als geplant stattfinden zu lassen. Du trägst Verantwortung deinem Volk gegenüber und es ist dringend notwendig, dass du diese auch wahrnimmst. Je früher, desto besser für alle Beteiligten.«
Woher kamen die strengen Worte seines sonst so besonnenen Vaters auf einmal? Er konnte nicht sagen, ob Senia womöglich aus Frust mit ihren Eltern gesprochen und ihnen Druck gemacht hatte, die Dringlichkeit der Hochzeit zu verstärken. Rigoras war ein Freigeist, der Ruhe und Erholung in der Natur fand, doch die Tatsache, dass er in einigen Jahren die Erbschaft seines Vaters antreten und ein Volk zu regieren haben würde, erfüllte ihn eher mit Anspannung als mit Stolz. Ihm war dennoch bewusst, dass Traditionen bewahrt werden mussten. Er wollte seinen Vater nicht entehren oder die Bräuche Fayons missachten – nichts widerstrebte ihm mehr. Und wenn er in seinem Leben eines gelernt hatte, dann, dass Widerstand gegen die Entscheidungen seines Vaters in jederlei Hinsicht zwecklos war.
»In Ordnung, Vater. Wenn es dein Wunsch ist, dass ich meine Nachfolge früher antrete, dann werde ich dem nachkommen.«
Senias Miene hellte sich sichtbar auf, sie strahlte und griff unter dem Tisch nach Rigos Hand, die auf seinem Bein lag; zu einer Faust geballt und starr, wie der Rest seines Körpers.
»Das höre ich gern! Dann lasst uns unsere Gläser erheben und auf die Zukunft unserer beider Familien trinken! Auf Rigoras und Senia, die schon bald als Ehemann und Ehefrau über unsere Ländereien und unser Volk herrschen werden. Möge die angehende Reise meines Sohnes von Erfolg gekrönt und die Vermählung unserer beiden Kinder gesegnet sein!«
Der Rest des Abends zog monoton und farblos an Rigoras vorbei. Er lächelte, nickte, antwortete auf Fragen und verabschiedete seine Gäste am Ende höflich.
Als Senia und ihre Eltern den Heimweg antraten, sah er ihnen nach, bevor er zu dem kleinen Stall auf der Rückseite des Hauses schlich. Sein treuer Gefährte Truffles, ein großgewachsenes, dunkles Wildschwein, das viel zu gutmütig und freundlich für seine Art war, lag friedlich schlummernd auf einem Berg voll Stroh und streckte seinem Besitzer die Schnauze entgegen, als es ihn erkannte. Die Stalltür fiel hinter ihnen ins Schloss und die beiden sprinteten gemeinsam los in den Wald; er wollte alle nahenden Verpflichtungen vergessen. Die heutigen Ereignisse, den Auftrag des Ordens, seine Hochzeit und die damit verbundene Übernahme der Herrschaft. Noch einmal im Moment leben, die Nacht genießen und frei sein. Doch so sehr er sich bemühte, er konnte das Gefühl, dass sein Vater an diesem Abend nicht völlig aufrichtig gewesen war, nicht abschütteln.
7
»Mein Kopf,
all dieses Durcheinander.
Stimmen streiten untereinander.
Sie sagen ich soll gehen,
sagen ich muss bleiben,
Stärke zeigen, sie schützen, doch
das Band schließlich durchschneiden.
Wohin sie mich auch rufen,
nachts, wenn meine Sorgen wandern,
durch meinen Geist,
mir Qual bereiten,
darf ich nicht hören, nicht sehen, nicht spüren,
sie bringen doch nur Schwierigkeiten.
Denn die, die sich ihnen hingaben,
verursachten das, womit wir uns nun plagen.«
8
Die Hochebenen des Jonaugebirges waren wie aus einem Märchenbuch. Ein schmaler Weg schlängelte sich vor Piaras und Soutas Füßen durch die grünen Hügel. Umrandet von stellenweise begrasten Bergen, hätte dieser Ort ein perfektes Ausflugsziel dargestellt, wenn die beiden unter anderen Umständen hierher gereist wären.
Dunkle Wolken zogen auf und schickten dicke Regentropfen vom Himmel. Der Pfad war mittlerweile matschig geworden, Piaras Stiefel wurden mit jedem Schritt schwerer. Der ohnehin schon lange Marsch verlangte von den beiden nun volle Konzentration. Durchgefroren und mit den Kapuzen tief in ihren Gesichtern stapften sie voran und hatten eine Rast dringend nötig. Das Wetter in der Provinz Sithrieta, die sie am mittlerweile zwanzigsten Tag ihrer Reise erreicht hatten, war unberechenbar, wie Piara nun am eigenen Leib erfuhr. Angestrengt hielten sie Ausschau nach einem geeigneten Unterschlupf, so gut es der dichte Regenschwall zuließ.
Ein Felsvorsprung am Horizont weckte das Interesse von Souta, der schnellen Schrittes den rutschigen Pfad entlang eilte und sich immer wieder nach Piara umdrehte.
»Ich glaube, dass wir uns dort vorne ein wenig ausruhen können. Kannst du noch?«, fragte er. Piara hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten.
Sie nickte ihm zu und wickelte ihre Jacke fest um ihren Körper, um dem kalten Wind ein wenig Einhalt zu gebieten. Der Felsvorsprung bot genug Platz für zwei; zu Soutas und Piaras Überraschung war der Boden verhältnismäßig trocken geblieben. Erleichtert ließ Piara sich nieder – heilfroh darüber, dass ihr durch den Windschutz allmählich wieder wärmer wurde. Souta zog die dicke Decke aus Yakwolle aus seinem Rucksack, die ihnen in den letzten Tagen schon gute Dienste geleistet hatte. Die durchnässten Jacken der beiden befestigte er an der oberen Kante des Felsvorsprungs, um den Regen auch von dieser Seite abzuhalten. Wenig später saßen beide unter der Decke und tranken heißen Tee, für den sie bei diesem Wetter mehr als dankbar waren. Die runden Teebeutel, die Souta noch am Morgen bei seinen Besorgungen aus einem Dorf mitgenommen hatte, waren mit einem speziellen Pulver versehen: Ganz gleich, welche Teekräuter oder getrockneten Früchte man hinein füllte und mit Wasser übergoss, die Flüssigkeit begann kurz darauf zu kochen und man erhielt dampfend heißen Tee. Besonders in der nördlichen Provinz Jedroya hatte die Bevölkerung regelmäßig mit tiefen Temperaturen im Minusbereich zu kämpfen, was die Pulverbeutel, wie sie der Einfachheit halber oft genannt wurden, zu einer notwendigen Erfindung machten.
Souta lehnte an seiner Tasche und studierte die Karte, während Piara dem Regen lauschte und darauf wartete, dass die dunklen Wolken an ihnen vorüberzogen. Dabei knabberte sie an einem Apfel, den sie in den Tiefen des Rucksacks gefunden hatte. Gedankenverloren verfolgte sie die Wassertropfen, die von den zitternden Ästen und Blättern zu Boden glitten und im dichten Gras verschwanden.
Regen war in Clay eine Seltenheit, besonders in den letzten Jahren hatte es immer längere Dürreperioden gegeben. Interessanterweise war nur das Land rund um das Dorf betroffen. Der Rest der Provinz war zwar trocken, doch erfreute sich zumindest gelegentlicher Regengüsse.
Neben Piara erklang ein lautes Niesen, das sie hochschrecken ließ; fast hätte sie ihren Apfel fallen lassen.
»Ich hoffe, du hast dich nicht erkältet. Der Regen lässt nach, wir können sicher bald ein Feuer machen.«
»Ich bin okay, es ist nur etwas staubig und ich bin müde. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass wir hier Brennholz finden, was meinst du?«
Piara überlegte einen Moment. »Kannst du das denn nicht trocken ‘zaubern’?«, fragte sie neckisch und zog das letzte Wort extra in die Länge.
Souta schenkte ihr einen ungläubigen Blick. »Du hast keine Ahnung, wie Alchemie funktioniert, was?«
Sie lachte, füllte seinen Becher mit frischem Tee auf. »Keine Chance! Und bitte erspar mir deinen Vortrag über mein vergeudetes Talent.« Piara zwinkerte ihm halbironisch zu. Obwohl sie sich für Pflanzen und die Herstellung von Heilmitteln interessierte, konnte sie sich nicht im Geringsten für den Beruf ihres Bruders begeistern.