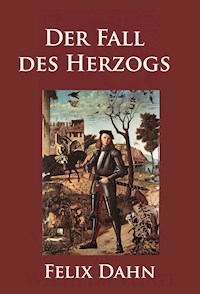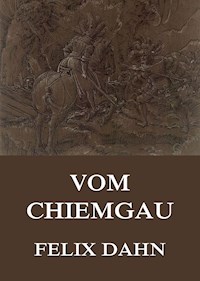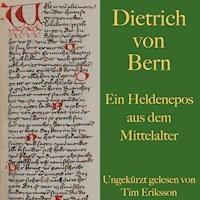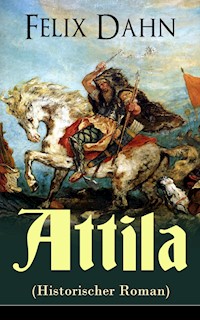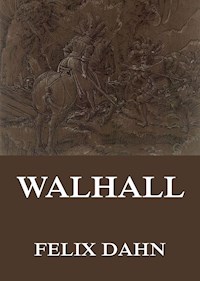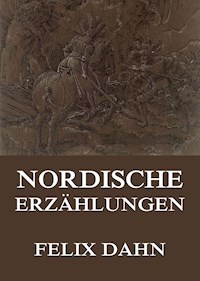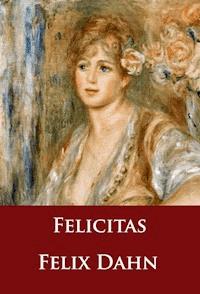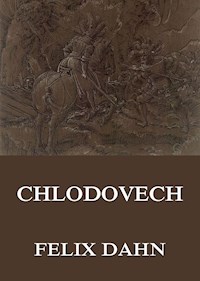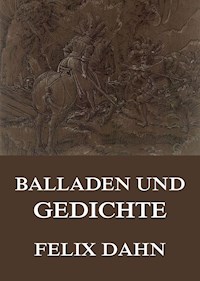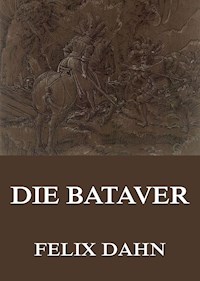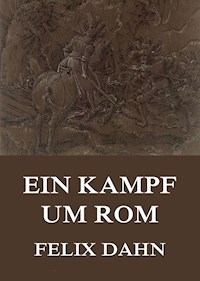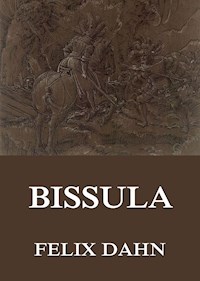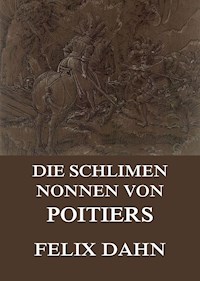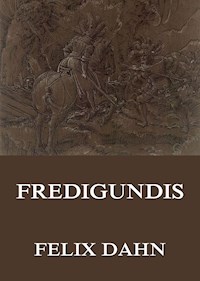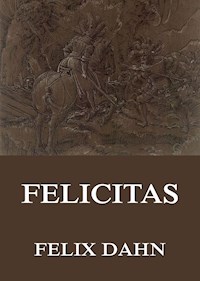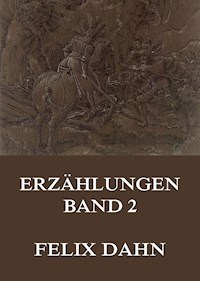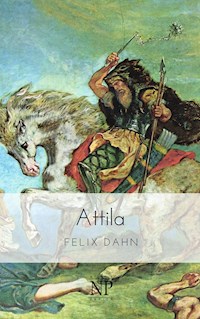
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Komplettveröffentlichung aller sechs Bände in überarbeiteter Fassung Attila, König der Hunnen, beherrschte Mitte des 5. Jahrhunderts weite Teile Europas, seine Herrschaft reichte vom Schwarzen Meer bis zu den Ausläufern der Alpen. Er war ein grausamer Eroberer, der keine Gnade mit seinen Feinden kannte. Unter rätselhaften Umständen starb er in seiner arrangierten Hochzeitsnacht mit der gotischen Prinzessin Ildikó. Felix Dahn webte um diese historischen Fakten einen spannenden und literarisch anspruchsvollen Text, der auch heute noch zu unterhalten weiß. Ähnlich wie in seinem epochalen Meisterwerk »Kampf um Rom« achtete der Autor darauf, seine Geschichte so historisch korrekt wie möglich zu schreiben. Felix Dahn war Rechtswissenschaftler, Geschichtsforscher und Rektor an der Universität Breslau. Er gehörte zu den produktivsten Autoren seiner Zeit und veröffentlichte auch zahlreiche Gedichte. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Felix Dahn
Attila
Historischer Roman aus der Völkerwanderung
Felix Dahn
Attila
Historischer Roman aus der Völkerwanderung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: P. Franke, Berlin, 1935 3. Auflage, ISBN 978-3-954184-49-1
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Zweites Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Drittes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Fünftes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Sechstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Zum Buch
Attila, König der Hunnen, beherrschte Mitte des 5. Jahrhunderts weite Teile Europas, seine Herrschaft reichte vom Schwarzen Meer bis zu den Ausläufern der Alpen. Er war ein grausamer Eroberer, der keine Gnade mit seinen Feinden kannte. Unter rätselhaften Umständen starb er in seiner arrangierten Hochzeitsnacht mit der gotischen Prinzessin Ildikó.
Felix Dahn webte um diese historischen Fakten einen spannenden und literarisch anspruchsvollen Text, der auch heute noch zu unterhalten weiß. Ähnlich wie in seinem epochalen Meisterwerk »Kampf um Rom« achtete der Autor darauf, seine Geschichte so historisch korrekt wie möglich zu schreiben.
Felix Dahn war Rechtswissenschaftler, Geschichtsforscher und Rektor an der Universität Breslau. Er gehörte zu den produktivsten Autoren seiner Zeit und veröffentlichte auch zahlreiche Gedichte.
*
Informationen über Gratisangebote und Neuveröffentlichungen unter:
www.null-papier.de/newsletter
*
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Dunkel lag die schwüle Sommernacht auf dem gewaltigen Donaustrom. –
Fast einem Meeresarme glich die unüberblickbare Breite der Fluten, die, an den beiden Uferseiten oft in Schlamm versumpfend, auch in der Mitte des Bettes die ungeheueren Massen ihrer Gewässer nur träge vorwärts wälzten nach Osten: denn sehr zahlreich waren die kleinen Werder, die, mit Busch- und Baumwerk üppig begrünt, dem rinnenden Zuge hemmend sich vorgelagert hatten. – Eines dieser schmalen Eilande erhob sich nur wenig über den Spiegel des Flusses; rings von manneshohem Schilf umgürtet trug es nur ein paar Bäume: uralte Weidenstämme, nicht sehr hoch aufgeschossen, jedoch von mächtigstem Umfang, knorrig, mit fantastischen Auswüchsen an Krone, Ästen und Rinde.
Der Mond stand nicht am Himmel; und die Sterne waren bedeckt von dichtem Gewölk, das der feuchtwarme Südwest mit triefenden Schwingen langsam vor sich her schob. Im fernen Osten aber zuckte zuweilen fahler Schein über den schwarzen Himmel hin, geisterhaft, unheimlich; noch drohender drückte dann die dem raschen Aufleuchten folgende tiefe, wie Verderben brütend schweigende Nacht. – – Mit leisem Gurgeln und Zischen drängte sich das Gerinn des Stromes langsam, zögernd an der kleinen Aue vorüber, die, im Westen breit, gegen Osten spitz zulaufend, ungefähr ein Dreieck bildete. Das Schilf ging allmählich auf den sumpfigen flachen Ufern der Insel in dichtes Weidengebüsch über und in stachligen Seidelbast. – Rings alles dunkel, einsam, still: selten nur stieg in dem tiefen Strom ein Raubfisch empor, der, in nächtlicher Jagd, patschend aufschlug: dann ein kurzes Kreiseln auf der Oberfläche – gleich wieder alles ruhig.– – Da flog plötzlich aus dem Gebüsch des linken, des nördlichen Ufers ein großer Vogel schwerfällig auf: – laut kreischend, mit schrillem Warnruf. Er strich langsam auf den Werder zu: aber, im Begriff, auf einer der alten Weiden aufzubäumen, – schon schwebte er über deren Wipfel – schwang er sich plötzlich, jäh ablenkend, mit wiederholtem, aber noch viel lauterem Ruf des Schreckens und der Warnung, hoch empor und eilte nun, mit hastigem, scharf klatschendem Flügelschlag, in ganz anderer Richtung, nach Osten, dem Strom folgend, davon: bald war er in dem Nachtgewölk verschwunden.
Auf dem Eiland aber regte sich’s nun leis in dem Weidengebüsch. Eine Gestalt, die bisher, ganz versteckt in dem Strauchwerk, auf dem feuchten Ufersand sich niedergekauert gehalten hatte, richtete sich ein wenig auf. »Endlich!« sprach eine jugendliche Stimme leise. Der Jüngling wollte aufspringen. Aber ein zweiter Mann, der neben ihm in dem Gestrüpp verborgen lag, zog ihn am Arme nieder und flüsterte: »Still, Daghar. Die den Reiher aufgescheucht, können auch Späher sein.«
Von dem Nordufer her näherte sich nun rasch der kleinen Insel, von dem dunkeln Spiegel der Flut noch dunkler, weil massig, sich abhebend, ein länglicher Streif, wie ein schwarzer Schatte dahingleitend. Es war – schon konnte man es jetzt unterscheiden – ein Kahn: pfeilschnell schoss er heran; und doch völlig lautlos. Die vier Ruder mieden sorgsam jedes Geräusch beim Eintauchen, beim Anziehen und beim Aufheben. – Schon flog, mitten im Anlaufen geschickt gewendet, der Nachen nicht mit dem spitzen Vorderbug, sondern mit dem breiten Hintergransen in das dichte Schilf: das knisternde Reiben der steifen Rohre an der dahingleitenden Seitenwand des Bootes, das wehende Rauschen der dabei gestreiften federgleichen Blüten war der einzige wahrnehmbare Laut. Die beiden Ruderer sprangen an das Ufer und zogen den Kahn noch höher auf das Land.
Die beiden Wartenden hatten sich einstweilen erhoben: schweigend reichten sich die vier Männer die Hände: kein Wort ward gewechselt. Schweigend gingen sie von dem Ufer weiter in das Innere der Aue, die im Westen, Norden und Süden sanft sich erhöhte, nach Osten steiler abfiel; sie näherten sich so den mächtigen Weidenstämmen oben auf dem Scheitel der Insel. Da machte der ältere der beiden früher schon Angelangten Halt, hob das behelmte Haupt, warf das langwallende weiße Haar in den Nacken und sprach mit Seufzen: »Gleich nächtlichen Schächern müssen wir uns zusammenstehlen – wie zu verbotener Meintat.« »Und es gilt doch der edelsten aller Taten«, rief der Jüngling an seiner Seite, den Speer fester fassend: – »der Befreiung.«
»Der Tod schwebt über unsern Häuptern!« flüsterte warnend der jüngere der beiden Ankömmlinge, den braunen Bart, den ihm der nasse Wind in das Gesicht schlug, niederstreichend.
»Der Tod schwebt überall und immer ob den Sterblichen, Graf Gerwalt«, erwiderte sein Kahngenosse: Festigkeit und Zuversicht lagen in seiner Stimme. »Ein wackres Wort, König Ardarich!« rief der Jüngling. »Nur die Art des Todes macht den Unterschied«, nickte der in den langen weißen Haaren. »Gewiss, König Wisigast«, fiel Gerwalt ein. »Und mir graut vor den Qualen, unter denen wir sterben werden, ahnt er nur, dass wir uns heimlich trafen.« Er schauderte.
»Allwissend ist er doch nicht!« eiferte der Jüngling grimmig. »Das ist nicht einmal Wodan«, meinte der greise König. »Aber kommt«, mahnte Gerwalt, den dunkeln Mantel fester um die stämmigen Schultern ziehend. »Der Wind wirft uns plötzlich ganze Schaufeln voll Regen in die Augen. Dort – unter der Weide – finden wir Schutz.«
Alle vier traten nun auf die Nordostseite unter den Schirm des breitesten der Weidenstämme: reichlich fanden sie hier Raum nebeneinander.
»Beginne gleich, König der Rugen«, mahnte Gerwalt, »und ende bald. Weh’ uns, wenn wir nicht sichere Stätte wiedergewonnen haben, bevor der erste Tagesdämmer aufglänzt. Seine Reiter, seine Späher stecken, jagen, lauern überall. Wahnsinn war es, dass ich mich bereden ließ, hierher zu kommen. Nur, weil ich so hoch dich ehre, König Wisigast, meines Vaters Freund, nur weil du, König Ardarich, mir die Schwertleite gabst vor zwanzig Wintern, – weil ich euch beide warnen will, solang ich Atem habe, zu warnen. Bloß deshalb ging ich mit zu diesem tödlichen Wagegang. – Mir war’s, auf dem schattendunkeln, leise fortziehenden Strom: – wir fahren nach Hel!« »Nach Hel kommen nur Feiglinge«, brauste der Jüngling auf, zornig die dunkelblonden, kurzkrausen Locken schüttelnd, »die den Bluttod scheuen.«
Der Braunbärtige fuhr mit der Faust an das Kurzschwert im Wehrgehäng.
»Beginne, Freund Wisigast«, mahnte König Ardarich, sich an den Stamm der Weide lehnend und den Speer schräg vor die Brust drückend, den flatternden Mantel zusammenzuhalten. »Und du, jung Daghar, bändige dich. Ich sah diesen Alamannengrafen einst neben meinem Schildarm stehen, dort – an der Marne – da hielten nur noch die allertodeskühnsten Helden stand.« »Was ich zu sagen hätte«, begann der Rugenkönig, – »ihr wisst es selbst. Unertragbar ist’s, des Hunnen Joch! Wann wird es fallen?« »Wann die Götter es brechen«, sprach Gerwalt.
»Oder wir«, rief Daghar. Aber König Ardarich sah sinnend vor sich hin und schwieg.
»Ist es etwa nicht unertragbar, Graf Gerwalt?« fragte der König, »Du bist ein tapferer Mann, Suabe: und ein stolzer Mann, stolz, wie dein ganzes hochgemutes Volk. Muss ich dir vorhalten, was du kennst, was du erduldest, so voll wie wir? Der Hunne herrscht, so weit er will. Nicht Rom, nicht Byzanz wagt noch den Kampf mit ihm, dem Schrecken aller Länder! Und den Schrecken aller Meere, den furchtbaren Vandalen Geiserich, nennt er seinen Bruder. Alle Völker hat er sich unterworfen von den Toren von Byzanz im Mittag bis zu den Bernsteininseln des Mitternachtmeeres. Und wie herrscht er! Nach Willkür! Nach Laune ist er manchmal großmütig, aber nur seine Laune auch begrenzt ihm immerdar die Gewalt, überall die Grausamkeit, den Frevel. Kein König ist seiner Würde, kein Bauer seiner Garbe, zumal kein Weib seines Gürtels sicher vor seiner Willkür, seinem Gelüst. Jedoch tiefer noch als die anderen Stämme, die er mit seinen Hunnen bezwang, erbarmungsloser tritt er uns in den Staub, uns, die Völker mit lichtem Haar und blauem Aug’, die wir in Asgardh unsre Ahnen haben. Uns ›Germanen‹ – wie der Römer uns nennt – nicht unterdrücken nur, – schänden will er uns.«
»Ausgenommen mich«, sprach König Ardarich ruhig, ein wenig sich aufrichtend, »und meine Gepiden.«
»Jawohl«, rief Daghar unwillig, »dich – und dann noch den Amaler Valamer, den Ostgoten. Euch rühmt er seinen Speer und sein Schwert. Euch ehrt er, – aber um welchen Preis! Wofür zum Lohn?« – »Zum Lohn unsrer Treue, junger Königssohn.« »Treue! Ist das der höchste Ruhm? Mich lehrte man anders in der Skiren Königshalle! – Der blinde Vater, König Dagomuth, sang es zur Harfe schon dem Knaben, bis ich’s spielend lernte:
Reichster Ruhm, Edelste Ehre, – Höre ’s gehorchend: – Ist Heldenschaft.«
»Und gut hast du, jung Daghar, beides vom Vater gelernt: die Heldenschaft und das Harfen. Den besten Sänger, den hellsten Harfner rühmen dich ringsum Männer und Maide. Und tapfer sah ich – zu meines Herzens Freude – das Schwert dich schwingen gegen Byzantiner und Sklabenen. Nun lerne noch dies: – vom älteren Manne lernen, Daghar, ist nicht schmachvoll! – all’ Heldentum hebt an mit Treue.« »Und das ist alles?« fragte Daghar ungeduldig. »Von mir – zu ihm – ja!« »So hast du denn, Freund Ardarich«, mahnte König Wisigast, »kein Herz für deine Stammgenossen, Nachbarn, Freunde? Es ist wahr –: der Gepiden und der Ostgoten Rechte hat er – bisher! – gewahrt: euch hält er die Verträge ein. Aber all’ uns andere? Meine Rugen, Dagomuths Skiren, die Heruler, die Turkilinge, die Langobarden, die Quaden, die Markomannen, die Thüringe, deine Suaben, Gerwalt, – ist es ihm nicht Wollust, auch den Treuverbliebenen jedes Vertragsrecht nach Willkür zu brechen? Euch ehrt – euch belohnt er mit reichen Schatzgaben, mit Beuteanteilen, auch wo ihr gar nicht gefochten habt – und uns? – Uns bricht er und nimmt er, was uns gebührt. Glaubst du, das weckt nicht Hass und Neid?« –
»Gewiss«, seufzte Ardarich, den grauen Bart streichend. »Es soll ihn ja wecken!« »Er legt es darauf an«, fuhr der Rugenkönig fort, »uns andere zur Verzweiflung, zum Losbrechen zu treiben.« »Um euch sicher zu vernichten«, nickte Ardarich traurig.
»Deshalb fügt er zum Drucke den Hohn, die Schmach. So hat er den Thüringen zu der alten Jahresschatzung von dreihundert Rossen, dreihundert Kühen, dreihundert Schweinen plötzlich auferlegt eine Jahresschatzung von – dreihundert Jungfrauen.«
»Ich erschlag’ ihn doch noch, den Jungfrauenschänder!« schrie da laut jung Daghar.
»Nie gelangst du, Hitzkopf«, erwiderte Gerwalt, mit der Hand winkend, »auf Speeresweite an seinen Leib. In dichten Klumpen umballen ihn überall auf Schritt und Tritt seine Hunnen wie Bienen den Schwarmkorb.« – »Und die tapfern Thüringe« – forschte König Ardarich sehr aufmerksam – »haben sie’s schon bewilligt?« – »Weiß nicht«, fuhr Wisigast fort. – »Ja, vor ein paar Jahren, da ging ein Hauch des Hoffens durch die zitternden Völker: sie hoben aufatmend die gebeugten Häupter! Als dort in Gallien – gedenkst du’s noch, Freund Ardarich? – jener Fluss nicht mehr fließen konnte – so voll lag er von Leichen! – und blutschäumend über die Ufer quoll?«
»Ob ich’s gedenke!« stöhnte der Gepide. »Zwölftausend meines Volkes liegen dort.« – »Da musste er, der Allgewaltige, zum ersten Mal weichen. Dank den herrlichen Westgoten und dank Aëtius«, rief Daghar.
»Und als er bald darauf«, fiel Gerwalt ein, »auch in Italia umkehrte vor einem alten Mann, einem Priester aus Rom, der an einem Stecken ging, da hofften die Geknechteten im ganzen Abendland –«
»Es geht zu Ende, die Gottesgeißel ist geknickt«, fuhr Wisigast fort. »Schon flackerte dort und da die Flamme der Freiheit auf!« rief Daghar. »Zu früh!« sprach der Gepidenkönig ernst. »Ja freilich, zu früh«, seufzte Gerwalt. »Mit Strömen Bluts hat er gelöscht.« – »Und jetzt!« klagte Wisigast. »Verderblicheres als je zuvor plant er für das nächste Frühjahr. Zwar seine letzten Ziele hält er noch streng verhüllt: – nur ahnen mag man sie: – aber ungeheuer müssen sie sein, nach den ungeheueren Mitteln, die er aufbietet. All’ seine Völker – wohl viele hundert Namen! – aus beiden Erdteilen! Und aus dem dritten, aus dem mittägigen Land, aus Afrika, reicht ihm der Vandale die Hand zum fürchterlichen Bunde!«
»Wem mag es gelten? Wieder dem Westen?« forschte Gerwalt. »Oder dem Ostreich?« fragte Daghar. »Oder beiden!« schloss Ardarich. »Wie dem sei«, fuhr der Rugenkönig fort, »sechsmal so stark wie vor drei Jahren wird er sein! Und die Gegner? In Byzanz ein Schwächling auf dem Thron! Im Westen? Aëtius in Ungnade bei Kaiser Valentinian, vom Mörderdolch bedroht. Bei den Westgoten drei, vier Königsbrüder, hadernd um die Krone. Verloren ist die Welt, für immerdar verloren, werden auch Gallien und Spanien geknechtet. Dann stürzen auch Byzanz und Rom. Er muss fallen, bevor er auszieht zu diesem letzten Kampf, zu einem zweifellosen Sieg. Sonst ist der Erdkreis ihm verknechtet. Hab’ ich recht oder hab’ ich unrecht, Freund Ardarich?«
»Recht hast du«, seufzte der und drückte die geballte Linke an die Stirn.
»Nein, unrecht hast du, König Wisigast!« rief der Alamanne dazwischen. »Du hättest recht, wär’ er ein Sterblicher wie wir und gleich anderen Sterblichen bezwingbar. Er aber ist ein Unhold! Der Christenhölle entstiegen! so raunen unsere Priester des Ziu, eines Unholds Sohn und einer wölfischen Alraune. Speer nicht spürt er, Schwert nicht schlägt ihn, Waffe nicht wundet! Ich hab’ es erlebt, gesehen! Ich stand neben ihm an jenem Strom in Gallien: ich stürzte, und Hunderte, Tausende stürzten neben mir unter dem Gewölk von Pfeilen und von Speeren: er stand! Aufrecht stand er! Er lachte! Er blies – ich hab’s gesehen! in den spitzen, kargen Kinnbart – und die römischen Pfeile prallten wie Strohhalme zurück von seinem Elchvließ. Dass er kein Mensch ist, das zeigt am besten seine – Grausamkeit!«
Er verstummte und schauderte. Er schlug beide Hände vor die Augen. »Dreißig Jahre sind es bald«, fuhr er nach einer Weile fort. »Ich war ein Knabe. Aber immer noch seh’ ich sie vor mir – auf den spitzigen Pfählen sich windend, noch hör’ ich sie brüllen vor Schmerz – im Aufruhr gegen den Schrecklichen von ihm gefangen – den greisen Vater, den Bruder, die ganz schuldlose Mutter. Und – vor unsern Augen! – meine vier schönen Schwestern zu Tode gequält von ihm, dann von seinen Rossknechten! Mir stieß er das Antlitz auf den zuckenden Leib des Vaters und sprach: ›So endet Untreue wider Attila. Knabe, lerne hier die Treue.‹ – Ich habe sie gelernt!« schloss er mit bebenden Lippen.
»Auch ich«, sprach der König der Gepiden. »Anders: aber noch eindringlicher. Den Schrecken? Ich würd’ ihn abschütteln. Ich hatte ihn abgeschüttelt! Aber mich zwingt der stärkste Zwang: die Ehre! – Auch ich fand – vor geraumer Zeit – wie heute du, Freund Wisigast! – das Joch nicht mehr ertragbar und wollte mein Volk, den Erdkreis retten. Alles war vereinbart: der Bund mit Byzanz, der geheime Vertrag mit gar vielen Germanenkönigen und Häuptlingen der Sklabenen. Ich lag in meinem Zelt und schlief – drei Nächte vor dem beredeten Tag. Als ich erwachte, saß er – er selbst – an meinem Bett! Entsetzt wollte ich auffahren. Da drückte er mich sanft mit der Hand auf das Lager zurück und sagte mir – unsern ganzen Plan und den Vertrag – vier Seiten eines römischen Briefes füllte er – auswendig! her. Dann schloss er: ›Die anderen sind schon gekreuzigt, alle siebzehn. Dir verzeihe ich. Ich lasse dir dein Reich. Ich traue dir. Sei mir fortan getreu.‹ – Am selben Tage noch jagte er mit mir und meinen Gepiden allein im Donauwald. Ermüdet schlief er ein, das Haupt auf meinen Knien. So lang er lebt, muss ich ihm Treue halten.«
»Und die Welt muss hunnisch sein und bleiben!« klagte der König der Rugen. »Ja, so lang er lebt.« – »Nach dem nächsten Sieg der Hunnen ist sie’s dann für immerdar.« »Die Söhne Attilas«, sprach Ardarich nachdrucksvoll, »sind nicht er selbst.« – »Wohl! Aber Ellak ist kein Schwächling und stark genug, nach diesem neuen Siege zu behaupten, was der Vater gewann. Dann gibt es keinen Feind auf Erden mehr gegen das Hunnenreich.« »Dann – doch wohl!« sprach Ardarich. »Echte Königsrede«, rief Daghar ungeduldig. »Allzu rätselhaft! So muss denn gekämpft werden ohne die Gepiden – am Ende gegen sie! König Wisigast, schicke mich zu Balamer, dem Amalung. Ich will ihn –«
»Spar’ dir den Ritt, jung Daghar«, sprach Ardarich. »Hat er auch den begnadigt und – gefesselt?« zürnte der Jüngling. – »Nein. Aber Blutbrüderschaft haben sie getrunken.« »Pfui des ekeln Hunnenbluts!« rief der Königssohn. – »Auch der Ostgote kämpft nicht gegen das Hunnenreich, solang Attila lebt.« »Der kann noch lange leben; sechsundfünfzig Winter zählt er erst«, grollte Daghar. »Und unterdessen geht die Welt verloren«, seufzte Wisigast.
»Besser die ganze Welt«, sprach der Gepide ruhig, voll sich aufrichtend, »als meine Ehre. – Komm, Gerwalt, wir brechen auf. Ich kam, weil ich längst ahnte, was Freund Wisigast sinnt. Ihn hören, ihn warnen wollt’ ich um jeden Preis, auch unter Wagung des Lebens, nur nicht der Ehre. Alter Rugenheld im weißen Haar: – das hoffst du selber nicht, die Hunnenmacht zu brechen, wenn Valamer und ich sie stützen. Und wir müssen sie stützen, greifst du – jetzt! – sie an. König im grauen Bart, hast du die erste Königskunst noch nicht gelernt: – warten? Hörst du nicht, alter Kampfgenoss: warten!«
»Nein, nicht warten!« rief leidenschaftlich Daghar. »Lass, König Wisigast, Gepiden und Ostgoten den höchsten Kranz des Siegs, des Ruhms verschlafen. Wir warten nicht! Du sagst es ja, nach nächstem Frühjahr ist’s zu spät. Wir schlagen los! Wie? Wir sollten nicht stark genug sein? Deine Rugen! Meine Skiren! Wisand der Heruler mit starker Söldnerschar! Der edle Langobarde Rothari mit seiner Gefolgschaft! Der edle Markomanne Vangio mit seinen Gesippen! Die drei Häuptlinge der Sklabenen Drosuch, Milituch und Sventoslav! Endlich versprach ja selbst der Kaiser zu Byzanz, durch seinen nächsten Gesandten an den Hunnen insgeheim uns Gold und Waffen…«
»Wenn er’s nur hält!« unterbrach Ardarich. »Junger Königssohn, du gefällst mir. Harfen kannst du hell und schlagen und reden kannst du rasch. Nun lern’ auch noch das vierte – schwerer und für den künftigen König nötiger als beides – schweigen! Wenn ich nun alle, die du aufgezählt, dem großen Hunnenchan angebe?«
»Das tust du nicht!« rief der Jüngling: aber er erschrak.
»Ich tu’ es nicht, weil ich mir selbst gelobt, geheim zu halten, was mir hier vertraut wird. Ich darf es geheim halten: denn nur euch, nicht Attila droht dieser Anschlag Verderben. Du zweifelst, kühner Daghar? Alle, die du genannt – und wögen sie zehnmal schwerer! – nicht einen Span splittern sie aus Attilas über die Erde gespanntem Joch. Schad’ um deine rasche Jugend, du feuriger Held! Schade um dein weißes, teures Haupt, mein alter Freund! Ihr seid verloren, lasst ihr euch nicht warnen. Wartet! – Du weigerst den Handschlag, Wisigast? Du wirst es bereuen, wann du einsehen wirst, dass ich mit Recht gewarnt. Aber meine Hand – ob heute ausgeschlagen – bleibt deines besten Freundes Hand. Und bleibt immer offen nach dir ausgestreckt: das merke! – Ich komme, Gerwalt.«
Und er verschwand nach links hin in dem Dunkel. Fast unhörbar glitt auf der Nordseite des Werders der schmale Nachen in die schwarze Flut. –
Nachdenksam sah der Greis dem Freunde nach; er stützte beide Hände auf den Knauf des mächtigen Langschwerts, das er unter dem Mantel im Wehrgehänge trug; langsam, wie von schweren Gedanken belastet, sank ihm das Haupt auf die Brust. »König Wisigast«, drängte der Jüngling, »du wirst doch nicht schwanken?« »Nein«, erwiderte dieser gedrückt. »Ich schwanke nicht mehr. Ich gab es auf. Wir sind verloren, wagen wir’s allein.« »Und wären wir’s«, rief Daghar ausbrechend in lodernder Glut, »wir müssen’s dennoch wagen! Vernimm, was ich – vor den Fremden – verschwieg. Wir müssen handeln! Sofort!« – »Warum?« – »Weil … weil! Um ihrer, um deiner Tochter willen.« – »Ildikó! Was ist mit ihr?« – »Sein Sohn hat sie gesehen und … –«
»Welcher?« – »Ellak. Er kam in eure Halle, als du zu uns zur Jagd geritten warst.« – »Wer sagte dir’s? Er doch sicher nicht.« – »Sie selbst –!«
»Und mir nicht?«
»Sie wollte dich nicht ängstigen, vor der Zeit, – du kennst ihre starke Seele! – ohne Grund vielleicht, meinte sie. Aber es ist Grund, zu handeln. Er sah die schönste Jungfrau in allem Germanenvolk und er begehrte sie: – wer kann sie sehen und ihrer nicht begehren? Er wird bei seinem Vater…«
»Ildikó? Mein Kind! Komm! Lass uns eilen! Nach Hause! Rasch.«
Sie schritten nach dem spitz zulaufenden Ostende des Eilands, wo ein Floß, aus sechs breiten Balken kunstlos gefügt, auf das schlammige Ufer gezogen und durch ein vor dem oberen Querbalken senkrecht in den Uferboden getriebenes Sperrholz fest gehalten war. Beide sprangen darauf. Daghar schlug das Gezimmer mit dem Floßhebel nieder und schob vom Ufer ab, pfeilschnell stromabwärts schoss das Floß; der Jüngling stieß vorn mit der Stange, bald rechts, bald links, hin und wieder springend, der Alte steuerte hinten mit dem breiten Floßruder: – auf das rechte, das südliche Ufer hielt er zu. – Beide waren hastig, heiß erregt, voll Ungeduld, nach Hause zu kommen. –
Und nun, nachdem auch das seltene, schwache Plätschern des Ruders in der Ferne verhallt war, nun lagerte wieder tiefes Schweigen wie auf dem Strome, so auf dem verlassenen Werder.
Eine Welle blieb alles ruhig.
Das ziehende Wasser gurgelte leise; das hohe Schilf neigte die tief dunkelbraunen, wehenden Blütenfahnen vor dem Westwinde bis auf den Spiegel des Stromes herab; eine breitflügelige Fledermaus huschte geräuschlos darüber hin, mit unfehlbar sicherem Erschnappen die Nachtmücken erhaschend. Sonst alles still, unbelebt.
Da schien sich der breite Stamm der Weide, unter welcher die vier Männer verhandelt hatten, seltsam zu erhöhen: zwischen seinen Wipfelzweigen hob sich aus dem Baum eine dunkle Gestalt.
Zuerst tauchte auf ein behelmtes Haupt, dann ein breiter, ummantelter Rumpf, der sich mit zwei starken Armen auf die Krone des Baumes stemmte. Nun lauschte und spähte der Mann scharf umher. Da alles ruhig war und leer blieb, zog er auch die Beine aus dem Hohlstamm und sprang herab auf den Boden. Eine zweite, eine dritte Gestalt hob sich aus der breiten hohlen Weide und glitt herab.
»Hatt’ ich nun recht, o Herr?« rief der dritte leidenschaftlich. Es war eine jugendliche Stimme. »War nicht alles, wie ich vorausgesagt?« Der Angeredete gab keine Antwort. Es war so dunkel: – seine Züge waren nicht zu sehen. Die Gestalt war stämmig, kurz, nicht edel gebildet. »Merke dir genau die Namen, Chelchal«, befahl der Angeredete dem anderen Begleiter, statt dem Frager zu erwidern. »Ich vergesse sie nicht. Wisand – Rothari – Vangio – die drei Sklabenenhunde. Lade sie zu unserm größten Fest, den drei Tagen Dzriwils, der Rossegöttin. Das fällt nicht auf, ist Sitte. Sie und all ihre Gefolgen und Vettern, alle muss ich sie haben!«
»Herr, du bist also zufrieden? Gib mir denn den vorbedungenen Lohn«, drängte der Mahner. »Meinst du, es ward mir leicht, die Treue und den jungen, edelsinnigen Herrn zu verraten, mir, seinem eigenen Schildträger? Nur die Gier, die rasende, die hoffnungslose – wenn du nicht halfst – nach jenes Mädchens unsagbarem, herzverbrennendem Reiz konnte mich … Du glaubst nicht, Herr, wie schön sie ist! Wie schlank, wie üppig doch, wie weiß … –«
»Schlank? – Und doch üppig? – Und weiß? Ich werde all’ das sehn.« – »Wann?« – »An ihrem Hochzeitstag, versteht sich. Ich werde nicht fehlen dabei.« – »Eile! Du hörst, schon hat Ellak – mir eilt es! Wann – wann wirst du sie mir geben?« – »Sobald ich mich deiner Treue, deines Schweigens voll versichert. Sag’ selbst: deinen nächsten Herrn hast du an mich verraten, den du wenig liebst, nur fürchtest. Welch Mittel soll ich wählen gegen dich, dass du nicht auch mich verrätst?« – »Welches Mittel? Jedes, das du willst. Das stärkste, sicherste, das dir einfällt.« »Das sicherste?« wiederholte der andere bedächtig, indem er ganz langsam unter seinen weiten Mantel griff. »Gut! Wie du selbst geraten.« Er holte flugs ein langes krummes Messer hervor und stieß es dem Ahnungslosen mit solcher Wucht schlitzend in den Bauch, dass die geschweifte Spitze unter den Rippen hervordrang.
Lautlos fiel der Mann auf den Rücken.
»Lass ihn liegen, Chelchal. Die Raben finden ihn schon. Komm.« – »Herr, lass mich allein hinüberschwimmen an den nächsten Werder, wo wir den Nachen verborgen haben. Ich rudere ihn her und hole dich. Du schwammst bereits von dort fast über den halben Strom hierher. Es wird dir zu viel.« – »Schweig. Der Mann, der jede Nacht ein Germanenweib zerstört, wird wohl zweimal in einer Nacht ein Stücklein Donau zwingen. – Das Schwimmen und das Horchen hat gelohnt. Nicht nur all jenes Unterholz, alt und jung, fäll’ ich auf einen Streich: auch die beiden stolzen Eichen beug’ ich: den Gepiden und den Amaler. Sie müssen meinen Söhnen gleiche Treue schwören, wie mir selbst. Oder sterben. Auf, Chelchal! Ich freue mich auf das kalte Bad. Komm, hochbus’ge Donau, komm in diese Arme!«
Zweites Kapitel
Rugiland, das Gebiet des Königs Wisigast, erstreckte sich von dem rechten Ufer der Donau westlich bis an die Höhenzüge, aus welchen die Krems und der Kamp entspringen.
Einen scharfen Tagesritt von der Donau entfernt lag, umgeben von zahlreichen niedrigen Nebengebäuden, die stattliche Halle des Königs auf einer sanften Höhe. Die Halde hinan zogen sich Eichen und Buchen, ausreichend gelichtet, den Blick freizugeben von dem Fürstenhaus im Norden in das Tal; hier unten schlängelte sich ein breiter, schönflutiger Bach – fast ein Flüsslein zu nennen – um den Hügel her von Süden nach Nordosten durch üppigen Wiesgrund.
An jenem Bache wogte, im hellen Morgenlicht des Sommertags, rühriges, fröhliches Leben: eine Schar von jungen Mädchen war auf dem grünen Ufer eifrig beschäftigt, allerlei wollene und linnene Gewande in dem rasch fließenden Wasser von klarer lichtgrüner Farbe zu waschen. Es war ein heiteres Bild, reich an wechselnder, freier, anmutvoller Bewegung.
Denn mit Hast oder Last der Arbeit schienen es die Lustigen nicht allzu streng zu nehmen: lautes Schäkern, mutwilliges Lachen scholl gar oft aus dem durcheinander wimmelnden Rudel, deren rote, gelbe, blaue, weiße Röcke sich leuchtend abhoben von dem saftigen Grün der im Morgentau glitzernden Wiese. Die Mädchen hatten den Rock des langen hemdartigen Kleides aufgeschlagen und den Zipfel in den breiten Gürtel gesteckt, rühriger schaffen zu können: die weißen Füße waren unbeschuht und die vollen, runden Arme leuchteten wiederstrahlend im Morgenlicht; die eine oder andere hatte wohl einen breiten, aus braunem Schilf geflochtenen, ganz flachen Sonnenhut unter dem Kinne zusammengebunden, die meisten aber ließen das beinah ausnahmslos blonde Haar frei flattern. Zuweilen sprang eine der Arbeitenden, über den Bach Gebeugten, auf, hoch die schlanke, jugendliche Gestalt reckend, die nackten Arme in die Hüften stemmend und das durch die gebückte Stellung gerötete Antlitz im frischen Frühwind kühlend.
Denn etwa zwölf der Mädchen knieten nebeneinander auf dem gelben, ganz kleinkörnigen Ufersande, spülten die Linnen- oder Wollenstücke wiederholt in dem lebhaft flutenden, lustigen, lockenden Gerinne, hoben sie dann heraus, legten sie auf große, flache, saubere Steine, welche zu diesem Behuf hier zusammengetragen worden waren, und schlugen und klopften mit glatten Scheiben von weichem, weißem Birkenholz eifrig darauf los, patschten auch wohl einmal herzhaft daneben auf die Fläche des Bachs, dass das Wasser hoch aufspritzte und der aufschreienden Nachbarin zur Seite Haupt, Hals und Busen tüchtig durchnässte.
Dann rangen sie die gesäuberten Stücke – jedes siebenmal, so verlangte, nach Friggas Gebot, der altvererbte Brauch – mit aller Kraft der jungen Arme aus, das Wasser sorglich auf den Ufersand – nicht wieder in den Bach – abtriefen lassend, und warfen die erledigten Gewande hinter sich auf den dichten Rasen, neue Arbeit greifend aus den zierlichen, von Weiden geflochtenen, hohen Körben, die jede zur Rechten neben sich stehen hatte.
Hinter den knienden Spülerinnen und Klopferinnen aber gingen, schnellfüßig, auf und nieder die Spreiterinnen, lasen die von jenen abgelegten Stücke auf und trugen sie auf breiten, wenig vertieften Mulden von Lindenholz ein paar Schritte weiter von dem Fluss hinweg auf die Mitte der im hellsten Sonnenlicht badenden Wiese: denn hier war der Tau bereits aufgesogen, der nah’ am Bach und dann auch auf der entgegengesetzten Seite, unter den Büschen und Wipfeln des Waldes an der Westseite des Angers, noch reichlich glitzerte.
Sie spreiteten Stück um Stück, sorgfältig die Fältlein auseinander ziehend, reihenweise aus. Die Wiese trug die holdesten Blumen: Ehrenpreis und Frauenschuh, Tausendschön und Erdraute duckten gar gern und willig die nickenden Köpflein unter den feuchten, den kühlenden Schutz vor der sengenden Sonne. Und manchmal kam zutraulich ein Tagfalter geflogen, das bunte Pfauenauge oder die zarte Aurora, welche die warmen, lichtbestrahlten Waldwiesen liebt, oder der schöne, langsam, wie feierlich, schwebende Schillerfalter ließ sich nieder auf der anlockenden Fläche der weißen Wolle und legte die breiten Flügel voll auseinander, in süßem Behagen sich sonnend.
Nahe vor der reichblumigen Wiese gabelte sich der breite Fahrweg, der von der Königshalle den Hügel herab gen Süden führte: nach Westen zu wandte er sich in den Wald, nach rechts, nach Osten, verlief er in jener Matte.
An der Stelle der Gabelung hielt im Schatten dichtästiger, breitblätteriger Haselbüsche ein langer Leiterwagen, bespannt mit drei ganz weißen Rossen, eines voraus, zwei nebeneinander; an sechs halbkreisförmigen Reifen war über den Wagen ein Dach aus starkem Segeltuch gespannt; zahlreiche, säuberlich nebeneinander auf dem Grunde des Wagens aufgereihte Körbe, gefüllt mit bereits getrockneter Wäsche, bezeugten, dass die Arbeit schon geraume Zeit gewährt habe.
Vorn, an dem Querbrett des Wagens, lehnte, hochaufgerichtet, ein Mädchen; das war schön über alle Maßen. Um Hauptes Höhe überragte die schlankhüftige, aber an Nacken, Schultern und Busen in stolzer Fülle prangende, die herrliche Gestalt ihre beiden Gefährtinnen, die doch ebenfalls das Mittelmaß überstiegen. Ein einziges weißes Gewand flutete in langen Falten um die jungfräulichen Glieder; den lichtblauen Mantel hatte sie abgelegt und über das Wagengeländer gehängt. So waren der Hals und die wunderschönen, feingerundeten Arme sichtbar: das Weiß ihres Fleisches schimmerte, ohne zu blitzen, wie mattweißer Marmor. Ein handbreiter Gürtel von seinem, mit Weid blau gefärbtem Leder hielt das wallende Wollhemd um die Hüften zusammen; die feinen Knöchel wurden nicht mehr von dem blauen Saum erreicht; zierlich aus Stroh geflochtene Sohlen schützten den Fuß, über dem hochgeschwungenen Rist mit roten Riemen verschnürt.
Die königliche Jungfrau trug kein Gold als nur ihr Haar; das aber war an diesem wunderreichen Geschöpf ein Wunder für sich: das Satte, Warme, Tiefgoldige der Farbe, die seidenzarte Feinheit jedes einzelnen Härleins und die erstaunliche Fülle. Drei ihrer schmalen, langen Finger breit erhob sich auf ihrer weißen Stirn die Flechte, die, ein unvergleichlich Diadem, sie schmückte: und hinter dieser Stirnflechte teilte sich erst auf dem vollendet edel gebildeten Haupt die überquillende Menge in zwei prachtvolle, dreisträngige Zöpfe, die, an den Enden mit blauen Bändern zusammengehalten, ihr bis unter die Kniekehlen reichten.
So lehnte sie, aufgerichtet zu ihrer vollen Höhe, an dem Wagen, den rechten Arm ruhend über den Rücken des weißen Hengstes des Zwiegespanns vorgelegt, während sie die Knöchel der linken Hand oberhalb der Augen hielt, die Sonnenstrahlen auszuschließen. Denn wachsam blickte sie aus nach der Arbeit der Mädchen an dem Flüsschen und auf der Wiese. Ihre großen runden Augen, goldbraun, ähnlich an Farbe dem Auge des Adlers, leuchteten: scharf, fest, kühn war der Blick; manchmal hob sie stolz die starke, gerade Nase und die schön geschwungenen, tief dunkelblonden Brauen.
Plötzlich ward der schwere Wagen in jäher Bewegung nach rückwärts gerissen: das vorderste Ross stieß nicht ein Wiehern, einen Schrei tödlichen Schreckens aus, fuhr zurück auf die beiden anderen, bäumte sich, stieg – – : Wagen und Rosse schienen von der erhöhten Straße in den Talgrund herunter stürzen zu müssen. Kreischend rannten die beiden Gefährtinnen nach rückwärts, den Hügel hinauf.
Aber die hohe Maid sprang vor, riss den steigenden Hengst am Zaume nieder mit kraftvollem Arm, schaute einen Augenblick, das schöne Haupt beugend, scharf spähend, auf die Erde und trat dann mit dem rechten Fuß fest und sicher zu.
»Kommt nur wieder«, sprach sie nun ruhig, mit der Spitze des Fußes auf der Straße etwas zur Seite schiebend, das sich zuckend im Staube wand. »Er ist tot.« »Was war es?« forschte ängstlich eine der Gefährtinnen, neben dem Wagen wieder auftauchend: neugierig und furchtsam zugleich steckte sie das braunlockige Köpflein vor, den dunkelgrünen Mantel wie zum Schutze vorhaltend.
»Ein Kupferwurm, Ganna; die Pferde fürchten ihn sehr.« »Mit Recht«, meinte die zweite der geflüchteten Gesellinnen, auf der anderen Seite des Wagens sich wieder heranwagend. »Und die Menschen! Hätt’ ich’s gewusst, – noch rascher wär’ ich gelaufen. Mein Vetter starb an dem Biss.« – »Man muss sie zertreten, ehe sie beißen können. Seht ihr – gerade hinter dem Kopf – am Hals – zertrat ich sie.«
»Aber Ildikó!« rief Ganna entsetzt, beide Arme erhebend. »Oh Herrin! Wenn du fehl tratst!« klagte die zweite. »Ich trete nicht fehl, Albrun. Und mich beschützt Frigga, die freudige Frau.« »Ja freilich! Ohne deren Hilfe …!« rief Albrun. »Weißt du noch, Ganna, wie ich – im vorigen Frühling war’s – da unten beim Waschen kopfüber in das Wasser gefallen war? Du schriest: und du und alle die zwanzig anderen – ihr liefet an dem Ufer hin mir nach, wie ich dahin schoss im wirbelnden Wasser – –« »Gewiss! Aber sie schrie nicht. Hinein sprang sie und haschte dich am roten Mantel – dieser war es, derselbe – den du stets so gerne trägst, du weißt, er lässt dir gut! – haschte dich mit der Linken und mächtig rudernd mit dem starken rechten Arme zog sie dich ans Land.«
»Und als ich«, lächelte das Königskind, »mir das triefende Haar ausstreifte …«
»Da hatte sich darin festgeklemmt die Muschel, die wir Friggas Spange nennen …« »Die Perlen tragende«, fuhr Albrun fort. »Und da wir die Schalen auseinander zwängten …« – »Da lag darin die schönste, größte Edelperle, die je Mädchenauge entzückt hat.« – »Ja, gewiss« sprach Ildikó ernst, leicht mit der Linken über die Braue streichend, »ich stehe in Friggas Schutz und Frieden. Wie hätt’ ich sonst, da mir die Mutter starb, sobald sie mich geboren, an Leib, Seele und Sitte doch ganz leidlich gedeihen mögen? Frau Frigga hat – an Mutter Statt – der Vater mich befohlen: ist sie doch unsrer Sippe lichte Ahnfrau! Abendelang hat mir der treue Vater in der Halle, am glimmenden Herdfeuer, vorerzählt von ihr, von aller Frauen fraulichster und hehrster. Und oft und oft, wann ich dann einschlief, sah ich die blonde, die schöne Frau an meinem Lager stehn, und ich spürte, wie sie mir hinstrich mit der weißen Hand – hier – über Stirn und Braue hin. Und ich erwachte wohl auch: – dann war mir, ich sähe noch ihr weiß Gewand entschweben und Funken sprühte dann, fuhr ich süß erschrocken darein, mein knisternd Haar. Unsichtbar allüberall begleitet mich, behütet mich, befriedet mich die weiße Frau. – Aber nun genug der müß’gen Mädchenworte! Zur Arbeit wieder!«