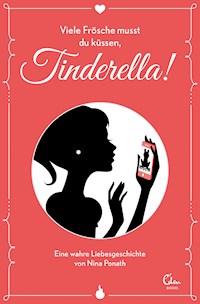6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Für manche war es wie die Reise ins Paradies, für andere ein monatelanger Horrortrip - und für alle von ihnen der Anfang eines unabhängigen Lebens: Nina Ponath hat 33 Ex-Au-pairs befragt, die über ihre schönsten, peinlichsten und kuriosesten Erlebnisse auf unbekanntem Terrain erzählen. Carolin etwa gerät schon vor ihrer Abreise nach New York ins Visier dubioser Geschäftemacher. Sylvia erwischt ihren italienischen Gastgeber im Tanga und mit einer großbusigen Blondine. Und Steffi verliert wegen eines kleinen Quälgeistes und seines arroganten Vaters zwar die Nerven, gelangt aber an die Kontaktdaten von Stars und Sternchen. Sie und die 30 anderen Weltreisenden, die in diesem Buch auspacken, werden ihre Zeit als Au-pair niemals vergessen - genauso wenig wie der Leser ihre Geschichten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Nina Ponath
Au-pair
33 wahre Geschichten über skurrile Gastfamilien, verrückte Kleinkinder und das große Abenteuer Ausland
INHALT
Vorwort
Hello, salut, hola!
»Au-pair« – der Begriff bedeutet »Gegenleistung« und kommt aus Frankreich, wohin es auch heute noch, trotz Globalisierung und Sparangeboten von Ryan Air, neben den USA und Großbritannien die meisten Au-pairs zieht. Die Motive ähneln sich: Kulturen unverfälscht kennenlernen, die Sprachkenntnisse verbessern – eben etwas geben und für seine Arbeit mehr als nur Geld zurückbekommen. Die tatsächliche Gegenleistung für die 35-Stunden-Woche, die aus Windelnwechseln, Unterwäschebügeln und viel Langeweile besteht, reicht vom Tripper bis zum Gerichtsverfahren – nicht immer verläuft ein Au-pair-Aufenthalt so, wie man ihn sich vorgestellt hat. Ich selbst wagte 2007, direkt nach dem Abitur, den Versuch und ging als Au-pair nach Frankreich. Meine eigene Familie ziehe ich zwar jeder Gastfamilie der Welt vor (nicht zuletzt, weil es in meiner Kindheit schon vor 22 Uhr etwas Warmes zu essen gab und nicht jeder Familienurlaub von einem Foto-knipsenden Au-pair überschattet wurde), doch wenigstens meine Liebe zur französischen Sprache wurde nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten entfacht. Und so konnte ich nach fünf Monaten in Frankreich, inklusive Familienwechsel und einem ziemlich verrückten Ende, endlich die lästige Frage »Und, was machst du jetzt mit deinem Abitur?« beantworten und begann mein Französischstudium auf Lehramt. Ich mag Kinder nach wie vor, auch wenn mir die Liebe meines Au-pair-Zöglings mal eine ziemlich miese Magen-Darm-Grippe eingehandelt hat. (Es ist grundsätzlich nicht ratsam, sich von Zweijährigen auf den Mund küssen zu lassen, auf deren Lippen sammeln sich nämlich mehr Bakterien als auf der Toilettenbrille.)
Dass ich heute auf jede Art von Zukunftsfrage mit »Ich werde Lehrerin« antworten kann, ist sehr wichtig für mich, weil es genau diese Frage war, die mich überhaupt auf die Idee gebracht hatte, meiner gewohnten Umgebung zu entfliehen. Ganz allein auf sich gestellt hat man im Ausland massig Zeit, sich über sich selbst, seine Wünsche und Ziele klar zu werden. Die Geschichten der verschiedenen Au-pairs, mit denen ich mich über Erfahrungen austauschte, zeigten Ähnliches: Einige wissen die Zukunftsfrage heute ein Stückchen weiter zu beantworten, da sich der zuvor vorhandene Kinderwunsch auf Nimmerwiedersehen verabschiedet hat, manch andere hat sich in ihr Gastland verliebt und entgeht den Zukunftsfragen der Verwandtschaft für alle Zeiten in ihrer neuen Heimat.
Ob man nach England, Frankreich, Spanien oder in die Niederlande geht – Au-pair ist eine Erfahrung, die man nicht wieder vergisst, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Das sollen die dreiunddreißig folgenden Geschichten verdeutlichen.
»Das Leben ist wie ein Buch. Wer nicht verreist, liest immer nur die erste Seite.«
AUGUSTINUS VON HIPPO
1. GESCHICHTE
Ciao, amore!
Lara (21), Abiturientin, Lübeck, über ihre 2 Monate als Au-pair in Mailand, Italien
Wow, dachte ich beim Anblick meiner neuen Mailänder Bleibe. Das hohe alte Stadthaus im landestypischen Ocker hatte schon auf den Fotos nicht schlecht ausgesehen, aber wer konnte denn ahnen, dass sich die neue Wohnung auch von innen als Designerwerk erweisen sollte? Von den Edelstahllampen bis zum Wandbild – welches vermutlich mehr wert war, als ein durchschnittliches Einfamilienhaus – war sämtliches Mobiliar farblich aufeinander abgestimmt. Bei mir passte normalerweise nicht einmal die Unterwäsche zusammen.
»Zehn Mille«, bemerkte mein Gastvater, dem mein erstaunter Blick nicht entgangen war. »Inzwischen müsste das sogar zwanzig Mille wert sein.«
Patrick war deutsch, ein waschechter Kölner. Darauf hatte ich bei der Auswahl meiner Gastfamilie großen Wert gelegt, da ich selbst kaum Italienisch sprach. Mithilfe einiger perfekt einstudierter Vokabeln hatte ich Freundinnen und Familie bisher glaubhaft machen können, die zwei Jahre Italienisch-AG hätten sich irgendwie gelohnt, dabei waren die einzigen Begriffe, die ich in der Eros-Ramazotti-Radio-Beschallung verstand, die Worte »grazie mille«, »ciao« und »amore«. Egal, hier in dieser traumhaften Stadt würde ich meine Italienischkenntnisse endlich aufbessern können. Wie es schien, lernte man bei den Italienern ohnehin sehr schnell; Patrick zumindest hatte sämtliche Macho-Eigenschaften, die man den Italienern andichtet, bereits verinnerlicht. Gelungene Integration, herzlichen Glückwunsch! Während der ganzen Autofahrt hatte er versucht, mir ein Gespräch über italienische Frauen aufzuzwingen. Die seien der Grund, warum er überhaupt ausgewandert war, denn »die sind einfach am besten im Bett, und wenn man ihnen Brüste kaufen will, stellen die sich nicht so an wie die deutschen Weiber, sondern bedanken sich brav, wie’s sich gehört.«
So wie sich ihr Dekolleté spannte, schien meine Gastmutter demnach eine äußerst dankbare Person zu sein. »Ciao Lara«, begrüßte sie mich überschwänglich und drückte mir drei Küsse auf die Wangen, die verdächtig nach Campari rochen.
»Ciao«, erwiderte ich, froh, nun endlich meine Italienischkenntnisse zur Schau stellen zu können.
»Das ist Sylvia«, kommentierte Patrick. »Schön, dass du kein Italienisch sprichst, es gibt nichts Schlimmeres als tratschende Weiber.«
Was sollte das denn bitte heißen, immerhin hatte ich soeben auf Italienisch »Hallo« gesagt! Meine Fremdsprachenkenntnisse waren definitiv größer als die mancher deutscher Politiker, denn their English makes nobody so fast after.
»Hai fame?« Sylvia zeigte auf den gedeckten schwarzen Teakholz-Tisch auf der Terrasse. Ich nickte. Na bitte, klappte doch wunderbar mit der Kommunikation!
»Magst ’n Steak?«, fragte Patrick und schaufelte sich selbst ein blutiges Stück auf den Teller.
»Nein danke. Ich bin Vegetarier.«
Nicht, dass ich das nicht schon vorher angegeben hätte, aber Patrick war ja, wie ich auf unserer Autofahrt bereits hatte erfahren dürfen, »kein Kopfmensch«. Anders gesagt, ich traute dem getöteten Rind auf seinem Teller ein größeres Auffassungsvermögen zu als meinem neuen Vater auf Zeit.
»Vegetarier biste? Na dann viel Spaß, in dreißig Jahren fasst dich keiner mehr an«, prophezeite er nun schmatzend.
»Warum?«, fragte ich und ärgerte mich noch im selben Moment. War mir doch egal, ob dieser Typ mich mit fünfzig noch anfassen würde. Bevor ich Sex mit so einem habe, kaufe ich mir lieber einen einfühlsamen Vibrator. Die labern wenigstens nicht.
»Na, weil du dann aussiehst wie unsere Putzfrau, die Martha. Schau dir die mal an, die wabbelt stärker als das Meer bei Flut. Man braucht halt Proteine, nicht wahr, amore?« Patrick übersetzte und stieß bei Sylvia auf begeisterte Zustimmung. Hätte mich auch gewundert, wenn sie dem etwas entgegengesetzt hätte, denn so wie sie aussah, hatte sie ohnehin nichts, das ihr allein gehört – weder Geld noch eine Meinung.
»Wir haben dir ja noch gar nicht Luca vorgestellt«, bemerkte Patrick nun und ließ von seinem Steak ab. »Amore, vieni!«
Da stand er also, mein kleiner Au-pair-Junge Luca, acht Jahre alt, »lebensfroh, freundlich, sportlich, immer gut gelaunt«, wie es in Patrick Beschreibung hieß. Seine Lebensfreude und Freundlichkeit waren im Moment allerdings vollends dem Gameboy in seiner Hand gewidmet.
Na, dann wollen wir mal! Aus meinem Koffer kramte ich ein Lego-Auto hervor, einen echten »Jungentraum«, wie mir mein Bruder beim Kauf versichert hatte. »Ich hab was für dich«, verkündete ich und näherte mich mit vorsichtigen Schritten meinem zukünftigen Zögling. Der starrte mich aus großen braunen Augen an, als würde er kein Wort verstehen – von wegen zweisprachige Erziehung sei so empfehlenswert. Aber wenigstens nonverbal schien er sich prima verständigen zu können, so gierig wie er mir das Geschenk aus den Händen riss. Erwartungsvoll beobachtete ich, wie er das Papier zerfetzte.
»Cos’ è?« fragte Luca an seine dürre Mama gewandt, die nach drei Blättern Abendessen beschlossen hatte, das restliche Hungergefühl mit Wein zu vertreiben.
»Lego, amore«, erklärte Patrick und fügte an mich gerichtet hinzu: »Der Kleine kennt so was nicht. Du weißt ja, die Kinder von heute hängen nur vorm Fernseher mit ihrem Nintendo in der Hand.«
Wie zur Bestätigung pfefferte Luca meinen Lego-Traum in die Ecke und verzog sich mit seinem Gameboy auf das Sofa. Dabei hieß es in meinem Au-pair-Führer doch ausdrücklich, man solle ein landestypisches Gastgeschenk mitbringen!
»Hmm«, räusperte ich mich verlegen und holte ein weiteres Paket heraus, »für euch hab ich auch noch eine Kleinigkeit.«
»Marzipan?«
Ich nickte stolz. »Lübecker Marzipan, das wird bei mir zu Hause hergestellt.«
»Weißt du nicht, dass das total fett macht?«, fragte Patrick. »Also die Sylvia darf davon nichts essen, ich sage ja jetzt schon immer: Wenn die nicht bald auf sich und ihren Arsch achtet, tausche ich sie aus und kauf mir zwei Zwanzigjährige.«
Begeistert von seinem Witz klopfte sich Patrick auf die Schenkel und unterstrich so die ohnehin schon bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einem Affen. Super, damit hatte er sich jetzt wirklich zum unangefochtenen Vollidioten Nummer eins gekürt. Ich hoffte doch sehr, dass er mit einer der Zwanzigjährigen nicht mich meinte. Ich hielt ja generell nicht viel von Dreiecksbeziehungen, aber wenn schon, dann bitte mit einem Menschen und keinem Affen.
»Aber das bleibt zwischen uns, wa? Die Alte versteht uns ja eh nicht.«
Ich quittierte das anzügliche Zwinkern mit einem Gähnen. »Ich bin müde«, entschuldigte ich mich und trottete bald darauf in mein Zimmer.
Okay, die Gastfamilie war nicht unbedingt mein Fall, oder anders gesagt: Ich war mir ziemlich sicher, dass Patrick und Sylvia bei Frauentausch auf RTL2 eine gute Figur gemacht hätten, so oft wie sie den Fremdschäm-Reflex aktivierten. Aber dafür war ich in Mailand! Das bedeutete schnittige Italiener, schönes Wetter, Schuhe … und Italienisch lernen. Dafür konnte man die Flodders hier ruhig in Kauf nehmen. Entschlossen schob ich meinen Koffer unter das Bett.
Tja, wenn das Wetter in Mailand wenigstens immer schön wäre! Seit einer Woche regnete es nun schon und ganz ehrlich, in meinem Zimmer hocken und Eros-Ramazotti-Lieder hören konnte ich auch in Lübeck.
»Lara!«
Erst jetzt bemerkte ich das penetrante Klopfen an der Tür.
»Warte, ich komme.«
Hastig erhob ich mich von meinem Bett und folgte einem ziemlich wütend dreinblickenden Patrick auf die Terrasse. »Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die Gartenmöbel reinstellen, wenn es regnet?«
Ach ja, da war ja was. Neben der Aufgabe, Luca den Nintendo zu reichen und ihn dann beim Spielen zu beobachten, bis seine Eltern von der Arbeit zurückkamen, war die Rettung der Teakholzmöbel wahrscheinlich meine sinnvollste Tätigkeit. Oder zumindest die, deren Nichterfüllung am schnellsten entdeckt wurde, wie ich mit einem Blick auf das sich wellende Holz bemerkte.
»Boah ey, ich könnte kotzen, das sind zehn Mille, die draufgehen.« Schnaufend rückte Patrick die Möbel zurecht, die meiner Meinung nach auch nicht viel besser aussahen als unsere Plastikstühle zu Hause. Die konnte man wenigstens hochheben, ohne sich dabei einen Hexenschuss zu holen! Wobei das Gewicht Patrick wahrscheinlich ganz gelegen kam – einmal Stechheben ersetzt eine Stunde Fitnessstudio, ’ne Zehntel Mille gespart, höhö!
»Musst den ganzen Tag schon nichts machen und nicht mal das kriegste hin«, motzte Patrick in seinem Kölsch vor sich hin. »Typisch Frau, nichts wie Ärger machen die.«
Na super. Dann konnte ich ihn ja eigentlich auch allein hier stehen lassen, zumal Patrick ohnehin Unterhalter und Zuhörer in einer Person war. Blablablablabla. Nur Müll, der aus seinem Mund kam! »Watt stehste denn so rum? Wenn du nichts zu tun hast, geh raus und such dir ’ne Beschäftigung! Geh Klamotten kaufen oder so.«
Ein waschechter Rausschmiss. Fassungslos schlüpfte ich in meine Schuhe und ging hinaus auf die Straße, wo mir ein paar lästige Tränen in die Augen schossen. Typisch, immer wenn ein filmreifer Wutanfall angebracht wäre, musste ich heulen. Wobei das in diesem Fall vielleicht tatsächlich die bessere Alternative war. Das würde doch keine Krankenkasse der Welt zahlen, wenn man sich mit einem solchen Proll wie Patrick anlegt. Wo war ich hier nur gelandet? Schluchzend ging ich die Straße hinunter und hielt plötzlich inne: Ach, das war doch alles Mist! Hatte ich es wirklich nötig, mich so behandeln zu lassen? Wahrscheinlich waren selbst die Offiziere beim Bund netter zu ihren Truppen, und deren Tütensuppen waren auch nicht schlimmer als Sylvias Low-Carb-Menüs. Ich drehte mich auf dem Absatz um und stiefelte zurück zur Villa. Dieser unhöfliche Primitivling konnte mich überhaupt nicht rausschmeißen, ich würde jetzt nämlich kündigen!
»Patrick?«, rief ich, als ich die Eingangshalle betrat.
Stille. Er schien nicht da zu sein.
Dann würde ich halt zuerst meinen Koffer holen, ehe ich es mir noch anders überlegte.
»Oddio!« Eine kurvige, nackte – oder scusa, mit Kindergrößen-Höschen bekleidete – Blondine wich erschrocken aus dem Flur zurück. Konnte man ihr nicht wirklich verübeln, denn der grelle Schein der Designerlampen war wirklich nicht geeignet, um sich in Szene zu setzen.
»Ma che cos’ è …?«
Mein ebenfalls spärlich bekleideter Gastvater trat aus dem Schlafzimmer – seinem Tiger-Tanga fehlte nur noch die Aufschrift »Wildboy« oder »Stecher« und er wäre der Renner in jedem Porno-Katalog gewesen.
»Hehe Lara. La ragazza au-pair.« Patrick schaute dümmlich von seiner Blondine zu mir. »Dat ist genau dat, wonach es aussieht, aber pssst!«
Ich verzog angewidert den Mund.
»Mensch Mädel, guck nicht so böse. Gut, dass du kein Italienisch kannst. Erspart mir jede Menge Stress mit Sylvia.«
Wortlos verschwand ich in meinem Zimmer und holte meinen Koffer.
»Was wird’n das?«, fragte Patrick, als ich an ihm vorbei zur Haustür stolzierte.
Mit einem zuckersüßen Lächeln drehte ich mich um: »Ciao amore, grazie mille!«
2. GESCHICHTE
La Gourmande
Nele (24), Kochkursleiterin, Nantes, über ihr Jahr als Au-pair in ihrer heutigen Heimatstadt
Au-pair wird man nicht, weil man viel Geld verdienen will. Au-pair wird man aus Leidenschaft. Meine galt neben Kindern (ich babysittete seit meinem 15. Lebensjahr) vor allem dem Kochen und, zugegeben, den Arten von Essen, von denen in den neuen Ernährungszeitschriften dringend abgeraten wird. Besonders Süßspeisen hatten es mir schon immer angetan.
Von denen wird’s in meiner Gastfamilie hoffentlich genug geben, dachte ich, als ich die Bewerbung der Familie Mineau aus Nantes las. Vater Mineau arbeitete als Pâtisseur, Madame Mineau belieferte mit dem Brot der Bäckerei sämtliche Lokale in der Umgebung und sah auf dem Foto aus, als würde sie den Großteil der Lieferungen selbst verdrücken. Damit war der Grundstein der für einen Au-pair-Aufenthalt unverzichtbaren Sympathie schon mal gelegt. Ich kann Frauen, die aus anderen Gründen als einer Magen-Darm-Verstimmung freiwillig Knäckebrot essen, nämlich nicht ausstehen.
Wobei Madame Mineau anscheinend eine mindestens achtwöchige Knäckebrot-Diät hinter sich hatte, so dünn und abgezehrt wie sie aussah, als sie mir am Bahnhof entgegenkam. »Comment ça va?«, fragte ich, hocherfreut endlich mal meine Französischkenntnisse erproben zu können. Meine bisherigen Erfahrungen stammten nämlich ausschließlich aus den Schulunterricht, und da hatte sich seit der siebten Klasse zumindest sprachpraktisch nicht viel getan, denn wir hatten hauptsächlich stillschweigend Camus gelesen, voller Angst vor der Aussprache. Kann sein, dass ich deshalb mit meiner Begrüßung unwissentlich irgendeine unumstößliche französische Knigge-Regel verletzt hatte – Madame Mineau brach jedenfalls in Tränen aus.
Ich stand ziemlich ratlos da. Gut, ich wusste, dass die Franzosen in Sachen Körperkontakt nicht so scheu sind wie die Deutschen, immerhin unterstreichen sie jede Begrüßung mit drei bis vier Küssen – je nach Region. Aber diese Frau, die ich seit maximal fünf Minuten kannte, in den Arm zu nehmen, kam mir doch ein wenig übertrieben vor. So wartete ich stumm ab, bis sich meine Gastmutter beruhigte. Endlich wischte sich Madame Mineau über die Augen. »Entschuldigung.«
Kein Problem. Als Frau sind mir tränenreiche Dramen natürlich nicht fremd. Oder anders gesagt: An manchen Tagen bringt mich eine Neunzigerjahre-Powerballade von Brian Adams mehr zum Flennen als andere Menschen eine gute Dosis Pfefferspray. Hier würde ich allerdings wenig Gelegenheit zum Weinen haben, dachte ich, als wir durch die bezaubernden Straßen von Nantes fuhren, die kleine Céline auf dem Rücksitz.
»Arbeitet Monsieur Mineau?«, fragte ich. Dank meiner Erfahrungen als Aushilfe bei einem Düsseldorfer Bäcker wusste ich, wie der Hase in der Brotbranche läuft. Ein echter Traumjob für Napoleon wäre das – drei Stunden Schlaf und schon was zu tun.
»Papa ist weg«, antwortete Céline vom Rücksitz. So wie ihre Stimme zitterte, hoffte ich, dass Depressionen in Frankreich nicht ansteckend waren.
»Wir sind dabei, uns scheiden zu lassen«, erklärte Célines maman nun und überfuhr dabei beinahe ein wandelndes französisches Klischee mit Baskenmütze und Baguette in der Hand.
»Conard!«, fluchte Madame Mineau und wurde von einem neuerlichen Tränenausbruch geschüttelt. Okay, deutsche Umarmungsscheu hin oder her, ich legte den Arm um meine Gastmutter.
Die nächsten Tage waren ziemlich trostlos. Von Madame Mineau erfuhr ich, dass sie eine Woche vor meiner Ankunft von ihrem Mann verlassen worden war. »Für eine andere«, wie das immer so ist.
Gut, dass ich keinen Freund habe, dachte ich. Erst braucht man viele Monate, um ihm eine Beziehung schmackhaft zu machen, und dann ist er in null Komma nichts weg, fast wie ein Drei-Gänge-Menü. Und so wie Speisen hartnäckig auf den Hüften liegen bleiben, verhält es sich auch mit Liebeskummer – und der war bei Madame Mineau ziemlich heftig. Wenigstens zum Arbeiten konnte sie sich noch aufraffen.
»Ist maman krank?«, fragte mich Céline besorgt, als ihre Mutter beim Familienfrühstück (welches für sie seit Tagen – echt französisch – nur aus Kaffee bestand) mal wieder unangekündigt von einem Tränenausbruch geschüttelt wurde.
»Non, non«, wehrte ich bestimmt ab. Nur liebeskrank, und dagegen würden wir jetzt etwas unternehmen! Entschlossen stand ich auf und ging zum Regal. Erst einmal die Bilder abnehmen! Wie soll man sich denn auch gut fühlen, wenn einen das Objekt des Liebeskummers von allen Wänden angrinst? Ich bin grundsätzlich für die Verdrängungsstrategie – manchmal ziehe ich monatelang nur Stretch-Röcke an, damit ich nicht bemerke, dass meine Jeans schon wieder kleiner geworden ist. In diesem Fall kam man mit Verdrängung allerdings nicht allzu weit. Ein fehlender Ehemann fällt nun mal mehr auf als eine enge Jeans.
»Ich werde mit Céline das Brot ausliefern«, verkündete ich und schlug damit einen ganzen Fliegenschwarm mit einer Klappe: Während ich Madame Mineau die Arbeit abnahm, erlebte ich endlich mal etwas anderes als die täglichen Räuber-und-Gendarm-Spiele mit Céline, bei denen sie, ganz Scheidungskind, ihrer Wut mit virtuellen Gewehren freien Lauf ließ.
»Amuse-toi bien«, erinnerte ich Madame Mineau beim Hinausgehen in der Hoffnung, sie würde die gängigen Anti-Liebeskummer-Tipps aus der Marie-Claire beherzigen.
Mit zwei Baguettestangen unter dem Arm schlenderte Céline lustlos hinter mir her, während ich sie – soweit es meine Französischkenntnisse zuließen – wie wild über die Umgebung ausfragte. »J’sais pas«, war ihre einzige Antwort. Eigentlich würde es reichen, Französisch erst ab der zwölften Klasse zu lernen, wenn man später ohnehin mit einem einzigen Satz auskommt.
»Hier wären wir«, sagte Céline vor einer kleinen, rustikalen Crêperie, die zu Madame Mineaus Kundschaft gehörte.
»Ah, was für schöne Mädchen«, begrüßte mich ein Kellner, dessen übermäßig glückliche Miene den Verdacht auf das eine oder andere Gläschen Cidre weckte. »Bonjour, je suis Pierre.«
Charmant, die Franzosen! Auch Célines Miene hellte sich ein wenig auf, als Pierre ihr freundlich über die Haare wuschelte.
Und weiter ging’s. Die Runde war ganz schön lang und nach drei weiteren Restaurants knurrte mir der Magen. Auch wenn es heißt, Nantes wäre eine Kleinstadt, fühlten sich die Wege von Lokal zu Lokal an wie ein Halbmarathon. Drei Ladungen Brot hatten wir noch auszuliefern. Wenn ich mir ein Stückchen abriss, würde es ja wohl kaum auffallen …
»Guck mal dort, der Hund«, versuchte ich mein tierbegeistertes Au-pair-Kind abzulenken. »Où ça?«, und happs! Oh Mann, das war mit Abstand das leckerste Brot, das ich je gegessen hatte, sogar besser als jeder Kuchen. Sollte Marie-Antoinette dem hungernden französischen Volk des 18. Jahrhunderts tatsächlich vorgeschlagen haben, statt Brot Kuchen zu essen, verstand ich die Empörung bei diesem Geschmack nur allzu gut.
»Quelle gourmande«, kicherte Céline über mein Schmatzen – upps, erwischt!
Madame Mineau hatte die Zeit, in der wir fort waren, gut genutzt. Zum ersten Mal, seit ich hier war, hatte sie sich geschminkt und gebürstet. Im Flur stand ein großer Müllsack, prall gefüllt mit allerhand Krimskrams: Bilderrahmen, DVDs, Hemden, einem Tennisschläger.
»Alles Krempel von meinem Mann«, erklärte sie knapp. Das war Trennungs-Feng-Shui vom Feinsten: den Krempel des Exmannes wegschmeißen und hoffen, dass er selbst dabei wie durch Voodoo ebenfalls vom Müllschlucker zermalmt wird. Es ging voran. Abends beschloss ich, für uns alle zu kochen. Man sagt ja immer, Liebe ginge durch den Magen. Wortwörtlich heißt das: Erst schluckt man sie verliebt runter, bis man wohlig satt ist, dann kotzt man so viel Liebe aus, dass einem sämtlicher Appetit vergeht. Mein Rezept dagegen: Nudeln, die wecken Glücksgefühle. Man schaue sich nur die Italiener an, die laufen ständig durch die Gegend, als hätten sie sich gerade frisch verliebt oder zumindest richtig guten Sex gehabt, und dabei liegt es nur an der Mischung aus 362 Kilokalorien und 75,2 Gramm Fett. Und ordentlich Brot, das man in die Reste der Gorgonzola-Soße dippen kann. Nicht unbedingt empfehlenswert für die Figur, aber für die Seele.
»Magst du mir das Rezept für dein Brot geben?«, fragte ich Madame Mineau, die in die Küche kam, um mir zuzuschauen.
»Aber sicher, warte.« Mit flinken Bewegungen griff sie in den Küchenschrank und baute Mehl, Olivenöl, Hefe und Salz vor uns auf. »Eigentlich ist das Rezept ja ein Geheimnis«, sagte sie augenzwinkernd, während ihre Finger schon die Zutaten zusammenkneteten. Im Takt ihrer Hände breitete sich auf ihrem Gesicht ein immer zufriedeneres Lächeln aus.
Das Essen schmeckte dann auch vorzüglich. Selbst Céline, die sonst eher zu der Sorte Kind gehört, die den ganzen Tag auf Bäume klettert und darüber so profane Dinge wie die Nahrungsaufnahme einfach vergisst, nahm sich ein zweites Mal nach.
Ich konnte kaum aufhören, von Madame Mineaus Brot abzubrechen. »Elle est gourmande, la fille au-pair«, kommentierte Céline. Mein Gott ja, ich esse gern, auch wenn ich eigentlich schon satt sein müsste und der Knopf meiner Hose gesprengt wird.
»Das ist zu gut«, schmatzte ich fröhlich.
»Findest du wirklich?« Madame Mineau lächelte zufrieden. Ja, das Brot war so fantastisch gut, dass man damit direkt … plötzlich kam mir eine Idee.
»Wollen wir was basteln?«, fragte ich Céline.
Die nickte unschlüssig, folgte mir aber hinauf in mein Gastzimmer. Dort breiteten wir einen Haufen aus Filz- und Wachsmalstiften aus.
»Okay Céline«, sagte ich, »kannst du ein richtig schönes Baguette malen?«
Klar konnte sie das. Während Céline damit beschäftigt war, eine rot-blaue Schlange zu malen (Baguettes sind manchmal rot-blau, ich war doof, dass ich das nicht wusste), blätterte ich wie wild in meinem PONS-Wörterbuch. »Cours de cuisine«, »experte de pain«, »cuisine allemande«, »la gourmande« ...
Am nächsten Tag übernahmen wieder Céline und ich die Tour. »Ah, meine kleinen Freundinnen«, begrüßte uns Pierre in der Crêperie.
»Könnten Sie das hier für uns auslegen?«, fragte ich.
»Bien sûr.« Bitte, war doch ganz einfach!
Auf dem Rückweg legten wir einen Stopp beim Supermarkt ein, wo wir einen ganzen Wagen mit Leckereien vollschaufelten: Kartoffeln, Schweinefleisch, Sahne, allerhand Obst und das Wichtigste: Zitronen-Kaugummis für Céline, der ich Kaugummiblasen zeigen sollte.
»Was habt ihr denn alles eingekauft?«, fragte mich Madame Mineau schockiert, als wir mit unseren Plastiktüten bepackt zu Hause aufkreuzten.
»Surprise, surprise«, antwortete ich geheimnisvoll.
Die Überraschung ließ noch drei Tage auf sich warten, dann war es endlich so weit: Um Punkt sieben klingelte es zum ersten Mal an der Tür.
»Wer ist das?«, fragte Madame Mineau erstaunt aus dem Wohnzimmer.
»Ich mach das schon!« Eilig rannte ich aus der Küche, in der schon alles vorbereitet war, zur Haustür.
Drei Französinnen standen da, eine Kleine mit schwarzem Kurzhaarschnitt, eine ältere Dame, die in ihrem Pelzmantel ziemlich fein aussah, und eine junge Frau, deren Begeisterung fürs Kochen man an ihren Hüften ablesen konnte.
»Bonjour«, begrüßten sie Madame Mineau beim Hineingehen. Die war sichtlich verwirrt: »Was, was … Entschuldigung, aber worum geht es hier?«
Die junge Französin zückte den von Céline und mir entworfenen Zettel: »La Gourmande: experte de pain et experte de la cuisine allemande donnent des cours de cuisine chaque mercredi. Adresse: 6 Rue de la Gaudinière, 44000 Nantes.« Ein Kurs, in dem der Backprofi Madame Mineau und meine Wenigkeit unsere Kochkünste weitergeben würden.
Madame Mineau schaute mich verblüfft an, fasste sich aber wieder. »Na dann kommen Sie herein«, forderte sie die ungebetenen Gäste auf. Eine Weile später standen Salat, echter deutscher Schweinebraten mit Kroketten und das wohl beste Brot der Welt auf dem Tisch. Der hinreißende Duft zauberte uns allen ein Lächeln ins Gesicht.
»Quelle gourmande«, sagte Madame Mineau liebevoll, als ich mir heimlich ein Stück Brot abbrach. Die anderen Frauen lachten.
Heute, zwei Jahre später, kann ich nur sagen: Kochkurse gibt man nicht, weil man viel Geld verdienen will. Kochkurse gibt man aus Leidenschaft. Leidenschaft fürs Kochen und fürs Essen. Und nicht zuletzt aus Freundschaft zu seiner Geschäftspartnerin und früheren Gastmutter.
3. GESCHICHTE
Z(w)eitfamilie
Tessa (19), Abiturientin, Paderborn, über ihr Jahr als Au-pair in Miami
Meinen Entschluss, nach dem Abitur als Au-pair zu arbeiten, fasste ich an meinem achtzehnten Geburtstag, mit dem Empfang einer Postkarte aus Miami. »Happy Birthday, liebe Tessa«, verkündete sie in großen pinken Druckbuchstaben, unterzeichnet von »Charlie McKenzee«.
»Wer ist Charlie McKenzee?« Ich hielt die Karte so unsicher in der Hand, als handle es sich nicht um ein simples Stück Pappe, sondern um eine Briefbombe.
»Ach, das ist mein Bruder«, antwortete meine Mutter lapidar.
Ah so, ich hatte schon gedacht, es sei etwas Wichtiges. Ist ja normal, dass man seine Familienmitglieder nach und nach im ¼-Takt kennenlernt: Zwanzig, vierzig, sechzig, achtzig … jetzt sind wir komplett! Das war wieder mal typisch für meine Familie: bloß nicht zu offen miteinander umgehen, bloß nicht zu ehrlich sein! Manchmal hatte ich das Gefühl, mit völlig fremden Menschen zusammenzuwohnen. Ich war Einzelkind und meine Eltern als Anwälte nicht oft zu Hause. Die einzige Notiz, die ich von ihnen nahm, war die am Herd: »Essen für dich, musst du nur noch aufwärmen.« Wenn sie dann mal da waren, löcherten sie mich mit Fragen, die wohl aus einem GU-Erziehungsratgeber kamen: »Wie war dein Tag? Hast du was in der Schule gelernt?« Später dann vermehrt: »Und, was machst du nun, nach deinem Abitur?«
»Au-pair bei Onkel Charlie«, antwortete ich eines Tages. Gesagt, getan: Ich hatte das Leben in Paderborn ohnehin ziemlich über und bevor ich, wie meine Eltern vor mir, Jura studieren würde, wollte ich erst ein richtiges Familienleben kennenlernen.
»Dann mach’s mal gut«, verabschiedeten sich meine Eltern am Hamburger Flughafen von mir – kurz und schmerzlos wie eine Tetanus-Impfung. Ich war vor allem erleichtert, erfreut und ein bisschen aufgeregt natürlich. Die Aufregung verflog jedoch schlagartig, als ich meine neue Familie am Flughafen stehen sah.
»Tessa, wie schön, dich kennenzulernen. Bitte verzeih mir meinen Akzent, ich habe so lange kein Deutsch mehr gesprochen«, empfing mich Charlie, der neben seiner Frau Nancy stand. Ihr Lächeln hätte gut auf die Titelseite eines Reiseprospekts gepasst.
»Die Kinder freuen sich schon ganz doll, nicht wahr? Johnny, Lilith, you’re pretty excited to meet my niece Tessa?«
»Niece, what’s a niece?«, nuschelte Johnny, den ich auf fünf Jahre schätzte.
»She’s not a niece. She’s our sister«, erklärte Lilith ihrem kleinen Bruder ernsthaft. Ich musste lachen. Vom Einzelkind zur Schwester dieses entzückenden Doppelpacks, das ging schneller als eine ungewollte Schwangerschaft.
Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Morgens brachte ich meine »Geschwister« in die Schule und in den Kindergarten, wo ich sämtlichen Zwergenfreunden stolz als »sister« präsentiert wurde, danach hatte ich Freizeit und Sprachkurse, bis ich Lilith und Johnny abends abholte und mit ihnen Hausaufgaben machte.
»Can you teach me some German?«, fragte Lilith eines Abends, als wir über ihren Heften brüteten.
»Sure.«
»What’s ›I‹ in German?«
»Ich.«
»Love?«
»Lieben.«
»You.«
»Du.«
»Ich lieben du.« Lilith umarmte mich.
Liliths Liebesbekenntnis war das erste, das ich seit Jahren gehört hatte – was heißt seit Jahren, eigentlich konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, je ein »Ich liebe dich« von meinen Eltern zu Ohren bekommen zu haben. Ganz anders die McKenzees: Bei jeder Gelegenheit umarmten Nancy, Charlie und die Kinder mich, ihre »sister« oder das »good girl«. Ich fühlte mich so wohl wie noch nie in meinem Leben. Die Abende verbrachten wir immer zusammen, schauten fern oder gingen essen, alles Dinge, die in den meisten Familien wahrscheinlich ganz normal waren, aber die ich nie kennengelernt hatte. Meine Eltern in Deutschland hatten sich immer gleich nach dem Essen in ihre Arbeitszimmer verzogen, um dort »kurz einen Fall durchzugehen«. Als Kind hatte ich geglaubt, es wäre normal, mehr Zeit mit meiner Oma als mit ihnen zu verbringen. Bei den McKenzees fühlte ich mich nun endlich richtig zu Hause, und so wurden aus den ursprünglich geplanten sechs Monaten Au-pair bald schon acht.
»Bleib einfach, solange du willst«, bot mir Charlie an.
»Und wenn das für immer ist?«
»Dann ist es eben für immer.«
Die Rechnung hatte ich ohne die Juristen gemacht, wie sich einige Tage später herausstellen sollte. »Wir kommen dich im Mai besuchen«, kündigte meine Mutter am Telefon an. Ihre Stimme klang bestimmt, sie duldete keinen Widerspruch.
Ich fühlte mich ziemlich mulmig. Wahrscheinlich ist es Vorfreude, versuchte ich mir einzureden, doch das stimmte nicht. Je näher der Mai heranrückte, desto schlimmer wurde das komische Gefühl. Am Tag der Ankunft meiner Eltern war es so schlimm, dass ich befürchtete, mein Herz würde gleich aus der Brust springen.
Meinen neuen Eltern schien das nicht zu entgehen.
»Everything’s gonna be fine.« Nancy lächelte mich vom Beifahrersitz aus aufmunternd an.
Ich hoffte es.
Der Wagen parkte. Ich schnallte Lilith und Johnny ab, die vergnügt neben mir herhüpften, als wir uns dem Gate näherten.
Meine Eltern standen schon da. »Tessa als Kinderfrau, na das ist doch was!«, polterte mir mein Vater entgegen und klopfte dazu im Takt auf meine Schulter.
»Hallo Tessa. Hallo Charlie«, begrüßte uns meine Mutter und reichte ihrem Bruder und mir die Hand.
Lilith runzelte die Stirn und bedeutete mir mit einer Geste, ich sollte mich zu ihr hinunterbeugen.
»They are your parents?«, flüsterte sie neugierig. Ich zuckte entschuldigend mit den Schultern.
Nancy und Charlie redeten auf dem Weg zum Auto wie wild auf meine Eltern ein. Ob der Flug in Ordnung gewesen sei, ob in Deutschland immer noch so schlechtes Wetter herrsche. »Ich wusste gar nicht, dass ihr Amerikaner so gesprächig seid«, stellte meine Mutter sarkastisch fest. »Immerhin fangt ihr Kriege an, ohne vorher mit der UNO zu reden …«
Ich war nur froh, dass Nancy, die zur Begrüßung extra ein Vier-Gänge-Menü vorbereitet hatte, kein Deutsch verstand.
»Das ist also Miami«, bemerkte meine Mutter geistreich, als wir durch die Stadt fuhren. »Mir wäre es zu heiß hier. Wohnen hier nicht auch so viele Rentner? Das habe ich in irgendeiner Zeitschrift beim Friseur gelesen, welche war es noch gleich ...«
Ich hätte sie am liebsten angeschrien, aber in meinem Hals war ein Kloß, so groß, dass mir schon das Schlucken echte Schwierigkeiten bereitete.
»Ah, ein Fertighaus, das haben die Amerikaner ja gern«, kommentierte mein Vater.
Wir stiegen aus.
»Tessa, du willst bestimmt etwas Zeit mit deinen Eltern allein verbringen«, sagte Charlie. »Zeig ihnen doch ein bisschen die Gegend, solange Nancy das Essen vorbereitet.«
»Aber … ich würde Nancy gern beim Kochen helfen«, erwiderte ich hastig, obwohl ich mir sonst nicht viel aus Kochen mache. Das erste und letzte Mal, dass ich für Johnny und Lilith gekocht hatte, hatten wir danach eine Pizza bestellen müssen – meine Spaghetti bolognese hatten einen höheren Acrylamidgehalt als ein Aschenbecher aufgewiesen.
»Ist alles okay?«, fragte mich Nancy in der Küche. Ich nickte stumm und hackte wie wild auf die Zwiebel ein.
Beim Essen war es viel stiller als sonst. Normalerweise redeten wir Erwachsenen freundschaftlich über unseren Tag, während Lilith wie am Band plapperte und Johnny piesackte, der meist verträumt vor seinem Teller saß und erst dann anfing, wenn wir anderen schon aufgegessen hatten. Doch heute erinnerte es mich eher an das »Abendbrot« in Paderborn: Der Großteil der Sätze, die fielen, hatte etwas mit den Lebensmitteln auf dem Tisch zu tun:
»Tessa, gibst du mir bitte den Salat?«
»Charlie, könntest du mir das Wasser reichen?«
»Tessa, könntest du Nancy fragen, wie dieses Gericht heißt?«
Lilith und Johnny waren sichtlich verstört. Seit rund fünf Minuten saßen sie nun wortlos da und nuckelten mit großen Augen an ihren bunten Plastikbechern.
»Und, macht sie sich gut als Au-pair?«, fragte mein Vater seinen Schwager, als wir alle aufgegessen hatten.
»Was sagt er?«, fragte mich Lilith. Ich übersetzte.
»What’s an au-pair?«, fragte sie nun.
Mein Vater lachte lauthals los. »Das ist ja zum Brüllen! Scheinst deine Arbeit ja super zu machen, wenn die Kinder nicht mal wissen, dass du ihr Au-pair bist.«
Schlagartig wurde mir klar, warum ich mich in den letzten Tagen so merkwürdig gefühlt hatte. Meine Au-pair-Familie war mir zur neuen Familie geworden – aber eine neue Familie auf Zeit, woran meine Eltern mich nun schmerzlich erinnerten.
»I’m your au-pair«, erklärte ich Lilith mit belegter Stimme.
Sie schüttelte vehement den Kopf. »You’re not an au-pair. You’re my sister.«
Meinem Vater blieb das Lachen im Hals stecken: »Wird sie ja sehen, was das für eine Schwester ist. In einem Monat bist du wieder zurück in Deutschland, pünktlich zu deinem Jura-Studium.«
Meine Mutter hatte ebenfalls das Gesicht verzogen. »Es wird Zeit, dass du wieder richtig zu leben beginnst. Hier drückst du dich doch nur vor der Zukunft. Du musst endlich etwas mit dir anfangen.«
»Was soll sie denn deiner Meinung nach damit anfangen?«, fragte Charlie interessiert. Seine Stimme klang ganz ruhig dabei und hätte keinen krasseren Gegensatz zu dem Gekeife meiner Eltern bieten können.
»Jura studieren, wie ein vernünftiger Mensch«, polterte mein Vater und klang wieder so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aufbrausend, bestimmt. Ich hatte keine Chance. Ab ins Mauseloch, Widerspruch war zwecklos.
»Dann bin ich also kein vernünftiger Mensch?«, fragte Charlie und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er wirkte ziemlich amüsiert. Plötzlich wurde mir klar, dass die ganze Sache wirklich amüsant war. Da kamen meine Eltern, die seit ihrer Kindheit nichts anderes als Paderborn gesehen hatten, und maßten sich doch tatsächlich an, meiner neuen Familie, die so ziemlich die zufriedensten Menschen der Welt waren, zu erklären, wie ein vernünftiges Leben abzulaufen hatte. Das war doch lachhaft. Jawohl, lachhaft! Johnny und Lilith stimmten sofort lauthals in mein Lachen ein.
»Wüsste nicht, was daran so lustig ist«, sagte meine Mutter stirnrunzelnd.
»Wundert mich nicht. Humor liegt in der Familie, nicht wahr, Tessa?« Charlie zwinkerte mir liebevoll zu. Er hätte es gar nicht tun müssen, weil ich ihn auch ohne Worte verstand.
Klammheimlich war ich von Tessa Schröder zu Tessa McKenzee geworden. Meine Au-pair-Familie war meine neue Familie geworden.
Und sie ist es auch heute noch.
»Wir helfen dir mit allem«, sagte Charlie, nachdem meine Eltern zurück zum Flughafen gefahren waren. Dieser Abschied war wesentlich tränenreicher ausgefallen als mein erster, und dabei ging ich dieses Mal doch gar nicht, sondern blieb. Blieb, um hier das Leben mit einer richtigen Familie und richtigen Geschwistern zu führen, das ich mir immer schon gewünscht hatte.
4. GESCHICHTE
Ein eigenes Zimmer
Miriam (25), BWL-Studentin, Malente, über »Travel & Work« in Australien – und wie sie davon erlöst wurde
Schule hat einen ziemlich fetten Haken: Erst redet man monatelang, vielleicht sogar jahrelang vom Abitur, sammelt fleißig Punkte und Punkte für den ersehnten 2,0-Durchschnitt, und wenn es dann so weit ist, weiß man überhaupt nicht mehr wofür. So ging es mir jedenfalls – abgesehen von dem 2,0-Abitur, das bei mir beinahe doppelt so hoch ausfiel. Die lang ersehnte Freiheit erschien mir und auch meinen Freundinnen plötzlich als tiefes, schwarzes Loch.
»Warum können wir nicht einfach noch mal fünfzehn sein?«, stöhnte Christina, meine beste Freundin, mit der ich auf dem Abiball heimlich auf der Toilette rauchte – unser kleiner Abschiedsprotest gegen die Schultoiletten, die grundsätzlich dreckiger waren als das durchschnittliche Dixie-Klo.
»Mit fünfzehn durften wir aber noch nicht rauchen«, stellte ich fest.
»Na und? Als ob wir uns daran gehalten hätten.«
Wir kicherten.
»Nein ernsthaft, das ist doch alles ganz großer Mist.« Christina drückte ihre Zigarette energisch an der Wand aus, irgendwo zwischen »Frau Hamann stinkt« und »Andre ist schwul«. »Ich weiß noch nicht einmal, was ich morgen frühstücken möchte, wie soll ich da wissen, was ich mit meinem restlichen Leben anfangen will?«
Ich war ratlos. Gestern war die letzte Abiturprüfung gewesen und nun, nach dem wohlverdienten Besäufnis, machte sich der Kater davon und wurde von rationalem Alltagsdenken abgelöst.
»Irgendwas wird uns schon einfallen«, erwiderte ich.
Christina fiel tatsächlich etwas ein: Sie bekam einen Ausbildungsplatz bei der städtischen Sparkasse und ich fühlte mich verlassener als ein Kinosaal nach dem Happy End. Fast bedauerte ich, kein Junge zu sein, denn dann hätte ich wenigstens zum Bund gehen können, aber so als Mädchen … Klar, wenn man auf Kerle in Camouflage-Anzügen steht, ist das eine klasse Gelegenheit, aber ich bevorzuge den blonden, verwuschelten Surfertyp, der vornehmlich auf den Wellen des Pazifiks zu Hause ist. Das war’s! Ich wollte nach Australien!
»Ich würde mich das nicht trauen«, meinte Christina, als wir in meinem Zimmer saßen und »Travel & Work« googelten.
»Wieso«, fragte ich, »hier steht’s doch überall: Die Australier sind die warmherzigsten Menschen der Welt.«
»Wer weiß, wer solche Testberichte schreibt? Und wenn was schiefgeht, stehst du da, ohne Geld auf einem fremden Kontinent.«
»Chrissie, das ist ein anderer Kontinent und kein anderer Planet. Kreditkarten kennen die da schon!«
Von meinen Eltern, denen mein Australien-Plan überraschenderweise gut gefiel, war ich bereits mit allem Möglichen ausgestattet worden, vom Flug bis zur Visa-Karte. Der letzte Monat vor der Abreise verging wie im Flug, der Flug wiederum wie ein Monat, mit Zwischenlandung in Singapur und gefühlten 720 Stunden zwischen einem Schweiß ausdünstenden Rentner und einem Typen in meinem Alter, der in regelmäßigen Abständen zur Kotztüte griff.
»Fliegst du in den Urlaub?«, fragte er mich in einem der kotzfreien Intervalle.
»Travel & Work«, antwortete ich knapp und steckte schnell die Nase in meinen Reiseführer.
Mein Abblockversuch war nicht allzu erfolgreich: »Echt? Das ist ja klasse, das mach ich auch!« Kotzis Begeisterung kannte keine Grenzen mehr. »In welchem Hostel bist du?«
Ich kramte meine Reiseunterlagen aus meinem Rucksack.
»Wir sind im selben Hostel!« Super, dieser Tatsache hatte ich es zu verdanken, dass ich während des ganzen restlichen Fluges einen Monolog über mich ergehen lassen musste – dabei lief im Fliegerfernsehen Sex and the City 2.
Kotzi hieß eigentlich Timo, kam aus Berlin und hatte wie ich einen »fruit-picking«-Job auf einer Obstplantage in Aussicht. Die Kotztüte hatte ihren Dauereinsatz der Tatsache zu verdanken, dass er »’ne fette Abschiedsparty« hinter sich hatte. »Bin jetzt aber wieder nüchtern«, erklärte er bei der Landung in Sydney. »Heute Abend können wir weiterfeiern. Hostels sind eh Party-Hochburgen.«
Das konnte ich mir gut vorstellen, als sich unsere roommates vorstellten: Justina, Baptiste, Jane, Samantha, Adrian und Massimo, mit denen wir ein Zehner-Zimmer belegten, waren schon dabei, ihre ersten Biere zu kippen. Und das um drei Uhr nachmittags!
»Wo arbeitet ihr?«, wollte Justina, eine blonde polnische Schönheit, wissen.
Ich nannte ihr den Namen der Plantage und sie verzog das Gesicht. »Fruit-picking? Das ist hart.«
Ich zuckte mit den Schultern. Das Härteste, was dieses Püppchen in ihrem Leben wohl bisher geleistet hatte, war zu lernen, wie man auf High Heels durch die Gegend humpelt.
»Was arbeitest du denn?«, fragte Timo, der nur noch Augen für Justina hatte.
»Barkeeperin.«
»Na das ist natürlich um Welten besser als fruit-picking«, warf ich ein.
»Ist da etwa jemand eifersüchtig?«, erkundigte sich Timo augenzwinkernd. Ich fühlte mich ertappt. Irgendwie hatten uns der lange Flug und die vielen Kotztüten zusammengeschweißt und mir passte es gar nicht, dass sich diese kleine Kournikova dazwischendrängte. Überhaupt passen mir Mädchen nicht, die besser aussehen als ich. Das ist der Grund, warum ich mir die inTouch kaufe und nicht die Vogue, ich konzentriere mich lieber auf die Fehler anderer Frauen, statt ihre mit Photoshop bearbeiteten Gesichter zu bewundern.
Justinas Fehler war eindeutig der Alkohol. Während wir anderen an unserem Bier nuckelten, kramte sie eine ganze Flasche Wodka aus der Schublade.
»Durst?«, fragte sie, und tänzelte dabei, die Flasche an den Lippen, auf die Jungs zu. Die Antwort wartete sie gar nicht erst ab, sondern fing sofort an, Massimos möglichen Durst mit ihrem Speichel zu stillen. Oh Gott, ging die ran! Andere Menschen nehmen ja Geld dafür, dass man ihnen beim Petting zuschauen darf, aber Justina hatte die wirtschaftliche Seite des Porno-Markts eindeutig noch nicht entdeckt.
»Lass uns rausgehen«, meinte ich an die anderen Jungs gewandt, als Justina sich völlig ungeniert von ihrem T-Shirt trennte.
»Wieso?«, fragte Timo grinsend. Es wunderte mich nicht, dass ihm dieser Lapdance gefiel, sie hatte nämlich mindestens Körbchengröße 70 C, wie ich neidisch feststellen musste.
»Na ja, weil … wenn ich mir so was ansehen will, gehe ich auf YouPorn.«
»Bist du frigide?«, fragte Baptiste mit einem hübschen französisch betonten »g«. Ich schüttelte entsetzt den Kopf. Nein, ich war bestimmt nicht frigide, aber von Gang-Bangs hielt ich nun mal auch nicht viel.
»Trink mal ’n bisschen, dann wirst du entspannter«, meinte Timo und strich mir dabei über das Bein. Ob es Zufall war oder nicht, konnte ich nicht sagen. Theoretisch war unser Zimmer so klein, dass es unmöglich war, einen Meter weit zu laufen, ohne jemanden zu berühren. Trotzdem fühlte ich mich geschmeichelt. Timo sah eigentlich gar nicht so schlecht aus: ziemlich groß, blonde Locken, etwas schlaksig, aber mit einem niedlichen Lächeln. Das war mir im Flugzeug gar nicht so aufgefallen – vermutlich wegen der Kotztüte.
Richtig entspannen konnte ich mich mit steigendem Alkoholpegel aber auch nicht. Von Justinas Hochbett waren nun rhythmische Stoßgeräusche zu hören. »Ich gehe auf den Flur«, entschuldigte ich mich und blieb dort allein sitzen, bis um halb zwei Uhr morgens von dem sprichwörtlichen Bumsen nichts mehr zu hören war.
Am nächsten Tag war ich hundemüde – nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um seinen neuen Job anzutreten. Fruit-picking erwies sich als echte Knochenarbeit: Auf einem Feld unter der australischen Sonne Bananen von den Stauden zu pflücken erinnerte plötzlich nicht mehr an Freiheit und Urlaubskataloge, sondern an ein Arbeitslager.
»Zieh nicht so ein Gesicht«, versuchte Timo mich aufzumuntern und hielt mir eine Banane unter das Gesicht. »Wie ist die Stimmung, bitte sprechen Sie ins Mikrofon!«
Die Zeit verging so viel schneller, wenn wir rumblödelten! Flugs war es abends und im Bums-Hostel schon wieder Party-Stimmung.
»Könnt ihr etwas leiser sein?«, fragte ich ziemlich genervt, als schon wieder Poltergeräusche aus Justinas Bett kamen. Dieses Mal war Massimo offensichtlich gegen Baptiste ausgetauscht worden, denn statt des gestrigen »Oh, oh, oddio!«, hörte man nun: »Oh bon, mais, oh, mon dieu!« Eigentlich natürlich super, so ein kostenloser Sprachkurs, nur war es um zwei Uhr nachts zu spät zum Vokabelnlernen.
Von Tag zu Tag wurde ich müder und meine Laune sank synchron. Niedliche Kängurus und Koala-Bärchen hatte ich bisher noch nicht zu Gesicht bekommen, dafür umso mehr Schlangen. Es nervte mich, den ganzen Tag auf Zehenspitzen durch die Gegend zu laufen, mein Rücken tat mir weh und nachts bekam ich wegen der allabendlichen Orgien zu wenig Schlaf.
»Könnt ihr mal einen Abend nicht saufen?«, seufzte ich einige Wochen später, als Justina wieder mal die Wodkaflasche zückte.
»Seid ihr Deutschen alle so unentspannt?«, fragte sie und tänzelte auf Timo zu.
»Keine Ahnung, dann bin ich kein Deutscher«, erwiderte er und genoss es sichtlich, endlich Justinas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ich ging vorsichtshalber auf den Flur, weil ich wirklich keine große Lust hatte, mir Timos Gestöhne anzuhören, weniger weil ich die deutschen Ausrufe dabei schon zur Genüge kannte (»Ja, Mann, oh ja, mein Gott, ja!«), sondern mehr, weil ich eifersüchtig war. Ich hatte im Flugzeug neben Timo gesessen und somit gingen sämtliche Besitzansprüche an mich. Diese Polen mussten immer alles klauen!