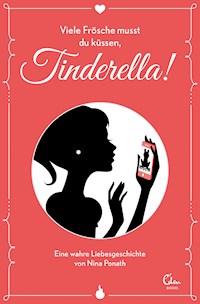6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
So unterschiedlich wie die Gründe, in eine WG zu ziehen, sind auch die 33 wahren Geschichten, die Nina Ponath zusammengetragen hat. Mit viel Witz erzählt die Autorin von WG-Liebhabern und -Leidgeprüften, von vermeintlichen Freak-Kommunen, die sich als Paradies herausstellen, und Traumwohnungen, die zu Settings von Horrorfilmen werden. Zu den Hauptdarstellerinnen eines solchen werden Janina und Steffi. Eigentlich sind die beiden beste Freundinnen – zumindest bis sie anfangen, sich nicht nur die Miete, sondern auch den Mann zu teilen. Lea hat da mehr Glück: Sie findet während ihrer Suche nach einer WG nicht nur ein passendes Zimmer, sondern auch eine neue Liebe. Die 33 humorvollen, überraschenden und mitunter erschreckenden Berichte zeigen: Eigentlich sollte jeder mal mit Fremden zusammengelebt und gelitten haben. Denn wo könnte man besser die Grenzen der eigenen Geduld austesten als in einer WG?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Nina Ponath
WO IM KÜHLSCHRANK PILZE WACHSEN
33 wahre WG-Geschichten über merkwürdige Mitbewohner, unkonventionelle Untermieter und wunderliche Wohnkonzepte
»Die Probleme fangen mitunter schon beim gnadenlosen Casting für die neue Wohnung an, bei dem man häufig auf Menschen trifft, deren Freundschaftsanfragen man selbst bei Facebook beschämt ablehnen würde.«
HORROR, HAREM UND HERAUS-FORDERUNGEN
VORWORT VON NINA PONATH
Sie sind überall. Von den Schwarzen Brettern der Uni bis hin zu Internetportalen wie www.wg-gesucht.de oder www.studenten-wg.de: Wohngemeinschaften, die fremde Menschen vereinen sollen, um Mietkosten, Klobrille und den einen oder anderen Fußnagel auf dem Badezimmerboden zu teilen.
Seit den Sechzigern sind es vorrangig junge Studenten, die sich auf eine solche Form des Zusammenlebens einlassen und dabei nicht immer nur positiv überrascht werden. Die Probleme fangen mitunter schon beim gnadenlosen Casting für die neue Wohnung an, bei dem man häufig auf Menschen trifft, deren Freundschaftsanfragen man selbst bei Facebook beschämt ablehnen würde.
Da wäre der potenzielle WG-Partner Nr. 1, der munter erzählt, das Hochbett des Ex-Mitbewohners sei auch zu verkaufen, aber eher unpraktisch, weil man beim Sex gegen die Decke stoße. Kandidatin Nr. 2 hingegen lässt einen bei Verneinung der Frage »Bist du Veganer?« gar nicht erst durch die Tür, weil sie mit Massentierhaltung und Kapitalismus nichts zu tun haben will. Hat man dann endlich eine Wohnung gefunden, kann es passieren, dass sich die Mitbewohnerin nicht nur wie selbstverständlich am Kleiderschrank, sondern auch heimlich am Freund bedient.
Mir selbst blieben von den drei WGs, die ich im Laufe meiner Studienzeit bewohnt habe, zwei Handynummern in meiner Kontaktliste und eine Tupperdose mit chemischen Drogen im Küchenschrank – eine Bilanz, mit der ich leben kann.
Dass man in WGs noch viel mehr teilen kann als nur Heiz- und Wasserkosten, habe ich erfahren, als ich diese 33 wahren Geschichten zusammengetragen habe. Für manche Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist ihre WG ihre Familie: Alleinerziehende tun sich in Eltern-WGs zusammen, um ihren Alltag besser zu bewältigen, Rentner bewahren sich in Senioren-WGs ihre Autonomie – und viele andere haben in ihrer Wohngemeinschaft ganz einfach die schönste Zeit ihres Lebens.
Natürlich ist jedes noch so harmonische Zusammenleben immer auch mit Konflikten verbunden, was Fernseh-WGs wie Big Brother erfolgreich vermarkten, wenn sie zeigen, wie viel Reibungsfläche die hochgeklappte Toilettenbrille bietet. Aber allen Differenzen und Streitigkeiten zum Trotz kann man etwas Wertvolles lernen, wenn man sich der Herausforderung des WG-Lebens stellt: die Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen, und jede Menge Selbsterfahrung.
1. Kapitel
WG VS. KOMMUNE 1: BANAL STATT KOMMUNAL
Rainer Langhans (72), Autor und Filmemacher, München, ehemaliges Mitglied der Kommune 1, über Selbsterfahrung in Gemeinschaften
Wenn man sich mit WGs beschäftigt, fällt fast überall der Begriff der Kommune 1, in der zum ersten Mal öffentlichkeitswirksam gemeinschaftlich gewohnt wurde. Wie bist du zu dieser neuen Form des Zusammenlebens gekommen?
Ich bin 1962nach Berlin gekommen, allein. Gewohnt habe ich, wie die meisten damals, zur Untermiete bei völlig fremden Leuten. In meinem Zimmer durfte ich nichts verändern und fühlte mich so einsam. In Berlin kannte ich keine Menschenseele und zweifelte an mir selbst: Ich war ein Mensch, der mit keinem konnte und mit dem keiner wollte, hielt mich deshalb sogar für verrückt. Was ich damals nicht wusste, war, dass ich mit meinen Problemen absolut nicht allein war: Wir alle standen ja auf diesem Leichenberg, den unsere mörderischen, kleinbürgerlichen Familien geschaffen hatten, und wollten nun alles anders machen. Mit der Gründung der Kommune versuchten wir, anders zu werden als unsere Eltern: neue Menschen. So etwas wie die Kommune 1, eine Gemeinschaft, in der Menschen zusammenwohnten, die weder verwandt noch verheiratet waren und sich gemeinsam ganz neu erfinden wollten, das war vorher undenkbar gewesen. Als Student hatte man entweder bei seinen Eltern oder eben zur Untermiete zu wohnen.Die Kommune 1 war daher von Anfang an in einer neuen Weise politisch, da sie das Private revolutionierte, auch wenn sie uns natürlich ganz nebenbei vor der Vereinsamung schützte. Wir wollten uns lieben.
Wie haben andere Menschen damals auf diese neue Lebensform reagiert?
Für die war das völlig abwegig, dass plötzlich Männer und Frauen, die nicht verheiratet waren, zusammenwohnten. Es gab in diesem erzkatholischen Adenauer-Deutschland sogar einen Paragrafen, der das gesetzlich verboten hat, sodass es ziemlich lange dauerte, bis wir überhaupt eine Wohnung bekamen. Als man dann nach dem Pudding-Attentat 1967 auf uns aufmerksam wurde, haben sich alle unheimlich über uns aufgeregt und schließlich nur eines »verstanden«: »Die erlauben sich den schärfsten Sex.« All diese Mythen um die Orgien in der Kommune und so weiter, darum ging es uns gar nicht – wir hatten eine viel tiefere Form der Liebe, eine Liebe zu Menschen, die nicht geschlechtsgebunden oder sexuell war.
Also ist die Fähigkeit, andere Menschen zu lieben und sich auf sie einzulassen, eine Grundbedingung für das Leben in Gemeinschaft?
Ja, bei uns war das so. Wir liebten die Menschen! Das war eine Zeit, in der wir alle erfüllt waren von Liebe und bereit, miteinander zu kommunizieren. Diese Erfahrung war ähnlich wie die, die sich heute in den Communitys des Internets zeigt.
Denkst du, dass man in der Interaktion mit anderen Menschen mehr lernen kann als nur von sich selbst?
Absolut! Das Leben mit anderen – viele Menschen kennen und lieben zu lernen – fördert die Selbsterkenntnis. Wenn ich nur in mich selbst hineingucke, lerne ich viel weniger als in der Interaktion. Man erkennt die eigenen Verhaltensmuster doch erst durch die Reaktionen der anderen Menschen und kann dann erst an sich arbeiten. Gerade wenn man jung ist, noch nicht weiß, wer man ist und wie man leben soll, ist es wichtig, zu erfahren, wie man von anderen gesehen wird.
Wie hat das Leben in der Kommune für euch funktioniert?
Wir haben uns bewusst aufeinander eingelassen, wir wollten aneinander arbeiten, wirklich miteinander lernen. So kleinliche Dingen wie »Wer räumt heute auf?« – das hat uns sooo wenig interessiert! Wir hatten auch keinen Putzplan. Wer sich wirklich auf andere Menschen einlassen will, regt sich nicht über eine unaufgeräumte Küche auf. Das Materielle und das Körperliche trennt uns doch bloß voneinander.
Gab es bei euch gar keine Hierarchie?
Nein. Es gab Unterschiede, der eine war zurückhaltender, der andere extrovertierter. Gleich waren wir nicht, aber gleichgestellt.
Was hältst du von Beziehungen in einer Wohngemeinschaft? War es schwierig für dich und Uschi Obermaier, inmitten so vieler Menschen zu leben?
Für Uschi war das Leben in der Kommune schwierig, weil sie ein sehr eifersüchtiger Mensch war und immer noch ist – ihr waren zu viele Menschen um uns herum und sie hat mich immer wieder gebeten, nur mit ihr zusammenzuleben. Darauf habe ich mich ihr zuliebe eingelassen und wir haben ein halbes Jahr lang versucht, wie ein typisches Pärchen zu wohnen. Das ging schief: für mich zu wenig Liebe.
Wie hat sich die Kommune 1 aufgelöst?
Die Kommune wurde nach einem Jahr zerschlagen, weil wir wie nach einem gigantischen Trip langsam wieder runterkamen. Wir waren körperlich und psychisch total fertig und konnten einfach nicht mehr. Die Liebe zwischen uns war wieder verschwunden. Wir haben uns dann alle auseinandergelebt. Zur Beerdigung meines damaligen Freundes Fritz Teufel wurde ich nicht mal eingeladen. Ich bin trotzdem hin, aber alle haben mich schräg angeguckt, ich war da nicht erwünscht. Ist schon merkwürdig, dass Menschen, denen man einmal so nah war, nicht mal mehr mit einem reden wollen. Das ist dasselbe wie mit den Leuten, mit denen ich im Dschungelcamp war, was für mich übrigens auch eine Form der Kommune ist. Du bist den Leuten so nah, aber danach siehst du sie nicht wieder. Dann eines Abends sind sie beim Promi-Boxen – dass kommt einem ziemlich fremd vor.
Warum, glaubst du, kommen solche fremden Seiten plötzlich zum Vorschein? Verstellt man sich im Zusammenleben mit anderen?
Ja. Und in einer Kommune lernt man sich unverstellt kennen und kommt sich nahe. Shows wie das Dschungelcamp und diese ganzen Castingshows sind eigentlich Kommunen-Shows, die genau wie die Kommune 1 – zumindest für kurze Zeit – den Menschen positiv verändern. Wenn man so eng mit anderen zusammenlebt, kommt man auf einen besseren Weg, man wird anders. Die Medien zeigen natürlich nicht, was da wirklich auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert, was für Entwicklungen die Teilnehmer durchmachen. Der eigentliche Reiz einer Castingshow liegt doch nicht darin, dass da jemand lernt, besser zu singen, wie immer behauptet wird, sondern in der Gruppendynamik. Das, was die Medien dann daraus machen, ist aber etwas völlig anderes als das, was drinnen passiert. Da werden nur die negativen Dinge an die große Glocke gehängt. Die anschließenden Bearbeitungen, in denen jeder etwas gelernt hat, weren nicht gezeigt.
Du lebst heute immer noch in einer WG mit fünf Frauen in München. Ist Alleinleben nichts für dich?
Nachdem die Kommune 1 zerschlagen wurde, habe ich mich lange Jahre nach innen gewandt, um mich spirituell zu entwickeln. Danach habe ich mich wieder nach außen gewandt. Heute lebe ich in einer weiterentwickelten Kommune mit fünf Frauen zusammen. Wir haben alle eine eigene Wohnung, sind vor allem auf der materiellen Seite voneinander getrennt. Dadurch leben wir geistig sehr eng zusammen und lernen täglich aufs Neue voneinander. Denn Liebe ist etwas Geistiges. Darum geht es doch im Leben: Liebe deinen Nächsten wie (zuvor) dich selbst, oder?
Warum lebst du heute nur noch mit Frauen zusammen und nicht mit Männern? Lebt es sich leichter mit Frauen?
Frauen sind kommunikativer als Männer und haben ein größeres Bedürfnis nach Nähe. Männer wollen irgendwann ihr eigenes Ding machen, deshalb halten mich ja auch alle für verrückt.
Wieso funktionieren deiner Meinung nach Wohngemeinschaften so häufig nicht?
Wohngemeinschaften sind meistens reine Zweckgemeinschaften, die aus ökonomischen Gründen entstehen. Man will Mietkosten sparen und sucht sich dafür jemanden, dessen Sauberkeitsvorstellungen einigermaßen mit den eigenen übereinstimmen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich solche Gemeinschaften schnell wieder zerschlagen. In der Kommune 1 ging es nicht um die Ökonomie, sondern um den Geist, die gemeinsame Arbeit am eigenen Inneren. Erst dadurch kann man liebevoll mit den anderen leben. Das ist in WGs eher selten ein Thema. Es kommt natürlich auch mal vor, dass man mit Freunden zusammenzieht, weil es da schon vorab eine persönliche Ebene gab, aber im Prinzip geht es dem Großteil der WG-Bewohner darum, Kosten zu sparen. WGs sind für mich deshalb auch keine Kommunen, sondern nur ein verdünnter Ableger, ein Jugendphänomen, ein Mittel, um in einer Zeit zu überleben, in der man wenig Geld hat. Wären WGs Kommunen, würden sie besser funktionieren. Die Kommune findet man heute nicht in den WGs, sondern im Internet, in den Web-Communitys.
2. Kapitel
GESICHTSKONTROLLE
Svetlana (20), Zahnmedizinstudentin, Göttingen, über einen harten WG-Casting-Marathon
Svettie, ich glaube, du bist angenommen worden.« Meine Mama winkte mir vom Postkasten mit einem weißen Briefumschlag, auf dem unübersehbar der Stempel der ZVS prangte. Mir wurde augenblicklich schlecht.
»Sag das bloß nicht zu früh«, sagte ich, als ich mit pochendem Herzen den Umschlag aufriss.
Liebe Frau Kapik, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Georg-August-Universität Göttingen für den Studiengang Zahnmedizin zugelassen sind.
Oh mein Gott! Ich hatte es geschafft! Da hatten sich all die Monate Feier-Abstinenz und Bio-Lernmarathon tatsächlich gelohnt. Zahnmedizin, das hatte ich schon immer machen wollen, und mit Göttingen als Studienort hatte ich es noch dazu wirklich gut getroffen: Die Stadt war groß genug, aber nicht zu groß, sodass man schnell mit anderen Studenten in Kontakt kommen und trotzdem auch mal ungeschminkt in den Supermarkt gehen konnte. Außerdem gab es diese wunderschöne Altstadt mit den gemütlichen Bars und dem kleinen Kino.
Aber offenbar war ich nicht die Einzige, die darauf brannte, nach Göttingen zu ziehen. Als ich abends die gängigen WG-Seiten nach einem passenden Zimmer durchforstete und bei jedem Angebot unter 280 Euro Warmmiete begeistert zum Telefonhörer griff, lautete die uniforme Antwort: »Nee, leider schon lange weg. Bist ein bisschen spät dran.«
Nach der fünften Ansage dieser Art war ich ganz schön entmutigt. Wer rechnet bitte damit, dass es leichter ist, einen Studienplatz über die ZVS zu kriegen als ein simples Zimmer zur Untermiete? Vielleicht war ich die Suche zu streng angegangen, versuchte ich mich zu beruhigen. War ja klar, dass die WGs mit »23-jährigen, entspannten Sportstudenten« schneller vergeben waren als die, deren Anzeige mit »Farmville v(v)ill erweitert werden« begann. Gut, manche Wohnungsbeschreibungen lasen sich wirklich wie verzweifelte Kontaktanzeigen, wie zum Beispiel die vom »kommunikativen, aufgeschlossenen Ralf, 32-jähriger junggebliebener Ingenieur«. Einen Versuch war Ralf trotzdem wert, bei meiner derzeitigen Bilanz. Ich wollte schließlich nicht unter der Brücke schlafen.
»Ja klar, das Zimmer ist noch frei«, sagte Ralf begeistert, »kannst es dir jederzeit anschauen.« Na bitte, man muss halt ein bisschen offener sein, dachte ich und so konnten auch Bernd und Yusuf, die »überzeugten Freaks«, Maggi, »die Ökotrophologin mit Gewissen« und Saskia, »die gern Gedanken und Miete teilen will«, mich nicht abschrecken.
Freitagvormittag ging es los: ich stieg in die Bahn, ausgerüstet mit einer Liste von Adressen und den dazugehörigen Wegbeschreibungen von Google Maps, einer Liste mit den Telefonnummern von Ralf, Bernd, Yusuf, Maggi und Saskia sowie einem Fotoapparat, damit ich meinen Eltern später zeigen konnte, wie das Zimmer aussah, für das sie zukünftig Miete zahlen sollten. Ein paar Seiten im Studienführer und ein kurzes Nickerchen später hielt die Bahn ruckartig. Ich stieg aus.
Das war also Göttingen. Sah ein bisschen anders aus als auf den Bildern bei Google, aber dennoch war die Stadt wirklich hübsch mit den vielen schwarz-weißen Fachwerkhäusern und den engen Gassen, in denen es von Studenten auf Fahrrädern nur so wimmelte.
So. Ganz hier in der Nähe müsste mein Ziel Nummer 1 sein, die Wohnung von Ralf. Nummer 42. Entschlossen drückte ich auf die Klingel.
»Ist das die Svetlana?«, begrüßte mich eine fröhliche Stimme durch die Lautsprecheranlage.
»Ja, ich möchte mir das Zimmer anschauen.«
»Na dann, komm hoch!«
Der Türöffner dröhnte.
Einen Lift gab es leider nicht und so musste ich die 65 Treppenstufen in den dritten Stock zu Fuß laufen. Falls ich hier einziehen sollte, konnte ich mir mein teures Anti-Cellulite-Gel von Douglas zukünftig sparen.
»Hey«, begrüßte mich Ralf. »Magst du mir deine Jacke geben? Möchtest du was trinken?« Er tänzelte wie ein Kammerdiener um mich herum.
»Ja, warum nicht?«, antwortete ich, obwohl ich offen gestanden lieber erst das Zimmer angeschaut hätte.
»Super, dann komm doch mit in die Küche.«
Ich folgte ihm und schätzte dabei sein Aussehen ab. Eine Schönheit war Ralf ganz sicher nicht. Er sah älter aus als die 32 Jahre, die er angegeben hatte, was vielleicht an seinem Kleidungsstil lag. In der braunen Cordhose und dem gelben, verwaschenen Pulli unter dem gestreiften Pullunder hätte sich jeder Rentner wohlgefühlt.
»Bitte schön, extra gefiltertes Leitungswasser.« Mit stolzem Gesichtsausdruck reichte Ralf mir ein Glas und forderte mich auf: »Dann erzähl doch mal von dir!«
»Ja also.« Ich räusperte mich verlegen. Gott, das war ja schlimmer als ein Blind Date. Warum konnte ich mir nicht einfach kurz das Zimmer anschauen und es dabei belassen? »Ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht …«
»Schön!«
»... und nun fange ich an, Zahnmedizin zu studieren …«
»Spannend. Dann kannst du mich auch mal untersuchen, wenn du magst, ich habe nämlich ein paar Plomben, die demnächst mal ausgewechselt werden müssten.«
»… ich spiele Gitarre, fahre gern Fahrrad, lese, mache viel mit meinen Freundinnen …«
»Gitarre? Dann bist du also musikalisch?«
»Hmm.« Ich nickte kraftlos. »Kann ich mir jetzt das Zimmer angucken?«
»Ja entschuldige, natürlich, selbstverständlich!« Ralf nickte wild. »Hatte fast schon vergessen, warum du hier bist. Das kommt davon, wenn man sich so nett unterhält.«
Wenn das hier für Ralf eine »nette« Unterhaltung war, freute er sich vermutlich über jeden Callcenter-Anruf. Der Arme. Ein bisschen tat er mir leid, als er nun eifrig voraustänzelte.
»Das hier wäre dein Zimmer.« Er öffnete mir die Tür zu einem hübschen, ziemlich großen weißen Altbau-Traum, mit – haltet euch fest – Stuck und eigenem Balkon! Sehr nice!
»Ich habe einen Balkon?«, sagte ich völlig perplex. Für einen Balkon würde ich gnädigerweise darüber hinwegsehen, dass mein zukünftiger Mitbewohner offensichtlich eine Macke hatte.
Ralf nickte. »Ja, ist ganz nett, nicht wahr? Ich habe auch einen, aber auf dem kann man leider nicht sitzen.«
»Das Zimmer ist ein Traum!«
»Danke«, sagte Ralf. »Willst du mal meins sehen?«
Ich nickte. Eigentlich interessierte mich sein Zimmer nicht wirklich, aber wenn er es mir gern zeigen wollte, wollte ich mal nicht so sein.
»Herzlich willkommen in ›Gockel’s Heaven‹!« Ralf stieß die Nebentür auf und mir stockte für einen kurzen Moment der Atem: Die gesamten Wände, vom Fußboden bis zur Decke, waren tapeziert mit selbst gemalten Postern und DIN-A3-Blättern, die alle eins zeigten: Hähne in allen möglich Variationen, Hahnkämme, Hähnchen am Spieß, Hähnchenköpfe, Hähne, die fraßen, kämpften, krähten …
»Oh«, sagte ich. Zu diesem Anblick fiel mir wirklich nichts Besseres ein. »Oh.«
»Ja, ein echtes Kunstwerk, ich weiß.« Ralf verbeugte sich.
»Warum malst du so viel Hähne?«, fragte ich, als ich endlich wieder zu meiner Sprache gefunden hatte.
»Na, weil wir alle im tiefsten Innern nichts anderes sind als Hähne. Schau uns Männer an. Wir stolzieren mit aufgeblähter Brust herum, prügeln uns um die Frauen, schmücken uns mit Bettgeschichten … Wie die Gockel.« Ralf zeigte auf eines der Poster und strich dem darauf abgebildeten Hahn liebevoll über den Kamm. »Meine kleinen Freunde. Darf ich euch Svetlana vorstellen? Sie wird bald bei uns einziehen. Das ist eine ganz nette Henne, da könnt ihr euch sicher sein.«
Ich hoffte sehr, dass er gerade einen Scherz machte. Vielleicht wollte er so die Toleranz seiner zukünftigen Mitbewohner testen. Oder es gab hier eine versteckte Kamera.
»Ah ja«, sagte Ralf, als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, »ich wollte dir ja noch Krookikoo zeigen. Folge mir bitte.«
Er ging entschlossenen Schrittes zur roten Gardine, hinter der ein Balkon zum Vorschein kam, der eigentlich genauso aussah wie der vom Zimmer nebenan. Eigentlich – abgesehen davon, dass er über und über mit Stroh bedeckt war, aus dem es laut raschelte.
»Das ist Krookikoo«, sagte Ralf, als ein roter Kamm zum Vorschein kam, »der Haushahn. Sei so nett und sag Hallo, Krookikoo.«
Der Hahn blickte kurz nach oben und widmete sich dann wieder dem Käfer, den er genüsslich zerpickte.
»Willst du Krookikoo nicht Hallo sagen?« Ralfs Frage klang wie eine Aufforderung.
»Doch, doch, hallo Krookikoo«, sagte ich eilig. Man weiß ja nie, wie Verrückte reagieren, wenn man sie verärgert.
»Schön«, sagte Ralf zufrieden, »dann haben wir uns ja alle kennengelernt. Wann ziehst du ein?«
»Du«, sagte ich zögerlich, »ich weiß nicht so genau. So ein Hahn auf dem Balkon … der macht doch bestimmt Lärm, oder?«
»Ein bisschen. Aber frühstens um fünf Uhr.«
»Ich glaube, das ist dann nichts für mich. Ich muss mich auf mein Studium konzentrieren, weißt du, da brauche ich genug Schlaf.«
Ralf guckte mich an, als hätte ich ihm eine gepfefferte Ohrfeige gegeben. »Es ist doch immer dasselbe mit euch blöden Hühnern«, schimpfte er. »Wir Gockel kämpfen um euch, tun alles für euch, und ihr? Ihr seid nur am Gackern und schaut uns nicht einmal an.«
»Entschuldige«, sagte ich.
»Ist schon okay. Du weißt ja, wo die Tür ist, oder? Ich würde jetzt gern ein bisschen allein sein.«
Ich beeilte mich, die Wohnung zu verlassen. Da hatte ich ja wirklich einen Volltreffer gelandet. Aus all den Anzeigen im Internet hatte ich mir ausgerechnet einen Psychopathen ausgesucht. Nur gut, dass ich das schnell genug bemerkt hatte. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich hier eingezogen wäre, in den »Gockel’s Heaven« – wer wusste schon, was Ralf noch für geheime Macken und Spleens hatte.
Die nächste Wohnung auf meiner Liste war ziemlich weit weg, sodass ich den Bus nehmen musste. Als ich ausstieg, ließ zumindest die Lage schon mal Gutes hoffen: mitten in der Altstadt, umgeben von meinen besten Freunden World Coffee und H&M.
Mit einem guten Gefühl im Bauch drückte ich auf die Klingel.
Und noch mal. Und noch mal.
Hatte ich mir die Nummer von Saskia aufgeschrieben? Ich ließ meine Tasche auf den Boden fallen und kramte darin herum. Na bitte.
»Hallo, hier ist die Mailbox von Sassi. Wenn ihr eine Nachricht hinterlassen wollt, sprecht bitte nach dem Piepton.«
Pieeeeep.
»Hallo, hier ist Svetti. Wir waren heute um 13 Uhr bei dir in der Wohnung verabredet, ich wollte mir das freie Zimmer angucken. Wäre lieb, wenn du mich zurückrufen könntest, ich bin in der Gegend. Tschüss.«
Gut. Bis Saskia sich meldete, konnte ich mir die Wohnung von Maggi angucken, die nur ein paar Straßen entfernt lag. Dieses Mal wurde mein Klingeln sofort mit dem Surren des Türöffners belohnt.
»Hallo«, rief mir ein Mädchen von der Wohnungstür unten links entgegen, »du bist Svetti?«
Es klang nicht so, als wäre sie allzu erfreut darüber.
»Ja, das bin ich.«
Maggi musterte mich abfällig. »Du trägst eine Lederjacke? Das ist doch hoffentlich Kunstleder?«
»Nein, ich hoffe nicht«, antwortete ich. Die Jacke hatte nämlich stolze 169 Euro gekostet und war innen mit einem unmissverständlichen Echtleder-Zeichen ausgestattet.
»Sorry, dann brauchst du gar nicht reinzukommen«, sagte Maggi und verschränkte die Arme über der Brust. »Ich bin nämlich Veganerin und das sollte meine Mitbewohnerin auch sein. Ich möchte keine Leute unterstützen, die sich ’nen Dreck darum scheren, wie viel Kohlendioxid mit Tierhaltung produziert wird.«
»Ja, aber …«
Zu spät. Maggi hatte bereits die Tür hinter sich zugezogen. Dabei wäre ich noch gern losgeworden, dass ihr H&M-Shirt sie ungefähr so individuell machte wie eine Nase im Gesicht, und dass es auch nicht gerade ein Kavaliersdelikt war, Kinderarbeit zu unterstützen. Immer die Doppelmoral dieser pseudo-revolutionären »Wir sind ja so individuell«-Spinner! Das Problem war: Wenn es so weiterging, würde ich mich zum Studienbeginn selbst – ganz gegen den Strom – mit einem Stapel Zeitschriften vor den Kaufhäusern aufstellen müssen, um mir abends mit einer Flasche Wodka die Lage schönzutrinken.
Auf dem Weg in den östlichen Stadtteil, in dem die Wohnung der beiden Jungs lag, musste ich mir zur Aufheiterung erst einmal einen Kaffee kaufen. Dass es so schwer sein würde, eine Wohnung zu finden, hatte ich nicht erwartet. Hoffentlich würde sich die nächste WG nicht als ganz so großer Reinfall entpuppen. Mein Handy piepte.
Hey Svetlana, tut mir leid, hatte vergessen, dir abzusagen. Das Zimmer ist schon vergeben, da war jemand schneller. Sorry. Sassi.
Na super. Es war tatsächlich, wie mein Mathelehrer Herr Jacobs immer gesagt hatte, wenn jemand seine Hausaufgaben vergessen hatte: »Diese Generation ist unzuverlässig, faul und blöd.«
Viel erwartete ich nicht mehr, als ich vor dem großen, weißen Fachwerkhaus stand, das Bernd und Yusuf bewohnten. Mal schauen, was dabei rauskommt, dachte ich und ging hinein.
»Na, denn komm ma reen«, sagte eine Stimme aus dem ersten Stock. Sehen konnte ich nichts, weil es im Flur zappenduster war. Der Typ klang zumindest ganz nett.
»Hey«, sagte ich und hielt ihm meine Hand hin.
»Na, nu sei ma nicht so steif«, sagte der Typ und klopfte mir auf die Schulter, »ich bin der Bernd.«
Bernd sah etwas … sagen wir mal »gewöhnungsbedürftig« aus. In seinen Ohren steckten Ringe mit dem Durchmesser eines durchschnittlichen Ikea-Glases, seine rechte Gesichtshälfte zierte ein Tattoo in Form eines Knochens und hinter seinem rechten Ohr klemmte, ganz selbstbewusst, ein frisch gedrehter Joint. So wirklich mein Geschmack war das ja nicht, aber nun ja, es war nun mal nicht so, als hätte ich die Qual der Wahl.
»Willste das Zimmer sehen?«
Ich nickte.
»Hier. Das ist das Zimmer von Marco, der zieht demnächst aus.« Bernd zeigte auf die Tür gegenüber der Garderobe und öffnete sie.
Ich verstand sofort, warum dieser Marco ausziehen wollte – ein Umzug war wahrscheinlich billiger als der Kammerjäger, der hier dringend notwendig gewesen wäre. Unter dem Hochbett stapelten sich Pizzakartons und leere Joghurtbecher, Jeans und dreckige Socken. Auf der Gardinenstange saß kurioserweise ein blauer Wellensittich, der munter die Tapete von den rot-schwarzen Wänden knabberte.
»Bleibt das etwa so?«, fragte ich entsetzt.
»Weiß nicht. Für das Bett müsstest du Marco schon ’n bissl Geld geben, schätze ich«, antwortete Bernd, völlig ungeachtet der Tatsache, dass ich keine Möbel übernehmen wollte, sondern mich eigentlich gefragt hatte, ob das Zimmer etwa nicht entmilbt, neu tapeziert und gestrichen werden würde. »Würde dir aber davon abraten, das Hochbett zu übernehmen. Das ist echt unpraktisch beim Sex. Hab das mal bei einer Hausparty benutzt, da stößt man dauernd gegen die Decke. Wenn du mich fragst, ist der Marco asexuell, dass dem das nie aufgefallen ist.«
Während Bernd erzählte, machte er es sich im Schneidersitz auf dem Boden bequem, zog den Joint hinter seinem Ohr hervor und zündete ihn an. »Willste auch?«, fragte er.
»Ich weiß nicht«, sagte ich zögerlich, als mich glücklicherweise die Türklingel rettete.
»Ah miste, ich geh schon.« Bernd sprang auf.
Eigentlich war das der geeignete Moment, um sich zu verziehen. Dass Bernd und ich glücklich und harmonisch zusammenleben würden, erschien mir eher unwahrscheinlich, doch bevor ich rausgehen konnte, hörte ich ihn schon wieder zurückkommen.
»Yusuf, kommst ma mit? Das Mädel, das nach ’nem Zimmer sucht, ist hier.«
»Hey.«
»Hey.« Yusuf, der wider Erwarten strohblond und blauäugig war, klopfte mir auf die Schulter. »Du willst hier einziehen? Dann erzähl doch ma.« Er kniete sich neben Bernd auf den Boden und nahm einen Zug von dem Joint.
»Ja, also, ich fange dieses Semester an, Zahnmedizin zu studieren.« Wie häufig musste ich diesen Spruch eigentlich noch loswerden?
»Da willste doch nicht echt hingehen, oder?« Yusuf verzog angewidert das Gesicht, aber eine Antwort schien er nicht zu erwarten, denn er legte schon los: »Du musst es nur schlau anstellen. Denen beim BAföG-Amt fällt eh erst auf, dass du keine Studienleistungen bringst, wenn’s schon zu spät ist. Kann dir sonst auch ’nen guten Arzt empfehlen, der ist echt locker mit Attesten.«
»Ich hatte eigentlich schon vor, zu meinen Vorlesungen zu gehen«, sagte ich und stand auf.
Yusuf musterte mich. Erst neugierig, dann verstört. »Du Bernd«, sagte er und reichte seinem Kumpel den Joint zurück, »ich glaube, mit der da wird das nix. Zu spießig.«
»Sorry. Wir sind nämlich ’ne Künstler-WG«, sagte Bernd in meine Richtung.
»Glaube ich sofort.«
Ich bin nämlich durchaus der Meinung, dass es eine »Kunst« ist, mit Menschen zusammenzuwohnen, bei deren Anblick man im wahren Leben die Straßenseite wechseln würde. Deshalb habe ich nach meiner erfolglosen Suche nach einem WG-Zimmer ein Zimmer im Göttinger Studentenwohnheim gefunden. Ganz ohne Mitbewohner und: ohne Casting.
3. Kapitel
PRIVAT-SPERRE
Nina (23), Studentin, Hamburg, über einen Monat mit dem Monster im Sack
Ich sah sie schon von Weitem, meine neue Mitbewohnerin, und überlegte tatsächlich für eine kurze Sekunde, ob ich einfach umkehren und so tun sollte, als hätte sie sich in der Adresse geirrt.
»Kannst du mit anpacken, ich habe eine Vitrine, die ein bisschen schwerer ist!«
Vor meiner Haustür stand ein Mädchen, vielleicht auch ein Kerl – angesichts des lockigen Kurzhaarschopfes war es relativ schwer, darüber ein klares Urteil zu fällen –, und hinter ihr ein vollgepackter Hertz-Transporter mit bayrischem Kennzeichnen.
Das hatte man davon, wenn man einmal im Leben eine gute Tat tun wollte. Vor zwei Wochen hatte ich mich spontan entschieden, ein Zimmer meiner neuen Wohnung bis zum Einzug meines Freundes unterzuvermieten. So viel Platz brauchte ich allein nämlich nicht und meine Eltern waren von den Winterhuder Mietpreisen ohnehin nicht allzu begeistert. Die Hamburger Wohnungssuchenden schienen die 400 Euro Warmmiete für ein Zwölf-Quadratmeter-Zimmer jedoch weniger abzuschrecken: Innerhalb von einer Stunde hatte ich knapp zwanzig Anrufe auf meinem Handy, darunter auch einer von Jelenka, meiner neuen Mitbewohnerin. Sie kam aus Bayern und wollte zum Wintersemester in Hamburg ihr Studium beginnen. Dieses Wochenende war sie zur Wohnungssuche hergekommen, aber sie hatte nichts gefunden, wie sie mir schluchzend am Telefon erzählte und damit mein Herz erweichte.
»Okay«, sagte ich, »wir können uns ja morgen auf einen Kaffee treffen und gucken, ob es passt, dann kannst du dir auch das Zimmer angucken.«
»Morgen bin ich leider gar nicht mehr da«, weinte Jelenka, »ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg.«
»Bist du bei Facebook?«
»Nein.«
»Na gut.« Ich überlegte kurz. Sie würde ja ohnehin nur einen Monat bei mir wohnen; selbst wenn wir uns nicht gut verstehen sollten, würde die Zeit schnell vergehen.
»Dann ziehst du halt so ein«, sagte ich kurzentschlossen.
Bäääm. So einfach und ohne wirklich nachzudenken, hatte ich die Katze im Sack gekauft und jetzt stand sie da, eher Monster als Katze, wobei mir augenblicklich klar wurde, weshalb sie keine andere WG gefunden hatte.
»Tut mir leid, aber ich kann die Vitrine nicht schleppen, ich kriege davon Rückenschmerzen«, hörte ich mich nun antworten. Ganz ehrlich, wenn ich schwitzen will, gehe ich joggen, außerdem hatte ich meinen Umzug ja auch allein bewerkstelligen müssen.
»Ach, so schwer ist die gar nicht«, versuchte das Monster, mich zu überzeugen.
»Kann ich euch helfen?«, fragte ein Mann vom Straßenrand.
Monster blickte sich gehetzt um und raunte mir zu: »Wohnt der hier im Haus? Nicht, dass der was klauen will.«
»Ach was«, sagte ich. Außerdem konnte er von mir aus gern ihre Möbel klauen, solange ich sie dann nicht schleppen musste. »Es wäre sehr nett, wenn Sie meiner Mitbewohnerin beim Tragen helfen könnten«, sagte ich lieblich lächelnd und kramte, um nicht ganz nutzlos rumzustehen, Handtücher, Blumentöpfe und anderen Schnickschnack aus dem Wagen.
Als Monster und ihr mehr oder weniger freiwilliger Helfer endlich alle Sachen hochgetragen hatten, setzte sie sich zu mir in die Küche. »Hast du was dagegen, wenn ich bade?«, fragte sie mich.
»Nein, Quatsch, warum?«, fragte ich verwirrt. Immerhin zahlte sie die Hälfte der Miete, da konnte ich ihr ja schlecht verbieten, die Badewanne zu benutzen, auch wenn es mir nicht wirklich einleuchtete, weshalb man sich um zwölf Uhr mittags in die Wanne setzen sollte.
»Manche Leute haben ja was dagegen«, sagte Monster schulterzuckend. »Aber schön, dann mache ich es mir kurz in der Badewanne gemütlich.«
Und weg war sie. Kurz. So kurz, dass das Badezimmer, als ich um 18 Uhr aus der Uni zurückkam, immer noch besetzt war.
»Kannst du bitte kurz rausgehen? Ich muss mal auf Toilette«, rief ich, dringlich an die Badezimmertür klopfend.
»Kannst ruhig reinkommen, ich zieh den Vorhang zu«, bot mir Monster großzügig an.
»Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel Nähe«, antwortete ich. »Ich hätte es lieber, dass du rausgehst.« Wirklich, ich habe nicht umsonst mit knapp einem Jahr den Windeln abgeschworen.
»Warte kurz«, antwortete Monster. Während ich nervös von einem Bein auf das andere tippelte, hörte ich, wie drinnen das Wasser abgelassen wurde und Monster an irgendwas rumwerkelte. Eine halbe Ewigkeit später ging die Tür auf, keine Sekunde zu spät, wenn es nach meiner Blase ging, und ich hastete zur Toilette. Irgendwas roch hier merkwürdig, bemerkte ich. Der penetrante Gestank schien vom Fensterbrett herzurühren, auf dem irgendwelche komischen Blüten lagen.
Sehr spirituell, die Alte, dachte ich kopfschüttelnd und besah das Badesalz, das auf dem Wannenrand stand: »Basenbad mit zwölf Mineralien gegen Übersäuerung.« Oh Gott, so eine war das also. Ich hasse diese Weiber, die sich mit Fasten und Entschlackungskuren aus der Brigitte quälen, wenn man sich stattdessen einfach den Bauch mit Schokolade vollschlagen und glücklich sein kann. Gut, dass sie nur zur Zwischenmiete hier war, wir mussten ja keine Freunde werden. Würde auch schwer werden, wie ich eine Stunde später bemerkte, als ich an Monsters Zimmer klopfte, weil ich ihr den Mietvertrag geben wollte. Die Türklinke hakte, die Tür war abgesperrt.
»Kann ich kurz herein?«, fragte ich.
»Geht gerade schlecht«, antwortete Monster. »Warte kurz.«
Irgendwie verbrachte ich, seit Monster hier war, erstaunlich viel Zeit mit Warten, fast wie ein Mann. Endlich ging die Klinke hinunter.
»Oh, du hast dich fertig eingerichtet«, sagte ich so neutral wie möglich angesichts der Geschmacklosigkeit, die mir entgegenschlug. Überall im Zimmer brannten Duftkerzen, auf dem braunen Korbsessel thronte ein unheimlicher gekreuzigter Jesus in Holz, wobei der leicht sektenhafte Eindruck noch gesteigert wurde von den Zetteln, die anstelle der üblichen fröhlichen Sauf-und-Absturz-Fotos die Wand zierten. Auf denen standen so bedeutungsvolle Dinge wie: »Lieber Gott, ab heute möchte ich ein besserer Mensch sein« und »Gott, ich weiß, dass es nur einen für jeden gibt, bitte zeige mir meinen Partner.«
Oh weh.
»Ich wollte dir den Mietvertrag geben«, sagte ich sehr zögerlich. Die Frage war, ob ich diese Frau tatsächlich hier wohnen lassen wollte.
Monster strahlte mich begeistert an. »Super.«
Mit einem mulmigen Gefühl sah ich zu, wie sie ihre Unterschrift auf den Zettel setzte.
Das mulmige Gefühl ließ bis zum Wochenende nicht nach, als mich meine Freundin Isa aus Magdeburg besuchen kam. »Ist deine Mitbewohnerin gar nicht da?«, fragte sie, als wir uns in der Küche wahllos mit Rotwein auf Wodka und Himbeersirup für den Club du Nord warmtranken.
»Ich hab keine Ahnung«, flüsterte ich. »Ich bin erst vor einer Stunde nach Hause gekommen und seitdem ist das Zimmer zu.«
»Na, dann geh doch rein«, schlug Isa vor.
»Geht nicht, die schließt immer ab.«
»Wie, die schließt ab?«, fragte Isa ziemlich laut.
»Psst«, machte ich. »Na ja, sie schließt immer ab. Egal ob sie da ist oder weggeht.«
»Krass.« Isa schüttelte den Kopf. »Vielleicht masturbiert sie den ganzen Tag und hat Angst, dass du reinkommst.«
»Eher nicht, die ist derbe dicke mit Jesus.«
Monster kam den ganzen Abend nicht aus ihrem Zimmer, ging nicht mal auf die Toilette. Vielleicht hatte sie ja Glück und hatte ähnlich verrückte Freunde gefunden.
Am nächsten Morgen wurden Isa und ich durch ein lautes Klingeln wach.
»Oh fuck, meine Eltern«, fluchte Isa. »Ich hab den Wecker nicht gehört.«
In Windeseile schlüpfte sie in ihre Jeans und das fast durchsichtige, nun mit Flecken versiffte Top und hastete zur Tür.
»Der Schlüssel ist weg«, schallte es uns von dort entgegen.
»Wie weg?«, hörte ich Isa aus dem Flur fragen.
»Na weg.«
Müde rappelte ich mich auf, nicht ohne mir von meinem dröhnenden Kopf eine stattliche Beschwerde einzuhandeln, dann tappte ich hinaus auf den Flur. Dort stand ein offenbar ziemlich übernächtigtes Monster, leicht nach Dreck und Abfall müffelnd, die schwarzen Schamhaar-Locken noch zerzauster als üblicherweise, die Hände voll mit Alnatura-Einkaufstaschen, aus denen ein penetranter Geruch nach Hopfen und Baldrian strömte.
»Der Schlüssel ist weg«, wiederholte sie nun in meine Richtung.
»Jaaa – dann wirst du ihn wohl verloren haben«, antwortete ich gedehnt und konnte mir nicht verkneifen: »Kommt wohl davon, wenn man sein Zimmer immer abschließen muss.«
Isa schien richtig verstört. »Wieso schließt du denn dein Zimmer ab?«, fragte sie.
»Nur so«, antwortete Monster mit gehetztem Blick. »Privatsphäre.«
»Na denn – ist ja auch deine Privatsache, wie du da jetzt wieder reinkommst«, sagte ich und machte es mir mit Isa in der Küche zum Katerfrühstück bequem.
Aus dem Flur dröhnte nun lautes Hämmern.
»Ich gehe mal kurz gucken«, sagte ich an Isa gewandt. Monster stand mit Schraubenschlüssel und Hammer bewaffnet vor ihrer Zimmertür und werkelte munter daran herum.
»Lass das mal bitte«, sagte ich so geduldig, wie es mir möglich war. »Dafür gibt es doch Schlüsseldienste oder Dietriche.«
»Hab kein Handy«, meinte Monster abweisend.
»Wieso denn das nicht?«
»Ist im Zimmer.«
»Dann nimm halt meins«, sagte ich. »Warte, ich suche dir die Nummer vom Schlüsseldienst raus.«
Zwei Minuten später wählte ich die Nummer des Hamburger Schlüsseldienstes. »Der könnte in einer halben Stunde kommen, wenn du willst«, sagte ich an Monster gewandt.
»Hab kein Bargeld«, erwiderte Monster, »mein ganzes Portemonnaie ist weg, wahrscheinlich in meinem Zimmer.«