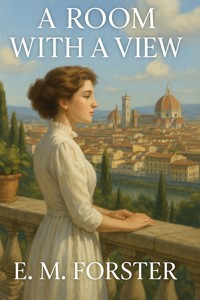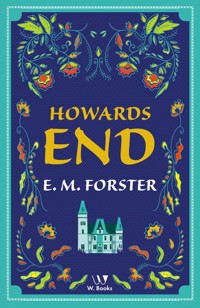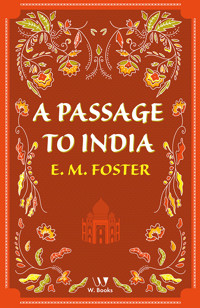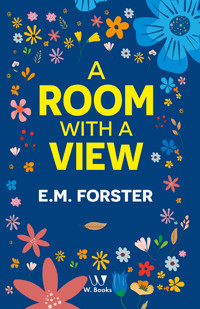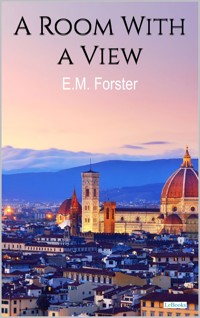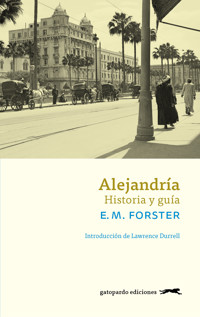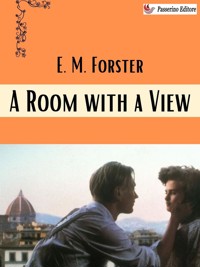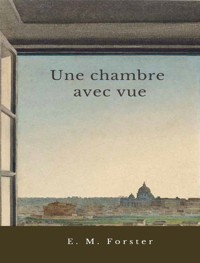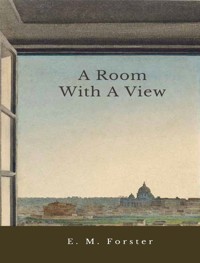Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eder & Bach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker der englischen Literatur und der berühmteste Indien-Roman des 20. Jahrhunderts. Kein Autor beschrieb die britische Kolonialzeit Indiens so eindrucksvoll wie E.M. Forster. Eines von 12 bisher vergriffenen Meisterwerken aus der ZEIT Bibliothek der verschwundenen Bücher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
E. M. Forster
Auf der Suche nach Indien
Roman
Aus dem Englischen von Wolfgang von Einsiedel
Titel der Originalausgabe: »A Passage to India«
Copyright © The Provost and Scholars of King’s College, Cambridge, 1924, 1979
Copyright für die deutsche Übersetzung: © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1985
Copyright © dieser Ausgabe bei Eder & Bach GmbH, 2015
Umschlaggestaltung: hilden_design, München
Satz und Repro: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-945386-18-7
Buch I Moschee
1
Mit Ausnahme der – ohnehin vierzig Kilometer abgelegenen – Marabar-Grotten hat die Stadt Tschandrapur dem Besucher nichts Ungewöhnliches zu bieten. Vom Ganges nicht so sehr bespült wie gesäumt, zieht sie sich ein paar Kilometer weit am Ufer entlang, kaum zu unterscheiden von all dem Unrat, den sie so großzügig ablagert. Da der Ganges an dieser Stelle nicht heilig ist, sind auf der Flussseite auch keine Badestufen zu sehen, ja, von der Flussseite ist überhaupt nicht viel zu bemerken. Das weite, wechselvolle Panorama des Stromes ist von Basaren verstellt. Die Straßen sind dürftig, die Tempel unansehnlich, und wenn es auch einzelne stattliche Häuser gibt, so liegen sie doch in Gärten versteckt oder stehen in Hintergassen, deren Schmutz nur den geladenen Gast nicht abzuschrecken vermag. Niemals war Tschandrapur groß oder schön, aber vor 200 Jahren lag es an der breiten Handelsstraße, die das – damals kaiserliche – Oberindien mit der See verband, und aus jener Zeit stammen auch die stattlichen Häuser. Im 18. Jahrhundert erstarb die Freude am Zierat, die ohnehin auf die oberen Schichten beschränkt war. Im Basarviertel ist nicht das Geringste von Malerei, und so gut wie nichts von Schnitzerei wahrzunehmen. Das Holz selbst scheint aus Lehm zu bestehen – jeder Stadtbewohner aus wandelndem Lehm. So heruntergekommen, so eintönig ist alles, was dem Blick des Beschauers begegnet, dass man fast wünschen könnte, der ganze Auswuchs würde bei der nächsten Überschwemmung vom Ganges wieder in den Erdboden zurückgespült. Tatsächlich stürzen Häuser zusammen, ertrinken Menschen, die man auch unbekümmert verwesen lässt, aber im Allgemeinen bleibt die Umrisslinie der Stadt mehr oder weniger die Gleiche, auch wenn sie, wie eine niedere und doch unzerstörbare Lebensform, sich hier ein wenig baucht, dort ein wenig zusammenzieht.
Auf der dem Fluss abgewandten Seite sieht alles gleich anders aus. Hier befindet sich ein ovaler maidan und ein lang gestrecktes düsteres Hospital. Auf dem höher gelegenen Gelände in der Nähe des Bahnhofs stehen ein paar Häuser, die wohlhabenden Eurasiern gehören. Hinter der Eisenbahn, deren Gleise zum Fluss parallel verlaufen, senkt der Boden sich und reckt sich dann wieder ziemlich steil in die Höhe. Auf der zweiten Erhebung ist die kleine Beamtenstation errichtet, und von hier aus gesehen bietet Tschandrapur fast ein neues Bild. Es ist eine Gartenstadt, nein, keine Stadt, sondern ein Hain, spärlich mit Hütten gesprenkelt. Ein tropischer Lustgarten, von einem edlen Strom bespült. Die buschigen Palmen und Nim-Bäume, die Mango- und Pepulbäume, sonst stets von den Basaren verdeckt, schieben sich nunmehr ins Blickfeld und verdecken ihrerseits die Basare. Von uralten künstlichen Teichen gespeist, schwingen sie sich aus Gärten, oder sie bersten aus erstickendem Buschwerk und verfallenden Tempeln. Nach Licht und Luft drängend und von stärkeren Kräften erfüllt als der Mensch und alles von ihm Geschaffene, scheinen sie über der unteren Ablagerung dahinzuschweben, um einander mit ihren Zweigen und winkenden Blättern zu grüßen, eine Wohnstatt für gefiederte Wesen. Vor allem nach der langen Regenzeit verhüllen sie, was in der Tiefe vor sich geht, aber immer von Neuem verklären sie, auch verdorrt oder unbelaubt, in den Augen der weiter oben hausenden Engländer das Bild der Stadt. Deshalb vermag auch der Neuankömmling diese Stadt zunächst nicht für so kümmerlich zu halten, wie er es nach ihrer Beschreibung erwarten sollte: erst an Ort und Stelle wird er geneigt sein, sich eines Besseren belehren zu lassen. Was die Beamtenstation selbst betrifft, so löst sie keinerlei stärkere Empfindung aus. Sie entzückt den Betrachter nicht, aber sie stößt ihn auch nicht ab. Sie ist höchst zweckmäßig angelegt. An weithin sichtbarer Stelle befindet sich ein Klubgebäude aus rotem Backstein, an weniger sichtbarer ein Kramladen und ein Friedhof. Die kleinen Bungalows liegen gleichmäßig verteilt an Straßen, die einander rechtwinklig schneiden. Nein, diese Siedlung hat nichts Hässliches an sich, aber wirklich schön ist nur die Aussicht, die man von ihr aus genießt. Und mit der Stadt selbst hat sie nichts anderes gemein als den sie beide überwölbenden Himmel.
Auch am Himmel pflegen allerlei Veränderungen vor sich zu gehen, weniger auffällige als die bei Fluss und bei Pflanzenwuchs. Bisweilen wird der Himmel durch Wolken in eine Landschaft verwandelt, aber für gewöhnlich ist er nur eine weite Kuppel, von Mischtönen überhaucht. Der vorwaltende Farbton ist Blau, am Tage zu Weiß verblassend, wo er ans Weiß der Erde rührt, nach Sonnenuntergang aber von einem neuen Saum umkränzt – Orange, das nach der Höhe zu in zartestes Purpur übergeht. Aber der blaue Untergrund bleibt bestehen, auch des Nachts. Wie Lampen hängen dann von der Decke des ungeheuren Gewölbes die Sterne herab. Der Abstand zwischen beidem ist winzig klein, verglichen mit der dahinter sich breitenden Ferne, und diese fernere Ferne hat, wenngleich dem Bereich aller Farbe entrückt, als Letzte das Blau von sich abgetan.
Es ist der Himmel, der alles verfügt – nicht nur die Wechselfolge des Wetters, der Jahreszeiten, sondern auch den Augenblick, in dem die Erde sich wieder zu schmücken hat. Aus eigenen Kräften vermag die Erde nur wenig zu tun, es sei denn, dass sie hie und da ein paar Blumen hervortreibt. Aber wenn es dem Himmel gefällt, kann er Herrlichkeit auf die Basare Tschandrapurs niederregnen, ein lichtes Segenszeichen von Horizont zu Horizont gleiten lassen. Der Himmel ist dessen fähig, weil er so stark, so gewaltig ist. Seine Stärke, täglich erneuert, rührt von der Sonne her, seine Größe von der tief unter ihm ruhenden Erde. Kein Bergesgipfel stört die Reinheit der Wölbungslinie. Meile um Meile liegt die Erde flach hingestreckt, wirft sich ein wenig auf und duckt sich wieder. Nur im Süden, wo ein paar Finger und Fäuste den Boden durchstoßen haben, ist die endlose Fläche gebrochen. Diese Fäuste und Finger sind die Felshügel des Marabar, die in ihrem Innern die seltsamen Grotten bergen.
2
Das Fahrrad fiel zu Boden, ehe ein Diener es auffangen konnte, und der junge Mann, der es eben losgelassen hatte, sprang die Stufen zur Veranda empor. Er sprudelte über vor Lebhaftigkeit.
»Hamidullah, Hamidullah«, rief er, »komme ich zu spät?«
»Erspare dir jede Entschuldigung«, sagte sein Gastgeber. »Du kommst immer zu spät.«
»Sei doch bitte so freundlich, mir auf meine Frage zu antworten. Bin ich jetzt zu spät gekommen? Hat Mahmoud Ali schon alles aufgegessen? Dann will ich lieber woanders hin. Mr. Mahmoud Ali, wie geht es Ihnen?«
»Danke der Nachfrage, Dr. Aziz. Ich pfeife gerade auf dem letzten Loch.«
»Und das ausgerechnet vor dem Essen? Armer Mahmoud Ali!«
»Hamidullah weilt schon nicht mehr unter den Lebenden. Er hat den Geist aufgegeben, als Sie gerade angeradelt kamen.«
»Ja, das stimmt«, bemerkte der andere. »Stell dir bitte vor, dass wir beide aus einer anderen, besseren Welt das Wort an dich richten.«
»Gibt es in eurer besseren Welt möglicherweise auch so etwas wie eine hookah?«
»Lass das Albern, Aziz. Wir sind gerade dabei, etwas höchst Betrübliches zu erörtern.«
Die hookah war, wie gewöhnlich im Haus seiner Freunde, zu fest gestopft und gluckerte missmutig. Aziz setzte ihr liebevoll zu, bis der Tabak ihm in Lunge und Nase emporschoss und den Beizgeruch brennenden Kuhdungs vertrieb, der sich bei seiner Fahrt durchs Basarviertel darin eingenistet hatte. Ein köstliches Gefühl! Aziz geriet bald in einen Entrückungszustand, der zwar erschlaffend, aber gleichzeitig erfrischend war und hinter dessen Schleiern auch die Unterhaltung der beiden andern ihm nicht sonderlich betrüblich vorkommen wollte – sie erörterten gerade, ob es überhaupt möglich sei, mit einem Engländer befreundet zu sein. Mahmoud Ali bestritt es, Hamidullah vertrat die gegenteilige Meinung, aber das mit so vielen Vorbehalten, dass keine Gereiztheit zwischen ihnen aufkommen konnte. Ja, Aziz fand es herrlich, draußen auf der breiten Veranda zu liegen, während vor seinen Augen der Mond immer höher stieg und in seinem Rücken die Diener das Essen anrichteten, ohne dass irgendetwas Unliebsames zu befürchten gewesen wäre.
»Du brauchst nur an das zu denken, was mir selber heute Vormittag zugestoßen ist.«
»Ich behaupte auch nur, dass es in England möglich ist«, erwiderte Hamidullah, der vor langer, langer Zeit einmal dort gewesen war, ehe das zur großen Mode wurde, und der in Cambridge so gastliche Aufnahme gefunden hatte.
»Hier ist es jedenfalls undenkbar, Aziz. Herr Rotnase hat mich vor Gericht heute schon wieder beleidigt. Ich mache ihm keinen Vorwurf daraus. Er hatte den Auftrag, mich zu beleidigen. Noch bis vor Kurzem war er wirklich ganz nett, aber nun haben sie ihn ’rumgekriegt.«
»Ja, hier dürfen sie nicht sein, was sie sein wollen – das meine ich gerade. Sie kommen mit der guten Absicht her, Gentlemen zu sein, und müssen sich dann gleich sagen lassen, dass sich das gar nicht schickt. Denk an Lesley, denk an Blakiston. Heute ist es dein Herr Rotnase, und morgen wird es Fielding sein. Ich erinnere mich noch, wie es am Anfang mit Turton war. Ihr werdet’s mir beide nicht glauben, aber ich bin damals mit Turton zusammen in seinem Wagen herumkutschiert – in einem anderen Teil der Provinz – ausgerechnet mit Turton! O ja, wir standen einmal auf ganz vertrautem Fuß miteinander. Er hat mir sogar seine Briefmarkensammlung gezeigt.«
»Und nun ist er sicher davon überzeugt, dass du sie ihm stibitzen würdest. Turton. Aber Herr Rotnase wird sich einmal noch sehr viel schlimmer aufführen als Turton.«
»Das wohl kaum. Sie sind am Ende alle gleich hier, der eine ist nicht besser und nicht schlimmer als der andere. Ein Engländer braucht nach meiner Meinung nur zwei Jahre hier zu sein, ein Turton oder ein Burton oder wer sonst. Den einzigen Unterschied macht ein Buchstabe. Und die Engländerinnen schaffen es in einem halben Jahr. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Ist es nicht so?«
»O nein«, erwiderte Mahmoud Ali, in den Ton bitteren Scherzens einstimmend – bei jedem Wort schmerzhaft berührt und zugleich amüsiert. »Ich meinerseits entdecke immer neue Unterschiede zwischen unseren Herrn und Gebietern. Herr Rotnase mümmelt vor sich hin, Turton spricht deutlich, Mrs. Turton nimmt Schmiergelder, Frau Rotnase dagegen nicht – kann es auch gar nicht, weil es sie bisher noch nicht gibt.«
»Schmiergelder?«
»Wussten Sie denn nicht, dass die Turtons im Zusammenhang mit irgendeinem Kanalprojekt einmal der Regierung von Zentralindien leihweise zur Verfügung gestellt wurden und dass irgendein Radscha ihr eine Nähmaschine aus purem Gold zum Geschenk machte, damit die Wasserstraße durch sein Gebiet geleitet würde?«
»Und hat er das erreicht?«
»O nein. In dem Punkt ist nämlich Mrs. Turton ganz gerissen. Wenn wir armen Nigger Schmiergelder annehmen, dann tun wir auch wirklich, wofür man uns bezahlt – und gleich haben wir das Gesetz auf dem Hals! Die Engländer stecken Schmiergelder ein, ohne auch nur das Geringste dafür zu unternehmen. Ich finde sie bewundernswert.«
»Wir alle finden sie bewundernswert. Bitte, Aziz, reich mir doch die hookah.«
»Oh – noch nicht. Sie schmeckt so gut!«
»Du alter Egoist.« Hamidullah hob plötzlich die Stimme und rief im Kommandoton nach dem Essen. Die Diener riefen zurück, dass es fertig sei. Was gar nichts anderes hieß, als dass sie selber wünschten, es fertig zu haben, und was auch in diesem Sinne verstanden wurde, denn niemand rührte sich von der Stelle. Hamidullah fuhr weiter in der Unterhaltung fort, aber sein Tonfall hatte gewechselt, und er sprach offensichtlich mit innerer Bewegung.
»Wie verhält es sich nun aber mit meinem Fall, dem Fall des jungen Hugh Bannister? Ja, da wäre also der Sohn meiner lieben dahingegangenen Freunde, des Pfarrers Bannister und seiner Frau – die Güte, die sie mir bei meinem Aufenthalt in England erwiesen haben, lässt sich weder schildern noch vergessen. Sie waren wie meine eigenen Eltern, und ich konnte mit ihnen reden, wie jetzt mit euch. Während der Ferien war das Pfarrhaus ein Heim für mich. Sie vertrauten mir alle ihre Kinder an – wie oft habe ich den kleinen Hugh auf den Armen getragen! Auch zum Begräbnis der Königin Victoria habe ich ihn mitgenommen und ihn dabei auf diesen Händen über die Köpfe der Menge emporgehalten.«
»Königin Victoria war ganz anders«, murmelte Mahmoud Ali.
»Nun höre ich, dass der Junge im Lederhandel in Kanpur tätig ist. Ihr könnt euch denken, wie sehr ich darauf brenne, ihn wiederzusehen und ihm das Fahrgeld zu bezahlen, damit dieses Haus auch für ihn zum Heim werde. Aber es hat gar keinen Zweck. Die anderen Anglo-Inder werden ihn längst zu einem der Ihren gemacht haben. Er wird wahrscheinlich vermuten, ich wolle irgendetwas von ihm, und das wäre mir beim Sohn meiner alten Freunde ein unerträglicher Gedanke. Oh, was ist mit diesem Land eigentlich schiefgegangen, Vakil Sahib? Ich frage Sie!«
Nun griff endlich Aziz mit in die Unterhaltung ein. »Warum immerzu von Engländern reden? … Warum mit diesen Burschen überhaupt befreundet oder nicht befreundet sein? Lassen wir sie doch einfach aus dem Spiel und amüsieren wir uns! Die Königin Victoria und Mrs. Bannister waren die einzigen Ausnahmen, und die sind nicht mehr am Leben.«
»Nein, nein, das kann ich nicht zugeben. Ich habe auch noch andere Ausnahmen kennengelernt.«
»Ich auch«, sagte Mahmoud Ali, einen unerwarteten Frontwechsel vollziehend. »Die Damen sind sich durchaus nicht gleich.« Die Stimmung der Freunde war umgeschlagen, und sie riefen sich kleine Akte der Gefälligkeit und der Höflichkeit ins Gedächtnis. »Sie sagte auf die natürlichste Weise von der Welt: Danke recht schön.« – »Sie bot mir eine Pastille an, als mein Hals von Staub ganz rau war.« Hamidullah konnte sich an bedeutsamere Beispiele englisch-engelhaften Verhaltens erinnern, aber der andere, der lediglich Anglo-Indien kannte, musste sein Gedächtnis schon nach Bagatellen durchwühlen, und so war es nicht weiter überraschend, dass er bald wieder auf seine frühere Feststellung zurückkam: »Aber natürlich sind das alles nur Ausnahmen, und die beweisen gerade die Regel. Die Durchschnittsengländerin ist wie Mrs. Turton, und Sie, Aziz, wissen ja, was das bedeutet.« Aziz wusste es nicht, stimmte aber zu. Auch er war allzu geneigt, seine persönlichen Enttäuschungen zu verallgemeinern – das Gegenteil wäre für die Angehörigen einer nicht unabhängigen Nation auch mehr als schwierig gewesen. Ja, mit gewissen Ausnahmen waren alle Engländerinnen hochnäsig und bestechlich. Von der Unterhaltung wich aller Schimmer, und ihr graufarbiges Band entrollte sich ins Unabsehbare.
Ein Diener kündigte an, dass das Mahl aufgetragen sei. Sie nahmen keine Notiz von ihm. Die beiden Älteren waren bei ihrer ewigen Politik angelangt. Aziz schlenderte in den Garten hinaus. Süß dufteten die Sträucher – champak mit grüner Blüte –, und Einzelklänge persischer Verse wogten ihm durch den Sinn. Mahl, Mahl, Mahl … aber als er dafür ins Haus zurückkehrte, war Mahmoud Ali seinerseits entschwunden, um seinem sais ein paar Anweisungen zu erteilen. »Dann komm doch inzwischen ein bisschen mit zu meiner Frau«, sagte Hamidullah zu Aziz, und zwanzig Minuten lang verweilten beide hinter dem purdah. Die Begum war eine entfernte Tante von Aziz – die einzige weibliche Verwandtschaft, die er in Tschandrapur besaß –, und sie hatte bei dieser Gelegenheit allerhand zu dem Familienereignis einer Beschneidung zu bemerken, bei der es nicht feierlich genug zugegangen war. Es war nicht ganz einfach, von der Begum loszukommen, weil sie erst mit ihrem eigenen Mahl beginnen konnte, wenn die anderen das ihre bereits hinter sich hatten, und infolgedessen zog sie das Gespräch in die Länge, um nicht den Eindruck des Ungeduldigseins zu erwecken. Nachdem sie das Ritual der Beschneidung ausgiebig beanstandet hatte, ging sie zu verwandten Themen über und fragte Aziz, wann er sich wieder zu verheiraten gedenke.
Ehrerbietig, aber etwas gereizt erwiderte er: »Einmal ist für mich genug.«
»Ja, er hat seine Pflicht schon getan«, fiel Hamidullah ein. »Setz ihm nur nicht zu sehr zu, den Fortbestand seines Namens hat er ja gesichert – zwei Jungen und deren Schwester.«
»Tante, bei der Mutter meiner Frau geht ihnen nicht das Geringste ab – bei ihr hat sie selbst die letzten Lebenstage verbracht. Ich kann die Kinder sehen, wann immer mir danach zumute ist. Sie sind noch ganz klein.«
»Und er lässt ihnen sein ganzes Gehalt zukommen und lebt selbst wie ein kleiner Büroangestellter und sagt keinem Menschen, warum. Was sollte er nach deiner Meinung noch mehr?«
Aber das war nicht, was die Hamidullah-Begum im Sinn hatte. Nachdem sie ein paar Augenblicke lang aus Höflichkeit der Unterhaltung eine andere Wendung gegeben hatte, rückte sie offen damit heraus. »Was soll nur aus unseren Töchtern werden«, fragte sie, »wenn die Männer nicht heiraten wollen? Sie werden sich unter dem Stande verehelichen oder müssen sogar –.« Und wieder einmal begann sie mit der schon oft vorerzählten Geschichte von einer Dame kaiserlichen Geblüts, die in dem engen Umkreis, in dem ihr eigener Stolz ihr eine Gattenwahl vergönnte, keinen geeigneten Mann hatte finden können und unvermählt ihr Dasein zu fristen hatte, auch wohl unvermählt ins Grab sinken würde, weil nun, da sie dreißig war, kein Mann sie mehr haben wollte. Während ihnen von dieser Tragödie berichtet wurde, waren beide Männer ehrlich überzeugt, dass die Gemeinschaft als Ganzes daran mitschuldig war. Dann schon fast lieber Vielweiberei, als dass eine Frau ohne die ihr von Gott zugedachten Freuden ins Grab sinken musste! Ehe, Mutterschaft, häusliche Machtvollkommenheit – wofür wäre sie sonst wohl auf der Welt, und wie hätte auch der Mann, der ihr solches vorenthalten, am Jüngsten Tage ihrem – und seinem – Schöpfer unverzagt ins Antlitz blicken sollen? Aziz verabschiedete sich mit den Worten: »Ja, vielleicht … aber etwas später …« – seine stereotype Antwort auf jedes diesbezügliche Ansinnen.
»Du solltest nicht hinausschieben, was du für richtig hältst«, sagte Hamidullah. »Indien ist nur darum in ein solches Schlamassel geraten, weil wir alles immer wieder hinausschieben.« Aber da er bemerkte, dass sein jugendlicher Verwandter eine etwas sorgenvolle Miene aufgesetzt hatte, fügte er ein paar begütigende Worte hinzu und machte damit jeden Eindruck zunichte, den seine Frau möglicherweise bei ihm hervorgerufen hatte.
Während beider Abwesenheit war Mahmoud Ali davonkutschiert. Er hatte Bescheid hinterlassen, dass er in fünf Minuten wieder zurück sein werde, dass aber die anderen keinesfalls mit dem Essen auf ihn warten sollten. Diese ließen sich denn auch mit einem entfernten Vetter der Familie, Mohammed Latif, der, auf Hamidullahs Freigebigkeit angewiesen, die Position weder eines Untergebenen noch eines Gleichgestellten innehatte, zum ersten Gang nieder. Latif öffnete die Lippen nur, wenn man ihn anredete, und da niemand es tat, blieb er selbst stumm, ohne sich im Entferntesten gekränkt zu zeigen. Hin und wieder stieß er auf – in Anerkennung des üppigen Essens. Ein sanfter, zufriedener, unredlicher alter Mann, der sein ganzes Leben lang nicht einen Finger krumm gemacht hatte. Solange einer seiner Verwandten ein Haus besaß, durfte er selbst einer Heimstatt gewiss sein, und es war auch kaum zu erwarten, dass eine so wohlhabende Familie wie die seine als Ganzes jemals Bankrott machen würde. In mehreren hundert Meilen Entfernung führte seine Frau ein ähnliches Schmarotzerdasein – in Anbetracht der Kostspieligkeit einer Eisenbahnkarte stattete er ihr niemals einen Besuch ab. Aziz hielt ihn, wie auch die Diener, ein wenig zum Besten und begann dann gleich, Verse zu rezitieren – zuerst auf Persisch und dann gelegentlich auf Arabisch. Er hatte ein gutes Gedächtnis und war für sein jugendliches Alter auch recht belesen. Seine Lieblingsthemen waren der Verfall des Islam und die Flüchtigkeit der Liebe. Die anderen lauschten ihm voller Entzücken, denn für sie war die Dichtkunst eine gesellschaftliche, und nicht, wie überwiegend in England, eine private Angelegenheit. Sie wurden es niemals müde, Worte zu hören und wieder Worte. Sie atmeten sie mit der kühlen Nachtluft ein und machten sich auch über ihre Bedeutung nicht allzu viel Gedanken. Der Name des Dichters – Hafiz, Hali, Iqbal – war in sich selbst schon Gewähr. Das weite Indien – Hunderte von Ländern, die Indien hießen – flüsterte draußen in der Nacht unter einem gleichmütigen Mond vor sich hin. Aber im Augenblick schien es für sie nur ein einziges Indien zu geben, das ihre, und sie gewannen ihre ehemalige Größe zurück, als sie den Verlust dieser Größe beklagen hörten, sie fühlten sich selbst wieder jung, weil sie an die Flüchtigkeit der Jugend gemahnt wurden. Ein scharlachroter Diener unterbrach die Rezitation – der chuprassi des britischen Oberarztes, der Aziz ein Stück Papier aushändigte.
»Der alte Callendar will mich in seinem Bungalow sehen«, sagte er, ohne Anstalten zum Aufstehen zu machen. »Er hätte immerhin so höflich sein können, mich wissen zu lassen, warum.«
»Irgendein Krankheitsfall, würde ich denken.«
»Nein, sicher nicht, gar nichts. Er hat herausgefunden, wann wir beim Essen sitzen, und es macht ihm Vergnügen, uns jedes Mal dabei zu stören, um uns seine Macht fühlen zu lassen.«
»Ja, das stimmt schon, andererseits mag es sich wirklich um etwas Ernsthaftes handeln – man kann es einfach nicht wissen«, sagte Hamidullah, Aziz mit einiger Rücksicht einen Pfad zum Gehorsam bahnend. »Solltest du dir nicht lieber erst den Mund spülen, wenn du pan gekaut hast?«
»Wenn mein Mund erst gespült werden muss, gehe ich nicht. Ich bin Inder, und es ist eine indische Gewohnheit, pan zu kauen. Damit muss der Oberarzt sich schon abfinden. Mein Fahrrad bitte, Mohammed Latif.«
Der arme Verwandte stand auf. Dem Bereich des Stofflichen nur lose zugehörig, legte er lediglich die Hand auf den Sattel, während ein Diener den eigentlichen Transport übernahm. Gemeinsam hoben sie das Rad über eine am Boden liegende Reißzwecke. Aziz hielt die Hände unter die Wasserkanne, trocknete sie, drückte sich den grünen Filzhut kleidsam in die Stirn und schwirrte dann mit unerwarteter Entschlossenheit die Straße hinab.
»Aziz, Aziz, du unvorsichtiger Bengel …« Aber er war bereits mitten im Basarviertel, wie ein Wahnsinniger in die Pedale tretend. Er hatte keine Lampe, keine Klingel, keine Bremse an seinem Rad. Aber was haben Nebensächlichkeiten wie diese in einem Land zu besagen, in dem ein Radfahrer nur die eine Hoffnung hat, dass jedes der auf seinem Weg von ihm erspähten Gesichter sich in Luft auflöst, bevor er damit zusammenprallt! Und um diese Stunde war es in der Innenstadt ziemlich leer. Als einer der Reifen die Luft verlor, sprang Aziz ab und brüllte nach einer Tonga.
Zunächst konnte er freilich keine auftreiben und musste auch erst das Fahrrad im Haus eines Freundes abstellen. Weitere Zeit vertrödelte er mit Mundspülen. Aber schließlich rasselte er im Triumphgefühl hoher Geschwindigkeit der Beamtensiedlung zu. Als er ihrer öden Gepflegtheit ansichtig wurde, überfiel ihn plötzlich eine gewisse Niedergeschlagenheit. Die Straßen, auf die Namen siegreicher Generale getauft und im rechten Winkel sich kreuzend, waren symbolisch für das Netz, das Großbritannien über Indien geworfen hatte und in dessen Maschen er sich jetzt verfing. Als er an Major Callendars Gartenpforte anlangte, konnte er sich nur mit Mühe zurückhalten, von der Tonga abzuspringen und den kleinen Weg bis zum Bungalow zu Fuß zurückzulegen – mit einiger Mühe nicht deshalb, weil er ein unterwürfiges Gemüt hatte, sondern weil sein Gefühl – die empfindlichere Seite seines Wesens – eine grobe Zurechtweisung befürchtete. Im vorausgehenden Jahr war es einmal zu einem besonderen »Fall« gekommen. Ein vornehmer Inder war am Haus eines britischen Beamten vorgefahren, war aber vom Diener zur Umkehr genötigt und von ihm bedeutet worden, er solle auf angemessene Weise wieder erscheinen – ein einziger »Fall« unter Tausenden von Besuchen bei Hunderten von Beamten, aber ein leider weithin bekannt gewordener Fall. Der junge Mann wollte ihn keineswegs wiederholt sehen. Er entschloss sich zu einem Kompromiss und ließ außerhalb des breiten Lichtscheins halten, der über die Veranda fiel.
Der Oberarzt war nicht zu Hause.
»Aber der Sahib hat mir wohl Bescheid hinterlassen?«
Der Diener erwiderte mit einem gleichgültigen Nein. Aziz war in heller Verzweiflung. Es war ein Diener, dem er bei einer früheren Gelegenheit aus purer Vergesslichkeit kein Trinkgeld gegeben hatte, und nun konnte er das nicht mehr nachholen, weil Leute in der Vorhalle waren. Er war überzeugt, dass eine Nachricht für ihn da war und dass der andere sie ihm aus Rache vorenthielt. Während beide noch hin und her redeten, traten die Leute heraus. Es waren zwei Damen. Aziz lüftete den Hut. Die eine, in großer Abendtoilette, streifte den Inder mit einem einzigen Blick und wandte sich instinktiv von ihm ab.
»Ja, Mrs. Lesley, es ist eine Tonga«, rief sie aufgeregt.
»Unsere Tonga?«, fragte die Zweite, bei Aziz’ Anblick dem Beispiel der Ersten folgend.
»Man sollte die Gaben der Götter nicht missachten«, gellte sie, und beide sprangen hinein. »Tonga Wallah, Klub, Klub. Warum rührt der Idiot sich nicht von der Stelle?«
»Fahr schon los – ich werde morgen bezahlen«, sagte Aziz zu dem Kuli. Und als dieser sich in Bewegung setzte, rief er höflich: »Es ist mir ein Vergnügen, meine Damen.« Sie antworteten nicht – sie waren viel zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt.
Da war es nun also wieder einmal passiert, das Übliche – gerade wie Mahmoud Ali es vorher beschrieben hatte. Die unverzeihliche Kränkung: seine Verbeugung übersehen, sein Gefährt in Beschlag genommen. Gewiss hätte es noch schlimmer kommen können. Irgendwie beruhigte es ihn, dass die Damen Callendar und Lesley korpulent waren und mit ihrem Schwergewicht den hinteren Teil der Tonga herunterdrückten. Schöne Frauen würden ihm ärger zu schaffen gemacht haben. Er wandte sich dem Diener zu, drückte ihm ein paar Rupien in die Hand und fragte nochmals, ob nicht Bescheid für ihn da sei. Jener wiederholte in sehr höflichem Ton die frühere Antwort. Major Callendar war gerade vor einer halben Stunde abgefahren.
»Ohne etwas zu bemerken?«
In Wirklichkeit hatte er gesagt: »Dieser verdammte Aziz!« – Worte, die der Diener wohl verstanden hatte, die zu wiederholen er aber nun zu höflich war. Man kann zuviel Trinkgeld geben und auch zu wenig: die Münze, mit der man sich die ganze Wahrheit erkauft, muss erst noch geprägt werden.
»Dann will ich ihm ein paar Zeilen schreiben.«
Der Diener wies mit einer großmütigen Geste ins Innere des Hauses, aber Aziz glaubte es seiner Würde schuldig zu sein, diesseits der Schwelle zu verharren. Auf die Veranda hinaus wurden ihm Papier und Tinte gebracht. Er begann: »Sehr geehrter Herr Major! Auf Ihren ausdrücklichen Befehl habe ich, wie es sich für einen Untergebenen gehört, nicht gesäumt –«. Er hielt inne. »Sag ihm, dass ich hier war – das genügt«, rief er, seinen Protest in Stücke reißend. »Hier ist meine Karte. Besorge mir eine Tonga.«
»Huzoor – sie sind alle gerade beim Klub.«
»Dann bestelle mir telefonisch eine am Bahnhof.« Und da der Diener sich eilig anschickte, das Gewünschte zu tun, sagte er: »Schon gut, schon gut, ich möchte doch lieber zu Fuß gehen.« Er ließ sich ein Zündholz reichen und steckte sich eine Zigarette an. Diese kleine Aufmerksamkeit hatte, wiewohl erkauft, etwas Beruhigendes für ihn. Er durfte auf Entsprechendes rechnen, solange er noch Rupien in der Tasche hatte – immerhin etwas. Hätte er nur schon den Staub Anglo-Indiens von den Sohlen geschüttelt, sich aus dem Netz herausgewunden, und sähe er sich nur wieder Umgangsformen und Gebärden gegenüber, die ihm vertraut waren! Er begann, eine ihm ungewohnte Tätigkeit, rasch auszuschreiten.
Aziz war behende und klein und zierlich gebaut, aber im Grunde recht kräftig. Dennoch ermüdete es ihn, zu Fuß zu gehen, was in Indien bis auf den Neuankömmling jeden ermüdet. Der Boden scheint etwas Feindliches an sich zu haben. Er gibt entweder nach, und man sinkt beim Gehen tief in ihn ein, oder er ist unerwartet zäh und scharfkantig, und mehr als einmal verspürt man, ausschreitend, den Gegendruck von Stein und Kristall. Nach einer Reihe solch kleiner Überraschungen fühlt man sich ganz erschöpft. Und Aziz trug obendrein Schuhe, die keine Absätze hatten – in jedem Land eine für Fußgänger unzulängliche Ausrüstung. Am Außenrand der Beamtenstation schwenkte er in die Moschee ein, um hier ein wenig zu rasten.
Er hatte gerade für diese Moschee stets etwas übrig gehabt. Sie war anmutig gegliedert, und die bauliche Anordnung sagte ihm zu. Im Hof, den er durch ein verfallenes Tor betrat, befand sich ein Reinigungsbrunnen mit fließendem klarem Wasser – Teil einer die ganze Stadt versorgenden Zuflussleitung. Die Pflasterung des Hofes bestand aus geborstenen Platten. Der überdachte Teil der Moschee war weiträumiger, als es sonst der Fall war – man fühlte sich bei seinem Anblick an eine englische Gemeindekirche erinnert, bei der eine Seitenwand fehlt. Von dort, wo Aziz saß, konnte er in drei Bogengänge hineinblicken, deren Dunkel nur durch eine kleine Hängelampe und den Mond aufgehellt war. Die Vorderwand schien, im vollen Mondlicht, aus Marmor zu bestehen, und auf dem Fries hoben sich die neunundneunzig Namen Gottes schwärzlich vom Steingrund ab, während der Fries selbst weiß leuchtend vor dem nächtlichen Himmel stand. Am Wettstreit der Gegensätze und am Wechselspiel der Schatten im Innern des Baus fand Aziz Gefallen, und er versuchte, beidem sinnbildliche Bedeutung für irgendeine Wahrheit der Liebe oder der Religion abzugewinnen. Wann immer eine Moschee ästhetisches Wohlgefallen bei ihm erweckte, vermochte sie auch seine Einbildungskraft zu beflügeln. Der Anblick eines anderen Tempels, sei es von Hindus, von Christen oder von Griechen, würde ihn gelangweilt, würde auch sein Schönheitsgefühl unbeteiligt gelassen haben. Hier aber war der Islam, war seine geistige Heimat, mehr als ein Glaube, als ein Schlachtruf, mehr, sehr viel mehr … Islam: ein Lebensgehäuse, das köstlich-erlesen und gleichzeitig dauerfest war und in dem sein Körper und seine Gedanken sich daheim fühlen durften.
Sein Ruhesitz befand sich auf einer niedrigen Mauer, die den Hof zur Linken begrenzte. Vor seinen Füßen fiel der Boden in Richtung der Stadt ein wenig ab, die jetzt nicht mehr war als ein Schattengebilde von Bäumen, und in der Stille vernahm er vielerlei ferne Laute. Zur Rechten, drüben im Klubgebäude, steuerte die englische Kolonie den Klang eines Amateurorchesters dazu bei. Irgendwo anders rührten Hindus die Trommeln – er wusste, dass es Hindus waren, weil der Rhythmus dem seines Wesens zuwiderlief –, während andere eine Totenklage angestimmt hatten – er wusste, wer der Verstorbene war, denn er hatte ihm erst am Nachmittag den ärztlichen Totenschein ausgestellt. Endlich waren Eulen zu hören und der Pandschab-Express … und aus dem Garten des Stationsvorstehers wehte berückender Blumenduft. Aber die Moschee – nur ihr war geistige Wirklichkeit eigen, und dem vielfältigen Anruf der Nacht sich verschließend, wandte er sich ihr wieder zu und schmückte sie mit Bedeutungen, von denen ihr Erbauer sich nie hätte träumen lassen. Eines Tages würde auch er eine Moschee errichten lassen, kleiner als diese, aber von erlesenstem Geschmack, auf dass alle, die zufällig hier des Weges kamen, das gleiche Gefühl der Glückseligkeit auskosten durften, das er selbst jetzt empfand. Und ganz in ihrer Nähe sollte, in einem niedrigen Gewölbe, sein Grab sich befinden, mit einer persischen Inschrift:
»Ohne mich wird nun, wehe, viele Jahrtausende
Die Rose erblühen, der Frühling erschimmern,
Aber wer im Geheimen mein Herz verstanden hat,
Wird herpilgern zu dem Grab, das mir Ruhestatt ist.«
Er hatte diesen Vierzeiler einst auf dem Grab eines Königs im Dekhan erblickt und betrachtete ihn als Ausdruck einer tiefsinnigen Weltanschauung – stets setzte er das Pathetische mit dem Tiefgründigen gleich. Das geheime Verstehen des Herzens! Mit Tränen im Auge wiederholte er die Floskel, und währenddessen schien eine der Moscheesäulen ins Wanken zu geraten. Sie bebte in der Düsternis, schien sich abzusondern. Geisterglaube spukte ihm im Blut, aber er rührte sich nicht von der Stelle. Eine zweite Säule bewegte sich, eine dritte, und dann trat ins Mondlicht hinaus die Gestalt einer Frau – einer Engländerin. Plötzlich von Wut gepackt, rief er laut: »Madam! Madam! Madam!«
»Oh, oh«, hauchte erschrocken die Frau.
»Madam, dies ist eine Moschee. Sie haben kein Recht, sie zu betreten! Sie hätten Ihre Schuhe ablegen sollen. Dies ist für Moslems eine heilige Stätte.«
»Ich habe die Schuhe abgelegt.«
»Tatsächlich?«
»Ich habe sie am Eingang gelassen.«
»Dann bitte ich um Verzeihung.«
Noch immer erschrocken, bewegte die Frau sich dem Ausgang zu, wobei sie sich absichtlich auf der anderen Seite des Reinigungsbrunnens hielt. »Ich bitte aufrichtig um Verzeihung für meine Worte«, rief er ihr nach.
»Ja, es war doch alles in Ordnung, nicht wahr? Wenn ich meine Schuhe ausziehe, bin ich doch zugelassen?«
»Natürlich. Aber so wenige Damen nehmen sich diese Mühe, vor allem, wenn sie glauben, dass es niemand sieht.«
»Das macht doch nicht den geringsten Unterschied. Gott ist hier.«
»Madam!«
»Bitte lassen Sie mich nun gehen.«
»Oh, kann ich Ihnen jetzt oder ein anderes Mal in irgendeiner Weise gefällig sein?«
»Nein, danke schön, wirklich nicht – Gute Nacht.«
»Darf ich wohl Ihren Namen wissen?«
Sie stand nun im Schatten des Torwegs, sodass er ihr Gesicht nicht erkennen konnte, aber sie sah das seine und sagte mit einem Wechsel der Stimme: »Mrs. Moore.«
»Mrs. –.« Ein paar Schritte vortretend, bemerkte er, dass sie gar keine junge Frau mehr war. Ein Traumschloss, leuchtender als die Moschee, sank in Trümmer, und er wusste nicht, ob er froh sein sollte oder betrübt. Sie war älter als die Hamidullah-Begum, hatte ein rötliches Gesicht und weißes Haar. Ihre Stimme hatte ihn getäuscht.
»Mrs. Moore, ich fürchte, ich habe Sie erschreckt. Ich werde meinen Glaubensbrüdern – unseren Freunden – berichten, was Sie gesagt haben. Dass Gott hier ist – wie gut, wie schön das klingt! Sie sind wohl noch nicht lange in Indien?«
»Gar nicht lange. Aber woran erkennen Sie das?«
»An der Art, wie Sie mit mir sprechen. Nein, nicht nur das. Aber darf ich Ihnen einen Wagen holen?«
»Ich bin nur eben vom Klub einen Moment herübergekommen. Sie führen dort ein Stück auf, das ich schon in London gesehen habe, und im Saal war es so heiß.«
»Was ist denn das für ein Stück?«
»›Cousin Kate‹.«
»Sie sollten bei Nacht hier lieber nicht allein spazieren gehen, Mrs. Moore. Es treibt sich allerhand Gesindel herum, und von den Marabar-Hügeln wagen sich mitunter sogar Leoparden hierher. Auch Schlangen.«
Sie stieß einen Laut des Schreckens aus. An die Schlangen hatte sie nicht mehr gedacht.
»Oder auch ein bestimmter Käfer mit sechs Pünktchen auf den Flügeln. Sie lesen ihn auf, er sticht, und Sie müssen sterben.«
»Aber Sie gehen ja selbst hier spazieren!«
»Oh, ich bin es gewohnt.«
»Die Schlangen gewohnt?«
Beide lachten. »Ich bin Arzt«, sagte er. »Schlangen trauen sich nicht an mich heran.« Seite an Seite ließen sie sich in dem weiten Eingangstor nieder und streiften sich die Schuhe wieder über.
»Darf ich bitte noch eine Frage an Sie richten? Warum kommen Sie eigentlich um diese Zeit des Jahres nach Indien, ausgerechnet jetzt, wo das kühle Wetter zu Ende geht?«
»Ursprünglich hatte ich die Absicht, früher zu kommen, aber es gab einen unvermeidlichen Aufschub.«
»Bald wird es hier ganz ungesund für Sie sein. Und warum kommen Sie ausgerechnet nach Tschandrapur?«
»Um meinen Sohn zu besuchen. Er ist der Richter für diese Stadt!«
»Aber nein, entschuldigen Sie, das ist ja unmöglich. Der Richter in unserer Stadt heißt Mr. Heaslop. Ich kenne ihn ganz genau.«
»Er ist trotzdem mein Sohn«, sagte sie lächelnd.
»Aber Mrs. Moore – wie kann er das sein?«
»Ich war zweimal verheiratet.«
»Ja, nun verstehe ich. Und Ihr erster Gatte ist gestorben.«
»Jawohl, und auch mein zweiter Mann.«
»Dann sind wir genau in derselben Lage«, sagte er geheimnisvoll. »Dann ist der Richter in dieser Stadt der Einzige, der Ihnen von allen Ihren Angehörigen geblieben ist?«
»Nein, ich habe noch zwei jüngere Kinder – Ralph und Stella, die in England leben.«
»Und der Herr hier in der Stadt – er ist Ralphs und Stellas Halbbruder?«
»Ganz richtig.«
»Mrs. Moore – das ist alles ungeheuer seltsam, weil auch ich, genau wie Sie, zwei Söhne und eine Tochter habe. Ist das nicht eine merkwürdige Zufallsfügung?«
»Wie heißen denn Ihre Kinder? Doch nicht wohl auch Ronny, Ralph und Stella?«
Die Frage entzückte ihn. »Nein, das nun wirklich nicht. Wie komisch das klingt! Sie heißen ganz anders – Sie werden überrascht sein. Hören Sie bitte. Ich werde Ihnen jetzt die Namen meiner Kinder sagen: das erste heißt Achmed, das zweite Karim, das dritte – die Erstgeborene – ist Dschemila. Drei Kinder sind genug. Ist das nicht auch Ihre Meinung?«
»O ja.«
Beide versanken für einen Augenblick in Schweigen und gedachten ihrer eigenen Sprösslinge. Mrs. Moore erhob sich mit einem Seufzer.
»Hätten Sie nicht einmal Lust, sich frühmorgens das Minto-Krankenhaus anzusehen?«, fragte er. »Etwas anderes habe ich Ihnen in Tschandrapur nicht zu bieten.«
»Danke schön, ich habe es bereits gesehen. Sonst hätte ich es mir wirklich gern von Ihnen zeigen lassen.«
»Dann hat es Ihnen wohl der Oberarzt gezeigt?«
»Jawohl, er und Mrs. Callendar.«
Seine Stimme wechselte den Klang. »Oh, eine wirklich reizende Dame!«
»Möglicherweise. Wenn man sie etwas näher kennt.«
»Wie? Was? Sie hat Ihnen nicht gefallen?«
»Sie hat es durchaus nicht an Freundlichkeit fehlen lassen, nur finde ich sie nicht gerade reizend.«
»Sie hat eben erst ohne meine Einwilligung meine Tonga entführt«, brach Aziz aus. »Nennen Sie so etwas reizend? – Und Major Callendar stört mich Abend für Abend beim Essen. Er lässt mich aus dem Haus meiner Freunde holen, und ich habe sofort zu ihm zu gehen und eine höchst anregende Unterhaltung abzubrechen, und dann ist er nicht da – nicht einmal eine Botschaft von ihm. Bitte schön – ist das reizend? Aber was kommt es schon drauf an! Ich kann mich ja nicht zur Wehr setzen, und das weiß er. Ich bin nur ein Untergebener, und meine eigene Zeit ist alles andere als kostbar. Für einen Inder ist die Veranda gerade gut genug, ja, jawohl, warum sollte er sich auch niedersetzen? Und Mrs. Callendar nimmt meine Tonga – ich bin einfach Luft für sie!«
Mrs. Moore hielt ihm ihr Ohr zugeneigt.
In Erregung geraten war Aziz zum einen bei dem Gedanken an die ihm angetane Kränkung, in weit höherem Maße aber deshalb, weil ein anderer Mensch ihm Teilnahme schenkte. Und das war es auch, was ihn zu Wiederholungen, Übertreibungen, Widersprüchen verführte. Sie hatte ihm ihr Mitgefühl dadurch bewiesen, dass sie ihm gegenüber Kritik an einer anderen Engländerin übte. Aber selbst vorher schon war er dieses Mitgefühls gewiss gewesen. Die Flamme, die nicht einmal der Anblick bloßer Schönheit entzünden kann, loderte auf, und wenn seine Worte auch wehleidig klangen, so begann sein Herz doch im Geheimen zu glühen. Und sogleich ging ihm die Zunge über.
»Sie verstehen mich, Sie wissen, wie einem Menschen zumute ist. Oh, wenn doch auch die anderen Ihnen ähnlich wären!«
Etwas überrascht erwiderte sie: »Ich glaube, ich verstehe von anderen Menschen nicht viel. Ich weiß nur, ob ich sie gern habe oder nicht.«
»Dann sind Sie Orientalin!«
Sie ließ sich, wie er es vorgeschlagen hatte, von ihm zum Klub zurückbegleiten und bemerkte an der Tür, sie wünschte, sie wäre selbst Mitglied, weil sie ihn dann mit hätte hereinbitten können.
»Im Klub von Tschandrapur sind Inder nicht einmal als Gäste zugelassen«, sagte er einfach. Er verbreitete sich auch nicht weiter über die ihm angetanen Kränkungen, denn er fühlte sich glücklich. Als er unter dem lieblichen Mond hügelab wanderte und die liebliche Moschee wieder vor sich erblickte, war es ihm, als habe er nicht weniger Besitzanrecht auf das ganze Land als irgendeiner der anderen. Was lag schon daran, dass ein paar schwächliche Hindus bereits vor ihm da waren, ein paar frostige Engländer noch nach ihm da sein würden!
3
Als Mrs. Moore den Klubsaal wieder betrat, war man schon mitten im dritten Akt der Aufführung von »Cousin Kate«. Die Fenster waren verhängt, damit die Diener ihre Memsahibs nicht schauspielern sehen konnten, und infolgedessen war die Hitze ganz unerträglich. Einer der elektrischen Ventilatoren wirbelte um sich selbst wie ein wunder Vögel, ein anderer funktionierte nicht. Da Mrs. Moore keine Lust verspürte, sich wieder unter die Zuschauer zu mischen, suchte sie stattdessen das Billardzimmer auf, in dem sie mit dem Ausruf: »Ich möchte aber etwas vom wahren Indien sehen!«, begrüßt wurde, und schon hatte das ihr zugeteilte Dasein wieder Besitz von ihr ergriffen. Der Ausruf kam von Adela Quested, dem seltsamen, vorsichtigen jungen Mädchen, das sie im Auftrag Ronnys aus England hatte herüberbringen müssen, und Ronny war ihr – gleichfalls vorsichtiger – Sohn, der Miss Quested mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht mit aller Bestimmtheit heiraten würde, und sie selbst war eine etwas ältliche Dame.
»Auch ich möchte etwas davon sehen und wünschte nur, wir brächten es wirklich fertig. Offenbar wollen die Turtons am nächsten Dienstag irgendetwas veranstalten.«
»Das wird, wie immer, mit einem Elefantenritt enden. Denk nur an diesen Abend. ›Cousin Kate‹. Stell dir vor: ›Cousin Kate‹. Aber wo bist du denn in der Zwischenzeit gewesen? Ist es dir gelungen, den Mond diesmal im Ganges schimmern zu sehen?«
Zufällig hatten beide Frauen am Abend vorher in einem ferner gelegenen Seitenkanal des Stromes den Widerschein des Mondes erblickt, freilich vom Wasser so sehr in die Länge gezogen, dass er größer wirkte als der richtige Mond, und heller dazu, und das hatte ihnen Vergnügen bereitet.
»Ich bin bis zur Moschee gekommen, habe aber leider nichts vom Mond gesehen.«
»Heute wäre wohl auch der Winkel etwas anders – er geht erst später auf.«
»Später und immer später«, gähnte Mrs. Moore, die sich nach ihrem Spaziergang etwas müde fühlte. »Lass mich nachdenken – wir sehen hier nichts von der anderen Seite des Mondes, nein.«
»Aber, aber, so schlimm ist es mit Indien nun wieder nicht«, sagte eine freundliche Stimme. »Die andere Seite der Erde, na schön, aber wir halten es noch immer mit dem gleichen alten Mond.« Keine der beiden Frauen kannte den Sprecher, und keine sollte ihn je wieder zu Gesicht bekommen. Mit seinem gut gemeinten Wort entschwand er hinter den roten Backsteinsäulen im Dunkel.
»Wir bekommen nicht einmal etwas von der anderen Seite der Welt zu sehen – das ist unser Kummer«, bemerkte Adela. Mrs. Moore stimmte ihr zu. Auch sie war über die Reizlosigkeit ihres neuen Lebens enttäuscht. Ihre Reise, die sie zunächst über das Mittelmeer und dann zwischen den Sandflächen Ägyptens hindurch bis zum Hafen von Bombay geführt hatte, war so romantisch gewesen, und nur an ihrem Endpunkt hatten sie nichts anderes vorgefunden als den Gitterrost einer Bungalowsiedlung. Aber sie nahm die Enttäuschung nicht ganz so schwer wie Miss Quested – sie war immerhin vierzig Jahre älter und hatte erfahren, dass das Leben uns niemals in dem Augenblick unsere Wünsche erfüllt, den wir für den richtigen halten. Gewiss ereignet sich allerhand Abenteuerliches, aber niemals auf die Minute pünktlich. Nochmals bemerkte sie, sie hoffe, dass am folgenden Dienstag irgendetwas Interessantes zustande kommen werde.
»Lassen Sie sich etwas einschenken«, sagte eine andere freundliche Stimme – »Mrs. Moore – Miss Quested – lassen Sie sich beide Ihr Glas füllen!« Diesmal wussten sie, wessen Stimme es war – die des Verwaltungsdirektors Mr. Turton, in dessen Haus sie zu Abend gegessen hatten. Ganz wie ihnen, war es auch ihm bei »Cousin Kate« etwas zu heiß geworden. Ronny, berichtete er ihnen, verträte heute Abend Major Callendar, den irgendein indischer Untergebener hätte sitzen lassen, in der Rolle des Bühneninspizienten, und er mache seine Sache vortrefflich. Dann ließ er sich über Ronnys Vorzüge aus und äußerte ruhig und entschieden allerhand Schmeichelhaftes über ihn. Nicht, dass der junge Mann sich auf sprachlichem oder sportlichem Gebiet besonders hervortat oder dass er auch das der Jurisprudenz schon beherrschte. Aber – und das war offenbar ein gewichtiges Aber – Ronny hatte persönliche Würde.
Mrs. Moore vernahm es zu ihrer Überraschung, denn Würde gehört an sich nicht gerade zu den Eigenschaften, die eine Mutter ihrem Sohn zuzutrauen pflegt. Miss Quested vernahm es mit einer gewissen Besorgnis, denn sie war sich noch nicht darüber im Klaren, ob sie für würdige Männer allzu viel übrig hatte. Tatsächlich versuchte sie, diese Frage mit Mr. Turton zu erörtern, aber er verwies sie mit einer gutgelaunten Handbewegung zum Schweigen und fuhr fort zu äußern, was zu äußern er eigentlich gekommen war. »Kurz und gut – Heaslop ist ein Sahib. Er ist einer von denen, die wir hier brauchen. Er ist einer der Unseren.« Und ein anderer Zivilist, der sich gerade über den Billardtisch beugte, sagte vernehmlich: »Hört, hört!« Damit war die ganze Frage dem Bereich des Zweifels entrückt, und der Verwaltungsdirektor durfte seinen Weg fortsetzen, denn es riefen ihn andere Pflichten.
Inzwischen war die Theateraufführung am Ende angelangt, und das Amateurorchester spielte die Nationalhymne. Unterhaltung und Billardspiel brachen ab, die Gesichter nahmen einen steiferen Ausdruck an. Es war die Hymne der Besatzungsarmee, und die Klubmitglieder, Männer und Frauen, fühlten sich daran erinnert, dass sie Briten waren – Briten im Exil. Sie hatten ihr ein wenig Rührung zu danken und einen nützlichen Zuwachs an Willenskraft. Die dürftige Weise und die kurze Abfolge der an Jehova gestellten Ansprüche verschmolzen zu einem Gebet, wie es in England unbekannt war, und wenn die Teilnehmer am Gesang auch weder von der irdischen noch von der himmlischen Majestät eine deutliche Vorstellung hatten, so hatten sie gleichwohl irgendeine Vorstellung und fühlten sich so weit gestärkt, dass sie dem kommenden Tag mit Fassung ins Auge blicken konnten. Dann füllten sie die Gläser und boten sich gegenseitig etwas zum Trinken an.
»Adela – hier! Mutter – auch etwas!«
Die Angesprochenen lehnten dankend ab – sie hatten mehr als genug von drinks –, und Miss Quested, die immer geradeheraus sagte, was ihr in den Sinn kam, erklärte von Neuem, dass sie unbedingt etwas vom wirklichen Indien kennenlernen wolle.
Ronny war in bester Stimmung. Adelas Begehren mutete ihn komisch an, und er rief einem der in der Nähe Vorüberstreifenden zu: »Fielding! Wie kann man etwas vom wirklichen Indien kennenlernen?«
»Indem man Inder kennenzulernen sucht«, erwiderte jener und löste sich wieder in Luft auf.
»Wer war denn das?«
»Unser Schulmeister – vom Beamtenseminar.«
»Als ob man je vermeiden könnte, sie kennenzulernen«, seufzte Mrs. Lesley.
»Bisher habe ich es leider erfolgreich vermieden«, sagte Miss Quested. »Abgesehen von meinem eigenen Diener habe ich seit der Landung kaum mit einem einzigen Inder ein Wort gewechselt.«
»Oh, Sie Glückliche!«
»Aber ich möchte sie kennenlernen.«
Adela war nun der Mittelpunkt einer ganzen Gruppe belustigter Damen. »Sich zu wünschen, Inder kennenzulernen! Wie neu das klingt!«, sagte eine, und eine andere: »Eingeborene – man stelle sich vor!« Aber eine dritte, ernster gesinnte bemerkte: »Lassen Sie mich bitte erklären. Wenn wir mit Eingeborenen persönlich bekannt werden, heißt das noch lange nicht, dass sie uns deshalb auch mehr respektieren.«
»Was allerdings nicht nur im Fall von Eingeborenen gilt.« Aber die Sprecherin, so törichten wie freundlichen Herzens, fuhr fort: »Was ich sagen wollte – ich war vor meiner Heirat Krankenpflegerin und hatte beruflich eine ganze Menge mit Indern zu tun. Darum weiß ich Bescheid. Ich weiß, wie es sich mit Indern in Wahrheit verhält. Eine denkbar ungeeignete Stellung für eine Engländerin – ich war Krankenhausschwester in einem der indischen Fürstenstaaten. Die einzige Hoffnung, die mir blieb, war die, mich völlig abseits zu halten.«
»Selbst von den Patienten?«
»Das Beste, was man einem Eingeborenen antun kann, ist, ihn umkommen zu lassen«, erklärte Mrs. Callendar.
»Wenn er nun aber in den Himmel käme?«, fragte Mrs. Moore mit einem sanften, obschon etwas hinterhältigen Lächeln.
»Er kann hingehen, wo es ihm Spaß macht – Hauptsache, dass er nicht in meine Nähe kommt. Beim Anblick von Indern wird mir immer ganz anders.«
»Ich habe mir schon öfter Gedanken gemacht über das, was Sie in Bezug auf den Himmel sagen. Darum bin ich auch gegen die Missionare«, sagte die Dame, die einmal Krankenschwester gewesen war. »Ich bin durchaus für Militärgeistliche, aber gegen Missionare. Lassen Sie mich erklären.«
Aber bevor sie dazu ausholen konnte, griff der Verwaltungsdirektor wieder in die Unterhaltung ein.
»Möchten Sie wirklich den arischen Bruder kennenlernen, Miss Quested? Das lässt sich ohne Weiteres bewerkstelligen. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen so etwas Vergnügen machen würde.« Er dachte einen Augenblick nach. »Ich kann Sie mit jedem erdenklichen Typus zusammenbringen. Sie brauchen mir nur zu sagen, mit welchem. Ich kenne die Leute, die mit der Regierung zu tun haben, und ich kenne die Großgrundbesitzer. Unser Freund Heaslop kann die Anwälte herbeibeordern, wogegen wir uns auf Fielding verlassen dürfen, wenn Sie es speziell auf das Erziehungswesen abgesehen haben sollten.«
»Ich bin es etwas müde, malerische Gestalten an mir vorüberziehen zu sehen, wie auf einem Wandelbild«, erklärte die junge Dame. »Beim Landen fanden wir alles so großartig, aber der oberflächliche Reiz stumpft bald ab.«
Ihre persönlichen Eindrücke waren für den Verwaltungsdirektor ohne jedes Interesse – es war ihm lediglich darum zu tun, ihr den Aufenthalt in Indien so angenehm wie möglich zu machen. Ob sie wohl Lust auf eine Bridge-Party hatte? Er erklärte ihr, was das war – nicht etwa das wohlbekannte Kartenspiel dieses Namens, sondern eine Party, die die Kluft zwischen Ost und West überbrücken helfen sollte. Er selbst hatte den Ausdruck geprägt, und dieser belustigte alle, die ihn zu hören bekamen.
»Ich möchte nur die Inder kennenlernen, mit denen Sie gesellschaftlich verkehren – Ihre Freunde.«
»Nun, gesellschaftlich verkehren wir eigentlich nicht weiter mit ihnen«, sagte er lächelnd. »Sie haben alle erdenklichen Tugenden, und trotzdem halten wir sie uns vom Leibe, und es ist nun halb zwölf, und also zu spät, die Gründe dafür aufzuzählen.«
»Miss Quested – was für ein Name«, bemerkte Mrs. Turton, als sie sich mit ihrem Mann auf der Rückfahrt befand. Sie hatte die junge Dame nicht gerade ins Herz geschlossen – in ihren Augen war sie unmanierlich und verschroben. Hoffentlich war sie nicht herübergeschleppt worden, um sich mit dem netten kleinen Heaslop zu verheiraten. Nur sah es leider so aus. Im Stillen pflichtete ihr Mann ihr bei. Aber er äußerte, wenn es sich irgend umgehen ließ, niemals ein böses Wort über eine Engländerin, und darum bemerkte er lediglich, Miss Quested hege natürlich gewisse irrige Vorstellungen. Er fügte hinzu: »Indien wirkt Wunder in Bezug auf das persönliche Urteil, vor allem zur heißesten Zeit des Jahres. Es hat auch bei Fielding Wunder gewirkt.« Bei Erwähnung dieses Namens schloss Mrs. Turton die Augen und erklärte, dass Mr. Fielding nicht pukka sei, und lieber solle er Miss Quested heiraten, denn sie sei gleichfalls nicht pukka. Dann langten beide an ihrem Bungalow an, der, niedrig und weitläufig, das älteste und unbequemste Haus in der ganzen Beamtensiedlung war und einen Rasenplatz hatte, der wie ein eingelassener Suppenteller aussah. Sie genehmigten sich noch einen weiteren drink, der freilich nur aus Sprudel bestand, und gingen dann zu Bett. Ihr Aufbruch vom Klub hatte dem Abend dort vorzeitig ein Ende gesetzt, der, wie alle ähnlichen Veranstaltungen, einen offiziellen Anstrich gehabt hatte. Eine Gemeinschaft, die vor einem Vizekönig das Knie beugt und des Glaubens ist, dass die einen König umgebende Göttlichkeit übertragbar sei, muss auch vor jedem vizeköniglichen Ersatz Ehrfurcht empfinden. In Tschandrapur waren die Turtons wie kleine Götter. Bald jedoch würden sie sich in irgendeiner Vorortvilla zur Ruhe setzen und, fern der Stätte ihrer einstigen Herrlichkeit, im Exil ihre Lebenstage beschließen.
»Es war doch sehr anständig von dem hohen Herrn«, schwatzte Ronny, der über die seinen Gästen erwiesene Liebenswürdigkeit sehr befriedigt war. »Wisst ihr, dass er bisher noch niemals eine Bridge-Party veranstaltet hat? Und für euch hat er sogar schon ein offizielles Essen gegeben. Ich wünschte, ich hätte selber etwas arrangieren können. Aber sobald ihr die Eingeborenen ein bisschen genauer kennt, werdet ihr verstehen, dass es für den Burra Sahib einfacher ist als für mich. Ihnen ist er ja kein Fremder – sie wissen auch, dass er sich nichts vormachen lässt –, und ich selber bin noch nicht lange genug im Lande. Kein Mensch darf sich einbilden, dieses Land zu kennen, wenn er nicht mindestens zwanzig Jahre hier gelebt hat. Ach, da ist ja Mutter! Hier ist dein Mantel. Tja – nur ein Beispiel für die Art Irrtümer, die man sich hier leistet. Kurz nachdem ich herübergekommen war, lud ich mal einen indischen Verteidiger ein, eine Zigarette mit mir zu rauchen – bitte schön, eine einzige Zigarette. Später kam ich dahinter, dass im ganzen Basarviertel jeder seiner Unterlinge diese Tatsache an die große Glocke hatte hängen und allen Prozesslustigen hatte versichern müssen: ›Oh, kommt nur zu meinem Vakil Mahmoud Ali – er ist gut Freund mit dem Richter!‹ Seitdem habe ich ihn mir vor Gericht immer besonders scharf vorgeknöpft. Jedenfalls war das Ganze eine Lektion für mich, und für ihn hoffentlich auch.«
»Besteht aber die Lektion nicht darin, dass du alle indischen Verteidiger einladen solltest, eine Zigarette mit dir zu rauchen?«
»Vielleicht. Aber die Zeit ist leider beschränkt, und das Fleisch ist schwach. Mir ist es immer noch lieber, im Klub zusammen mit meinesgleichen zu rauchen.«
»Warum dann aber nicht die Verteidiger in den Klub einladen?«, fragte Miss Quested hartnäckig weiter.
»Nicht erlaubt.« Er war freundlich und geduldig und verstand offensichtlich auch, warum sie nicht verstand. Er ließ durchblicken, dass auch er einmal wie sie gedacht hatte, aber nicht sehr lange. Auf die Veranda hinaustretend, rief er mit fester Stimme etwas in Richtung des Mondes. Sein sais antwortete, und ohne den Kopf zu senken, gab er Anweisung, seinen Einspänner vorfahren zu lassen.
Mrs. Moore, die vom Klubbetrieb ein wenig benommen war, bekam im Freien gleich wieder einen klaren Kopf. Sie betrachtete den Mond, dessen Glanz das Purpurrot des umgebenden Himmels mit einem blässlichen Gelbgrün trübte. In England war der Mond ihr stets leblos und fremdartig vorgekommen. Hier war er mit der Erde und allen anderen Gestirnen zusammen in den Schal der Nacht eingehüllt. Ein plötzliches Gefühl für die Einheit alles Geschaffenen, der Verwandtschaft mit allen Himmelskörpern durchströmte die alte Frau wie Wasser einen künstlichen Teich, eine seltsame Frische hinter sich lassend. Sie hatte nichts gegen »Cousin Kate«, nichts gegen die Nationalhymne einzuwenden, aber der Nachhall von beidem war nun in einen neuen Klang eingegangen, so wie Cocktails und Zigarren in das nur für ihr inneres Auge sichtbare Bild von Blumen eingegangen waren. Als an der Straßenbiegung die Moschee aufschimmerte, lang gestreckt, kuppellos, rief sie aus: »O ja – bis hierher bin ich gekommen, hier bin ich gewesen.«
»Wann denn gewesen?«, fragte ihr Sohn.
»In der Zwischenpause.«
»Aber Mutter, so etwas darfst du dir einfach nicht leisten.«
»Das darf Mutter nicht?«
»Nein, wahrhaftig, nicht in diesem Land. Es gehört sich einfach nicht. Man hat sich beispielsweise vor den Schlangen in Acht zu nehmen. Am Abend kommen sie gewöhnlich aus ihren Schlupflöchern heraus.«
»Ach ja, das hat auch der junge Mann in der Moschee gesagt.«
»Das klingt ja ganz romantisch«, bemerkte Miss Quested, die, Mrs. Moore von Herzen zugetan, sich ehrlich darüber freute, dass ihr ein kleines Abenteuer vergönnt gewesen war. »Du triffst in der Moschee einen jungen Mann und erzählst mir dann nichts davon!«
»Ich war gerade drauf und dran, es dir zu erzählen, Adela, aber irgendwie bog die Unterhaltung dann in ein anderes Gleis ein, und ich vergaß es. Mein Gedächtnis wird immer unzuverlässiger.«
»War er nett?«
Mrs. Moore zögerte ein wenig, um dann mit vollem Nachdruck zu erklären: »Außerordentlich nett.«
»Wer war’s denn?«, forschte Ronny.
»Ein Arzt. Ich weiß nicht, wie er hieß.«
»Ein Arzt? Ich kenne in Tschandrapur keinen jungen Arzt. Wie merkwürdig! Wie sah er denn aus?«
»Er war ziemlich klein, hatte einen kleinen Schnurrbart und flinke Augen. Er rief mir etwas zu, als ich mich noch im dunklen Teil der Moschee befand – etwas, das sich auf meine Schuhe bezog. Auf diese Weise kamen wir ins Gespräch. Er bildete sich ein, dass ich welche anhätte. Aber glücklicherweise hatte ich dran gedacht, sie abzutun. Er erzählte mir von seinen Kindern, und dann hat er mich bis zum Klubeingang gebracht. Er kennt dich.«
»Ich wünschte, du hättest ihn mir gezeigt. Ich ahne nicht, wer es ist.«
»Er kam nicht mit in den Klub. Er sagte, er dürfe nicht mit hinein.«
Ronny ging endlich ein Licht auf. »Ach du lieber Himmel«, rief er, »das war doch nicht etwa ein Mohammedaner? Warum hast du mir nur um alles in der Welt nicht erzählt, dass du dich mit einem Eingeborenen unterhalten hast? Ich war völlig auf dem Holzweg.«
»Ein Mohammedaner! Das ist ja großartig«, rief Miss Quested aus. »Ronny, sieht das deiner Mutter nicht ganz ähnlich? Wir reden fortwährend davon, dass wir etwas vom wirklichen Indien sehen wollen, und sie geht hin und sieht es. Und dann vergisst sie, dass sie es gesehen hat!«
Aber Ronny fühlte sich beunruhigt. Nach den Worten seiner Mutter hatte er angenommen, dass der Arzt der junge Muggins vom anderen Ufer des Ganges war, und er hatte bereits alle kameradschaftlichen Gefühle gezückt. Was für eine Verwechslung! Warum hatte sie nicht wenigstens mit einem Nebenton in der Stimme angedeutet, dass sie von einem Inder sprach! Gereizt und ein wenig diktatorisch, begann er sie zu verhören: »Er rief dir in der Moschee etwas zu, wie? In welchem Ton? Unverschämt? Was hatte er zu so später Stunde dort zu suchen? Nein, es ist nicht die Stunde ihres Gebets.« Das Letztere war die Antwort auf eine Frage Miss Questeds, die sich ihrerseits ungemein interessiert zeigte. »Er hat dich also wegen deiner Schuhe zur Rede gestellt. Dann war es Unverschämtheit. Ein alter Kniff. Ich wünschte, du hättest sie anbehalten.«
»Ja, unverschämt war es schon, aber ein Kniff? Er war mit den Nerven so ziemlich am Ende – das konnte ich am Ton seiner Stimme erkennen. Sobald ich antwortete, benahm er sich völlig anders.«
»Du hättest ihm überhaupt nicht antworten sollen.«
»Na hör mal«, warf die logische junge Dame ein, »würdest du nicht zum Beispiel von einem Mohammedaner erwarten, dass er dir antwortete, wenn du ihn darum bätest, in der Kirche seinen Fez abzunehmen?«
»Das ist etwas anderes, etwas völlig anderes. Das kannst du nicht verstehen.«
»Nein, ich weiß, aber ich möchte es gern verstehen. Worin liegt denn, bitte, der Unterschied?«
Wenn sie sich doch nicht immer einmischen wollte! Was seine Mutter betraf, so war von ihr nicht allzu viel zu befürchten – sie war nichts als eine Touristin, Reisebegleiterin, die jederzeit wieder nach England zurückkehren durfte und von deren Eindrücken auch gar nicht viel abhing. Aber mit Adela, die ernstlich erwog, ihr weiteres Leben in diesem Land zu verbringen, verhielt es sich weitaus bedenklicher. Wie lästig, wenn sie von vornherein mit einer falschen Einstellung an die ganze Eingeborenenfrage heranginge! Die Stute zum Halten bringend, sagte er: »Da ist euer Ganges.«
Die Aufmerksamkeit der beiden Frauen war tatsächlich abgelenkt. Vor ihnen in der Tiefe war plötzlich ein seltsamer Schimmer sichtbar geworden, der weder mit dem Wasser noch mit dem Mondlicht zu tun hatte – er stand wie eine Leuchtgarbe auf dem Feld des Dunkels. Ronny erklärte, dass das die Stelle sei, an der die neue Sandbank sich bildete, dass das schwärzliche Gekräusel am oberen Ende der Sand sei, und dass in ihrer Nähe auch die Leichen aus Benares herabtrieben – oder vielmehr herabtreiben würden, wenn die Krokodile es zuließen. »Von einer Leiche ist nicht mehr viel übrig, wenn sie nach Tschandrapur gelangt.«
»Auch Krokodile im Fluss, wie schrecklich«, murmelte die Mutter. Die jungen Leute wechselten rasch einen Blick und lächelten. Es belustigte sie stets ein wenig, die alte Dame von solchen Anwandlungen leisen Schauders heimgesucht zu sehen, und damit war die Eintracht zwischen ihnen wiederhergestellt. »Was für ein schrecklicher Fluss«, fuhr Mrs. Moore fort. »Was für ein herrlicher Fluss!« Sie seufzte. Der Schimmer war bereits am Verblassen, vielleicht, weil mit Mond oder mit Sand eine Veränderung vor sich gegangen war. Bald war es wohl auch um die helle Garbe geschehen, und nichts anderes würde von ihr mehr verbleiben als ein winziger zitternder Lichtkreis, wie eingeglüht in die flutende Leere. Die Frauen überlegten, ob sie den Wechsel der Beleuchtung noch abwarten sollten oder nicht, während rings um sie her die Stille bereits in kleine Flackerlaute von Unruhe zerbröckelte und die Stute zu zittern begann. Um ihretwillen beschlossen sie, nicht länger zu warten. Sie fuhren gleich weiter bis zum Bungalow des Richters, wo Miss Quested schlafen ging und Mrs. Moore noch eine kurze Unterredung mit ihrem Sohn hatte.
Er wollte noch mehr von dem mohammedanischen Arzt wissen, den sie in der Moschee getroffen hatte. Es gehörte zu seinen Pflichten, verdächtige Individuen anzuzeigen, und möglicherweise war es irgendeiner der zweifelhaften hakim aus dem Basarviertel, der auf ein Opfer gelauert hatte. Als Mrs. Moore ihm berichtete, dass es jemand war, der im Minto-Hospital angestellt war, atmete er erleichtert auf und bemerkte, der Bursche müsse Aziz heißen, und er sei einwandfrei, völlig einwandfrei.
»Aziz – was für ein reizender Name!«
»Ihr beide kamt also ins Gespräch. Hattest du den Eindruck, dass er freundlich gesonnen war?«
Ohne die Bedeutung dieser Frage zu ermessen, antwortete sie:
»O ja, das schon, zumindest nach einer kleinen Weile.«
»Ich meine, ganz allgemein. Schien er uns gelten zu lassen – die brutalen Eroberer, die blutlosen Bürokraten – und wie man uns so nennt?«
»O ja, ich glaube schon – bloß die Callendars nicht. Für die Callendars hat er nicht das Geringste übrig.«
»Oh. Das hat er dir ohne alle Umschweife gesagt, wie? Das wird den Major interessieren. Ich überlege nur, worauf er mit seiner Bemerkung hinauswollte.«
»Ronny, Ronny, das wirst du doch Major Callendar um Himmels willen nicht weiterberichten?«
»O doch. Ich muss es sogar.«
»Aber lieber Junge –.«
»Wenn der Major erführe, dass ein mir unterstellter Inder schlecht von mir spricht, würde er es mir auch gleich wiedererzählen.«
»Aber lieber Junge – eine Privatunterhaltung!«
»Nichts ist in Indien privat. Das wusste Aziz genau, als er so offen sprach. Mach dir also keine Gedanken. Er muss für seine Äußerung irgendein bestimmtes Motiv gehabt haben. Ich bin sogar überzeugt, dass die Bemerkung nicht ehrlich gemeint war.«
»Wieso denn nicht ehrlich gemeint?«
»Er putzte den Major nur herunter, um Eindruck auf dich zu machen.«
»Lieber – ich weiß wirklich nicht, wie du das meinst.«