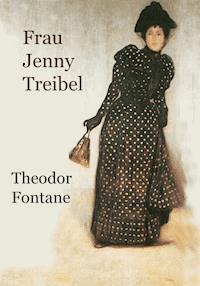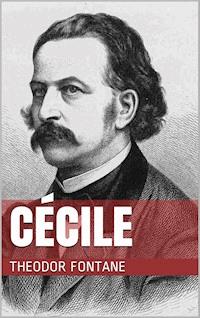12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fontanes »Short Stories« als Gegengift für den gestressten Menschen von heute
»Der moderne Mensch, angestrengter wie er wird, bedarf auch größerer Erholung. Findet er sie?« Mit dieser verblüffenden Frage schlägt Fontane 1873 neue erzählerische Wege ein. Entstanden sind kluge, vergnügliche Geschichten, die er selbst als »Short Stories« bezeichnete. Die schönsten sind hier versammelt und laden dazu ein, aus dem alltäglichen Wahnsinn herauszutreten und sich auf die Suche nach dem Glück zu machen.
Die brillanten Beobachtungen eines wachen Zeitzeugen, der sein bis heute gültiges Plädoyer zum Besten gibt.
»Man soll den Augenblick ergreifen. Ist es der rechte, so bedeutet es das Glück.«Theodor Fontane
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Fontanes »Short Stories« als Gegengift für den gestressten Menschen von heute
»Der moderne Mensch, angestrengter wie er wird, bedarf auch größerer Erholung. Findet er sie?« Mit dieser verblüffenden Frage schlägt Fontane 1873 neue erzählerische Wege ein. Entstanden sind kluge, vergnügliche Geschichten, die er selbst als »Short Stories« bezeichnete. Die schönsten sind hier versammelt und laden dazu ein, aus dem alltäglichen Wahnsinn herauszutreten und sich auf die Suche nach dem Glück zu machen.
Die brillanten Beobachtungen eines wachen Zeitzeugen, der sein bis heute gültiges Plädoyer zum Besten gibt.
»Man soll den Augenblick ergreifen. Ist es der rechte, so bedeutet es das Glück.« Theodor Fontane
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Theodor Fontane
Auf der Suche
Short Stories
Herausgegeben von Iwan-Michelangelo D’Aprile
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Auf der Suche
Eine Frau in meinen Jahren
Im Coupé
Onkel Dodo
Der letzte Laborant
Gerettet!
Anhang
Nachwort
Text- und Bildnachweis
Impressum
Auf der Suche
Eduard Hildebrandt: Sonnenuntergang in Siam, 1863
Ich soll Ihnen etwas schreiben, wenn es auch nur eine »Wanderung« wäre. Nun so sei’s denn; und wenn nicht eine Wanderung durch die Mark, was zu weitschichtig werden könnte, so doch wenigstens eine Wanderung durch Berlin W. Aber wohin? Ich war tagelang auf der Suche nach etwas Gutem und wollt’ es schon aufgeben, als mir der Gedanke kam, mein Auge auf das Exterritoriale zu richten, auf das Nicht-Berlin in Berlin, auf die fremden Inseln im heimischen Häusermeer, auf die Gesandtschaften. Das Neue darin erfüllte mich momentan mit Begeisterung und riss mich zu dem undankbaren Zitate hin, undankbar gegen unsere gute Stadt: »Da, wo du nicht bist, ist das Glück.«
Also Gesandtschaften! Herrlich. Aber wie sollte sich das alles in Szene setzen? Wollt ich interviewen? Ein Gedanke, nicht auszudenken. Und so stand ich denn in der Geburtsstunde meiner Begeisterung auch schon wieder vor einer Ernüchterung, der ich unterlegen wäre, wenn ich mich nicht rechtzeitig einer mehr als 30 Jahre zurückliegenden Ausstellung erinnert hätte, die der damals von seiner Weltreise zurückkehrende Eduard Hildebrandt vor dem Berliner Publikum zu veranstalten Gelegenheit nahm. Wie wenn es gestern gewesen wäre, steht noch der Siam-Elefant mit der blutrot neben ihm untergehenden Sonne vor mir; was mir aber in der Reihe jener damals ausgestellten Aquarelle mindestens ebenso schön oder vielleicht noch schöner vorkam, waren einige farbenblasse, halb hingehauchte Bildchen, lang gestreckte Inselprofile, die, mit ihrem phantastischen Felsengezack in umschleierter Morgenbeleuchtung, vom Bord des Schiffes her aufgenommen worden waren. Nur vorübergefahren war der Künstler an diesen Inseln, ohne den Boden derselben auch nur einen Augenblick zu berühren, und doch hatten wir das Wesentliche von der Sache, die Gesamtphysiognomie. Das sollte mir Beispiel, Vorbild sein, und in ganz ähnlicher Weise wie Hildebrandt an den Seychellen und Komoren wollt’ ich an den Gesandtschaften vorüberfahren und ihr Wesentliches aus ehrfurchtsvoller und bequemer Entfernung studieren.
Aber mit welcher sollt’ ich beginnen? Ich ließ die Gesamtheit der Gesandtschaften Revue passieren, und da mir als gutem Deutschen der Zug innewohnt, alles, was weither ist, zu bevorzugen, entschied ich mich natürlich für China, Heydt-Straße 17. China lag mir auch am bequemsten, an meiner täglichen Spaziergangslinie, die, mit der Potsdamer Straße beginnend, am jenseitigen Kanalufer entlangläuft und dann unter Überschreitung einer der vielen kleinen Kanalbrücken von größerem oder geringerem (meist geringerem) Rialtocharakter am Tiergarten hin ihren Rücklauf nimmt, bis der Zirkel an der Ausgangsstelle sich wieder schließt.
Eine Regenwolke stand am Himmel; aber nichts schöner als kurze Aprilschauer, von denen es heißt, dass sie das »Wachstum« fördern; und so schritt ich denn »am leichten Stabe«, nur leider um einiges älter als Ibykus, auf die Potsdamer Brücke zu, deren merkwürdige Kurvengeleise, darauf sich die Pferdebahnwagen in fast ununterbrochener Reihe heranschlängeln, immer wieder mein Interesse zu wecken wissen. Und so stand ich auch heute wieder an das linksseitige Geländer gelehnt, einen rotgestrichenen Flachkahn unter mir, über dessen Bestimmung eine dicht neben mir angebrachte Brückentafel erwünschte Auskunft gab: »Dieser Rettungskahn ist dem Schutze des Publikums anempfohlen.« Ein zu schützender Retter; mehr bescheiden als vertrauenerweckend.
Von meinem erhöhten Brückenstand aus war ich aber nicht bloß in der Lage, den Rettungskahn unter mir, sondern auch das schon jenseits der Eisenschienen gelegene Dreieck überblicken zu können, das, zunächst nur als Umspann- und Rasteplatz für Omnibusse bestimmt, außerdem noch durch zwei jener eigenartigen und modernster Zeit entstammende Holzarchitekturen ausgezeichnet ist, denen man in den belebtesten Stadtteilen Berlins trotz einer gewissen Gegensätzlichkeit ihrer Aufgaben so oft nebeneinander begegnet. Der ausgebildete Kunst- und Geschmackssinn des Spree-Atheners, vielleicht auch seine Stellung zu Literatur und Presse, nimmt an dieser provozierenden Gegensätzlichkeit so wenig Anstoß, dass er sich derselben eher erfreut als schämt; und während ihm ein letztes dienstliches Verhältnis der kleineren Bude zur größeren außer allem Zweifel ist, erkennt er in dieser größeren, mit ihren schräg aufstehenden Schmal- und Oberfenstern zugleich eine kurzgefasste Kritik all der mehr dem Idealen zugewandten Aufgaben der Schwesterbude.
Dieser Letzteren näherte ich mich jetzt, und zwar in der bestimmten Absicht (es war gerade Erscheinungstag der neuen Nummer), ein Exemplar der »Freien Bühne« zu erstehen, der »Freien Bühne«, deren grünen Umschlag einschließlich seiner merkwürdigen Titelbuchstaben im Stile von »Neue Lieder, gedruckt in diesem Jahr« ich schon von fernher erkannt hatte. Wissend, dass dieser Aufsatz bestimmt sei, in einem der nächsten Hefte besagter Wochenschrift zu erscheinen, hielt ich es für eine Anstandspflicht, durch Selbstbesteuerung meine staatliche Zugehörigkeit auszudrücken, und richtete deshalb, als ich nahe genug heran war, um bequem auf den grünen Umschlag hindeuten zu können, an die dame de comptoir die herkömmlich Frage: »Wie viel?« »Vierzig Pfennig.« »Und wird viel gekauft?« »Ja«, sagte sie freundlich und zugleich verschmitzt genug, um mir ihre Mitverschworenschaft außer Zweifel zu stellen.
Das Heft vorsichtig unter den Rock knöpfend, war ich inzwischen bis an den Anfang jener Straßenlinie vorgedrungen, die sich unter verschiedenen Namen bis zu dem Zoologischen Garten hinaufwindet, die ganze Linie eine Art Deutz, mit Köln am anderen Ufer, dessen Dom denn auch von der Matthäikirchstraße her herrlich herübersah und die Situation beherrschte. Nun kam »Blumes Hof« und gleich danach die Genthiner Straße mit ihrem Freiblick auf den Magdeburger Platz; und abermals eine Minute später stand ich vor Lützowufer 6–8, oder was dasselbe sagen will, vor dem drei Häuserfronten in Anspruch nehmenden »Statistischen Amt« – einem ganz eigenartigen Bau, der sich nur zu sehr mit den grundlegenden Prinzipien der Baukunst, wonach Großes und Kleines, und wenn es die Statistik wäre, seiner speziellen Bestimmung gemäß gestaltet werden muss, zu decken scheint.
Und nun war der Brückensteg da, der mich nach China hinüberführen sollte. So schmal ist die Grenze, die zwei Welten voneinander scheidet. Eine halbe Minute noch, und ich war drüben.
Kieswege liefen um einen eingefriedeten lawn, den an dem einen Eck ein paar mächtige Baumkronen überwölbten. Da nahm ich meinen Stand und sah nun auf China hin, das chinesisch genug dalag. Was da vorüberflutete, gelb und schwer und einen exotischen Torfkahn auf seinem Rücken, ja, war das nicht der Yang-tse-kiang oder wenigstens einer seiner Arme, seiner Zuflüsse? Am echtesten aber erschien mir das gelbe Gewässer da, wo die Weiden sich überbeugten und ihr Gezweig eintauchten in die heilige Flut. Merkwürdig, es war eine fremdländische Luft um das Ganze her, selbst die Sonne, die durch das Regengewölk durchwollte, blinzelte chinesisch und war keine richtige märkische Sonne mehr. Alles versprach einen überreichen Ertrag, ein Glaube, der sich auch im Näherkommen nicht minderte; denn an einer frei gelegten Stelle, will sagen da, wo die Maschen eines zierlichen Drahtgitters die chinesische Mauer durchbrachen, sah ich auf einen Vorgarten, darin ein Tulpenbaum in tausend Blüten stand und ein breites Platanendach darüber. Alle so echt wie nur möglich, und so war es denn natürlich, dass ich jeden Augenblick erwartete, den unvermeidlichen chinesischen Pfau von einer Stange her kreischen zu hören.
Aber er kreischte nicht, trat überhaupt nicht in Erscheinung, und als mein Hoffen und Harren eine kleine Viertelstunde lang ergebnislos verlaufen war, entschloss ich mich, ein langsames Umkreisen des chinesischen Gesamt-Areals eintreten zu lassen. Ich rückte denn auch von Fenster zu Fenster vor, aber wiewohl ich, laut Wohnungsanzeiger, sehr wohl wusste, dass, höherer Würdenträger zu geschweigen, sieben Attachés ihr Heimstätte hier hatten, so wollte doch nichts sichtbar werden, eine Tatsache, die mir übrigens nur das Gefühl einer Enttäuschung, nicht aber das einer Missbilligung wachrief. Im Gegenteil. »Ein Innenvolk«, sagte ich mir, »feine, selbstbewusste Leute, die jede Schaustellung verschmähn. All die kleinen Künste, daran wir kranken, sind ihnen fremd geworden, und in mehr als einer Hinsicht ein Ideal repräsentierend, veranschaulichen sie höchste Kultur mit höchster Natürlichkeit.« Und in einem mir angebornen Generalisierungshange das Thema weiter ausspinnend, gestaltete sich mir der an Fenster und Balkon ausbleibende Chinese zur Epopöe, zum Hymnus auf das Himmlische Reich.
Schließlich, nachdem ich noch einigermaßen mühevoll, weil durch den Flur des Hauses hin, einen in einer Hofnische stehenden antiken Flötenspieler entdeckt hatte, war ich um die ganze Halbinsel herum und stand wieder vor dem Gitterstück mit dem Tulpenbaum dahinter. Aber die Szene hatte sich mittlerweile sehr geändert; und während mehr nach rechts hin, in Front der massiven Umfassungsmauer, vier Jungen Murmel spielten, sprangen mehr nach links hin, vor einem ähnlichen Mauerstück, mehrere Mädchen über die Korde. Die älteste mochte elf Jahre sein. Jede Spur von Mandel- oder auch nur Schlitzäugigkeit war ausgeschlossen, und das mutmaßlich mit Wasser und einem ausgezahnten Kamm behandelte Haar fiel, in allen Farben schillernd, über eine fusslige Pellerine, der Teint war griesig und die grauen Augen vorstehend und überäugig; so hupste sie, gelangweilt, weil schon von Vorahnungen kommender Herrlichkeiten erfüllt, über die Korde, der Typus eines Berliner Kellerwurms.
Ich sah dem zu. Nach einigen Minuten aber ließen die Jungens von ihrem Murmelspiel und die Mädchen von ihrem über die Kordespringen ab und gaben mir, auseinanderstiebend, erwünschte und bequeme Gelegenheit, die blau und roten Inschriften zu mustern, die gerade da, wo sie gespielt hatten, die chinesische Mauer reichlich bedeckten. Gleich das Erste, was ich las, war durchaus dazu angetan, mich einer reichen Ausbeute zu versichern. Es war das Wort »Schautau«. Wenn »Schautau« nicht chinesisch war, so war es doch mindestens chinesiert, vielleicht ein bekannter Berolinismus, in eine höhere fremdländische Form gehoben. Aber all meine Hoffnungen, an dieser Stelle Sprachwissenschaftliches oder wohl gar Geschichte von den Steinen herunterlesen zu können, zerrannen rasch, als ich die nebenstehenden Inschriften überflog. »Emmy ist sehr, sehr nett« stand da zunächst mit Kinderhandschrift über drei Längssteine hingeschrieben, und es war mir klar, dass eine schwärmerische Freundin Emmys (welche Letztere wohl kaum eine andere als die mit der Pellerine sein konnte) diese Liebeserklärung gemacht haben müsse. Parteiungen hatten aber auch dies Idyll an der Mauer schon entweiht, denn dicht daneben stand: »Emmy ist ein Schaf«, welche kränkende Bezeichnung sogar zweimal unterstrichen war. Auf welcher Seite die tiefere Menschenkenntnis war, wer will es sagen? Hass irrt, aber Liebe auch.
Ich hing dem allem noch nach, mehr und mehr von der Erfolglosigkeit meiner Suche, zugleich auch von der Notwendigkeit eines Rückzuges durchdrungen. Ich trat ihn an, nachdem ich zuvor noch einen Blick nach dem gegenübergelegenen Hause, Heydt-Straße 1, emporgesandt hatte. Hier nämlich wohnt Paul Lindau, der, als er vor kaum einem Jahrzehnt in diese seine Chinagegenüberwohnung einzog, wohl schwerlich ahnte, dass er, ach, wie bald, von einem Landsmann (auch Johannes Schlaf ist ein Magdeburger) in den Spalten dieser Zeitschrift als Stagnant und zurückgebliebener Chinesling erklärt werden würde.
Was nicht alles vorkommt!
Und wieder eine Viertelstunde später, so lag auch die heuer schon im April zur Maienlaube gewordene Bellevuestraße hinter mir, und scharf rechts biegend, trat ich bei Josty ein, um mich, nach all den Anstrengungen meine Suche, durch eine Tasse Kaffee zu kräftigen. Es war ziemlich voll unter dem Glaspavillon oben, und siehe da, neben mir, in hellblauer Seide, saßen zwei Chinesen, ihre Zöpfe beinah kokett über die Stuhllehne niederhängend. Der jüngere, der erraten mochte, von welchen chinesischen Attentaten ich herkam, sah mich schelmisch freundlich an, so schelmisch freundlich, wie nur Chinesen einen ansehen können, der ältere aber war in seine Lektüre vertieft, nicht in Konfutse, wohl aber in die Kölnische Zeitung. Und als nun die Tasse kam und ich das anderthalb Stunden lang vergeblich gesuchte Himmlische Reich so bequem und so mühelos neben mir hatte, dacht’ ich Platens und meiner Lieblingsstrophe:
Wohl kommt Erhörung oft geschritten
Mit ihrer himmlischen Gewalt,
Doch dann erst hört sie unsre Bitten,
Wenn unsre Bitten lang verhallt.