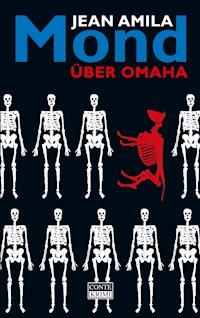Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Felix kommt nach Paris, um den Tod seiner Frau zu rächen. Die Verantwortlichen sitzen in einer Versicherung. Er gewinnt Riton Godots Unterstützung. Der Nachfolger des »Comte« denkt dabei an seine eigenen Interessen. Doch alle Fäden laufen bei Angèle Maine zusammen. Die Witwe des »Comte« (der in »Die Abreibung« ums Leben kam) wird zum Dreh- und Angelpunkt der Pariser Unter- und Halbwelt. Sie übernimmt die Führung – dabei wartet sie noch nicht mal auf Godot! »Sans attendre Godot« ist das einzige »Serial« unter Jean Amilas Krimis. Ein Teil des Personals aus »Die Abreibung«begegnet uns im Kampf zwischen bürgerlicher und Unterwelt wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I
»Ja!«, sagte Riton Godot nach einem längeren Schweigen. »Ich frag mich, ob –«
Er ließ den Satz unvollendet. In der typischen Manier des starken Mannes, dem es darauf ankommt, seine Männer hinter sich zu wissen. Gewöhnlich fand sich immer einer im Personal, der sich einen Ruck gab und versuchte, die Gedanken des Chefs in Worte zu fassen.
Doch weder Fred noch Jo machten Anstalten, sich bei ihrem Chef auf so plumpe Weise einzuschmeicheln. Waren sie nun Angestellte oder freie Mitarbeiter? Schwer zu sagen.
Jedenfalls genossen sie andächtig ihren eisgekühlten Pastis und lockerten den Kragen ihrer kurzärmeligen Hemden, damit die frische Luft des Ventilators sachte um ihre Brustbehaarung streichen konnte.
Es war ein drückend heißer Julitag in Paris.
Riton Godot seufzte. Er schwitzte. Sein Büro war zwar klimatisiert, doch sommers wie winters – er schwitzte immer. Ein kleines Gebrechen, mit dem er sich längst abgefunden hatte: Solange er schwitzte, lebte er.
»Was meint ihr, Jungs?«, fragte er. »Glaubt ihr an die Möglichkeit einer Schlichtung?«
Jetzt stand die Frage klar im Raum, jetzt mussten sie antworten. Fred, der kleine Sonnenverbrannte mit dem schmalen Schnurrbart, nahm einen Schluck des völlig trüben Getränks.
»Sie wissen ja«, sagte er, »Schlichtungen sind nicht gerade unsere Spezialität!«
»Stimmt!«, pflichtete Jo bei und schüttelte den Kopf; das kleine Gesicht des blonden jungen Mannes war so rot, dass er eigentlich nur aus dem Urlaub kommen konnte.
Man hatte sie wegen einer ›dringenden Angelegenheit‹ aus Juan-les-Pins zurückgerufen, wo sie es sich so richtig hatten gut gehen lassen: angesichts ihrer Vorgeschichte sicher nicht, um Verhandlungen zu führen!
Im Übrigen interessierten Godot ihre Kommentare nicht die Bohne. Er hatte nur der Form halber gefragt.
»Also ich«, sagte er, »glaub da nicht dran! Und deshalb seid ihr da, Jungs!«
Die drei befanden sich in einem halbdunklen Zimmer; das Fenster stand offen, die Jalousien waren heruntergelassen. Es roch nach englischen Zigaretten und Nelken. Der Verkehrslärm der Place Pigalle drang zu ihnen herauf; das hektische Anfahren der Autos, wenn die Ampel auf Grün sprang. Sie wussten, dass da draußen die Sonne nur so niederknallte und es ein Normalsterblicher auf der flirrend heißen Straße kaum aushalten konnte; in gewisser Weise war das ein tröstlicher Gedanke.
Riton Godot war in Hemdsärmeln. Breitbeinig stand er da; es sah so aus, als begutachte er seine Philodendren am Fenster. Er war ein korpulenter Südfranzose in den Fünfzigern, der sich durch Leibesübungen und viel Schwimmen fit hielt. Ein stämmiger Mann voll Kraft und Witz.
»Was mir da so vorschwebt, Jungs, das ist eine kleine Warnung ohne größeres Blutvergießen. Versteht ihr, worauf ich hinauswill? Ein harmloser kleiner Denkanstoß. Nichts weiter.«
»Schwierige Sache!«, sagte Fred.
Er wirkte nicht gerade begeistert, ja sogar ein wenig beleidigt.
»Die kennen uns! Wenn wir bei denen aufkreuzen, dann werden die kaum glauben, dass wir mit Niespulver, Chinaböllern und schmelzenden Löffeln vorbeikommen!«
»Aber, aber«, sagte Riton. »Wenns mir nur um Scherzartikel ginge, Jungs, dann hätt ich euch nicht hierher bemüht. Wenn ich nämlich Warnung sag, dann hab ich absolut nichts gegen eine kleine Maschinengewehrsalve. Wenn ihr zum Beispiel auf den Typ in seinem Auto ein paar Kugeln abfeuert, nur damit er sich so richtig ärgert, das wär erste Sahne!«
»Wenn er vorsichtig ist«, gab Fred zu bedenken, »dann wird er kaum allein unterwegs sein!«
»Wenn die Sache so einfach wäre«, sagte Godot, »dann hätte ich nicht extra zwei Meister hinzugeholt!«
Da kann man sagen, was man will, es macht doch immer wieder Freude. Auch der eisgekühlte Pastis verfehlte seine Wirkung nicht, und so fühlten sich Fred und Jo wie zwei Ritter, die zu einem Kreuzzug aufbrechen. In gewissem Sinne ging es ja auch um nicht viel weniger als um die Bestrafung eines Ungläubigen!
»Wie sieht denn die Schlichtung dieses Jahr aus?«, spöttelte Jo.
Riton sah ihn nicht im mindesten verärgert an.
»Mein Lieber, das eine schließt das andre nicht aus. Wenn man mit einem Starrkopf verhandeln will, dann versucht man zuerst, ihn weichzuklopfen. Ihr sollt ihn mir nicht zu Pastete verarbeiten, sondern bloß etwas einsichtiger machen. Eine kleine Gewehrsalve eben, die gekonnt danebengeht. Ich bin schließlich kein Sanguiniker!«
»Das lässt sich einrichten«, sagte Fred. »Wir bräuchten nur noch ein paar Hintergrundinformationen.«
»Ab jetzt werdet ihr auf zehn Sekunden genau über die Bewegungen unsres Mannes auf dem Laufenden gehalten. Ich hab schon jemand auf ihn angesetzt.«
Die beiden waren einverstanden. Alles schien bestens geplant.
»Sobald das erledigt ist«, sagte Riton, »könnt ihr ohne Zwischenstopp wieder ab nach Juan. Ich mach euch eure Überweisung dorthin, zu Don Camillo. Passt das?«
»Wir kennen uns schon lange, Herr Godot«, sagte Fred. »Ich denk, das passt.«
»Geht klar!«, sagte Jo.
Riton baute sich lächelnd vor ihnen auf.
»Ich lass euch soweit freie Hand, Jungs. Nur eine Sache: Die Warnung muss dem Empfänger bis morgen früh persönlich überbracht werden!«
Der Ventilator surrte, schwenkte leicht von links nach rechts. Fred und Jo saßen bequem in ihren tiefen Sesseln und widmeten sich wieder behaglich ihrem Pastis. Vor heute Abend brauchten sie nicht mit der Arbeit zu beginnen – das Leben war schön!
Wie ein grober Störenfried ohne Manieren ging plötzlich der Summer los. Riton nahm den Apparat, auf seiner Stirn bildete sich eine jähe Unmutsfalte.
»Ich hab doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will, verdammt noch mal!«
»Aber ja«, sagte die ruhige Stimme Ghislaines, »ich wollte Ihnen nur sagen, dass Frau Maine da ist!«
»Sagen Sie ihr, sie soll sich noch ein wenig gedulden!«
»Sie glauben doch wohl nicht, dass die auf mich hört!«, sagte Ghislaine leicht empört. »Sie ist schon im Treppenhaus!«
Riton Godot lief leicht rot an, doch war er intelligent genug, um sich nicht zu unnötigen Wutausbrüchen hinreißen zu lassen. Er hatte Maine gewollt, und er hatte sie bekommen: Jetzt war es zu spät für etwaige Bedenken.
»Ist gut!«, sagte er und legte auf.
Er drehte sich zu den beiden um.
»Meine Frau!«
Er wusste nicht, ob er stolz oder wütend sein sollte. Maine nahm sich zwar so einiges heraus; doch sie war zu sehr Dame von Welt, als dass man sie wie eine Normalsterbliche hätte behandeln und ihr starre Regeln hätte aufzwingen können. Man musste sie so nehmen, wie sie war; und dafür bekam man ja auch einiges geboten!
Er ließ es drei Mal schrill läuten, dann ging er äußerlich ruhig die Tür öffnen.
Fred und Jo hatten die Füße zum Sessel herangezogen, bereit, wie Gentlemen aufzuspringen, wenn die Dame das Zimmer betreten würde.
Maine trug ein schwarzgetüpfeltes gelbes Kleid, das ihre braungebrannten, drallen Arme frei ließ. Auf dem Kopf saß ein kleiner Glockenhut aus Stroh. Sie sah blendend aus, vielleicht ein klein wenig zu rundlich. Ihre reife, strahlende Gestalt zog unweigerlich die Blicke auf sich.
Fred und Jo waren aufgestanden und hatten die Gläser abgestellt. Maine hatte gerade ihre milde Phase und gab ihnen in leicht angeregter Stimmung ein Zeichen mit der Hand. Ritons Artilleristen kannte sie nur vage; sie war mit den Gedanken ganz woanders:
»Hier drinnen ist es angenehmer als draußen! Ich hoffe, ich stör euch nicht?«
»Wir waren grade fertig, Frau, äh –«
Fred wusste nicht so recht, welche Anrede die richtige war. Sollte man sie mit Frau Maine oder mit Frau Godot ansprechen? – Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte sie jeder die Gräfin genannt. Ihre Zeit als Witwe war kurz gewesen.
Eine verdammt schöne Frau! – ›Mann, wie alt ist die wohl?‹, fragten sich die beiden Männer. ›Fünfunddreißig? Vierzig?‹ – Und dabei sah sie wie fünfundzwanzig aus! Das Alter hatte bei ihr kaum Spuren hinterlassen. Sie brauchte einem nur in das Blickfeld zu kommen, da hatte man schon Lust, ihr auf der Stelle die Kleider vom Leib zu reißen; und dabei – aber das machte das Ganze noch schlimmer – war es, wie jeder wusste, absolut angebracht, ihr den größtmöglichen Respekt zu zollen.
»Ich arbeite gerade mit diesen Herren«, sagte Riton mit einem tadelnden Unterton. »Gibts ein Problem?«
»Absolut nicht! Ich bin auf dem Weg zum Gare du Nord hier vorbeigekommen.«
Als Riton Gare du Nord hörte, zog er die Stirn in Falten, so angestrengt musste er nachdenken. Schließlich schien es klick zu machen; er brach allerdings nicht gerade in Freudenstürme aus.
»Ah ja? Wann musst du am Bahnhof sein?«
»Ich hab noch eine halbe Stunde. Kommst du mit?«
»Also –«
Riton schien alles andere als begeistert. Er zeigte auf Fred und Jo.
»Wir haben da noch eine Kleinigkeit zu besprechen –«
»Du musst ja nicht!«, erwiderte Maine gleichgültig.
Sie nahm ihren Strohhut ab, schüttelte ihr blondiertes Haar, holte sich ein Glas aus der rollenden Minibar und schenkte sich von dem eisgekühlten Wasser ein. Sie trank in kleinen Schlucken, lange, ohne ein Wort zu sagen.
»Godot, mein Lieber, wie du wieder schwitzt!«, bemerkte sie schließlich, ohne kränkend sein zu wollen.
»Ach!«, sagte er gereizt. »Ich arbeite eben! Hättest du dir nicht am Bahnhof einen Fruchtsaft bestellen können, anstatt hier die Dame von Welt zu spielen?«
»Ach, wie freundlich er ist!«, sagte sie. »Ich weiß doch, was ich an ihm habe: Einen richtigen Kavalier der alten Schule: Zuvorkommend! Höflich! Nicht nötig, ihn zu fragen, was los ist, er setzt einen immer gleich ins Bild!«
»Was geht dich das eigentlich an!«, sagte Godot.
Er nahm nun seinerseits einen Schluck Pastis und beruhigte sich.
»Es gibt Ärger mit der Paconibande. Ich hatte ihnen zwei Frauen an der Bar zugestanden. Gestern Abend waren es zehn! – Wie im Puff! Und dazu noch nicht mal besonders schöne! Die kamen direkt von der Goutte d›Or da oben! Die haben mir sogar die Kundschaft vom Land verschreckt! – Da ist mirs zu bunt geworden und ich hab sie alle vor die Tür gesetzt!«
»Gut gemacht!«, sagte Maine. »Am besten sind sowieso eigene Animierdamen mit Sozialversicherung und allem drum und dran. Das ist anständiger!«
»Ich hab gleich den beiden da telegraphiert«, sagte Godot und wies auf Fred und Jo. »Gestern Abend haben wir dank Inspektor Léger, der ganz dick mit Ghislaine befreundet ist und im Gastraum saß, der Sache ein Ende gemacht. – Die Korsen waren zwar mit der ganzen Mannschaft angerückt, haben sich aber verzogen, als sie ihn in einer Ecke sitzen sahen.«
»Weiß er Bescheid?«
»Ach was! Aber ich kann nicht jeden Abend den Inspektor herbestellen! Ich hab Paconi einen ausgegeben und von einem Missverständnis gesprochen. – Doch Paco ist nicht dumm; er hat kapiert, dass er in dieser Gegend nichts mehr zu melden hat! Er hat mir gesagt, dass wir uns noch sprechen würden! – Begreifst du jetzt, was Sache ist?«
»Wie altmodisch!«, sagte Maine. »Methoden wie vor fünfzehn Jahren! Das ist ja zum Gotterbarmen!«
»Wenn du ne Ladung Kugeln in den Hintern bekommst, dann findest du das nicht mehr altmodisch! Ich bin einfach zu gutmütig! Dir sollte man mal ab und zu eine Tracht Prügel verabreichen wie den andern!«
Jo, der ein feines Gespür für so etwas hatte, merkte, dass Maine innerlich kochte. Er wollte die Situation entschärfen.
»Sie fahren also mit dem Zug weg?«
Die schöne Maine lächelte.
»Nein. Ich hol meine Tochter vom Bahnhof ab.«
»Wie rührend!«, sagte Godot. »Bis Madame hier ihren Arsch rausbewegt, werden wir uns ein ruhiges Eckchen zum Weiterarbeiten suchen – wir sind ja wohlerzogen. Im Keller, in der Toilette oder auf der Dachrinne! Was meint ihr, Jungs?«
Maine zuckte mit den Schultern.
»Godot, du bist ein Flegel! Als obs bei eurer Sache da auf fünf Minuten ankäme. Ich bin nun mal so, Godot, ich lass mich nicht gern in den Treppenverschlag abschieben. Aber ich hab mich ganz sicher noch nie jemandem aufgedrängt. Du willst mich nicht sehen? Also tschüs!«
Sie setzte wütend ihren Strohhut auf und ging zur Tür.
»Also, das gibts doch nicht!«, sagte Riton. »Zuerst bringt sie mich auf hundertachtzig, und am Ende geht sie beleidigt davon! Jetzt warte doch!«
Er wollte sie aufhalten, doch sie wich ihm aus und schlug die Tür zu.
»Das wars dann!«, stöhnte Godot. »Das ist keine Frau, sondern ein Naturereignis!«
Sein Fuß zuckte. Es war ihm anzusehen, wie gerne er jetzt ein paar Stufen hinuntergerannt wäre und ihr einen Arschtritt verpasst hätte. Doch Maine war nun einmal Maine; seine Meinung konnte man ihr zwar sagen, doch handgreiflich werden – undenkbar.
Fred und Jo enthielten sich geflissentlich jeglichen Kommentars und begannen wieder genüsslich an ihrem eisgekühlten Pastis zu nippen. In dem Moment begann das Telefon zu klingeln. Im Gegensatz zum Summer des internen Telefonnetzes schrillte es ohne Erbarmen.
Riton nahm wütend den Apparat.
»Ja, bitte?«
»Godot?«
Es war eine tiefe Männerstimme, die sehr kalt und fest klang. Riton erkannte sie sofort, und seine Gesichtzüge erstarrten. Um Zeit zu gewinnen, fragte er:
»Wer ist am Apparat?«
Der andere musste ihn ebenfalls erkannt haben.
»Godot«, sagte er, »das hättest du nicht machen sollen!«
»Was hab ich denn gemacht?«
»Du bist zu weit gegangen, Godot! Ich hab deinen Wachmann geschnappt und hatte mit ihm eben ein überaus interessantes Gespräch.«
Riton ballte die Faust. Dieser Trottel von Annibal hatte sich erwischen lassen.
»Versteh ich nicht!«, sagte er.
»Riton«, sagte die Stimme, »stell dich nicht blöder, als du bist! Es war ein Fehler von dir, so einen Idioten auf mich anzusetzen; doch es war ein noch größerer Fehler, deine hauseignen Killer zurückzuholen!«
Riton Godot war rot angelaufen, doch das war bei ihm weniger ein Zeichen von Angst oder Wut als die reflexartige Reaktion auf eine Gefahr; genau wie der Adrenalinstoß, der einen Tiger die Ohren anlegen und die Krallen ausfahren lässt. Seine Pupillen hatten sich verengt und seine Atmung ging flach. Er warf einen kurzen Blick hinter sich und versicherte sich, dass seine Männer da waren. Auf ein Zeichen kamen sie zu ihm her.
»Na sag mal!«, fing er betont gutmütig an. »Was erzählst du mir denn da für Geschichten, Paconi? Warst du grad im Kino?«
Die ausführliche Antwort, die Paconi gab, schien keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, wie genau er im Bilde war. Riton hörte ihm nur halb zu. Er hielt den Hörer mit seiner dicken Hand zu und, während er blitzschnell nachdachte, gab er mit zugekniffenen Augen seine Anweisungen.
»Fred! Geh runter in die Bar und schau dir mal die Gäste genauer an. Achte auf –«
Er verstummte auf einmal, war ganz Ohr. Was Paconi da am anderen Ende der Leitung sagte, schien plötzlich äußerst interessant zu sein. Eine Weile hörte er angespannt zu. Dann öffnete er den Mund, als wolle er antworten, besann sich aber und legte, ohne ein Wort zu sagen, einfach auf.
»Runter!«, ordnete er an.
Er selbst hechtete an das Fenster und warf einen Blick auf die Straße. Was er dort suchte, war anscheinend nicht da, denn er verzog enttäuscht das Gesicht.
»Jo, versuch Maine am Gare du Nord abzufangen! Sag ihr, sie soll mich anrufen. Und ob ihr das passt oder nicht, weich ihr nicht von den Fersen!«
II
Das Dach des Taxis war offen und die Scheiben heruntergelassen. Trotzdem ging von den Sitzen ein Gestank nach Fett aus, dass es einem fast übel wurde.
»Sie«, sagte Maine, als sie auf dem Gehsteig des G 7-Taxistands ausstieg, »fahren sicher öfters für eine Zoohandlung!«
»Nee«, antwortete der Fahrer, »meistens steh ich in der Warteschlange!«
Wenn jemand auch kein feines Näschen hat, kann er doch immer noch schlagfertig sein. Maine verkniff sich eine weitere Bemerkung, zahlte und betrat den Bahnhof.
Es war kaum etwas los; auch der Zug aus Boulogne-sur-Mer würde erst in einer knappen halben Stunde eintreffen. Bis dahin hatte sie nichts Besseres zu tun. Sie beschloss, sich in der chromblitzenden Bar neben der Sperre, wo Sandwiches mit Salat verkauft wurden, einen Fruchtsaft zu bestellen.
Sie wollte gerade die Tür aufstoßen, als sich eine Hand auf ihren Arm legte.
»Moment mal, bitte!«
Das wurde leise, aber bestimmt gesagt. Sie wandte sich um und sah zwei stämmige Männer mit Schlägervisagen, die in feinen Anzügen steckten. Sie traten selbstsicher auf, ihre Hände steckten nicht in den Jackentaschen.
»Frau Maine, immer schön uns nach! Anweisung von Riton!«
Es war durchaus möglich, dass Riton seine Männer schickte, um sie abzuholen. Doch Maine war alt genug, um zu wissen, dass das in dem Fall nicht so ablaufen würde! Kein unbekannter kleiner Aushilfsgangster würde es sich herausnehmen, Riton vor ihr anders als ›Herr Godot‹ zu nennen!
Zuerst wollte sie sich mit einem Scherz aus der Affäre ziehen, als sei sie nur eine ganz normale Bürgerin; doch die Gesichter der beiden sagten ihr gar nichts. Zwei kleine Korsen mit abweisenden Mienen, an denen jeder Scherz einfach abprallen würde: Die hielten sich streng an die Vorschriften! Sie waren gekommen, um sie mitzunehmen, das war klar!
Der, der sie festhielt, war ziemlich hässlich. Der andere war eigentlich ein schöner Mann, doch sein Hals war vernarbt, als hätte man auf ihm blaue Bohnen gesät.
Maine war keine zwanzig mehr, doch was ihr Reaktionsvermögen betraf, brauchte sie sich vor keinem noch so jungen Ding zu verstecken. Mit einem schnellen, heftigen Ruck befreite sie ihren Arm aus der Umklammerung und wollte dem eher Hässlichen die Tür in das Gesicht schlagen. Doch der Narbenhals packte sofort, ohne zu zögern, eisern zu.
»Aber, aber, Frau Maine!«
Er sprach übertrieben freundlich, doch sein Griff war unerbittlich. Maine fühlte, wie ihr Tränen in die Augen schossen, während die beiden Männer sie rechts und links am Arm packten und einfach hochhoben, geräuschlos, ohne Aufsehen zu erregen.
Sie wurde gekidnappt! Sie wollte »Nein!« schreien, doch eine Hand hatte sich schon auf ihren Mund gelegt, mit dem Daumen unter ihrem Kinn und der Handfläche unter ihrer Nase, damit sie nicht beißen konnte. Da waren Profis am Werk!
Sie hatte das dumpfe Gefühl, das einen überkommt, wenn man mit hundert Stundenkilometern aus einer Kurve geschleudert wird, und schloss die Augen, der Dinge harrend, die da noch kommen würden: Diesen ersten Streich hatte sie jedenfalls nicht kommen sehen!
Sie wurde gekidnappt, keine Frage! Sie konnte nicht einmal schreien, konnte sich kaum bewegen, so fest hatten sie die beiden im Griff! Sie dachte: ›Ich bin alt geworden!‹ und gab ausschließlich sich selbst die Schuld an ihrer misslichen Lage.
So kam sie nach etwa zehn Metern in die fast leere Abfahrtshalle, wo der nächste Schlag kam, aber anders als erwartet.
Sie hörte jemand mit eindeutig südfranzösischem Akzent: »He, ihr dort!” rufen, dann vernahm sie auch schon das dumpfe, hohle Geräusch von Faustschlägen! Jemand kam ihr zu Hilfe!
Zuerst sah sie nur einen Rücken und einen Schädel mit schütterem Haar. Sie dachte an Riton, der ›höchstpersönlich‹ den Retter spielte, was unvorhergesehen wäre, ihr aber schmeicheln würde. Ein flüchtiger Blick auf die Tweedjacke, die von mittelmäßiger Qualität war, genügte freilich, um ihr klar zu machen, dass es sich um einen Unbekannten handelte, der wahrscheinlich aus dem Metroschacht gekommen war.
Aber der Kerl schlug sich tapfer! Er hatte dem Narbenhals schon ganz schön was auf den Deckel gegeben und drosch mit gesenktem Kopf weiter auf ihn ein – wie ein wilder Stier!
Er hatte einen mächtigen Brustkorb und ließ seine kräftige Schultermuskulatur spielen. Sein Reaktionsvermögen war zwar alles andere als gut, doch wenn er mal einen Schlag untergebracht hatte, dann saß der auch!
Nach einem Schlag in den Magen schaute der Narbenhals so unglücklich drein wie ein Fisch auf dem Trockenen. Der kleine, eher Hässliche setzte seine Verteidigung gezielter ein, wich im richtigen Moment aus und versuchte, dem edlen Ritter Fußtritte in die Weichteile zu versetzen; doch, vorsichtig geworden, weil er dessen entfesselter Kraft zu nahe gekommen war, ging er zu sehr auf Distanz.
Da zog der Narbenhals ein Messer hervor. Er machte das ganz ruhig und sagte, wieder zu Atem gekommen:
»Hau ab, Fettsack!«
Der Fettsack hörte nicht auf ihn, schlug in das Leere, wie ein Mühlrad ohne Wasser. Maine bekam es mit der Angst zu tun.
»Vorsicht!«, schrie sie.
Einige Passanten waren stehengeblieben; fassungslos und unentschlossen standen sie da; lieber warteten sie den weiteren Verlauf der Schlägerei erst einmal ab, bevor sie irgendein Risiko eingingen. Wie der Chor in einer griechischen Tragödie würden sie nur als Masse reagieren. Zu fünft oder zu sechst waren sie noch nicht handlungsfähig.
»Zu Hilfe!«, schrie Maine, um sie aus der Reserve zu locken.
Sie schrie nicht, weil sie Angst um sich selbst hatte; sie war frei und hätte die jetzt günstigere Lage ausnutzen und sich einfach verabschieden können. Sie schrie um Hilfe für den guten Kerl da, der drauf und dran war, sich um ihrer schönen Augen willen abstechen zu lassen. Da konnte man doch unmöglich einfach tatenlos zusehen!
»Zieh ab!«, fuhr der Narbenhals fort. »Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß!«
Doch der gute Mann gab sich noch nicht geschlagen. Er war zwar außer Atem und schon ganz schön geschafft, ließ sich aber von dem Messer nicht abschrecken. Mit rotem Gesicht und fliegender Krawatte bot er seinen Widersachern die Stirn.
»Schämt ihr euch denn nicht?«
Ja, der Akzent verriet bei jedem Wort, das er sprach, ganz klar den Südfranzosen. Die anderen ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie hatten sich wieder gefangen und rückten ihm mit bösem Blick immer näher auf die Pelle. Maine sah plötzlich auf dem bleichen Gesicht des Narbenhalses eine Entschlossenheit, die auch vor Mord nicht zurückschrecken würde. Er kam dem Mann langsam immer näher und fauchte:
»Du ziehst jetzt Leine!«
»Die bringen ihn noch um!«, schrie einer aus dem Chor, ohne sich von der Stelle zu rühren.
Hart bedrängt begann der Mann von neuem auszuteilen, kassierte aber, langsamer werdend, immer öfter Schläge ein. Alles deutete auf das nahe Ende der Treibjagd hin.
›Armes Schwein!‹, dachte Maine traurig. ›Höchste Zeit, mich davonzumachen! Trotzdem danke, armer Trottel!‹
Sie drehte sich um und sah auf einmal, wie Jo den Bahnhof betrat. Er trug seine leicht trotzige Miene zur Schau und kam, seine rechte Hand unter die linke Jackettseite geschoben, ruhig auf sie zu.
Vier Meter vor ihnen blieb er stehen und schnauzte sie an:
»Na! Ihr da!«
Zuerst drehte sich der kleine Hässliche um, dann der Mann mit dem Messer. Jo war offensichtlich kein Unbekannter, denn die zwei Männer schienen ihn auf Anhieb zu erkennen. Ihre Züge erstarrten in einem gezwungenen Lächeln und sie wurden auf einen Schlag weniger aggressiv.
»Hallo, Jo!«, sagte der Narbenhals und klappte sein Messer zusammen.
»Geht ihr schon?«, fragte Jo sehr höflich, die Hand immer noch auf Herzhöhe.
»Was sein muss, muss sein!«, sagte der kleine Hässliche. »Wir werden zu Hause erwartet.«
Sie traten zum geordneten Rückzug an, wirkten gar nicht mehr bedrohlich; ihre Augen waren auf Jo gerichtet, der seine Hand immer noch unter dem Jackett hielt. Sie waren sofort höflich.
»Also tschüs, Jo! Bis bald!«
Sie wirkten wie ehemals gute Bekannte, deren Verhältnis sich im Lauf der Zeit wohl etwas abgekühlt hatte. Sie zogen sich zurück.
»Die haben sich an der Frau da vergriffen!«, empörte sich der Retter ganz außer Atem.
»Ja!«, antwortete der Chor. »Wir müssen die Polizei holen!«
Jo streifte die feigen Memmen nur mit einem kalten Blick. Draußen hörte man die Tür eines Wagens zuschlagen. – Er fasste Maine respektvoll am Arm.
»Kommen Sie hier lang, Frau Maine!«
»Warten Sie, Jo!«, sagte sie. »Ich will mich schon noch bei dem Herrn da bedanken.«
Der Herr sah sie an, ein Lächeln zeichnete sich in seinem roten, von den Schlägen mitgenommenen Gesicht.
»Grüß dich, Angèle!«
Maine zuckte zusammen.
»Aber das ist doch – ! Bist du das, Félix?«
»Aber ja!«, sagte der Mann. »Hab ich mich so verändert?«
Maine sah ihn an, ohne ein Wort zu sagen. Jahre war das schon her, Jahre – sie verzichtete darauf, nachzuzählen.
»Du hast dich jedenfalls gut gehalten«, sagte Félix ruhig. »Ehrlich, du bist immer noch zum Anbeißen, wie mit zwanzig!«
»So was!«, sagte sie endlich.
Ihr Gesicht hellte sich auf. Sie öffnete ihre Arme.
»Félix, komm, geben wir uns ein Küsschen!«
Das taten sie dann auch – ein rührender Anblick, die beiden. Jo sah seine Chefin ein ganz klein wenig vorwurfsvoll an.
»Frau Maine, Herr Godot hat noch gesagt, dass Sie sich mit ihm kurzschließen sollen.«
»Ach, der!«, sagte Maine wütend. »Was sollte denn dieser hinterhältige Angriff eben? Was wollten die von mir, diese zwei halben Portionen?«
»Das ist die Paconibande«, sagte Jo. »Die könnten uns noch übel mitspielen! Ich soll sie nicht allein lassen, Frau Maine; Herr Godot hat das befohlen.«
Maine runzelte die Stirn und seufzte. Dann wischte sie die Probleme mit einer Handbewegung beiseite und wurde wieder ganz die freundliche, mondäne Frau.
»Mein erster Mann«, sagte sie und zeigte auf Félix. »Der Vater meiner Tochter.«
Jo reichte ihm die Hand.
»Sehr erfreut! Und was machen Sie?«
»Bahnpostwagen!«, sagte Félix.
Jo stieß einen bewundernden Pfiff aus.
»Das gibts heute kaum noch, aber wenn, dann fällt da ganz schön was dabei ab!«
Maine verdrehte die Augen.
»Aber nein, Jo! Félix arbeitet wirklich in einem Bahnpostwagen, als Beamter bei der Bahnpost.«
Die Bewunderung wich aus Jos Miene, dafür wurde er herzlicher.
»Auch gut!«, sagte er. »So Leute braucht man auch!«
Es war jetzt fünf Uhr zwanzig; der Zug würde in einer knappen Viertelstunde eintreffen. Sehr wenig Zeit, um sich einem Verflossenen wieder anzunähern.
»So was!«, sagte Maine. »Ich hab geglaubt, du würdest nie weiter in den Norden kommen als bis Avignon. Ich hätt nicht gedacht, dass ich dich hier treffe.«
»Gestern Abend hab ich das auch noch nicht gewusst. Ich hab mich spontan entschlossen.«
»Wolltest du die Kleine früher sehen?«
»Ja«, sagte Félix. »Dich auch, ich wollte zu dir.«
Maine schwieg eine Weile: Der gute Félix! Er hielt sich zwar noch ganz gut, war aber kleiner und breiter geworden – das Alter war nicht spurlos an ihm vorübergegangen! Unwillkürlich betrachtete sie ihr Spiegelbild in einer Scheibe, sah eine noch sehr schöne Frau und war beruhigt.
»Wir könnten zusammen Abend essen«, schlug sie vor. »Ich hoffe nur, dass du mir Colette acht Tage lässt, wie ausgemacht?«
»Klar, keine Änderung im Plan«, beruhigte er sie. »Aber vielleicht werd auch ich acht Tage in Paris bleiben.«
»Urlaub?«
Er betrachtete sich seinerseits in der Scheibe der Auslage und verzog das Gesicht, als er einen Blutfleck im Mundwinkel bemerkte.
»Ich hab gesagt: Vielleicht!«
In seiner Stimme lag ein mysteriöser Unterton; Maine glaubte zu verstehen, dass er vor Jo nicht mit der ganzen Wahrheit herausrücken wollte. – Mit ihrem Taschentuch wischte sie ihm die Unterlippe ab und wandte sich dann an den Mann mit dem ungemein praktischen Jackett.
»Jo, könnten Sie mir nicht Ihren Schutz aus einer etwas größeren Entfernung angedeihen lassen?«
»Klar, Frau Maine«, sagte Jo mit einem vorwurfsvollen Unterton in der Stimme. »Aber vergessen Sie nicht, Herrn Godot anzurufen!«
»Nichts da!«, schnitt sie ihm grollend das Wort ab. »Ich hab diesem Flegel nichts zu sagen! Richten Sie ihm das bloß aus!«
»Das wird ihm aber nicht recht sein, Frau Maine!«
»Mir schnurzegal! Wenn ich im Kreis meiner Familie bin, will ich nicht gestört werden! Merken Sie sich das, Jo!«
»Sie haben ja gesehen, was passiert ist«, erwiderte Jo ernst. »Da nicht wir die Attacke gestartet haben, können wir nicht wissen, was als nächstes kommt!«
»Ja«, sagte sie zornig. »Als ich noch mit dem Grafen zusammen war, hätte sich niemand erlaubt, mich dermaßen respektlos zu behandeln! Im Zwergenreich sind die Halbstarken König!«
»Sie sind ganz schön hart, Frau Maine«, schloss Jo das Gespräch. »Herr Riton hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen!«
Wie ein geprügelter Hund ging er zum Telefon.
»Jedenfalls«, sagte Félix, »ist der junge Mann gerade rechtzeitig gekommen. Wo bist du da nur reingeraten, meine arme Angèle!«
Sie setzten sich an einen Tisch mit schwarzer Plastikplatte und bestellten zwei Bier. Der Vorname Angèle schien in Maine Rührung auszulösen.
»Ah, Félix! – Das sind fast zwanzig Jahre meines Lebens, die du einfach so wegwischst! – Angèle! – Das ist so, als wäre ich wieder ein kleines Mädchen, verstehst du. Niemand hat mich seither so genannt.«
Félix sah sie mit unverhohlener Bewunderung an.
»Ich hab ab und zu ein Foto von dir in der Zeitung gesehen. Aber, verdammt noch mal, du siehst noch besser aus als auf den Fotos!«
»Weiß Colette, dass du in Paris bist?«
»Nein. Ich hoffe, sie freut sich.«
»Ich hab sie seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Hat sie sich verändert?«
»Du wirst schon sehen! Sie sieht genauso aus wie du mit siebzehn!«
»Hoffentlich nimmt sie sich kein Beispiel an ihrer Mutter«, sagte Maine mit einem Anflug von Strenge. »Hast du sie zum Katechismus geschickt?«
»Das entspricht nicht meinen Überzeugungen«, antwortete Félix.
»Trotzdem«, sagte Maine, »das würde ihr jedenfalls auch nicht schaden!«
Sie mussten beide lachen; sie fasste ihn am Arm.
»Du hast mir da so einiges an Ärger erspart, Félix. Du bist immer noch ein guter Kerl. Danke.«
Er zog seine Hand zurück und verzog das Gesicht, als hätte man ihm einen Stich versetzt.
»Oh, nein, Angèle! Komm mir bloß nicht damit! Mein Leben lang hab ich nichts andres gehört, als dass ich ein guter Kerl bin, ein guter Familienvater, ein guter Bürger, ein guter Trottel – Nein, nein! Hurenzeug! Glaub mir, damit ist jetzt Schluss! Das sanfte Schaf ist tollwütig geworden! Und deshalb bin ich nach Paris gekommen!«
Ihm wurde bewusst, dass er ganz zornig geworden war, hielt abrupt inne, entschuldigte sich.
»Ich sag das natürlich nicht wegen dir, Angèle!«
»Was?«, fragte sie, »Hurenzeug?«
Sie brachen erneut in Lachen aus. Fünfzehn Jahre waren wie weggeblasen.
III
Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, beugte sich Colette aus dem Fenster der Wagentür.
Der Bahnsteig machte einen ganz verlassenen Eindruck und sie fragte sich schon, ob denn ihre werte Frau Mutter es für nötig befunden hätte herzukommen, als sie die kleine Gruppe in der Nähe der Sperren sah: ihr Vater, ihre Mutter und ein kleiner Blonder, den sie nicht kannte, der wohl der neue »Typ ihrer Mutter« war.