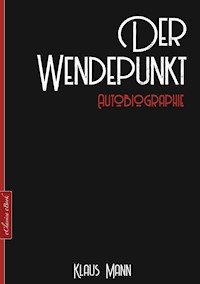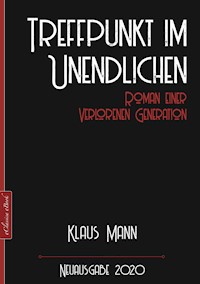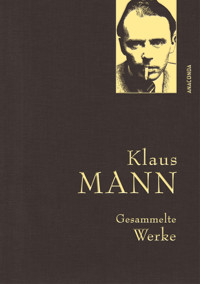9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der fünfte, abschließende Band von Klaus Manns essayistischen Schriften umfasst die Zeit von Ende 1942 bis zum Mai 1949. Als Soldat der US-Army kehrt Klaus Mann nach Europa zurück. Er nimmt am Feldzug in Italien teil und arbeitet für die psychologische Kriegsführung der Alliierten, schreibt Flugblätter und verhört deutsche Gefangene. Seine Aufrufe an die Deutschen auf der anderen Seite der Front, Texte eines Schriftstellers im Kriegseinsatz, werden in diesem Buch erstmals dokumentiert. Nach dem Ende des Krieges beschäftigt Klaus Mann die Zerstörung des geistigen Lebens durch zwölf Jahre Faschismus. Seine Essays aus dieser Zeit gehören zu den scharfsinnigsten Analysen der sogenannten Stunde null.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Auf verlorenem Posten
Aufsätze, Reden, Kritiken 1942–1949
Über dieses Buch
Der fünfte, abschließende Band von Klaus Manns essayistischen Schriften umfasst die Zeit von Ende 1942 bis zum Mai 1949. Als Soldat der US-Army kehrt Klaus Mann nach Europa zurück. Er nimmt am Feldzug in Italien teil und arbeitet für die psychologische Kriegsführung der Aliierten, schreibt Flugblätter und verhört deutsche Gefangene. Seine Aufrufe an die Deutschen auf der anderen Seite der Front, Texte eines Schriftstellers im Kriegseinsatz, werden in diesem Buch erstmals dokumentiert.
Nach dem Ende des Krieges beschäftigt Klaus Mann die Zerstörung des geistigen Lebens durch zwölf Jahre Faschismus. Seine Essays aus dieser Zeit gehören zu den scharfsinnigsten Analysen der sogenannten Stunde null.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 1994 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung tanatat/Shutterstock
ISBN 978-3-644-00436-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
«Heimweh nach Europa. Ich habe dieses Land hier satt.» Eine überraschende Tagebucheintragung: Als Klaus Mann diese Sätze notiert, am 29. Juli 1943, ist er Mitglied der US Army und bemüht sich um die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der Pazifist will mit der Waffe gegen den Hitler-Faschismus kämpfen, der Individualist sich unter das namenlose Heer mischen. Widersprüchliche Gefühle hält er in seinem Tagebuch fest. «Wie merkwürdig! – selbst ein Teil dieser amorphen, anonymen Masse zu werden! Schlicht einer dieser Soldaten, die im Bus reisen; warten, schwitzen …» Er genießt dieses Aufgehen in der Menge, ihm macht sogar die militärische Grundausbildung Spaß. Schießen auf dem Übungsplatz, Gewehrreinigen, Küchendienst oder auch die Teilnahme am «Infiltration Course»: «Auf schlammigem Boden kriechen (100 Yards), unter Maschinengewehrfeuer (echte Munition). Stacheldraht. Explosionen. Was für eine Erfahrung.»
Der letzte Band der gesammelten Essays Klaus Manns setzt ein mit dem ersten Artikel, der nach seiner Einberufung im Dezember 1942 veröffentlicht wird. Zum Militärdienst hat sich der Schriftsteller freiwillig gemeldet, und nicht allein politische Motive gaben den Ausschlag: Klaus Mann sehnt sich nach neuen Entwicklungen, nach Veränderungen. Doch sein Tatendrang wird gebremst, man hat ihn zwar genommen, aber abgeschoben auf einen Druckposten. Sein Antrag auf Einbürgerung wird hinhaltend beantwortet. Mehrfach bekommt er Besuch von den unauffälligen Herren der Military Intelligence, die ihm die seltsamsten Fragen stellen: zu seiner politischen Gesinnung, auch zu seinem moralischen Lebenswandel. Klaus Mann fühlt sich als Opfer einer zwielichtigen Kampagne, «denn diese Herren wissen natürlich sehr genau, daß ich weder ‹Kommunist› noch ein gefährlicher Wüstling bin». Getroffen werden soll, davon ist er überzeugt, der Geist des Internationalismus, die schöpferische Unabhängigkeit. Im Tagebuch spielt er mit dem Gedanken, sollte ihm die Staatsbürgerschaft verweigert werden, seinem Leben ein Ende zu setzen. «Mein Selbstmord wäre dann mehr eine Geste politischen Protests und nicht eine Geste extremen Überdrusses.»
Eine harte Geduldsprobe steht ihm bevor. Nachdem die Grundausbildung absolviert ist, bricht die Kompanie zum europäischen Kriegsschauplatz auf, nur Klaus Mann bleibt zurück: Er wird zunächst in einem Camp in Maryland, später in Missouri stationiert. Der Schriftsteller, dessen Gedanken um das Schicksal Deutschlands und die Literatur Europas kreisen, schreibt profane Gebrauchstexte für die Army: Er macht Propaganda für die Kriegsanleihe und organisiert eine Versteigerung für den guten Zweck, verfaßt belanglose Artikelchen für die «Camp Crowder Message» (z.B. über die neuen Bücher in der Leihbücherei des Camps oder die Wiederverwertung von Rohstoffen). In einer Artikelserie porträtiert er für die ahnungslosen GIs jene europäischen Städte, die er, der Weltenbummler und Flaneur, einst erkundet hat und die jetzt Ziele der amerikanischen Bomber sind. Der Intellektuelle ist im Camp ein Außenseiter: Die Kameraden nennen ihn spöttisch «Professor». In den FBI-Akten sind wenig schmeichelhafte Beurteilungen des Soldaten Klaus Mann nachzulesen. «Sergeant Coy Merritt bezeugt, daß das Subjekt (…) bei Anweisungen nicht aufgepaßt habe, zerstreut oder wie mit anderen Dingen beschäftigt gewirkt habe», heißt es in einem Memo; der Ausbilder faßt seinen Eindruck wie folgt zusammen: « … ein Bücherwurm mit wenig gesundem Menschenverstand, der die anderen Auszubildenden lediglich durch Mangel an Disziplin beeinflußt hat.» Seine Homosexualität kann er erfolgreich verheimlichen, und auf politische Diskussionen mit Unteroffizieren und Rekruten läßt er sich kaum ein. Das Mißtrauen des FBI – die Beamten vernehmen Bekannte, Freunde, Hotelangestellte und selbst den Vater als Zeugen – ist zwar nicht ausgeräumt, aber man kann dem prominenten Sohn des berühmten Dichters nicht länger die Bürgerpapiere verweigern: Am 25. September 1943 erhält Klaus Mann endlich die ersehnte amerikanische Staatsbürgerschaft.
Nun läßt auch der Marschbefehl nicht mehr lange auf sich warten. Am 2. Januar 1944 landet er mit einem Truppentransport in Marokko und nimmt anschließend am Feldzug der alliierten Streitkräfte in Italien teil. Ausgebildet bei der «First Mobile Radio Broadcasting Company» – unter diesem Decknamen verbirgt sich eine spezielle Propagandaeinheit, die u.a. «undercover radio stations» aufbauen soll –, stellt Klaus Mann seine Formulierungskünste in den Dienst der psychologischen Kriegführung: Er schreibt und redigiert Flugblätter, die sich an die Soldaten auf der anderen Seite der Front richten und zur Desertion aufrufen. Themen und Tenor variieren nur geringfügig: Der Krieg ist längst entschieden, der deutsche Soldat steht auf verlorenem Posten. «Wer jetzt noch stirbt, ist umsonst gestorben», heißt es in einem Flugblatt; ein anderes ist überschrieben: «Die Russen stehen in Ostpreußen! Und du sitzt hier in deinem Loch, irgendwo in Italien …»
Die Stimmungslage in der deutschen Truppe – z.B. die verzweifelte Hoffnung auf Hitlers angebliche «Wunderwaffe», aber auch die Angst, daß bei einer Desertion die Familie zu Hause Repressalien zu erleiden hat – wird von der P.W.B., der Psychological Warfare Branch, geradezu wissenschaftlich eruiert. Klaus Mann führt Dutzende von Verhören mit Kriegsgefangenen und wertet sie in stichwortartigen Protokollen aus: die Basis für die Flugblatt-Arbeit. Überwiegt anfangs noch die politische Agitation, so geht man zunehmend von der konkreten Situation der Landser aus. Verführerischer als jedes noch so einleuchtende Argument ist das Versprechen, daß das Leben in Schlamm und Dreck ein Ende hat. «Du wirst bei uns als Soldat – das heißt: anständig – behandelt. Und nach dem Krieg – und das heißt vielleicht: bald!–wirst du in deine Heimat zurückkehren.» Es wird versichert: «Unter keinen Umständen werden irgendwelche Einzelheiten über eure Gefangennahme veröffentlicht. Gutes Essen. Ihr könnt nach Hause schreiben, wie die Genfer Konvention es vorsieht.» Die materielle Überlegenheit wird höchst wirkungsvoll demonstriert: Bei einer besonderen Aktion werden Flugblätter mit je fünf Zigaretten – absolute Mangelware bei den deutschen Einheiten – abgeworfen. Mit ähnlich verlockenden Angeboten arbeiten – direkt oder unterschwellig – auch die Texte. Auf der Rückseite der Flugblätter ist oft «Fünf Minuten Englisch», ein «Blitzkurs für Landser», abgedruckt: elf Fragen in Deutsch und Übersetzung, beginnend mit dem Wunsch «Bitte noch eine Tasse Kaffee», wobei eine dritte Spalte das fremde Idiom in phonetischer Notation präsentiert: «Sam mor koffi, plies.»
«Den Zusammenbruch des Nazismus und die verschiedenen Reaktionen der Deutschen darauf zu beschreiben – das wäre in der Tat eine der aufregendsten, befriedigendsten Arbeiten, die ich mir vorstellen kann.» Der Wunsch geht in Erfüllung: Klaus Mann, der viele Gesuche um Versetzung einreicht, wird Anfang Mai 1945 als Sonderberichterstatter der Army-Zeitung «Stars and Stripes» nach Deutschland geschickt. Wenige Tage nach der bedingungslosen Kapitulation ist er in seiner Heimatstadt München, die er zwölf Jahre zuvor verlassen hat, und sucht das Elternhaus auf. Ihn erwartet ein Déjà-vu-Erlebnis besonderer Art: Die Villa, das vertraute Heim seit Kindertagen, hat eine seltsame Verwandlung erlebt – von den Nazis umgestaltet für ihr «Lebensborn»-Programm. In seiner Autobiographie «Der Wendepunkt» schildert Klaus Mann die Episode in literarischer Stilisierung; der hier als deutsche Erstveröffentlichung abgedruckte Artikel aus «Stars and Stripes» ist geprägt von der Frische des unmittelbaren Erlebnisses. Dies gilt auch für die zahlreichen Interviews, die der Korrespondent mit Politikern – Männern der ersten Stunde, aber auch dem prominentesten Kriegsgefangenen, Hermann Göring – und Künstlern führte.
Schon bei den Verhören im Camp fühlte sich Klaus Mann recht seltsam in seiner Rolle: «Meine eigene Position dort (in amerikanischer Uniform) recht traumartig – halb-amüsant, halbpeinlich …» Jetzt, im zerstörten Deutschland als Journalist der Besatzungsmacht, zieht er es manchmal vor, anonym zu bleiben. Winifred Wagner hat – Jahrzehnte später, im Gespräch mit Hans-Jürgen Syberberg – nicht ohne Häme erzählt, sie habe bewußt mit den beiden «angeblichen Amerikanern» (Klaus Mann wurde begleitet von Curt Riess) Englisch gesprochen: Natürlich habe sie das Spiel gleich durchschaut. «Hocherhobenen Hauptes, üppig und blond saß sie mir gegenüber, eine Walküre von imposantem Format und imposanter Unverfrorenheit», so der Eindruck von Klaus Mann. Die Begegnung mit der «unverschämt unverlogenen Schwiegertochter des deutschen Genius» empfindet er «erfrischend», verglichen mit den sonst üblichen «tiefen Verbeugungen und Hofknicksen», die die Deutschen vor den Siegern machen. Richard Strauss, der im Interview sich selbst entlarvt, gehört zu den selbstgerechten Opportunisten. Uneinsichtig protestiert er nach der Veröffentlichung gegen die «böswilligen Lügen, die seit dem Frühjahr 1945 von amerikanischer Seite, zuerst durch den Sohn von Thomas Mann, durch Presse und Rundfunk verbreitet werden». Als kritischer Journalist versagt Klaus Mann jedoch, sobald er alten Freunden gegenübersitzt. Er erliegt dem Charme eines Emil Jannings und sieht sich gezwungen, sich öffentlich zu korrigieren. Nur von seiner Haßliebe Gustaf Gründgens, der schon wieder als «der Liebling von Berlin» beim Theater Triumphe feiert, läßt er sich keineswegs beeindrucken.
«Bitter ist die Verbannung. Bitterer noch die Heimkehr», resümiert Klaus Mann die Erfahrung des italienischen Kollegen Silone. Auch für ihn führt kein Weg zurück: Hat er anfangs noch auf eine Position bei einer der neugegründeten Zeitungen oder einem Rundfunksender gehofft, so ist er letztlich froh, als Amerikaner für «Stars and Stripes» zu schreiben. Selbst in einer feuilletonistischen Gelegenheitsarbeit, die Impressionen von einer Vortragstournee referiert, löst die Vorstellung, in Deutschland zu leben, einen Alptraum aus. Politische und persönliche Enttäuschungen lassen ihn seine früheren Überzeugungen revidieren: Klaus Mann, der im Exil immer das andere, bessere Deutschland verteidigt hat, erscheint nun die Unterscheidung zwischen guten Deutschen und bösen Nazis «sentimental». Für ihn gibt es keinen Platz in diesem Land. Das «moralische, intellektuelle und politische Vakuum», das er als Vermächtnis des Nationalsozialismus diagnostiziert, füllt sich zwar allmählich – aber nicht mit den Werken der antifaschistischen Exilierten, die mit verstecktem Mißtrauen betrachtet oder offen angefeindet werden.
Im Kalten Krieg mag er sich auf keine Seite der Front schlagen: Die unheilvolle Entwicklung treibt Klaus Mann in die Isolation. Er gerät in eine Krise: Resignation lähmt seine Kreativität. «Biedere Trivialitäten für die Soldatenzeitung», mehr falle ihm nicht mehr ein, klagt er seinem Freund und Lektor Fritz Landshoff. In der Vergangenheit hatte er wesentliche Impulse nicht zuletzt aus seiner Rolle im Literaturbetrieb bezogen: Als Sprecher der jungen Generation, später als engagierter Vermittler der Exilliteratur gründete er Zeitschriften und gab Anthologien heraus, versuchte auf diese Art, die geistigen und literarischen Strömungen der Zeit zu bündeln und zu verstärken. Solche Projekte verfolgt er auch in der Nachkriegszeit, doch sie scheitern allesamt. Und die Ausbeute seiner eigenen literarischen Arbeit ist äußerst gering: Das Theaterstück «Der siebente Engel» findet keine Uraufführungsbühne; seine Mitarbeit an dem Rossellini-Film «Paisá» wird im Vorspann verschwiegen. Die wichtigste Arbeit dieser Jahre bleibt die Übertragung seiner Autobiographie ins Deutsche. «Der Wendepunkt» ist nicht bloß eine überarbeitete und erweiterte Fassung von «The Turning Point», sondern stellt den Lebensbericht unter eine Perspektive, die am Ende die Apokalypse beschwört. Nach Kriegsende gebe es nur die Alternative: eine «geeinte Welt» oder der «Abgrund».
In seinem letzten großen Essay «Die Heimsuchung des europäischen Geistes» zieht Klaus Mann eine Bilanz der «Gesamtkrise, die jetzt unsere Zivilisation in ihren Grundfesten erschüttert». Er läßt die wichtigsten kontroversen Positionen Revue passieren und kommt zu dem Ergebnis, daß in der «Schlacht der Ideologien» aus den Intellektuellen «ein schwacher, dissonanter Chor» geworden ist. Sie stehen auf verlorenem Posten: Was bleibt, ist die demonstrative Desertion aus dem Leben. Einem jungen Studenten legt er das Bekenntnis in den Mund: «Der Kampf zwischen den beiden antigeistigen Riesenmächten – dem amerikanischen Geld und dem russischen Fanatismus – läßt keinen Raum mehr für intellektuelle Unabhängigkeit und Integrität.» Helfen könne nur noch eine verzweifelte «Rebellion der Hoffnungslosen», bereit zur äußersten Konsequenz: dem Suizid. Eine Vorstellung, die ihn als Gedankenspiel schon einmal fasziniert hat, während des aktiven Kriegseinsatzes aber durch ein anderes Szenario zeitweilig verdrängt wurde. Der Außenseiter Klaus Mann will seinen Tod als Teil einer kollektiven Geste des Protests gedeutet wissen: Noch in diesem Moment radikalster Vereinzelung bemüht er sich um den «Anschluß an irgendeine Gemeinschaft».
Hamburg, im August 1994 Uwe Naumann/Michael Töteberg
1942
Hör zu, Hans!
Dorothy Thompsons Ansicht nach will das deutsche Volk Frieden. «Alle Völker dieser Erde wollen Frieden», sagt sie. «Daß es möglich ist, ein Friedensprogramm zu entwerfen, das sowohl der rationalen Seite des Menschen wie auch seinen tiefsten Sehnsüchten gerecht wird, ist die wichtigste politische Waffe in diesem Krieg und am besten geeignet, sämtliche Verduns in den Köpfen der Deutschen zu zerstören.»
Was Dorothy Thompsons Freund Hans betrifft – «einen für eine bestimmte Gesellschaftsschicht nicht untypischen Deutschen» –, so gibt es in seinem Kopf keine Verduns zu zerstören. Er ist ein deutscher Patriot, aber kein Nazi. Vor dem Krieg waren sich Dorothy Thompson und Hans völlig einig über die grundsätzlichen Fragen der Europa- und der Weltpolitik. Also ist Hans als Individuum keineswegs ein Feind, der besiegt werden muß, im Gegenteil – man sollte ihn, als potentiellen Verbündeten, mit Tatsachenmaterial und moralischer Unterstützung versehen. Und genau das bekommt er von seiner amerikanischen Freundin – eine Menge Informationen über ermutigende Tatsachen und unwiderlegbare Argumente.
Jeden Freitag zwischen März und September 1942 wandte sich Dorothy Thompson an Hans, über den Kurzwellensender von Columbia Broadcasting System. Die Manuskripte dieser Ansprachen wurden von einem Beamten der amerikanischen Militärbehörden geprüft. «Sie wurden jedoch nicht», betont die Autorin, «in Zusammenarbeit mit irgendeiner Regierungsstelle verfaßt, sondern sind ein individuelles und privates Unterfangen und werden auch jedesmal als solches von C.B.S. angekündigt.»
Wir wollen hoffen, daß nicht nur Hans, sondern Tausende, ja Millionen Deutsche am Radio saßen, wenn Dorothy Thompson sie von jenseits des Atlantiks informierte, tröstete und warnte. Allerdings sind in Hitlers Reich Kurzwellenempfänger ein gefährlicher Besitz. Doch vielleicht sind Hans und seine Freunde bei ihrer Suche nach der Wahrheit ebenso wagemutig und einfallsreich wie ihre Machthaber in der Kunst des Lügens. Wie dem auch sei, Dorothy Thompsons beherzte Appelle sind, ganz abgesehen von der Frage, ob sie ihre deutschen Empfänger wohl erreicht haben, höchst bewegend und bedeutsam. Diese wöchentlichen Ansprachen, jetzt als Buch erhältlich, können dazu beitragen, die Anti-Nazi-Moral nicht nur in Deutschland, sondern auch in diesem Land zu stärken.
Der anspruchsvollste Teil des Buches ist eine lange theoretische Einführung mit dem Titel «The Invasion of the German Mind». Dieser Text beginnt mit einigen scharfsinnigen Bemerkungen über psychologische Kriegführung im allgemeinen und behandelt dann das komplizierte Problem der deutschen Psychologie im besonderen. Dorothy Thompson ist stolz darauf, daß sie seit mehr als zwanzig Jahren versucht, «Deutschland zu verstehen und den geistigen und sozialen Charakter Europas zu erforschen». In der Tat gelingen ihr beachtliche Einblicke in die Widersprüche und Verwicklungen der germanischen Seele. Zwar ist ihr Resümee der deutschen Geschichte zu sehr verdichtet, um ganz gerecht zu sein; doch enthält es viele originelle Ideen und treffende Formulierungen.
Stilistisch zeichnet sich Dorothy Thompson durch die Fähigkeit aus, abstrakte Fragen spannend darzustellen, ohne dabei zu vereinfachen oder zu verzerren. Knapp und prägnant definiert und erläutert sie die beträchtlichen Widersprüche im deutschen Wesen – die erschreckende Mischung aus wissenschaftlichem Rationalismus und emotionaler Romantik, aus Überorganisation und chaotischer Anarchie. Was sie zur verhängnisvollen Trennung von Kultur und Politik in Deutschland zu sagen hat, ist nicht gerade brandneu, jedoch wahr und wichtig. «Die deutsche intellektuelle Kultur», schreibt sie, «hat vermutlich die ganze Welt stärker beeinflußt als Deutschland selbst.» Wie wahr! Und wie glänzend ausgedrückt!
Die Abschnitte über das Reich als mystisches Konzept sind informativ und wichtig, solange sie rational bleiben. Besonders gut gelingt es Dorothy Thompson, Hitlers ebenso konfusen wie gerissenen Versuch zu entlarven, «die Ideen des Heiligen Römischen Reiches, des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, des preußischen Klassenstaats und der revolutionären Konzepte von 1848 und 1918 in das Dritte Reich zu integrieren». Ich fürchte jedoch, ihre eigenen Ansichten sind ein wenig verworren, was den deutschen Nationalstaat betrifft, der (nach Meinung der Autorin) doch allen deutschen Liberalen so am Herzen liegt und unbedingt notwendig ist für die Welt. Ich möchte wissen, ob die Historiker der Behauptung von Dorothy Thompson zustimmen würden, daß die deutsche Entwicklung zur nationalen Einheit «niemals durch aristokratische, dynastische, reaktionäre oder klassenspezifische Interessen gefördert wurde, sondern nur durch ganz starke Tendenzen innerhalb des deutschen Volkes – genau wie die entsprechende Entwicklung in Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten vom Volk herbeigeführt wurde und nicht von bestimmten Schichten».
Es ist hier nicht möglich, auf die fundamentalen Unterschiede einzugehen zwischen den Konzepten einer «nationalen Einheit» in Frankreich, England oder den Vereinigten Staaten einerseits und in Deutschland andererseits. Selbst das italienische Risorgimento unterscheidet sich in wesentlichen Punkten (und zwar positiv) von seinem germanischen Pendant, das fürwahr kein Erwachen oder Erneuern des deutschen Genius bedeutete, sondern dessen Mißbrauch durch den preußischen Militarismus. Das Reich bedeutet, ganz einfach und bedauerlicherweise, die Hegemonie Preußens, zunächst über die süddeutschen und westdeutschen Staaten; dann über alle deutschsprachigen Länder (einschließlich Österreich, Böhmen, Schweiz und Elsaß); und schließlich über ganz Europa. Nietzsche – wahrhaft hellsichtig bei aller krankhaften Reizbarkeit – demaskierte und kritisierte den Begründer des deutschen Reichs, Bismarck, als den Mörder der deutschen Kultur. War Bismarck, der preußische Junker, etwa frei von reaktionären oder klassenspezifischen Interessen? Bismarcks verfluchte Schöpfung, «das Reich», ermöglichte es Wilhelm II., die Welt herauszufordern und zu bedrohen. Und vom Kaiser war es nur noch ein Schritt zum Führer.
Dorothy Thompson sagt – und darin stimme ich nicht mit ihr überein –: «Wenn es unser Ziel ist, in der Entwicklung Deutschlands das zu betonen und zu unterstützen, was dazu beitragen kann, diese Nation in den Rahmen eines von allen gewollten, demokratisch beseelten europäischen Systems zu integrieren, dann müssen wir die deutsche Einheit unterstützen.» Aber hatte nicht Hitler mit dem Schlachtruf «deutsche Einheit» Österreich und das Sudetenland besetzt? Ist Dorothy Thompson etwa für den «Anschluß»? Sie ist gegen Otto von Habsburg. Ich auch. Müßte ich allerdings wählen zwischen einer neuen österreichischen Monarchie und dem Überleben von Groß-Deutschland, bevorzugte ich – eine Besatzungsmacht.
Vielleicht liegt es in Thompsons Absicht, die Gefühle ihrer Hörer in Übersee zu schonen. Wie schon erwähnt, ist Hans kein Nazi, sondern ein Patriot. Er ist nicht empfindlich, was das Dritte Reich betrifft, aber das Reich selbst ist tabu. Seine amerikanische Freundin braucht kein Blatt vor den Mund zu nehmen, solange sie diesen einen wunden Punkt vermeidet.
«Listen, Hans!» ruft sie ihm jeden Freitag über den Ozean zu – leidenschaftlich und geduldig. «Hallo, du da drüben! Kopf hoch! Euer großer Führer ist am Ende; ich werde es dir beweisen.» Und sie beweist es mit eindrucksvollen Fakten und Zahlen, mit emotionalen und rationalen Appellen. Sie beherrscht viele Tonarten, kann hart und zupackend schreiben wie auch einfühlsam werbend. Stets jedoch entspringt ihre Überzeugungskraft einem unerschütterlichen Glauben, den sie in die schlichten und aufrichtigen Worte faßt: «Ich glaube, daß die Wurzeln der westlichen Zivilisation in der Vernunft und in der christlichen Moral liegen.»
Die deutschen Humanisten der großen klassischen Periode hätten diesem Credo zugestimmt. Vermutlich hätten sie aber Einwände gehabt gegen die Beharrlichkeit, mit der Dorothy Thompson die Idee des Reichs vermengt mit der kulturellen Mission des deutschen Volkes. Goethe beispielsweise vertrat die Ansicht, die Deutschen seien nur als Individuen achtbare Wesen, doch zu einem politischen Ganzen geeint würden sie chaotisch und gefährlich. Dem Größten aller Deutschen lag nichts an der Größe Deutschlands. Über die ganze Welt zerstreut – meinte er –, würden die Deutschen ihre Möglichkeiten optimal entfalten.
Hör zu, Hans! Hör zu, Dorothy Thompson!
Erinnerungen aus glücklichen Tagen
Der französisch-amerikanische Schriftsteller Julien Green ist eine der sonderbarsten und liebenswürdigsten Erscheinungen der neueren Literaturgeschichte. Seine Mutter kam aus Savannah im Staate Georgia; sein Vater aus Virginia, Prinz-William-Kreis. Im Jahre 1895 folgte Green senior einem Angebot der «Southern Cotton-Oil Company» und zog von Savannah nach Le Havre in der Normandie, wo er sich als Vertreter der amerikanischen Firma niederließ. Später zog die Familie nach Paris. Dort wurde Julien Green am 6. September 1900 geboren.
Er liebt Frankreich, ohne noch zu begreifen, daß er kein Franzose ist. Als kleiner Junge versuchte er, seiner Mutter zu imponieren und sie – womöglich – zu erschrecken, indem er mit den Füßen stampfte und dazu sang: «Tam, tam, tirelo.» Doch Madame Green aus Savannah nahm die Darbietung verständnislos und verdrossen auf. «Für wen hält der Affe sich jetzt?» erkundigte sie sich bei Juliens älterer Schwester. «Eleanor, frag den kleinen Französling, was er will!» Die Schwester fragte ihn auf französisch. «Ich bin ein Gallier!» verkündete Jung-Julien mit größter Bestimmtheit und kriegerischem Stolz. Hier griff, gewiß nicht auf französisch, die Mutter ein und schimpfte: «Ein Kind von mir und nennt sich einen Gallier?! Gallisch, haha. Du bist ein ganz gewöhnlicher Amerikaner!»
Nun, für einen «gewöhnlichen Amerikaner» ist Julien Greens Karriere als französischer Romancier höchst ungewöhnlich. Zweifellos rangiert der Autor so eigenwilliger Werke wie «Adrienne Mesurat», «Leviathan» und «Mitternacht» unter den besten Erzählern seiner Generation. Er trug seine persönlichen Rhythmen in die reiche Symphonie der zeitgenössischen französischen Literatur. Phantastisch, doch gezügelt, ein Träumer mit gesetzten Umgangsformen, so hat Green die große Tradition des französischen Romans um eine ganze Reihe neuer Vorstellungen und Akzente bereichert.
Die europäische Katastrophe zwang ihn, Frankreich zu verlassen. 1940 fand er Unterkunft in den Vereinigten Staaten – wie Dutzende seiner französischen Kollegen. Während aber andere exilierte Schriftsteller auf ihre amerikanischen Übersetzer oder auf die eigene linguistische Fixigkeit angewiesen sind, ist Greens Lage weniger entmutigend. Er hat es nicht nötig, die Regeln und Geheimnisse des englischen Stils zu ergründen. Nur wiederentdecken muß er die halbvergessenen Laute und Tonfälle seiner Muttersprache. Nach zwei Jahren, die er in Baltimore verbrachte, bringt er sein erstes englisch geschriebenes Buch heraus – einen Band voll von Heimweh und Dankbarkeit, den er fast ausschließlich seiner zweiten Heimat, Frankreich, widmet.
Zärtlich-sehnsüchtig beschwört er das Paris seiner Kindheit, mit dem ganzen Zauber, der längst dahin ist. Was für eine Fülle von Bildern und Klängen – flüchtig, doch unverderblich; zart, doch dauerhaft, da die Liebe sie festhält. Hier sind sie wieder, greifbar nahe, die Spiele und Kümmernisse der Frühzeit. Und immer ist da die herrliche Kulisse von Paris, die Straßen, Gärten, Monumente und die Kirchen der unvergleichlichen Stadt. «Ich glaube nicht», sagt Green, «daß ich je – irgendwo auf der Welt – eine Straße so schön finden werde, wie die Rue de Passy, als ich sechs war.» Auch kein Fahrzeug der Welt wird ihm je so erregend und köstlich erscheinen wie der Lieblings-Bus seiner Mutter, «der weithin betrauerte Bus ‹Passy–Börse›», der in Greens Gedächtnis die barocke Pracht einer Märchenkutsche annimmt.
«Ach, diese glücklichen Tage, die nicht wiederkehren!» ruft er, schier überwältigt vom Glanz der Erinnerungen und der Bitternis der Verluste.
Es gibt in Greens Buch dunkle Augenblicke – die unerklärlichen Ängste der Kindheit; der unheimliche Wachtraum vom Tod der Mutter, der in Wahrheit bevorstand – und humoristische Zwischenspiele. Doch heitere Besinnlichkeit herrscht vor. Selbst ein so umstürzendes Ereignis wie der Ausbruch des Ersten Weltkrieges vermag die Ruhe nicht zu stören.
«Ich kann nicht sagen», schreibt Green, «daß der Krieg von 1914 mich unglücklich gemacht hätte.» Damals war er vierzehn. Drei Jahre später trat er dem amerikanischen Felddienst als Ambulanzfahrer bei. «Ich war siebzehn», sagt er, «und es wurde befunden, ich solle ‹irgendwas tun›; jedermann – überall auf der Welt – tat irgendwas, für oder gegen die Alliierten.» Er hat den Krieg zwar gesehen, doch verweilt er kaum bei seiner Beschreibung. «Kriegserinnerungen», sagt er, «sind fast immer so öde, daß ich mich nicht dafür gewinnen kann, die meinen hier wiederzugeben; dabei ist mir klar, daß dies Erlebnis mich auf mancherlei Art bereichert hat.» Anregender als das Spektakel der mechanisierten Metzelei war der erste Eindruck von Italien, wohin er mit dem amerikanischen Roten Kreuz gelangte. «Erstmals Venedig, wenn man siebzehn ist – was immer ich mir erträumt haben mochte, und ich lebte oft ganz in meinen Träumen, dies übertraf sie alle.»
Er lebte oft ganz in seinen Träumen. An der Universität von Virginia, wo er drei Jahre verbrachte, träumte er ständig von Paris, «mit einer Art von ungesundem Trotz», wie er es nennt. Die Abschnitte, die diese amerikanische Episode behandeln, sind merkwürdig dünn und oberflächlich. Erst mit der Rückkehr des Helden und Erzählers nach Paris gewinnt der Bericht frische Spannung. Je intimer er die Stadt kennenlernt, desto leidenschaftlicher liebt er sie. «Jeder Spaziergang durch die Straßen», schreibt er, «schien ein neues Band zu knüpfen, das mich fesselte – an jeden Stein.»
Er wollte Maler werden, war aber bald entmutigt. «Was ich machte», sagt er, «sah aus, als lebte ich zur Zeit von Prud'hon und David; was also konnten Daumier, Cézanne und Matisse mir nutzen, die ich ziemlich unterschiedslos bewunderte? War es nicht reichlich närrisch, rückwärts zu gehen, während alle Welt hektisch nach vorn drängte?»
Er mußte sein eigenes Medium finden und entwickeln, eines, das ihm helfen würde, seine Hemmungen und Widerstände zu überwinden. Sein Medium ist die halb phantastische, schein-realistische Erzählung – die nüchterne Wiedergabe abenteuerlicher Alpträume, die peinlich genaue Darstellung von Bildern aus Traumstoff. Es ist Julien Greens Berufung, sein inneres Drama, seine unheilbare Sehnsucht auf die symbolischen Gesten und Handlungen erfundener Figuren zu übertragen. Genau das versuchte er schon zu tun, als er Anfang zwanzig war, und es gelang vorzüglich. Seine erste Erzählung, «The Pilgrim on the Earth», ist eine seiner schönsten. Seine beiden ersten Romane, «The Closed Garden» und «Avarice House», machten ihn weltweit berühmt.
Greens autobiographischer Bericht schließt mit dem Beginn seiner literarischen Karriere. Die düsteren Visionen von «Adrienne Mesurat» und «Leviathan» lauern hinter den letzten Seiten. Der Kontrast zwischen der stillen Luft, in der die Erinnerungen schweben, und der bösen Atmosphäre der frühen Romane, dem Erzeugnis jener «glücklichen Tage», ist ein wenig bestürzend. Betrügt Green sich selbst? War seine Jugend nicht ganz so glücklich, wie er jetzt meint? Oder ist der tragische Grundton seines Frühwerks künstlich erzeugt und «hochgespielt»? Aber die Echtheit all dieser trüben Eingebungen steht völlig außer Frage. Wie auch die zuversichtliche Stimmung, die über den Memoiren liegt, unverkennbar echt ist.
Künstler sind gespaltene Leute. Sie tauchen in die Tiefen ihres Unterbewußtseins und kommen uns mit den gräßlichsten und zauberhaftesten Dingen. Ein andermal lehnen sie sich zurück und erzählen – in aller Harmlosigkeit – die «wirkliche» Geschichte ihres Lebens, sehr hübsch und anspruchslos, nicht eben packend vielleicht, doch äußerst liebenswert. Von solcher Art ist Julien Greens Bericht von den glücklichen Tagen, die nie wiederkehren.
1943
Upton Sinclairs neuer Roman
«In schicksalhaften Zeiten wie diesen hat ein älterer Schriftsteller nichts anderes zu geben als Worte. Diese Ansammlung von Worten ist den Männern und Frauen in allen Teilen der Welt gewidmet, die ihr Leben aufs Spiel setzen für die Sache der Freiheit und des menschlichen Anstands.»
Diese schlichte Erklärung, das Motto von Upton Sinclairs Roman «Dragon's Teeth» (1941), kann man ebensogut dazu verwenden, sein neues Werk «Wide is the Gate» vorzustellen. Beide Bücher sind Teil einer umfänglichen dokumentarischen Saga, in der die Struktur der modernen Zivilisation dargestellt wird. Der Anspruch moralischen Bewußtseins und sozialer Verantwortung, der so charakteristisch ist für Sinclairs Gesamtwerk, wird besonders eindrucksvoll deutlich in diesen jüngsten Erzählwerken. Hier enthält sich der Autor bewußt und nachdrücklich aller ästhetischen Feinheiten und Nuancen. Er schreibt schlicht, realistisch, beinahe brüsk. Bescheiden und zugleich äußerst ambitioniert, verzichtet er fast ganz darauf, ein Künstler zu sein – verschmäht er doch die ganze Palette literarischer Kunstgriffe und nimmt das Leben direkt in Angriff – das wahre Leben, unverhüllt, schamlos und kolossal. Selbst Zolas naturalistischer Stil erscheint künstlich, verglichen mit Sinclairs höchst nüchternem Ansatz. Der große Franzose – in vielerlei Hinsicht Vorbild und Meister des Amerikaners – schwelgt verschwenderisch in Bildern voller Symbolik und in poetischen Anspielungen. In Zolas Werk gibt es ein musikalisches, um nicht zu sagen wagnerianisches Element, das bei Sinclair vollständig fehlt. Er ist trocken, didaktisch und – trotz seines rebellischen Pathos und der Liberalität seiner Ansichten – sogar eine Spur puritanisch.
Ist «Wide is the Gate» ein Roman? Wenn ja, so repräsentiert er ein neues und ziemlich gewagtes Experiment mit diesem traditionellen Genre. Ein Roman handelt in der Regel von erfundenen Personen und Situationen. In Sinclairs Geschichte indessen sind die meisten Personen und Ereignisse der Wirklichkeit entnommen – nicht einmal die Namen wurden geändert. Nazi-Größen und britische Politiker, spanische Widerstandskämpfer und internationale Finanzmagnaten, die Schieber und die Opfer des großen politischen Spiels – sie alle erscheinen ungeschminkt und heißen Adolf Schicklgruber Hitler, Sir Basil Zaharoff, Hermann Göring, Sir John Simon, Putzi Hanfstaengl, General Francisco Franco und so weiter. Manche Opfer werden allerdings mit fiktiven Namen eingeführt; dennoch sind sie ebenso unverkennbar authentisch wie die berühmten Tyrannen und Ausbeuter. Ich habe Mädchen gekannt wie Trudi Schultz, die tapfere und kluge Anti-Nazi-Kämpferin. Auch der spanische Loyalist Raoul Palma kommt mir vertraut vor, und ich bin gar nicht überrascht, daß er den Helden des Buches einer außerordentlichen Frau vorstellt, deren Gesellschaft ich tatsächlich in Barcelona genossen habe – Constancia de la Mora, aus einer der berühmtesten Familien Spaniens stammend und voll und ganz der Sache des spanischen Volkes verschrieben.
Der junge Mann, der so grundverschiedene Bekannte hat wie Herrn Hitler und Señora de la Mora, Trudi Schultz und Basil Zaharoff, ist ein Amerikaner namens Lanny Budd, der es ganz sicher verdient, im guten, alten, sentimentalen Sinn des Wortes ein Held genannt zu werden. Die Leser von «Dragon's Teeth» und der vorhergehenden Teile von Upton Sinclairs epischem Zyklus kennen bereits diese anziehende Persönlichkeit samt seiner Gattin, der Multimillionärin Irma Barnes Budd. Im neuen Teil der Chronik ist Lanny vierunddreißig Jahre alt, sieht aber jünger aus – ein ewiger Jüngling. Wir treffen ihn zunächst wieder in Südfrankreich bei der Beerdigung seines alten Freundes Freddi Robin, der in einem Konzentrationslager der Nazis ermordet wurde. Unermüdlich reist Lanny durch Europa; überall hat er Kontakt mit den Männern der Macht und des Bösen und schmiedet Ränke gegen sie. Wir erleben ihn in Hitlers Refugium in den Bergen bei Berchtesgaden, wie er sich mit dem Führer unterhält – eine brillante Szene übrigens, obschon sie vielleicht etwas abfällt gegen das meisterhafte Porträt Görings in «Dragon's Teeth».
Lanny arbeitet mit dem deutschen Widerstand zusammen, eilt von Berlin nach Cannes, von Salzburg nach Paris, von London nach Italien, dann über den Atlantik nach New York, von dort wieder zurück nach Frankreich, von Paris nach Barcelona, Valencia und Madrid. Er ist smart und naiv, unentwegt enthusiastisch – allen, die gegen Faschismus und politischen Rückschritt kämpfen, ein hingebungsvoller, wahrhafter Freund. Verständlicherweise ist seine Frau leicht irritiert über seine sozialistischen Tendenzen und die anwachsende Zahl seiner linken Freunde. Besonders verübelt sie ihm seinen engen Kontakt mit Trudi Schultz, die für Lanny offenbar mehr ist als eine gewöhnliche Kameradin. Irma hat wirklich viele Gründe, beunruhigt zu sein, während ihre mondänen Freunde sie mit hinterhältigen Fragen bestürmen: «Warum, in aller Welt, solltest du diesem Mann trauen? … Und wie, glaubst du, fühlen wir uns, wenn man uns sagt, wir seien verwandt oder befreundet mit einem weltfremden Genossen von Mördern? Haben die Reichen denn gar keine Rechte, die ein junger Salonbolschewist respektieren muß?»
Aber der weltfremde Genosse setzt seine riskanten Aktivitäten mit unvermindertem Elan fort. Er schmuggelt Trudi Schultz aus dem Dritten Reich heraus. Er vollbringt ein atemberaubendes Kunststück nach dem anderen und benimmt sich überhaupt wie manche der hilfreichen Helden, die man aus den Comicseiten der Zeitungen kennt. Dank Lanny Budd nimmt Upton Sinclairs nüchterner Tatsachenbericht zeitweilig beinahe märchenhafte Züge an. Der junge Held lebt in der scheußlichen, erbarmungslosen Welt, die wir alle kennen und die von dem Chronisten mit großer Gewissenhaftigkeit und gleichsam wissenschaftlicher Präzision dargestellt wird. Es ist eine schmutzige, gefährliche Welt voller Kämpfe und Verrat; die Welt der deutschen Konzentrationslager, des Kriegs in Abessinien, der Tragödie in Spanien, der Schande von München. Aber Lanny, der kluge Beobachter und mutige Kämpfer, scheint mit seinen Handlungen und Gedanken eine zukünftige, bessere Welt vorwegzunehmen. Dasselbe gilt für seinen Schöpfer – Upton Sinclair, den beharrlichsten Kreuzritter und Geschichtenerzähler der modernen Literatur.
Surrealistischer Zirkus
Nicht alles, was Hitler als «Kulturbolschewismus» diffamiert, ist deshalb auch Kultur. Der Surrealismus beispielsweise ist es nicht. In der Tat ist nach meiner Überzeugung der Surrealismus von denselben Tendenzen geprägt, die sich politisch im Nationalsozialismus ausdrücken: Unvernunft, Negation und Vandalismus. Ist Hitlers Programm, in Hermann Rauschnings Worten, eine Revolution des Nihilismus, so ist der Surrealismus die Revolution des Nihilismus in der Kunst.
Mancher Leser mag geneigt sein, Surrealismus mit moderner Kunst im allgemeinen und abstrakter oder phantastischer Malerei im besonderen zu verwechseln. Das ist ein Mißverständnis. Es trifft auch nicht zu, daß Surrealismus das persönliche Steckenpferd eines genialen jungen Mannes namens Salvador Dalí ist. Obgleich Uneingeweihte den begabten Katalanen für die absolute Verkörperung des Surrealismus halten mögen, ist er in Wirklichkeit nicht einmal ein echter Surrealist. Darauf haben wir das Wort der Hohepriester dieses Kultes.
Der springende Punkt ist, daß es gar keinen Surrealismus gibt. Es gibt lediglich Surrealisten – eine Clique von Dichtern, Journalisten, Malern, Bildhauern und Einfaltspinseln, die zusammenhalten, gegenseitige Bewunderung heucheln und alle beleidigen, die nicht ihrem Kreis angehören. Gründer und Anführer der surrealistischen Gruppe ist ein französischer Kritiker und Visionär namens André Breton. Sein Adjutant ist Max Ernst, ein Maler deutscher Herkunft. Will man Surrealist werden – und das bringt gewisse soziale und emotionale Vorteile mit sich – braucht man den Segen dieser beiden Herren. Sie können jeden ablehnen, wie begeistert surrealistisch man auch sein mag in seinen Gedanken, im Verhalten und in seinen künstlerischen Schöpfungen.
Andererseits haben die Surrealisten die Angewohnheit, alle möglichen Berühmtheiten, tote wie lebendige, als Mitglieder ihres Clubs zu vereinnahmen. Das «surrealistische Taschenwörterbuch» – ja, das gibt es wirklich! – vermerkt ehrwürdige Namen wie Jonathan Swift («Ein Surrealist in seiner Boshaftigkeit») und den deutschen Dichter Friedrich Hölderlin («ein Surrealist in seinem Wahnsinn»). Weiterhin wurden adoptiert Pythagoras, Barnum und der Marquis de Sade. Seit das Hauptquartier der Surrealisten von Paris nach Manhattan verlegt wurde, haben Monsieur Breton und seine Gefährten auch «Father Divine» und Superman (nicht den von Nietzsche, sondern die Comic-Figur) entdeckt.
Es muß gesagt werden, daß die Ansammlung der nichtsahnenden, quasi durch Zuruf ernannten Surrealisten, einschließlich Chaplin, Lenin und Cagliostro, wesentlich bunter und interessanter ist als die wirkliche surrealistische Gruppe. Traurige Tatsache ist, daß die Clique um Breton und Ernst in jüngster Zeit viel von ihrem Glanz verloren hat; vielleicht gibt es in New York mehr Konkurrenz als in Paris. Man kann nicht sagen, daß der surrealistische Zirkus seinen Reiz völlig eingebüßt hätte – er blüht und gedeiht noch immer –, aber er ist nicht mehr das, was er einmal war.
Die ganze Sache begann, kurz bevor oder während der Erste Weltkrieg allmählich seinem Ende entgegenging. Damals entstanden ganz neue, radikale künstlerische Bewegungen. Was in dem Jahrzehnt zwischen 1910 und 1920 geschah, war wirklich eine künstlerische Revolution: man denke an den Kubismus in Frankreich, den Expressionismus in Deutschland, den Futurismus in Italien und den Konstruktivismus in Rußland. Hier ist nicht der Platz, um die Gefahren und Verheißungen zu diskutieren, die in diesen schöpferischen Experimenten angelegt waren. Ungeachtet ihrer Verdienste oder Fehler verdienen diese Versuche es zumindest, ernstgenommen zu werden. Maler wie der Italiener Giorgio de Chirico, der Russe Marc Chagall und vor allem das spanische Genie Pablo Picasso haben fraglos entscheidend dazu beigetragen, das künstlerische Bewußtsein dieser Epoche zu formen und auszudrücken.
Vielleicht waren sogar die turbulenten Einfälle einer Gruppe namens Dada nicht ohne Bedeutung für die Stimmungen und Strömungen der tragischen und aufgewühlten Phase zwischen 1917 und den frühen zwanziger Jahren. «Respektlosigkeit wurde zur allgemeinen Haltung», sagt uns André Breton in seinem Vorwort zu «Die Kunst dieses Jahrhunderts». Er fügt hinzu: «Die Negation der bisherigen Werte ist vollständig geworden; es handelt sich wirklich darum, tabula rasa zu machen. Die Verzweiflung war groß, und die einzige Hilfe, sie zu überwinden, war der ‹schwarze Humor›: In New York signierte Duchamp eine Reproduktion der ‹Gioconda›, nachdem er sie mit einem schönen Schnurrbart verziert hatte; in Köln mußte man, um eine Ausstellung von Max Ernst zu besuchen, durch eine öffentliche Bedürfnisanstalt hinein- und hinausgehen … In Paris entwarf Picabia ein ‹Bild›, das aus einem leeren, am Fußboden festgemachten Rahmen bestand, von einem Rand zum anderen mit Fäden verspannt, an dem dazu ein lebendiger Affe angekettet war.»
Das war Dada, der unmittelbare Vorläufer des Surrealismus.
Der Begründer des deutschen Dadaismus, Max Ernst, hatte seine Heimatstadt Köln satt und zog, gemeinsam mit seinem Dada-Kollegen Johannes Theodor Baargeld, nach Paris. Diese beiden schlossen sofort Freundschaft mit einer Reihe geistesverwandter Franzosen um Breton. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die surrealistische Clique hauptsächlich aus Literaten, unter ihnen begabte Schriftsteller wie Louis Aragon und der Dichter Paul Éluard. Zu denen, die sich in diesem frühen Stadium seines Experiments um Breton scharten, gehörten auch René Crevel und Philippe Soupault, beides hochbegabte Autoren. Später gesellten sich ein paar talentierte Maler dazu – Joan Miró aus Barcelona; Yves Tanguy, ein ehemaliger Beamter der französischen Handelsmarine; André Masson, französischer Maler und Graphiker, und einige mehr. Was Dalí betrifft, so «schmuggelte er sich 1929 in die surrealistische Bewegung ein», um Breton zu zitieren.
Die Surrealisten glaubten an die kreative Funktion von Paranoia, Schabernack und Publicity. Besonders zeichneten sie sich aus durch üble Streiche, die mutig zu sein schienen, in Wirklichkeit aber nur grausam und geschmacklos waren. Breton ging kein sonderlich großes Risiko ein, als er ein Interview mit dem großen französischen Schriftsteller André Gide fälschte (dessen berühmtester Roman zufällig «Die Falschmünzer» heißt). Auch brauchte es nicht viel Phantasie, einen kränklichen Dichter namens Jean Cocteau zu quälen, den sie sich als bevorzugtes Objekt ihrer Abneigung ausgesucht hatten. Cocteau, in mancher Hinsicht ein Vorläufer und erfolgreicher Rivale der Surrealisten, mag ein dekadentes Monstrum sein, aber er verfügt über zwei Eigenschaften, die den meisten Surrealisten offenbar abgehen: Er besitzt Genialität, und er ist ein liebevoller Sohn. Als die alte Madame Cocteau schwer krank war, erhielt Jean die telefonische Nachricht, sie sei gerade gestorben. Er eilte zum Haus seiner Mutter – wo ihn das hämische Gelächter von Bretons mitleidsloser Bande empfing.
Auch ihre antireligiösen Scherze und Aktionen waren mit keinem ernsthaften Risiko verbunden. Die Kirche war nicht in der Position, die Symbole des christlichen Glaubens gegen die dreisten Beleidigungen zu verteidigen. Wie einfach ist es doch, mutig zu sein in einem liberalen Land! Und wie schäbig!
Dalí mit seinem unfehlbaren Instinkt für Publicity spürte als erster, daß sie mit dieser Art Unfug nicht weit kommen würden – jedenfalls nicht auf Dauer und nicht in einer Stadt, die derartige Possen bereits satt hatte. Auf der Suche nach neuen Jagdgründen entdeckte er die Vereinigten Staaten, wohin er nicht nur die surrealistischen Finessen exportierte, sondern auch die Muse der Surrealisten – eine legendäre Dame namens Gala, eine Russin von ungewöhnlicher Phantasie und Dynamik. Sie war eine treue Anhängerin der surrealistischen Bewegung, zunächst in ihrer Eigenschaft als Madame Paul Éluard, später als unermüdliche Förderin des Talents von Max Ernst und schließlich als Madame Salvador Dalí.
Dalís amerikanische Karriere, bereits 1934 in die Wege geleitet, verlief höchst eindrucksvoll. Der verwegene junge Mann aus Katalonien erwies sich als Meister darin, Skandale zu provozieren und Neugier zu erregen. Was er auch tat, es wurde zum Stadtgespräch. Seine Experimente mit dem Dekorieren und Einwerfen von Schaufenstern, sein Traumpavillon und seine phantastischen Filme, seine Ballette «Bacchanale» und «Labyrinth» – beide von der Metropolitan Opera produziert –, sein Schmuck (entworfen in Zusammenarbeit mit dem Herzog de Verdura) – all diese Posen und Ungereimtheiten sprachen die Phantasie des naiven, nur zu empfänglichen Publikums an. Gleichzeitig allerdings wurde sein handwerkliches Können von anspruchsvollen Sammlern anerkannt und gut bezahlt.
Seine maßlose Popularität diesseits des Atlantiks ging den in Paris gebliebenen Surrealisten allmählich auf die Nerven. Zunächst hatten sie es für eine gute Idee gehalten, ihr nebulöses Anliegen in Hollywood und New York von Dalí populär machen zu lassen. Der Katalane ging für ihr Gefühl jedoch viel zu weit, als er sich als Repräsentant, ja sogar Erfinder, Eigentümer und überhaupt als die Verkörperung der surrealistischen Bewegung darstellte. Breton spürte, daß sein Schüler dabei war, ihm die Schau zu stehlen. Er exkommunizierte Dalí. Seine Leute überschütteten den überheblichen Dissidenten mit Beleidigungen. Sie schimpften ihn einen Verräter, einen Dilettanten, einen Franco-Agenten und – der Gipfel aller Beleidigungen – einen Akademisten.
Genau zu der Zeit, als Dalí die surrealistische Welle in Amerika inszenierte und ausbeutete, in den Jahren um 1938/39, wurde Bretons Lage in Paris zunehmend verzweifelter. Es schockierte niemanden mehr, wenn die überspannten und nunmehr alternden jungen Männer ihre wütenden Schimpftiraden gegen Gott und die französische Akademie schleuderten, gegen den Völkerbund und das russische Ballett, Cézanne und die Bank von England. Nach und nach zogen sich die begabtesten Schriftsteller aus dem Kreis zurück. Der erste Deserteur war Philippe Soupault, der zum professionellen Journalismus zurückfand. René Crevel, der reinste und liebenswerteste von allen, beging Selbstmord und hinterließ auf seinem chaotischen Schreibtisch die schreckliche Botschaft: «Mich ekelt alles an.» Louis Aragon entsagte den makabren Überspanntheiten und schloß sich der disziplinierten Familie von Väterchen Stalin an. Desgleichen Paul Éluard, den die Surrealisten aus unerfindlichen Gründen «Amme der Sterne» nannten.
Eine Katastrophe von apokalyptischem Ausmaß bedrohte Europa und die Welt. Aber Breton und seine ausgelaugte Gefolgschaft machten unverdrossen weiter Propaganda für ihre geschmacklose Mischung aus Marxismus und Paranoia, aus Varieté und Psychoanalyse. Als die Nazihorden in Österreich, in die Tschechoslowakei, in Norwegen und in die Niederlande einmarschierten, verbreiteten die Surrealisten weiterhin ihre Bösartigkeiten und Absurditäten. Die drohende Katastrophe erschütterte unsere Zivilisation, aber die unermüdlichen Salon-Anarchisten blieben bei ihren gräßlichen Spielen und schrien sogar nach noch mehr Chaos.
Sie sollten es bekommen. Die Maginot-Linie erwies sich als eine Schimäre – wie ein von Ernst oder Dalí beschworenes Hirngespinst. Kurz, die Lage sah recht düster aus für diese verwöhnten «enfants terribles» einer kosmopolitischen Kaffeehausgesellschaft. Den Surrealisten gelingt es jedoch, stets der Tragödie auszuweichen. Ihr Glück erscheint nahezu surreal. Millionen sterben, die Welt fällt in Scherben, doch Bretons Gruppe wird auf den Schwingen eines hilfreichen Engels in Sicherheit gebracht.
In diesem Fall handelte es sich um Peggy Guggenheims Schwingen. Sie nahm nicht nur den surrealistischen Messias und seinen Propheten, d.h. Breton und Ernst, unter ihre Fittiche, sondern auch eine ganze Reihe ihrer Freunde. Die Gruppe belegte den Großteil der Sitze und Betten eines transatlantischen Klippers. Kurz nachdem Marschall Pétain sein Abkommen mit Hitler unterzeichnet hatte, unterschrieb die amerikanische Lady einen Scheck, und die surrealistische Familie erhob sich in die Lüfte. Max Ernst heiratete Miss Guggenheim, und der Surrealismus startete in seine amerikanische Phase – mit einem der großen amerikanischen Vermögen zu seiner Verfügung.
Also kann die ganze Show in den Vereinigten Staaten von vorn beginnen, mit solidem Hintergrund und greller Reklame. War der Surrealismus schon vor dem Krieg jämmerlich passé auf dem Montmartre und in Montparnasse, bieten sich nun neue Lebenschancen in der Park Avenue und den Galerien der 57. Straße. Schockiert und amüsiert erleben die Amerikaner eine Neuauflage der altbekannten Tricks: der extravaganten Publikationen und komplizierten Intrigen, des lautstarken künstlerischen Snobismus, der Kämpfe, des prätentiösen Lärms und der ganzen Aufgeregtheit. Natürlich müssen einige der gewagteren Dinge geopfert werden – das antikapitalistische und antireligiöse Zeug zum Beispiel dürfte für den Geschmack der Park Avenue eine Spur zu scharf sein.
Aber man hat eine Menge Spaß im Namen der Kunst, auch ohne grobe Blasphemien und rote Fahnen. Ein kompliziertes Netz an sozialen Vorrechten und Eifersüchteleien wird ausgeklügelt und weitergesponnen. Wen kann man gegen wen ausspielen? Was kann man tun, um den Erzschurken Dalí zu kompromittieren? Was geschieht mit den amerikanischen Naiven – entdeckt und hochgelobt von dem Kritiker und Kunstsammler Sidney Janis? Soll man ihnen Zutritt gewähren in das Guggenheim-Museum «Art of This Century»? Die Naiven könnten in der Ausstellung zu elegant und dekadent wirken mitten unter den farbenprächtigen Spielzeugen. Die Guggenheim-Galerie gleicht dem Amüsierpark einer zweitrangigen Weltausstellung, sagen wir in Mexico City oder Bukarest, mit allen möglichen sich drehenden Rädern, wechselnden Lichtern und mechanischen Tricks. Verborgen in all dem kann der Kenner allerdings ein paar wirklich ausgezeichnete Bilder von Chagall, de Chirico, Klee oder Braque entdecken.
Selbstverständlich unterhält die amerikanische Fortsetzung der surrealistischen Bewegung eine eigene kleine Zeitschrift. Sie heißt «View», und der Herausgeber ist ein junger Mann namens Charles Henry Ford. Sie ist außerordentlich drollig. Besonders gefiel mir die Ausgabe, in der ein Mr. Calas als Gastredakteur zeichnete. Der Leitartikel bestand aus einem Interview, das Mr. Breton Mr. Calas gewährte. Mr. Calas versichert uns, daß Mr. Breton ihm versicherte, daß die Herren Breton und Calas beide große Dichter seien. Es gab auch erbauliche Passagen über die «wahrhaftig surrealistische Flora» in der Umgebung New Yorks. Die ganze Nation wird begeistert sein zu erfahren, daß Breton vom Hudson River «kolossal» angetan war und bereits seinen «Einstand in die Geheimnisse der amerikanischen Schmetterlinge» feierte. Mr. Calas' letzte Frage lautete, ob Mr. Breton ein drittes Manifest des Surrealismus in Ordnung fände. «Absolut!» erwiderte Breton.
Warum sollten diese Leute nicht eine schöne und fröhliche Zeit verbringen, trotz Krieg und Hitler und anderer Ärgernisse? Man kann doch nichts Ernsthaftes einwenden gegen ihre harmlosen Spielchen. Es ist doch nichts dabei, eine surrealistische Ausstellung ihrer «Ersten Papiere» unter der Schirmherrschaft des «Coordinating Council of French Relief Societies» abzuhalten. Man bedenke die grundsätzliche Unschuld von: «Sein Knäuel: Marcel Duchamp.» «Sein Knäuel» ist ein höchst verblüffender surrealistischer Trick – eine Art Labyrinth, durch das die Besucher ihren Weg finden müssen. Marcel Duchamp, der Erfinder dieses Kunststücks, bezeichnet sich selbst als «französischer Maler, Kubist, Dadaist, Künstler und Anti-Künstler».
Das letzte Wort gibt den entscheidenden Hinweis. Ich bin gegen Surrealismus, weil ich für die Kunst bin. Anti-Künstler sind gerade im Begriff, die Welt zu zerstören. Hitler und Göring sind Anti-Künstler. Ebenso Laval, Franco und Mussolini. Surrealismus ist nicht die Krankheit, aber eines ihrer Symptome. Die Krankheit heißt Faschismus, die Revolution des Nihilismus. Die Surrealisten sind die Nihilisten der Kunst.
«Das Problem mit den Surrealisten war», meint Gertrude Stein, im allgemeinen nicht gerade konservativ in ästhetischen Dingen, «daß sie den richtigen Moment verpaßten, kultiviert zu werden … Sie wollten Publicity statt Kultur, und deshalb haben sie es nie geschafft, friedlich und erregend zu sein.»
Weit davon entfernt, friedlich und erregend zu sein, werden die Surrealisten immer langweiliger und bleiben dabei laut und derb. Nichts ist ermüdender als die Klischees des Wahnsinns. Vielleicht ist die Venus von Milo als obligatorische Schönheitsnorm langweilig, und die Surrealisten verspotten sie zu Recht. Doch was bieten sie an als Ersatz für das zerstörte Ideal? Eine Venus mit drei Profilen, einem Fischschwanz, mit Augen voller Ungeziefer und einem Klavier anstelle des Busens. Nichts als ein neues Klischee, ein neuer Schwindel.
Die Surrealisten wiederholen sich mit ermüdendem Eigensinn. Sie wollen einfach nicht einsehen, daß ihre Zeit vorbei ist. Sie begreifen nicht, daß ihre Spielereien albern wirken vor dem Hintergrund einer weltweiten Katastrophe. Mangelte es ihnen nicht an jeglichem Taktgefühl, so wüßten sie, wie töricht es ist, den Marquis de Sade zu bewundern, während sadistische Horden dabei sind, aus der Zivilisation einen Trümmerhaufen zu machen.
Die Frage ist nicht, ob und inwiefern die Surrealisten Künstler sind in ihrem Metier als Dichter, Maler, Schriftsteller und Kritiker. Einige sind, wie ich meine, recht talentiert – Yves Tanguy beispielsweise besitzt echte poetische Qualität; oder auch Dalí, wenn er gut ist. Nein, in ihrer Eigenschaft als Kreuzritter richten sie Schaden an. Die Gruppe um Breton und ihre Anhänger behaupten nach wie vor, sie hätten eine Aufgabe. Sie sehen sich als Erneuerer, als Anführer einer revolutionären Bewegung.
Doch welche Art von Revolution verkündet sie eigentlich? Einen Umsturz ohne feste Ziele, ohne durchführbares Programm. Seine sämtlichen Behauptungen bestehen aus Negationen, das Ganze läuft auf eine Farce hinaus. Er richtet sich nicht gegen eine bestimmte Ordnung, sondern gegen Ordnung und Vernunft an sich.
Diese Tendenzen findet man implizit in ihrer Prosa und ihrer Poesie, in ihrer Malerei und Musik, ihrer Bildhauerei und in ihren grotesken und wenig komischen Scherzen. Explizit formuliert sind sie in den surrealistischen Verlautbarungen. Mr. Calas in seiner Rolle als Bretons Agent für Öffentlichkeitsarbeit vermittelt Surrealismus als «die Revolte gegen die Schönheit». In «New Directions» huldigt er der Bewegung auch als Revolte gegen intellektuelle Verantwortung – «Der Verantwortung setzen die Surrealisten Offenbarung entgegen» – und als Revolte gegen den Humanismus. «Wieder einmal», sagt Calas, «naht das Ende des Humanismus. Ich muß Ezra Pound recht geben …»
Wie allgemein bekannt, ist Mr. Pound ein faschistischer Agent. Die Herren Calas und Breton und Ernst und ihr ganzer surrealistischer Klüngel sind nichts dergleichen. Ohne Zweifel verabscheuen sie den Faschismus von ganzem Herzen. Und doch haben ihre Methoden und ihre Philosophie dem Nazismus verwandte Züge. In ihrem eigenen, verkleinerten Rahmen sind sie ebenso brutal und verantwortungslos, ebenso lautstark und unklar, ebenso schlau und konfus wie der große Führer. Es wäre ganz und gar geschmacklos und unangemessen, eine Handvoll emigrierter Künstler und ihre verwirrten amerikanischen Freunde mit den teuflischen Nazis zu vergleichen. Ich versuche lediglich, die subtile, dabei tiefgehende Affinität aufzuzeigen zwischen der mörderischen Destruktion der Nazis und der verspielten Destruktion – von Werten, Formen, Gefühlen und tiefverwurzelten Empfindungen – bei bestimmten künstlerischen Bewegungen, von denen der Surrealismus das jüngste und auffälligste Beispiel darstellt.
Unsere Zivilisation ist viel zu sehr von dunklen, irrationalen Kräften bedroht, als daß man Logik und Harmonie niederschreien dürfte. Breton möchte, daß der Künstler schöpferisch ist, «völlig frei von dem Diktat der Gedanken, frei von jeglicher Vernunft und jeder ästhetischen oder moralischen Verpflichtung». Das ist ein schlechter Rat. Dieser blutbefleckte und vom Wahnsinn besessene Planet ist nur allzu frei von Vernunft und Moral.
Es kann und darf nicht der Zweck der Kunst sein, das gegenwärtige Chaos zu idealisieren und zu vermehren. Ihre Aufgabe sollte vielmehr darin bestehen, den allmählichen Wiederaufbau vorauszuahnen und anzuregen, der beginnen wird, wenn wir endlich «sein Knäuel», die düstere und unbegreifliche Zeit des verrückten kleinen Gefreiten, hinter uns haben.
Ich bin gegen Surrealismus, weil ich gesehen habe, wie die Welt aussieht «frei von jeder ästhetischen oder moralischen Verpflichtung». Sie gleicht der Hölle oder einem surrealistischen Gemälde.
Heinrich Heine als Essayist und Prophet
Möglicherweise wird Heinrich Heine als Dichter schon immer überschätzt; als Essayist und Kulturkritiker wird er jedenfalls nicht gebührend gewürdigt. Mögen auch die Verse Hölderlins und Novalis' eine Größe und Authentizität haben, wie sie Heines Lyrik oft fehlt, so ist es ebenso zutreffend, daß kein deutscher Dichter und nur sehr wenige europäische Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts sich mit Heine messen können auf dem Gebiet der Essayistik: Er übertrifft sie alle an politischer Klugheit und poetischem Charme.
E.B. Ashtons neue Übersetzungen in dem von Hermann Kesten herausgegebenen Auswahlband sind außerordentlich gelungen: Sie vermögen die besondere Melodie von Heines Stil beizubehalten – diese unverwechselbare Mischung aus Ironie und Anmut, aus frivolen und lyrischen Tönen. Welch heikle Aufgabe – jeweils das englische Äquivalent zu finden für unzählige Schattierungen von wilder Aggressivität bis zu grüblerischer Melancholie, von beißendem Sarkasmus bis zu prophetischer Inspiration.
Kesten, wie Heine ein deutscher Kosmopolit im Exil, ist nicht nur ein begeisterter Verehrer und kompetenter Kenner von Heines Werk, sondern in mancher Hinsicht auch ein legitimer Erbe von Heines Ideen und seiner literarischen Eigenart. Kestens biographische Einführung ist eine wirklich brillante Arbeit – formuliert im wahrhaft Heineschen Geist; sachlich und funkelnd zugleich, elegant und präzise. Kesten präsentiert uns Heine als beredten Humanisten und boshaften Spötter; er liefert uns Beispiele für Heines einnehmenden Witz und für seinen strengen, scharfsinnigen Realismus. Es gibt Heine als politischen Kommentator mit solch großartigen Texten wie «Freiheit und Nationalcharakter» (aus «Englische Fragmente», 1831) und «Das ist die Konterrevolution» (aus «Französische Zustände», 1833), und es gibt Heine als Reporter mit einem sehr modernen, mitreißenden und rationellen Stil: Jeder Auslandskorrespondent des Jahres 1943 könnte stolz sein, etwas geschrieben zu haben wie «Die Cholera in Paris» – eine eindrucksvolle Schilderung der Seuche, die 1832 in der französischen Hauptstadt wütete.
Er ist romantisch und populär im «Holländischen Divertimento», das Richard Wagners «Fliegendem Holländer» zugrunde liegt, gespenstisch und makaber in «Die bleiche Josepha» – einem äußerst unheimlichen Kapitel aus seinen unvollendeten Memoiren. Heiteren Witz und idyllische Schönheit findet man in Texten wie «Abschied von Göttingen» und «Der verstorbene Dr. Ascher» (beide aus «Die Harzreise», 1826), und bewegend tragische Töne dominieren in «Sie waren Emigranten» – einer schlichten, unvergeßlichen Beschreibung deutscher Flüchtlinge auf dem Weg nach Algier.
Ganz besonders gelungen ist die Auswahl literarischer Essays –das anmutige Porträt Jessicas (aus «Shakespeares Mädchen und Frauen», 1838), eine äußerst anregende Skizze «Zur Lektüre Cervantes'» (aus «Die Stadt Lucca», 1831) und – vielleicht noch interessanter, was das Thema betrifft – zwei Studien über Kant und Goethe (aus «Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland» und «Die romantische Schule»). Heines ambivalente Haltung Goethe gegenüber enthüllt zugleich Widersprüche und Gegensätzlichkeiten seines eigenen Charakters. Der Goethe-Essay in diesem Band hat einen beinah feindseligen Ton. Dennoch war Heine zweifellos aufrichtig, als er 1821 an den Olympier in Weimar schrieb: «Ich küsse die heilige Hand, die mir und dem ganzen deutschen Volk den Weg zum Himmelreich gezeigt hat …» Und einige Jahre später war es weder geprahlt noch geheuchelt, als er einen Brief an seinen Freund Varnhagen von Ense mit den stolzen und einfachen Worten schloß: «Wolfgang Göthe mag immerhin das Völkerrecht der Geister verletzen; er kann doch nicht verhindern, daß sein großer Name einst gar oft zusammen genannt wird mit dem Namen H. Heine.»
Heine erweist sich als fast unfehlbar scharfsinnig, wenn er sich mit der komplizierten und interessanten Problematik des deutschen Wesens befaßt. Vielleicht der bedeutendste seiner Essays ist «Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland» (1835). Diesem Buch entnahm Kesten die Abhandlungen über Luther und Kant und auch die bezeichnende Passage über die «deutsche Revolution» – die mit einer ernsten Warnung an die Franzosen endet. Heine wirkt geradezu wie ein Prophet, wenn er seine französischen Freunde eindringlich warnt, vor den Deutschen auf der Hut zu sein. «Haltet Euch immer gerüstet», rät er ihnen, «bleibt ruhig auf Eurem Posten stehen, das Gewehr im Arm. Ich meine es gut mit Euch, und es hat mich schier erschreckt, als ich jüngst vernahm, Eure Minister beabsichtigten, Frankreich zu entwaffnen.» Wann schrieb er diesen Satz nieder? Im Jahr 1834? Oder hundert Jahre später?
Kesten dokumentiert einige der unglaublichen Prophezeiungen aus Heines Buch «Lutetia», worin ein schrecklicher Krieg vorausgeahnt wird, in dem Frankreich «in der kläglichsten Weise seine politische Existenz einbüßen» könnte. «Doch das wäre», fährt Heine fort, «nur der erste Akt des großen Spektakelstücks, gleichsam das Vorspiel. Der zweite Akt ist die europäische, die Weltrevolution, der große Zweikampf der Besitzlosen mit der Aristokratie des Besitzes …» Und dann weiter: «Die Zukunft riecht nach Juchten, nach Blut, nach Gottlosigkeit und nach sehr vielen Prügeln. Ich rate unsern Enkeln, mit einer sehr dicken Rückenhaut zur Welt zu kommen.» Diese Worte schrieb er im Jahre 1842!
Nazi-Bedrohung in England
John Boynton Priestley gibt es sozusagen zweimal: einmal als kraftvollen Dramatiker und Romancier bester englischer Tradition; und zum zweiten als eine politische Autorität mit bedeutendem Einfluß – die aktivste und bemerkenswerteste Persönlichkeit in der englischen Literatur der Kriegszeit.
«Black Out in Gretley» erscheint auf den ersten Blick eindeutig als Werk des ersteren, eine routinierte und kompetente Arbeit, wie man sie vom Autor der «Engelgasse» erwarten kann. Priestley zeigt sich von seiner besten Seite, das heißt, der Roman ist ziemlich gut, aber eigentlich nicht außergewöhnlich vom künstlerischen oder psychologischen Gesichtspunkt her. Dabei gibt es nichts Gewöhnliches an dieser glänzend gemachten «Geschichte über und für die Kriegszeiten». Priestley verfügt nicht nur über eine fundierte, solide Begabung, sondern auch über viel literarischen Geschmack und Erfahrung. Er ist niemals schlecht und ganz bestimmt niemals holprig; allerdings sind seine Kunstgriffe manchmal ein wenig offensichtlich.
Wie exzellent konstruiert! – dieser grimmige Tatsachenbericht über die Aktivitäten der Fünften Kolonne in einer mittelgroßen englischen Industriestadt. Dieses Gretley ist ein deprimierender Ort – voller Geflüster und Geheimnisse –, an dem sich der Held und Erzähler der Geschichte auf der Jagd nach Nazi-Agenten befindet – im Auftrag der britischen Gegenspionage. Sein Name ist Humphrey Neyland, und er ist Kanadier, «grobknochig, dunkel, mit einem länglichen Gesicht, vorzugsweise mürrisch, eher intelligent als feinfühlig …»
Und genau so erzählt er seine Geschichte, mehr mit Intelligenz und drastischem Realismus als mit Charme und Feinfühligkeit. Nichtsdestoweniger ist Humphrey Neyland – beziehungsweise J.B. Priestley – auffallend gut in der Einführung und Beschreibung von Personen: sie sind alle absolut lebendig, die Schurken ebenso wie ihre Opfer. Welch unheimliche Schar! Sie könnten zur Handlung eines erstklassigen Spionagethrillers von Alfred Hitchcock gehören – zum Beispiel die Verdächtigen, die sich als unschuldig erweisen, wie Mrs. Yesmond vom Hotel «Queen of Clubs», die vermeintliche Anführerin der Fünften Kolonne, die jedoch in Wirklichkeit «nur ein bißchen auf dem Schwarzmarkt herumspekuliert, nur eine hübsche, luxuriöse und lüsterne Ratte ist». Oder die scheinbar harmlosen, ja sogar seriösen Damen und Herren, die ihre Schlechtigkeit hinter raffinierten Verstellungen aller Art verbergen: Diana Axton, die sich wie eine wagnersche Heroine fühlt und mit Hilfe eines «harmlosen Andenkengeschäfts am Marktplatz» den Nazibossen zu Diensten steht; Joe, «der Mittelpunkt jeder Party, in seiner Bar im ‹Queen of Clubs›, wo die Drinks reichlich fließen und die Jungs von der Air Force und der Army, ohne es zu wollen, ein wenig aus der Schule plaudern»; Mademoiselle Fifine, eine Akrobatin, die eine Varietébühne für die Kommunikation mit ihren Mitverschwörern benutzt; und schließlich Oberst Tarlington, der ehrenwerte Bürger und eiserne Nationalist, der in seinem Haus den Anführer aller Nazi-Intrigen von Gretley beherbergt – Kapitän Felix Rodel aus Deutschland.
Oberst Tarlington ist ein böse und gefährlich gewordener Oberst Blimp. Zweifellos ist es ziemlich wagemutig von Priestley, einen rigiden britischen Konservativen als feindlichen Agenten zu präsentieren. Er tut das keineswegs nur im Hinblick auf ein effektvolles Finale, sondern aus ganz ernsthaften, wohlüberlegten Gründen. Der Roman «Black Out in Gretley» richtet sich nämlich gegen Oberst Tarlington und seinesgleichen. Was wie ein anspruchsloser Thriller aussieht, entpuppt sich als ein Dokument von politischer Bedeutung – eine Demaskierung und Anklage bestimmter Repräsentanten der englischen Oberschicht und der «holzköpfigen Art, mit der sie diesen Krieg führen, in altbewährter Manier alles verpfuschen und durcheinanderbringen und den Menschen Enttäuschungen bereiten». So verbündet sich in diesem Roman Priestley Nummer zwei mit Priestley Nummer eins. Oder besser gesagt, der politische Kritiker und Propagandist Priestley benutzt den bewährten Unterhaltungskünstler Priestley zur Veranschaulichung seiner ernsten und packenden Botschaft.
Die Erziehung Deutschlands
Eine seltsame Kontroverse hat sich vor kurzem unter hierzulande lebenden deutschen Emigranten entwickelt. Alles begann mit einer Rede, die Emil Ludwig anläßlich einer «Win the War – Win the Peace»-Konferenz in Los Angeles gehalten hatte. Die Hauptpunkte von Ludwigs Ansprache wurden an die «New York Times» telegraphisch übermittelt und erschienen dort unter der Überschrift: «Kampf dem deutschen Volke, verlangt Ludwig». Diesem fragmentarischen Bericht zufolge kennzeichnete der bekannte Biograph Stalins und Verfasser von «The Mediterranean» das deutsche Volk als «Kriegernation» und schlug vor, daß nach Hitlers Niederlage eine kleine Armee von Professoren und Pädagogen aus den alliierten Ländern mit der mühsamen Aufgabe betraut werde, die Teutonen zu zivilisieren. Ohne einen derartigen Beistand, sagte Ludwig, käme die «Herrenrasse» nie zur Besinnung: «Religion, Geschichte und Philosophie – sie alle basieren auf Grundsätzen, die dem deutschen Charakter fremd sind.»
Die Polemik gegen diesen Vortrag – oder vielmehr gegen die unzureichenden, damals in New York zu lesenden Zitate daraus – wurde in den Spalten einer deutschjüdischen Wochenzeitung, «Aufbau/Reconstruction», eröffnet. Ein nichtjüdischer deutscher Emigrant – ein Geist allerersten Ranges und ein Mann von unbestreitbarer Integrität –, Paul Tillich, Professor am Union Theological Seminary, teilte entrüstet mit, daß er Emil Ludwigs Auffassungen mißbilligte. «Ein Satz wie ‹Hitler ist Deutschland›», schreibt der empörte Professor, ‹ist dem Arsenal der törichtsten antisemitischen Propaganda entnommen, nur dieses Mal nicht gegen die Juden, sondern gegen die Deutschen gerichtet.»
Diese erstaunliche These, in der Hitlers antisemitische und Ludwigs antideutsche Einstellung auf eine Stufe gestellt werden, bildet den Kern von Tillichs Argumentation. Wenn man das deutsche Volk unterschiedslos wegen eines einzigen Bösewichts, nämlich Adolf Hitler, diffamiert, verfährt man – Tillichs Ansicht zufolge – genauso unfair, wie wenn man die Verbrechen einzelner Juden gegen die jüdische Rasse und die jüdische Religion ins Feld führt. Der Professor forderte alle seine jüdischen Freunde auf, sich offen und nachdrücklich gegen Ludwig zu erklären; sonst würde er, Tillich, sich außerstande sehen, seinen Kampf gegen den Antisemitismus fortzusetzen. Am Schluß seines Aufsatzes sprach er jenen Männern und Frauen seine Anerkennung aus, die ihr Leben riskieren, indem sie innerhalb Deutschlands um die Seele und die Zukunft des deutschen Volkes kämpfen.