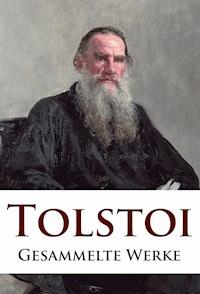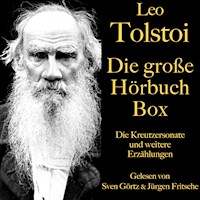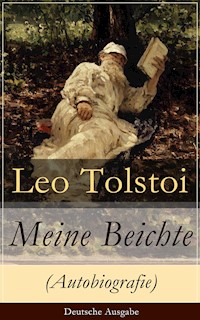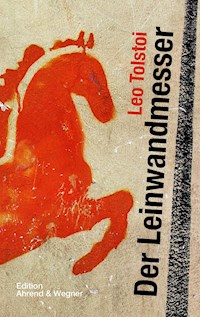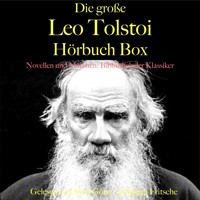Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Moskau in den 1880er Jahren: Der etwas über 30 Jahre alte Fürst Nechljudov nimmt als Geschworener an einem Moskauer Raubmordprozess teil. Angeklagt ist die 27jährige Prostituierte Maslova. Nechljudov erkennt die Frau wieder. Wenige Jahre zuvor hatte er eine Affäre mit ihr gehabt und sie danach übereilt verlassen. Maslova wird unschuldig zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Der Fürst Nechljudov wird nun von Gewissensbissen geplagt. Er fühlt sich dafür verantwortlich, dass die Frau zu einem Opfer der russischen Willkürjustiz werden konnte. Intensiv setzt er sich für die Aufhebung des Urteils gegen Maslova ein, scheitert jedoch. Schließlich wird das Urteil abgemildert. Maslova muss keine Zwangsarbeit leisten, wird aber nach Sibirien verbannt. Nechljudov entschließt sich, der Verbannten nach Sibirien zu folgen und ihr die Heirat anzubieten. Der Roman »Auferstehung« von Leo Tolstoi erschien 1899. Tolstoi verlegt seine Auferstehung des Menschen Nechljudov im Gegensatz zur christlichen Ostergeschichte in das Diesseits. »Auferstehung« war der letzte Roman von Leo Tolstoi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Auferstehung
TitelseiteErster Teil1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859Zweiter Teil12345689101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142Dritter Teil134567910111213141516171819202122232425262728ImpressumLeo Tolstoi
Auferstehung
Roman
»Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich sündigt, verzeihen? Bis auf siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis auf siebenmal, sondern bis auf siebzigmal sieben.« (Ev. Matthäi, XVIII, 21–12.)
»Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, des Balkens aber in deinem Auge achtest du nicht?« (Ev. Matthäi, VII, 3.)
»Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« (Ev. Johannis, VIII, 7.)
»Der Jünger ist nicht über seinen Meister; jeder Vollkommene aber wird wie sein Meister sein.« (Ev. Lucä, VI, 40.)
Erster Teil
1
Wie sehr sich die Menschen auch mühten, nachdem sich ihrer einige Hunderttausend auf einem kleinen Raume angesammelt hatten, die Erde, auf der sie sich drängten, zu verunstalten; wie sehr sie den Boden mit Steinen zurammelten, damit nichts darauf wachse, wie eifrig sie ihn von jedem hervorbrechenden Gräschen reinigten, wie sehr sie mit Steinkohlen, mit Naphtha dunsteten, wie sie auch die Bäume beschnitten, alle Tiere und Vögel verjagten – der Frühling war doch Frühling, sogar in der Stadt! Die Sonne wärmte, das neu auflebende Gras wuchs, grünte überall, wo man es nicht weggekratzt hatte, nicht nur auf den Rasenstücken der Boulevards, sondern auch zwischen den Steinplatten; Birken, Pappeln, Traubenkirschen ließen ihre klebrigen, duftigen Blätter sich entfalten; die Linden schwellten ihre berstenden Knospen; Dohlen, Spatzen und Tauben bereiteten schon frühlingshaft fröhlich ihre Nester; Bienen und Fliegen summten, von der Sonne erwärmt, an den Wänden. Fröhlich waren die Pflanzen, die Vögel, die Insekten, die Kinder. Nur die Menschen, die großen erwachsenen Menschen hörten nicht auf, sich und einander zu betrügen und zu quälen. Die Menschen glaubten, daß nicht dieser Frühlingsmorgen heilig und wichtig sei, nicht diese Schönheit der Gotteswelt, die zum Heil aller Wesen gegeben ist – die Schönheit, die zum Frieden, zur Eintracht, zur Liebe geneigt macht, sondern heilig und wichtig war das, was sie selbst sich ausgedacht hatten, um übereinander zu herrschen. So wurde in dem Bureau des Gouvernementsgefängnisses nicht für heilig und wichtig gehalten, daß allen Tieren und Menschen die Rührung und die Freude des Frühlings gegeben ist, sondern für heilig und wichtig ward gehalten, daß abends zuvor ein mit Nummer, Siegel und Überschrift versehenes Papier eingegangen war, darüber, daß zu neun Uhr morgens an diesem Tage, dem 28. April, drei sich in Untersuchung befindende und im Gefängnis gehaltene Gefangene – zwei Frauen und ein Mann – vorgeführt werden sollten. Eine dieser Frauen mußte als die wichtigste Verbrecherin abgesondert vorgeführt werden. Und nun kam auf Grund dieser Vorschrift um acht Uhr morgens am 28. April der Oberaufseher in den stinkenden Korridor der weiblichen Abteilung herein. Gleich hinter ihm betrat den Korridor eine Frau mit zerquältem Gesicht, mit grauen, krausen Haaren, die eine Jacke mit Tressen an den Ärmeln und einen Gürtel mit blauer Borte trug. Es war die Aufseherin.
»Wollen Sie die Maslowa haben?« fragte sie, indem sie sich mit dem diensthabenden Aufseher einer der Zellentüren näherte, die sich in den Korridor öffneten.
Der Aufseher schloß, laut mit seinen Schlüsseln rasselnd, auf, und nachdem er die Tür der Zelle geöffnet hatte, aus welcher eine noch übler riechende Luft strömte als die im Korridor, schrie er:
»Maslowa, vor Gericht!« und er machte die Tür wieder zu und wartete.
Sogar auf dem Gefängnishofe war frische, belebende, vom Winde in die Stadt getriebene Luft. Im Korridor aber herrschte eine niederdrückende, typhöse Luft, die vom Geruch der Ausleerungen, von Teer und Fäulnis gesättigt war und jeden Neuangekommenen sogleich in Niedergeschlagenheit und Betrübnis versetzte. Das erfuhr an sich selbst die vom Hofe gekommene Aufseherin, trotzdem sie an die schlechte Luft gewöhnt war. Sie empfand plötzlich, als sie in den Korridor eingetreten war, Müdigkeit und wurde schläfrig.
In der Kammer hörte man ein hastiges Getriebe, weibliche Stimmen und Schritte nackter Füße.
»Immer rasch! Du da, rühr' dich! Maslowa, sag' ich«, schrie der Oberaufseher in die Zellentür.
Nach etwa zwei Minuten kam aus der Tür lebhaften Schrittes ein nicht gerade hochgewachsenes, sehr vollbusiges junges Frauenzimmer im grauen Gefängniskaftan über einer weißen Jacke und weißem Rock. Sie drehte sich rasch um und stellte sich neben den Aufseher. An den Beinen trug sie leinene Strümpfe, darüber Gefängnispantoffeln; der Kopf war mit einem weißen Halstuch umbunden, unter welchem die Ringel der krausen, schwarzen Haare augenscheinlich mit Absicht hängen gelassen waren. Das ganze Gesicht der Frau war von der besonderen Weiße, die sich auf den Gesichtern von Menschen einzustellen pflegt, die lange Zeit hinter Schloß und Riegel zugebracht haben, und die an Kartoffelkeime im Keller erinnert. Ebenso sahen auch die kleinen breiten Hände aus und der volle weiße Hals, der aus dem großen Kragen des groben Kaftans hervorguckte.
In diesem Gesicht überraschten bei der matten Blässe besonders die sehr schwarzen, glänzenden, etwas geschwollenen, aber sehr lebhaften Augen, von denen eins ein wenig schielte. Sie hielt sich sehr gerade, indem sie die volle Brust herausdrückte. Nachdem sie auf den Korridor herausgetreten, sah sie, ihren Kopf etwas zurückwerfend, dem Aufseher gerade in die Augen und blieb stehen, voller Bereitwilligkeit, alles zu erfüllen, was man von ihr verlangen würde.
Schon wollte der Aufseher die Tür zuschließen, als sich daraus das runzelige, blasse und strenge Gesicht einer barhäuptigen grauen Alten, hervorstreckte. Die Alte begann der Maslowa etwas zu sagen. Aber der Aufseher drückte die Tür gegen den Kopf der Alten, und der Kopf verschwand.
Laut lachte in der Kammer eine weibliche Stimme. Auch die Maslowa lächelte und drehte sich nach dem Gitterfensterchen in der Tür um.
Von der andern Seite drängte sich die Alte an das Fensterchen, und mit heiserer Stimme sagte sie:
»Vor allem eins: sag' nichts Überflüssiges, bleib immer bei einem, und damit gut!«
»Wäre nur ein Ende – schlimmer wird es wohl nicht sein«, sagte die Maslowa, den Kopf schüttelnd.
»Ein Ende gewiß, aber nicht zwei«, bemerkte der Oberaufseher mit obrigkeitsmäßiger Überzeugtheit von seinem Witz. »Mir nach, marsch!«
Das durch das Fensterchen sichtbare Auge der Alten verschwand, und die Maslowa ging nach der Mitte des Korridors; mit raschen kleinen Schritten folgte sie dem Oberaufseher auf dem Fuße, und so stiegen sie die steinerne Treppe hinunter und gingen an den noch mehr als die Weiberzellen stinkenden und lärmenden Männerzellen vorbei, aus welchen sie überall die Augen in den Guckfenstern der Türen begleiteten, und in das Bureau, wo schon zwei Eskortesoldaten mit Gewehren standen. Der Schreiber, welcher dort saß, gab einem der Soldaten ein von Tabaksgeruch durchzogenes Papier, und, indem er auf die Gefangene zeigte, sagte er: »Übernimm sie.« Der Soldat, ein Bauer aus dem Gouvernement Nishnij-Nowgorod, mit rotem, von den Pocken zerwühltem Gesicht, steckte das Papier hinter den Ärmelaufschlag seines Mantels, und lächelnd blinzelte er von der Gefangenen seinem Kameraden zu, einem Tschuwaschen mit starken Backenknochen. Dann stiegen die Soldaten mit ihr die Treppe hinunter und gingen zum Hauptausgang.
In der Tür des Hauptausganges öffnete sich ein Pförtchen, und nachdem die Soldaten mit der Gefangenen die Schwelle des Pförtchens nach dem Hof überschritten hatten, kamen sie aus den Mauern hinaus und marschierten durch die Stadt, in der Mitte der gepflasterten Straßen.
Droschkenkutscher, Krämer, Köchinnen, Arbeiter, Beamte blieben stehen und betrachteten voll Neugier die Gefangene; einige schüttelten die Köpfe und dachten: sieh, wohin es führt, wenn man sich schlecht – nicht so wie wir – beträgt! Die Kinder sahen mit Entsetzen auf die Räuberin; es beruhigte sie nur, daß hinter ihr die Soldaten gingen, und daß sie jetzt schon niemand mehr etwas antun konnte. Ein Bauer vom Dorf, der Kohlen verkauft und in einem Wirtshause Tee getrunken hatte, näherte sich ihr, bekreuzte sich und reichte ihr eine Kopeke. Die Gefangene errötete, neigte den Kopf und sagte etwas.
Während sie die auf sich gerichteten Blicke fühlte, schielte sie unmerklich, ohne den Kopf zu drehen, auf diejenigen, die sie ansahen, und die auf sie gerichtete Aufmerksamkeit freute sie. Es freute sie auch die im Vergleich zum Gefängnis reine Frühlingsluft, aber es tat weh, mit ihren des Gehens entwöhnten und mit ungefügen Gefängnispantoffeln beschuhten Füßen auf die Steine zu treten, und sie sah auf den Weg unter ihren Füßen und bemühte sich, möglichst leicht zu treten. Während sie an einer Mehlhandlung vorbeiging, vor welcher Tauben, von niemand behelligt, ein wenig schaukelnd auf und ab spazierten, berührte sie fast mit dem Fuß einen Blautauber; aufflatternd und mit den Flügeln bebend, flog der Vogel hart an ihrem Ohr vorbei und überschauerte sie mit Wind. Sie lächelte, und dann seufzte sie schwer, indem sie ihrer Lage gedachte.
2
Die Geschichte der Gefangenen Maslowa war eine sehr gewöhnliche Geschichte.
Die Maslowa war die Tochter einer unverheirateten Hofmagd, die mit ihrer Mutter, die Viehmagd war, im Dorfe bei zwei Gutsbesitzerinnen, unverheirateten Schwestern, lebte. Dieses ledige Frauenzimmer gebar jedes Jahr, und – wie es auf dem Lande meist gemacht wird – man taufte das Kind, doch nachher ernährte die Mutter das unerwünscht erschienene, unnötige und bei der Arbeit störende kleine Wesen nicht, und es mußte bald Hungers sterben.
So starben ihr fünf Kinder. Alle waren sie getauft, nachher wurden sie nicht ernährt, und sie starben eben. Das sechste Kind – erzeugt von einem fahrenden Zigeuner – war ein Mädchen, und sein Schicksal wäre dasselbe gewesen, wenn es sich nicht begeben hätte, daß eins der beiden alten Fräulein auf den Viehhof gekommen wäre, um der Stallmagd einen Verweis wegen des nach der Kuh riechenden Rahms zu geben. In der Wohnung der Stallmägde lag die Wöchnerin mit ihrem schönen, gesunden Säugling. Das alte Fräulein erteilte sowohl für den Rahm als auch dafür einen Verweis, daß man eine Wöchnerin auf den Viehhof gelassen, und wollte schon weggehen, als sie das Kind erblickte. Sie ward gerührt und bot sich an, Taufmutter des Kindes zu sein. Sie hielt es auch über die Taufe; nachher gab sie der Mutter, aus Mitleid mit dem Patenkind, Milch und Geld, und das Kind blieb am Leben. Die alten Fräulein nannten es denn auch: »Die Gerettete«.
Das Kind war drei Jahre alt, als die Mutter erkrankte und starb. Der Großmutter, der Viehmagd, war die Enkelin zur Last, und so nahmen die alten Fräulein das Mädchen zu sich. Das schwarzäugige Mädchen wurde ungewöhnlich lebhaft und zierlich, und die alten Fräulein hatten ihre Freude an ihr.
Es waren zwei alte Fräulein: eine jüngere, etwas gutmütigere, Sophia Iwanowna – dieselbe, welche das Kind über die Taufe gehalten – und eine ältere, etwas strengere – Maria Iwanowna. Sophia Iwanowna putzte das Mädchen, lehrte es lesen und wollte aus ihm eine Ziehtochter machen. Maria Iwanowna sagte, daß man aus dem Mädchen eine Arbeiterin, ein gutes Stubenmädchen machen müsse, und daher war sie anspruchsvoll, strafte und schlug sogar hier und da das Mädchen, wenn sie schlechter Laune war. So wuchs das Mädchen, zwischen zwei verschiedenen Einflüssen, halb als Stubenmädchen, halb als Ziehkind auf. So nannte man es denn auch weder kühl Katka, noch zärtlich Katenka, sondern zwischen beidem: Katjuscha. Sie nähte, räumte die Zimmer auf, besorgte die kleine Wäsche, röstete, mahlte und trug den Kaffee auf, putzte die Heiligenbilder mit Kreide und saß bisweilen bei den Fräulein und las ihnen vor.
Sie hatte Bewerber, wollte aber keinen nehmen, da sie fühlte, wie das Leben mit jenen arbeitenden Leuten, die um sie freiten, schwer sein würde für sie, die durch die Süße des Herrenlebens verwöhnt war.
So lebte sie bis zu ihrem sechzehnten Jahr. Als sie aber sechzehn Jahre alt war, kam zu den Fräulein deren Neffe, ein Student. Er war Fürst und reich, und Katjuscha verliebte sich in ihn, ohne daß sie es wagte, es sich selbst, geschweige denn ihm zu gestehen. Dann kam derselbe Neffe zwei Jahre später auf dem Wege in den Krieg wieder zu den Tanten, brachte vier Tage bei ihnen zu, und am Abend vor seiner Abreise verführte er Katjuscha. Darauf drückte er ihr am letzten Tage einen Hundertrubelschein in die Hand und reiste ab. Fünf Monate nach seiner Abreise wußte sie bestimmt, daß sie schwanger sei.
Von der Zeit an war ihr alles gleichgültig, und sie dachte nur darüber nach, wie sie der Schande, die sie erwartete, entgehen könne. Nicht nur begann sie unwillig und schlecht den Fräulein zu dienen, sondern plötzlich brach sie los und ohne selber zu wissen, wie es geschah, sagte sie den Fräulein Grobheiten, die sie später selbst bereute, und bat, sie zu entlassen. Die Fräulein, die jetzt unzufrieden mit ihr waren, entließen sie.
Als Stubenmädchen kam sie von ihnen zu einem Polizeibeamten, zum Stanowoj, aber sie konnte dort nur drei Monate bleiben, weil der Stanowoj, ein Mann von schon fünfzig Jahren, zudringlich wurde. Einmal, als er sie besonders belästigte, erhitzte sie sich, nannte ihn Dummkopf und alter Teufel, gab ihm einen Stoß vor die Brust, daß er hinfiel und wurde dieser Grobheit wegen weggejagt. Wieder in einen Dienst zu treten, hatte nun keinen Zweck; bald sollte sie gebären, und so quartierte sie sich bei einer Witwe, der Dorfhebamme, ein, die mit Branntwein handelte. Die Niederkunft war leicht. Aber die Hebamme, welche eine kranke Frau im Dorf behandelte, steckte sie mit dem Wochenbettfieber an, und man brachte das Kind, einen Knaben, ins Findelhaus, wo es gleich nach der Ankunft starb, wie die Alte, die ihn hingebracht hatte, erzählte.
Geld hatte Katjuscha, als sie zu der Hebamme kam, im ganzen hundertsiebenundzwanzig Rubel; siebenundzwanzig davon verdient und hundert, die ihr der Verführer gegeben hatte. Als sie aber von ihr wegging, blieben ihr nur sechs Rubel übrig. Sie verstand nicht Geld zu sparen, sie brauchte es für sich und gab es jedem, der darum bat. Die Hebamme nahm ihr für Unterkunft, Kost und Tee für zwei Monate vierzig Rubel ab; fünfundzwanzig Rubel gingen für die Ablieferung des Kindes darauf; vierzig Rubel hatte sich die Hebamme leihweise ausgebeten, für eine Kuh, etwa zwanzig Rubel gingen so – für Kleider, für Geschenke fort, so daß Katjuscha, als sie gesund war, kein Geld mehr hatte und eine Stelle suchen mußte. Diese Stelle fand sich bei einem Förster. Der Förster war ein verheirateter Mann; aber ebenso wie der Stanowoj begann er vom ersten Tage an sich Katjuscha aufzudrängen. Er war ihr widerwärtig, und sie bemühte sich, ihn zu meiden, aber er war erfahrener und schlauer als sie; die Hauptsache aber war, daß er, als Hausherr, sie hinschicken konnte, wohin er wollte; so paßte er einmal eine günstige Minute ab und bemächtigte sich ihrer. Seine Frau erfuhr es, und als sie ihren Mann einmal allein mit Katjuscha im Zimmer überraschte, stürzte sie los, um sie zu schlagen. Katjuscha aber wehrte sich, und es entstand eine Prügelei, weswegen man sie aus dem Hause jagte, ohne ihr den verdienten Lohn zu bezahlen. Darauf fuhr Katjuscha in die Stadt und hielt sich bei ihrer Tante auf. Der Mann der Tante war Buchbinder und lebte früher gut; hatte aber jetzt nach und nach alle Kunden verloren und sich so völlig dem Trunk ergeben, daß er alles, was ihm unter die Hand kam, vertrank.
Die Tante indes hatte eine kleine Wäscherei, ernährte damit sich und die Kinder und unterhielt auch den verkommenen Mann. Sie schlug der Maslowa vor, bei ihr als Wäscherin einzutreten. Aber die Maslowa sah, was für ein schweres Leben die Waschfrauen hatten, die bei ihrer Tante arbeiteten, und sie zögerte und suchte in den Vermittelungsbureaus eine Stelle als Dienstmädchen. Sie fand auch eine Stelle bei einer Frau, die mit ihren beiden Söhnen, Gymnasiasten, zusammen wohnte. Acht Tage nach ihrem Antritt hörte der älteste Sohn, ein schon schnurrbärtiger Zögling der sechsten Klasse, auf zu lernen und ließ ihr mit seinen Zudringlichkeiten keine Ruhe mehr. Die Mutter gab an allem der Maslowa Schuld und kündigte ihr. Eine neue Stelle fand sie nicht, aber es traf sich, daß die Maslowa, als sie in das Stellenvermittelungsbureau kam, dort einer Dame mit Ringen und Armbändern an den aufgedunsenen nackten Armen begegnete. Nachdem die Dame die Lage der stellesuchenden Maslowa erfahren, gab sie ihr ihre Adresse und lud sie zu sich ein. Die Maslowa ging zu ihr. Die Dame empfing sie freundlich, bewirtete sie mit Pastetchen und süßem Wein und schickte dann ihr Stubenmädchen mit einem Zettel irgendwohin. Abends kam in das Zimmer ein hochgewachsener Mann mit langen ergrauenden Haaren und grauem Bart. Dieser alte Herr rückte sogleich der Maslowa näher und begann sie lächelnd mit glänzenden Augen zu betrachten und mit ihr zu scherzen. Die Hausfrau rief ihn hinaus in ein anderes Zimmer, und die Maslowa hörte sie sagen: »Eine ganz Frische, eben vom Dorfe.« Dann rief die Hausfrau die Maslowa heraus und sagte, das sei ein Schriftsteller, der sehr viel Geld habe und nicht sparen werde, wenn sie ihm gefiele. Sie gefiel ihm; er gab ihr fünfundzwanzig Rubel und versprach, sie oft wieder zu besuchen. Bald ging das Geld drauf für Bezahlung der Kost bei der Tante und für ein neues Kleid, einen Hut und Bänder. Nach einigen Tagen schickte der Schriftsteller wieder nach ihr. Sie ging. Er gab ihr noch fünfundzwanzig Rubel und schlug ihr vor, in eine eigene Wohnung zu ziehen.
Während die Maslowa in dem von dem Schriftsteller gemieteten Quartier wohnte, gewann sie einen lustigen Kommis lieb, der in demselben Hause wohnte. Sie erklärte das selber dem Schriftsteller und bezog eine kleine eigene Wohnung. Der Kommis aber, der sie zu heiraten versprochen hatte, reiste, ohne ihr etwas zu sagen, nach Nishnij; er hatte sie augenscheinlich verlassen; die Maslowa blieb allein. Sie wollte nun für sich in dem Quartier wohnen, aber das erlaubte man ihr nicht. Der Polizeibeamte teilte ihr mit, sie könne nur so leben, wenn sie einen roten Schein bekommen und sich einer medizinischen Untersuchung unterzogen habe. Darauf ging sie wieder zu ihrer Tante.
Als die Tante ihr modernes Kleid erblickte, den Umhang und den Hut, empfing sie sie achtungsvoll und wagte schon nicht mehr, ihr vorzuschlagen, Wäscherin zu werden, da sie glaubte, daß sie eine höhere Lebensstufe betreten habe. Für die Maslowa existierte jetzt nicht mehr die Frage, ob sie Wäscherin werden solle oder nicht. Sie blickte jetzt mit Mitleid auf das Sklavenleben, das die blassen Waschfrauen mit den mageren Armen – einige der Frauen waren schon schwindsüchtig – in den vorderen Zimmern führten, wo sie bei dreißig Grad im Seifendampf, bei im Sommer wie im Winter offnen Fenstern, wuschen und plätteten, und ihr grauste bei dem Gedanken, daß auch sie solche Sträflingsarbeit leisten sollte. Und zu dieser Zeit, die für die Maslowa besonders kummervoll war, weil sie keinen Beschützer fand, wurde sie von einer Vermittlerin aufgesucht, die ein Bordell mit Mädchen versorgte.
Die Maslowa rauchte schon längst; in der letzten Zeit ihres Verhältnisses mit dem Kommis aber und nachdem er sie verlassen, gewöhnte sie sich immer mehr und mehr ans Trinken. Der Branntwein zog sie nicht nur an, weil er schmackhaft schien, sondern hauptsächlich auch deshalb, weil er ihr die Möglichkeit verlieh, alles Schwere, das sie erlebt hatte, zu vergessen, und ihr eine Ungezwungenheit und feste Überzeugung von ihrer Würde gab, welche sie ohne Branntwein nicht hatte. Ohne Branntwein schämte sie sich immer und war niedergeschlagen. Die Vermittlerin bewirtete die Tante, und nachdem sie die Maslowa betrunken gemacht, schlug sie ihr vor, in eine gute – in die feinste »Anstalt« der Stadt einzutreten, indem sie ihr alle Vorteile und Vorzüge dieser Stellung vor Augen führte. Die Maslowa hatte die Wahl vor sich: entweder die erniedrigende Lage einer Dienstmagd, wo es ganz sicher Verfolgungen von Seiten der Männer und zeitweilige geheime Ehebrüche geben würde, oder die gesicherte, ruhige, gesetzliche Stellung und der offene, vom Gesetz erlaubte, gut bezahlte, beständige Ehebruch, und sie wählte das letztere. Außerdem glaubte sie damit an ihrem Verführer und an dem Kommis – an allen Leuten, die ihr Böses getan, Rache zu nehmen. Dabei lockte sie auch, und das war eines der Motive ihrer endgültigen Entscheidung, daß die Vermittlerin ihr sagte, sie könne so viele Kleider bestellen, wie sie nur wünsche; aus Samt, aus Seide, Ballkleider, die Schultern und Arme nackt lassen. Und als sich die Maslowa vorstellte, wie sie im hellgelben, ausgeschnittenen, mit schwarzem Samt besetzten Seidenkleide aussehen müßte, da konnte sie nicht widerstehen und gab ihren Paß ab.
Und noch an demselben Abend nahm die Vermittlerin eine Droschke und brachte sie in das berühmte Haus der Kitajewa.
Und so begann von dieser Zeit an für die Maslowa jenes Leben des chronischen Vergehens gegen göttliche und menschliche Gebote, das Hunderte und Hunderte von Frauen führen, nicht nur mit Erlaubnis, sondern unter der Gönnerschaft der herrschenden Gewalt, die mit dem Wohl ihrer Bürger betraut ist, und das für neun von zehn mit qualvollen Krankheiten, mit vorzeitiger Altersschwäche und Tod endigt.
Morgens und am Tage der schwere Schlaf nach den nächtlichen Orgien. Um drei, vier Uhr das müde Aufstehn aus schmutzigem Bette, Selterwasser nach der Völlerei, Kaffee – dann das faule Herumschlendern durch die Zimmer in Peignoirs, Jacken, Schlafröcken; das Schauen aus den Fenstern, verborgen hinter den Vorhängen; das träge Schelten untereinander; dann das Waschen, Einreihen, Parfümieren des Leibes, der Haare; das Anprobieren der Kleider; das Streiten darüber mit der Wirtin; das Betrachten im Spiegel, das Schminken des Gesichts, der Augenbrauen; die süße, fette Mahlzeit; dann das Anziehen des hellen, seidenen, den Körper entblößenden Kleides; das Hinaustreten in den aufgeputzten, hell beleuchteten Saal, die Ankunft der Gäste: Musik, Tanz, Bonbons, Wein, Rauchen, Ehebrüche mit den Jungen, mit Leuten mittleren Alters, mit halben Kindern, mit sich ruinierenden Greisen, mit Ledigen, mit Verheirateten, mit Kaufleuten, mit Kommis, mit Armeniern, mit Juden, mit Tataren, mit Reichen, Armen, Gesunden, Kranken, Betrunkenen, Nüchternen, Groben, Zarten, mit Militärs, mit Zivilisten, mit Studenten, mit Gymnasiasten – mit allen möglichen Klassen, Altersstufen, Charakteren. Und Geschrei und Späße, Prügel und Musik, Tabak und Wein, Wein und Tabak, und Musik vom Abend bis zum Tagesanbruch. Und nur am Morgen Erlösung und schwerer Schlaf. Und so jeden Tag, die ganze Woche. Am Ende der Woche aber der Gang in die Staatsanstalt, das Polizeibureau, wo im Staatsdienst stehende Beamten – Ärzte, Männer – diese Frauen manchmal ernst und streng, manchmal mit scherzhafter Lustigkeit, untersuchen, die von der Natur nicht nur den Menschen, zum Schutze gegen Verbrechen, sondern selbst den Tieren verliehene Scham vernichten, und ihnen dann das Recht zur Fortsetzung derselben Verbrechen geben, welche diese Frauen im Laufe der Woche mit ihren Mitschuldigen begangen haben. Und dann wieder eine gleiche Woche. Und so jeden Tag – im Sommer, im Winter, am Werktag wie am Feiertag.
So lebte die Maslowa sieben Jahre hindurch. Während dieser Zeit wechselte sie zweimal das Haus, und einmal war sie im Hospital. Im siebenten Jahre ihres Aufenthalts im Bordell und im zehnten Jahr nach ihrem ersten Fall, als sie siebenundzwanzig Jahre alt war, geschah mit ihr das, wofür sie ins Gefängnis kam und wofür man sie jetzt vor Gericht führte, nach sechsmonatiger Haft im Gefängnis zwischen Diebinnen und Mörderinnen.
3
Zu gleicher Zeit, da die Maslowa, von dem langen Gange ermüdet, mit ihrer Bewachung sich dem Gerichtsgebäude näherte, lag jener selbe Neffe ihrer Erzieherinnen, Fürst Dmitrij Iwanowitsch Nechliudow, der sie verführt, auf seinem hohen, zerwühlten Springfederbett mit der Daunenmatratze, knöpfte den Kragen seines sauberen Nachthemdes aus holländischer Leinwand mit den an der Brust festgebügelten Fältchen auf und rauchte eine Zigarette. Er sah mit starren Augen vor sich hin und dachte darüber nach, was ihm heute zu tun bevorstehe, und was gestern gewesen.
Sich des gestrigen Abends entsinnend, welchen er bei Kortschagins zugebracht, reichen und angesehenen Leuten, deren Tochter er, wie allgemein angenommen wurde, heiraten sollte, seufzte er, warf die ausgerauchte Zigarette fort und wollte aus der silbernen Zigarettendose eine neue nehmen; – besann sich jedoch anders, ließ seine glatten, weißen Beine vom Bett herab, fand mit ihnen die Pantoffeln, warf einen seidenen Schlafrock über die breiten Schultern und ging mit raschen Schritten in das ans Schlafgemach stoßende Ankleidezimmer, das ganz von dem feinen Geruch von Elixieren, Eau de Cologne, Bartpomaden und Parfüms durchdrungen war. Dort putzte er mit einem besonderen Pulver seine an vielen Stellen plombierten Zähne, spülte sie mit einem aromatischen Mundwasser, fing dann an, sich sorgsam zu waschen und mit verschiedenen Handtüchern abzureiben. Nachdem er sich die Hände mit parfümierter Seife gewaschen, putzte er sorgfältig mit Bürsten die langgewachsenen Nägel, wusch sich an dem großen marmornen Waschtisch das Gesicht und den starken Hals und trat noch in ein drittes Zimmer neben dem Schlafgemach, wo eine Dusche hergerichtet war. Als er dann mit kaltem Wasser den muskulösen, mit Fett belegten weißen Leib gewaschen und sich mit dem rauhhaarigen Laken abgerieben hatte, zog er die sauber geplättete Wäsche, die spiegelblank geputzten Stiefel an, setzte sich vor die Toilette, um mit zwei Bürsten den kleinen, schwarzen, krausen Bart und das auf dem vorderen Teil des Kopfes ziemlich dünn gewordene, krause Haar zu bearbeiten. Alles was er benutzte – Toilettengerät, Wäsche, Kleider, Fußbekleidung, Halsbinden, Nadeln, Hemdknöpfe, – war von der allerersten, teuersten Sorte, unauffällig, einfach, dauerhaft und kostbar.
Nachdem Nechliudow aus einem Dutzend Krawatten und Nadeln die ersten, die ihm unter die Hände kamen, genommen – einst war dies neu und unterhaltend, jetzt war es ihm vollständig gleichgültig – zog er die gebürsteten und auf dem Stuhle zurechtgelegten Kleider an und ging, wenn auch nicht vollkommen frisch, so doch sauber und duftend, in das lange Speisezimmer mit dem gestern von drei Männern gewichsten Parkettboden, dem ungeheuer großen Eichenbüfett und dem ebenso großen, zum Ausziehen eingerichteten Tische, der mit seinen breit auseinandergestellten, in der Form von Löwenklauen geschnitzten Füßen etwas Feierliches hatte. Auf diesem Tische mit der feinen, gestärkten, mit großen Namenszügen versehenen Decke stand eine silberne Kaffeekanne mit duftendem Kaffee, eine ebensolche Zuckerdose, eine Rahmkanne mit gekochter Sahne und ein Korb mit frischem Weißbrot, kleinen Zwiebäcken und Biskuits. Neben dem Gedeck lagen die eingetroffenen Briefe, Zeitungen und ein neues Heft der »Revue des deux mondes.«
Eben wollte sich Nechliudow an seine Briefe machen, als aus der Tür, die in den Korridor führte, eine wohlbeleibte und ziemlich bejahrte Frau in Trauer, mit einem Spitzenaufsatz auf dem Kopfe, der den auseinandergegangenen Haarscheitel verdeckte, sich hereinschob. Es war das Kammermädchen der seligen, vor kurzem in dieser selben Wohnung verstorbenen Mutter Nechliudows, Agrafena Petrowna, die bei dem Sohn als Haushälterin geblieben war.
Agrafena Petrowna hatte etwa zehn Jahre – zu verschiedenen Zeiten – mit Nechliudows Mutter im Auslande verbracht und hatte Aussehen und Manieren einer Dame. Von Kindheit an wohnte sie im Hause der Nechliudows und kannte Dmitrij Iwanowitsch, als er noch Mitenka genannt wurde.
»Guten Morgen, Dmitrij Iwanowitsch!«
»Guten Morgen, Agrafena Petrowna – was gibt's Neues?« fragte Nechliudow scherzend. »Ein Brief, entweder von der Fürstin oder von der Prinzessin; das Zimmermädchen hat ihn schon vor längerer Zeit gebracht, sie wartet bei mir«, sagte Agrafena Petrowna und übergab den Brief, bedeutungsvoll lächelnd.
»Schön, sogleich«, sagte Nechliudow, indem er den Brief nahm, und da er Agrafena Petrownas Lächeln bemerkte, zog er ein finstres Gesicht. Agrafena Petrownas Lächeln bedeutete, daß der Brief von der jungen Prinzessin Kortschagina war, die Nechliudow, nach Agrafena Petrownas Meinung, heiraten sollte. Und diese durch ihr Lächeln ausgedrückte Voraussetzung Agrafena Petrownas war Nechliudow unangenehm.
»Also ich sage ihr, daß sie etwas warten soll.« Und Agrafena Petrowna nahm das nicht an seinem Ort liegende Bürstchen zum Abfegen des Tisches, legte es an einen andern Ort und entschwand aus dem Speisezimmer.
Nechliudow öffnete den duftenden Brief, den ihm Agrafena Petrowna gereicht, und begann zu lesen.
»Indem ich die auf mich genommene Pflicht erfülle,« stand auf dem einen Bogen des dicken grauen Papiers mit den ungleichen Rändern, in einer scharfen, aber weiten Handschrift geschrieben, »erinnere ich Sie daran, daß Sie heute, den 28. April, im Geschworenengericht sein müssen und daher unmöglich mit uns und mit Herrn Kolosow mitfahren können, um Bilder zu besehen, wie Sie dies gestern mit dem Ihnen eigentümlichen Leichtsinn versprachen, à moins que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous vous refusez pour votre cheval, dafür, daß Sie nicht zur rechten Zeit erscheinen. Es fiel mir gestern ein, als Sie eben fortgegangen waren. Also vergessen Sie es nicht.
Prinzessin M. Kortschagina.«
Auf der andern Seite war hinzugefügt: »Maman vous fait dire, que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument, à quelle heure que cela soit.
M. K.«
Nechliudow runzelte die Stirn. Der Zettel war die Fortführung jener geschickten Arbeit, die schon seit zwei Monaten an ihm von der jungen Prinzeß Kortschagina ausgeführt wurde, und die darin bestand, daß sie ihn mit unmerklichen Fäden immer mehr und mehr mit sich verknüpfte. Unterdessen aber hatte Nechliudow, außer der bei nicht mehr jungen und nicht gerade leidenschaftlich verliebten Leuten gewöhnlichen Unentschlossenheit vor der Ehe, noch einen wichtigen Grund, weshalb er, selbst wenn er sich entschlösse, doch nicht sogleich seinen Antrag machen konnte. Dieser Grund bestand nicht darin, daß er vor bald zehn Jahren Katjuscha verführt und sie verlassen hatte – denn das hatte er vollständig vergessen, und hielt es nicht für ein Hindernis zum Heiraten – der Grund lag darin, daß er gerade jetzt mit einer verheirateten Frau ein Verhältnis hatte, das – obgleich von seiner Seite abgebrochen – ihrerseits noch nicht als abgebrochen anerkannt wurde.
Nechliudow war sehr schüchtern den Frauen gegenüber. Aber eben seine Schüchternheit hatte in dieser verheirateten Frau die Lust erweckt, ihn zu erobern. Diese Frau war die Gemahlin des Adelsmarschalls des Kreises, zu dessen Wahl Nechliudow gefahren war. Und die Frau zog ihn in ein Verhältnis hinein, das für Nechliudow mit jedem Tag hinreißender und zu gleicher Zeit auch immer widerwärtiger wurde. Anfangs hatte Nechliudow der Verführung nicht widerstehen können, dann, weil er sich vor ihr schuldig fühlte, konnte er dies Verhältnis nicht ohne ihre Einwilligung abbrechen. Und hier eben lag die Ursache, weshalb Nechliudow glaubte, daß er kein Recht habe, auch wenn er es wünschte, der Kortschagina seinen Heiratsantrag zu machen.
Auf dem Tische lag gerade ein Brief von dem Manne dieser Frau. Als Nechliudow die Handschrift und den Stempel sah, errötete er und empfand sogleich jenen Energieaufschwung, den er immer beim Nahen der Gefahr fühlte. Aber seine Aufregung war überflüssig; der Mann, der Adelsmarschall desselben Kreises, in dem die Hauptbesitztümer Nechliudows lagen, berichtete ihm, daß zu Ende Mai eine außerordentliche Versammlung des Semstwo anberaumt sei, und bat Nechliudow, auf alle Fälle zu erscheinen »et donner un coup d'èpaule« in den bevorstehenden wichtigen Fragen der Semstwoversammlung über die Schulen und Anfahrtsbahnen, bei denen man starken Widerstand der reaktionären Partei erwartete.
Der Adelsmarschall war ein liberaler Mann, der zusammen mit einigen Gleichgesinnten gegen die unter Alexander III. ausgebrochene Reaktion kämpfte und so ganz von diesem Kampf absorbiert war, daß er nichts von seinem unglücklichen Familienleben wußte.
Nechliudow vergegenwärtigte sich all die qualvollen Minuten, die er wegen dieses Mannes durchlebt; er vergegenwärtigte sich, wie er einmal geglaubt, der Mann wisse alles, und wie er sich zum Duell mit ihm vorbereitete, bei welchem er in die Luft schießen wollte; und die furchtbare Szene mit der Frau, als sie in Verzweiflung in den Garten stürzte, zum Teich, in der Absicht, sich zu ertränken, und er sie suchen lief.
»Ich kann jetzt nicht hinfahren, ich kann nichts unternehmen, solange sie mir nicht antwortet«, dachte Nechliudow. Vor einer Woche hatte er ihr einen entscheidenden Brief geschrieben, in welchem er sich als schuldig und zu jeder beliebigen Art von Genugtuung bereit erklärte, aber dennoch hielt er das Verhältnis, und zwar zu ihrem Besten, auf immer für beendigt. Und eben auf diesen Brief erwartete er Antwort und bekam keine. Daß er keine Antwort erhielt, war zum Teil ein gutes Zeichen. Wenn sie auf den Bruch nicht eingehen wollte, so hätte sie schon längst geschrieben oder wäre sogar selber gekommen, wie sie es früher tat. Nechliudow hatte gehört, daß gegenwärtig dort ein Offizier war, der ihr den Hof machte; das bereitete ihm Qualen der Eifersucht und freute ihn doch zugleich, wie eine Hoffnung auf Befreiung von der ihn peinigenden Lüge.
Der andere Brief war von dem Oberverwalter der Besitzungen. Der Verwalter schrieb ihm, daß er, Nechliudow, selber kommen müsse, um seine Erbschaft anzutreten, und außerdem, um die Frage zu entscheiden, wie die Wirtschaft fortzuführen sei: ob so, wie sie bei der Seligen geführt worden, oder so, wie er es auch der seligen Fürstin vorgeschlagen und jetzt dem jungen Fürsten vorschlage, nämlich, das Inventar zu vermehren, und alles Land, das jetzt den Bauern in Pacht gegeben war, selber zu bewirtschaften. Der Verwalter schrieb, daß eine solche Ausnutzung viel vorteilhafter sein würde. Dabei entschuldigte er sich wegen Verspätung der Zusendung der bereits zum Ersten des Monats fälligen 3000 Rubel. Dieses Geld würde mit der nächsten Post abgehen. Die Absendung habe sich deswegen verzögert, weil er das Geld von den Bauern nicht hatte bekommen können, deren Gewissenlosigkeit einen solchen Grad erreicht habe, daß es nötig war, sich an die Behörde zu wenden, um es beizutreiben. Dieser Brief war Nechliudow angenehm und gleichzeitig unangenehm. Es war angenehm, seine Macht über ein großes Eigentum zu fühlen und unangenehm, weil er in seiner ersten Jugend ein begeisterter Anhänger Herbert Spencers gewesen war und ihn als Großgrundbesitzer besonders jener Satz in den »Social Statics« traf, »daß die Gerechtigkeit den Privatgrundbesitz nicht zulasse«. In der Geradheit und Entschlossenheit der Jugend sagte er damals nicht nur, daß der Boden nicht Gegenstand des Privateigentums sein könne, und schrieb nicht nur in der Universität eine Abhandlung darüber, sondern er hatte damals auch in der Tat ein kleines Landstück, das nicht seiner Mutter, sondern durch Erbschaft vom Vater ihm persönlich gehörte, den Bauern abgetreten, da er das Land nicht gegen seine Überzeugung besitzen wollte.
Jetzt, da er durch die Erbschaft Großgrundbesitzer geworden war, mußte er eins von beidem: entweder auf sein Eigentum verzichten, wie er es vor zehn Jahren hinsichtlich der zweihundert Desiatinen Land von seinem Vater gemacht, oder in stillschweigendem Eingeständnis all seine früheren Gedanken als fehlerhaft und falsch anerkennen.
Das erstere konnte er nicht tun, weil er außer dem Landbesitz keine Mittel zur Existenz hatte. In den Staatsdienst treten wollte er nicht, wohl aber hatte er inzwischen die Gewohnheiten eines luxuriösen Lebens angenommen, von denen er glaubte, sich nicht losmachen zu können. Aber es hatte auch keinen Zweck, denn er besaß schon nicht mehr jene Überzeugungskraft, jene Entschlossenheit, jenen Ehrgeiz und jenen Drang, andere in Verwunderung zu setzen, die ihm in der Jugend eigen gewesen war.
Das zweite aber, Widerruf jener klaren und unwiderlegbaren Beweisgründe von der Unrechtmäßigkeit des Grundbesitzes, die er damals aus der »Sozialen Statik« von Spencer geschöpft und deren glänzende Bestätigung er dann viel später in den Werken von Henry George gefunden hatte, war ihm durchaus nicht möglich.
Und deswegen war ihm der Brief des Verwalters unangenehm.
4
Nachdem Nechliudow seinen Kaffee getrunken hatte, ging er ins Arbeitszimmer, um im Vorladungsschreiben nachzusehen, wann er im Gericht sein müsse, und um die Antwort an die Prinzessin zu schreiben. Ins Arbeitszimmer mußte man durch das Atelier gehen. Im Atelier stand eine Staffelei mit einem angefangenen Bilde, das umgedreht war, auch waren Skizzen aufgehängt. Der Anblick dieses Bildes, mit welchem er sich zwei Jahre lang abgequält, der Anblick der Skizzen und des ganzen Ateliers mahnten ihn an das in letzter Zeit mit besonderer Schärfe empfundene Gefühl seines Unvermögens, in der Malerei weiterzukommen. Er erklärte diese Empfindung durch sein zu fein entwickeltes ästhetisches Gefühl, aber dennoch war diese Empfindung sehr unangenehm.
Vor sieben Jahren hatte er den Staatsdienst aufgegeben, weil er entdeckt hatte, daß er Begabung zur Malerei habe, und von der Höhe der künstlerischen Tätigkeit sah er etwas verächtlich auf alle andern Berufe herab. Jetzt ergab es sich, daß er dazu kein Recht hatte. Und darum war jede Erinnerung daran unangenehm. Mit schwerem Gefühl betrachtete er die prachtvolle Einrichtung seines Ateliers, und in mißmutiger Laune betrat er sein Arbeitszimmer. Dieses war ein sehr großes, hohes Zimmer mit allen Arten von Zierat, Vorrichtungen und Bequemlichkeiten.
Nachdem er sogleich in der Schublade des großen Schreibtisches unter der Abteilung »Terminsachen« das Vorladungsschreiben gefunden, in welchem es hieß, daß er um elf im Gericht sein müsse, setzte sich Nechliudow, um der Prinzessin ein Billett zu schreiben, daß er für die Einladung danke und sich bemühen werde, zu Tisch da zu sein. Aber nachdem er ein Billett geschrieben, riß er es entzwei: es war zu intim; er schrieb ein anderes, – es war kalt, fast beleidigend. Er riß es wieder entzwei und drückte auf den Knopf an der Wand. In die Tür trat in grauer Kalikoschürze ein bejahrter Lakai; er hatte ein finsteres Aussehen und war, bis auf einen Backenbart, glattrasiert.
»Bitte, schicken Sie nach dem Kutscher.«
»Zu Befehl.«
»Und hier wartet jemand von Kortschagins, sagen Sie, ich ließe danken, ich würde mich bemühen, zu kommen.«
»Zu Befehl.«
»Unhöflich, aber ich kann nicht schreiben. Ich werde sie doch heute sehen«, dachte Nechliudow und ging, sich anzukleiden.
Als er sich angekleidet hatte und auf die Treppe hinauskam, erwartete ihn schon der Kutscher, der ihn meist fuhr, mit dem Wagen auf Gummirädern.
»Gestern waren Sie eben vom Fürsten Kortschagin weggefahren,« sagte der Kutscher, den starken verbrannten Hals im weißen Hemdkragen halbumwendend, »als ich kam; der Schweizer aber sagte: Gerade weg!«
Der Mietskutscher wußte, daß er Kortschagins besuchte und war gekommen, um ihn abzuholen.
»Sogar die Kutscher wissen um mein Verhältnis zu Kortschagins«, dachte Nechliudow, und es regte sich in ihm die unentschiedene Frage, die ihn in der letzten Zeit beständig beschäftigte: sollte er die Kortschagina heiraten oder nicht; er konnte diese Frage, wie die meisten Fragen, die sich ihm um diese Zeit aufdrängten, durchaus nicht entscheiden, weder auf die eine, noch auf die andere Weise.
Zugunsten der Ehe überhaupt sprach erstens der Umstand, daß die Heirat, außer den Annehmlichkeiten des häuslichen Herdes, indem sie die Unregelmäßigkeit des Geschlechtslebens beseitigte, die Möglichkeit eines moralischen Lebens bot; zweitens der Umstand, und dieser war die Hauptsache, daß Nechliudow hoffte, Familie und Kinder würden seinem jetzt inhaltslosen Leben einen Sinn geben. Das waren die Gesichtspunkte für das Heiraten. Gegen das Heiraten sprach aber erstens die allen nicht jungen Junggesellen gemeinsame Furcht, ihre Freiheit einzubüßen, und zweitens die unbewußte Furcht vor dem geheimnisvollen Wesen der Frau.
Zugunsten der Ehe, speziell mit Missi – Fräulein Kortschagina hieß Maria, und wie in allen Familien eines gewissen Kreises hatte sie einen Beinamen – war erstens zu sagen, daß sie von guter Rasse war, und daß sie in allem, von der Kleidung bis zur Manier zu sprechen, zu gehen, zu lachen, sich vor einfachen Leuten auszeichnete; sie zeichnete sich nicht durch etwas Außerordentliches aus, sondern durch »Korrektheit«; er kannte keinen andern Ausdruck für diese Eigenschaft und wertete diese Eigenschaft sehr hoch; und zweitens schätzte sie ihn höher als alle anderen Menschen, also, nach seinen Begriffen, verstand sie ihn. Und dieses Verstehen, das heißt, das Anerkennen seiner hohen Qualitäten, zeugte von ihrem Verstand und von der Richtigkeit ihres Urteils. Gegen die Heirat gerade mit Missi war erstens einzuwenden, daß man wahrscheinlich eine junge Dame finden könnte, welche noch viel mehr gute Eigenschaften als Missi hatte, und welche darum noch mehr seiner wert wäre; zweitens, daß sie schon 27 Jahre alt war und also sicher schon früher geliebt hatte; und dieser Gedanke war für Nechliudow qualvoll. Sein Stolz konnte sich nicht damit aussöhnen, daß sie auch in der Vergangenheit nicht ihn allein geliebt hatte. Selbstverständlich konnte sie nicht wissen, daß sie ihn treffen werde, aber der Gedanke allein, daß sie früher irgend jemand anders geliebt hatte, beleidigte ihn. So daß der Beweggründe ebenso viele für die Ehe, wie gegen sie waren; wenigstens waren ihrer Kraft nach diese Beweggründe gleich, und Nechliudow, über sich selbst lachend, nannte sich Buridans Esel. Und dennoch fuhr er fort, einer zu sein, weil er nicht wußte, zu welchem von beiden Bündeln er sich wenden solle.
»Übrigens, ohne Antwort von Maria Wasiljewna« – der Frau des Adelsmarschalls – »ohne damit vollständig zu Ende zu sein, kann ich nichts unternehmen«, sagte er zu sich selbst.
Und dies Bewußtsein, daß er mit der Entscheidung zögern könne und müsse, war ihm angenehm. »Übrigens werde ich alles das später überlegen«, sagte er sich selbst, als seine Droschke schon ganz geräuschlos zur Asphaltauffahrt des Gerichtsgebäudes hinanrollte. »Jetzt muß ich gewissenhaft, – wie ich es immer tue und für meine Schuldigkeit halte, meine öffentliche Pflicht erfüllen. Zudem aber pflegt es oft interessant zu sein«, sagte er zu sich und ging an dem Schweizer vorbei in den Flur des Gerichtsgebäudes hinein.
5
In den Korridoren des Gerichts herrschte rege Bewegung, als Nechliudow eintrat.
Die Diener gingen bald rasch, bald sogar im Trab, ja, sie huschten vorüber, ohne die Füße vom Boden zu heben, und liefen, kaum Atem holend, hin und her, mit Aufträgen und Akten. Die Gerichtskommissare, Advokaten, Gerichtsbeamten gingen bald hin, bald her; Bittsteller und Angeklagte ohne Bewachung strichen verzagt an den Wänden herum oder saßen voll Erwartung da.
»Wo ist das Bezirksgericht?« fragte Nechliudow einen der Wächter.
»Zu welchem wollen Sie? Es gibt eine Zivilabteilung, es gibt das Appellationsgericht.«
»Ich bin Geschworener.«
»Also Kriminalabteilung. Das hätten Sie gleich sagen sollen! Hier rechts, dann links und die zweite Tür.«
Nechliudow ging.
Neben der genannten Tür standen zwei Männer und warteten; einer war ein großer dicker Kaufmann, ein gutmütiger Mensch, der als Stärkung für die bevorstehende Arbeit ein Glas getrunken und einen Imbiß genommen hatte und in heiterster Gemütsverfassung war. Der andere war ein Kommis von jüdischer Herkunft. Sie sprachen vom Preise der Wolle, als der eben angelangte Nechliudow herankam und fragte, ob hier das Zimmer der Geschworenen sei.
»Hier, mein Herr, hier. Auch einer von uns Geschworenen?« fragte lustig zwinkernd der gutmütige Kaufmann.
»Nun, also werden wir uns zusammen etwas anstrengen«, fuhr er auf die bejahende Antwort Nechliudows fort. »Baklaschow von der zweiten Gilde,« sagte er, seine weiche, breite Hand – sie war so dick, daß sie sich nicht ballen ließ – reichend, »wir müssen uns etwas Mühe geben. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
Nechliudow nannte seinen Namen und ging in das Geschworenenzimmer.
In dem kleinen Geschworenenzimmer waren etwa zehn Personen verschiedener Art. Alle waren eben angekommen: einige saßen, andere gingen auf und ab, indem sie einander betrachteten und sich bekannt machten. Der eine war ein abgedankter Militär in Uniform, die anderen waren in Gehröcken, in Jacken, und nur einer im Kaftan.
Alle zeigten, – trotzdem viele sich hatten von ihrer Arbeit losreißen müssen und über die Belästigung klagten, – alle zeigten den Ausdruck eines gewissen Vergnügens im Bewußtsein der Erfüllung einer wichtigen öffentlichen Tätigkeit.
Die Geschworenen, die sich teils bekannt gemacht hatten, teils nur vermuteten, wer der andere sei, sprachen miteinander vom Wetter, vom frühen Frühling, von den bevorstehenden Geschäften. Diejenigen, welche mit Nechliudow nicht bekannt waren, beeilten sich, sich ihm vorzustellen, weil sie es augenscheinlich für eine besondere Ehre hielten. Und Nechliudow nahm es, wie immer unter Unbekannten, als das ihm Gebührende entgegen. Würde man ihn gefragt haben, warum er sich für höher als die meisten Leute hielt, so hätte er nicht antworten können, weil sein ganzes Leben keine besonderen Verdienste aufwies. Und daß er gut Englisch, Französisch und Deutsch sprach, daß er Wäsche, Kleider, Halstuch und Hemdknöpfe von den allerersten Lieferanten dieser Waren hatte, das, verstand er selber, konnte keineswegs Ursache der Anerkennung seiner Überlegenheit sein. Inzwischen aber erkannte auch er unzweifelhaft diese seine Überlegenheit an, nahm die ihm erwiesenen Zeichen der Achtung als das ihm Gebührende entgegen und fühlte sich beleidigt, wenn sie ausblieben. Im Zimmer der Geschworenen mußte er gerade dieses unangenehme Gefühl ihm bezeugter Nichtachtung erfahren. Unter den Geschworenen war ein Bekannter von Nechliudow. Es war Peter Gerasimowitsch (Nechliudow wußte nie seinen Familiennamen und posierte sogar ein wenig damit, daß er seinen Namen nicht kenne), der ehemalige Lehrer der Kinder seiner Schwester. Peter Gerasimowitsch war jetzt Gymnasiallehrer. Er war immer unerträglich für Nechliudow durch seine Familiarität, durch sein selbstzufriedenes Lachen, überhaupt durch »seine kommunen Manieren«, wie Nechliudows Schwester zu sagen pflegte.
»So, Sie müssen auch dran glauben,« empfing Peter Gerasimowitsch mit lautem Lachen Nechliudow, »konnten Sie sich nicht drücken?«
»Aber ich dachte ja nicht daran, mich zu drücken«, sagte Nechliudow streng und melancholisch.
»Nun, das ist aber Bürgertugend! Warten Sie nur, wenn Sie Hunger verspüren und wenn man Sie nicht schlafen läßt, dann werden Sie anders singen!« fing, noch lauter lachend, Peter Gerasimowitsch an.
»Dieser Popensohn wird mich bald duzen«, dachte Nechliudow, und indes sich auf seinem Gesicht eine Trauer ausprägte, die nur in dem Fall natürlich gewesen wäre, wenn er soeben den Tod seiner sämtlichen Verwandten erfahren hätte, ging er von ihm weg und näherte sich einer Gruppe, die sich um einen glattrasierten, hochgewachsenen, ansehnlichen Herrn bildete, der lebhaft etwas erzählte. Dieser Herr sprach von dem Prozeß, der eben in der Zivilgerichtsabteilung verhandelt worden war, wie von einer ihm gut bekannten Sache, indem er die Richter und die berühmten Advokaten mit Vor- und Zunamen nannte. Er erzählte von der wunderbaren Wendung, welche der berühmte Advokat der Sache zu geben verstanden, und nach welcher eine der Parteien, die alte Dame, obgleich sie vollständig im Recht sei, um nichts der Gegenpartei eine große Summe werde zahlen müssen.
»Ein genialer Advokat«, sagte er.
Man hörte ihm mit Achtung zu, und einige bemühten sich, eigene Bemerkungen einfließen zu lassen, aber er schnitt allen das Wort ab, als ob nur er allein alles richtig wissen könne.
Trotzdem Nechliudow zu spät gekommen war, mußte er noch lange warten. Die Sache wurde aufgehalten durch ein Gerichtsmitglied, das noch nicht angelangt war.
6
Der Vorsitzende kam früh ins Gericht. Es war ein hoher, starker Mann mit großem, ergrauendem Backenbart. Er war verheiratet, führte aber ein sehr lockeres Leben, ebenso wie seine Frau. Sie störten einander nicht. Heute früh hatte er von der Gouvernante, einer Schweizerin, die im Sommer bei ihnen in Stellung gewesen war, und die jetzt aus dem Süden nach Petersburg durchfuhr, die Mitteilung erhalten, sie erwarte ihn in der Stadt im Gasthofe »Italie« zwischen drei und sechs Uhr. Daher wollte er die Verhandlung des heutigen Tages gern früher anfangen und schließen, um vor sechs Uhr bei der rothaarigen Klara Wasiljewna sein zu können, mit der er im vorigen Sommer auf dem Lande einen Roman gehabt hatte.
Nachdem er in sein Zimmer eingetreten, riegelte er die Tür zu, holte aus dem Aktenschrank vom untersten Brett zwei Hanteln und machte zwanzig Bewegungen nach oben, nach vorn, seitwärts, nach unten und dann ließ er sich leicht dreimal nieder, wobei er die Hanteln über dem Kopfe hoch hielt.
»Nichts erhält einen so, wie Wassergüsse und Gymnastik«, dachte er, mit der linken Hand, die einen goldenen Ring auf dem Ringfinger trug, den angespannten Bizeps des rechten Armes betastend. Ihm blieb noch übrig, einen »Moulinet« zu machen, – er pflegte diese zwei Bewegungen immer vor dem langen Sitzen der Verhandlung auszuführen, – als die Tür erzitterte. Jemand wollte sie aufmachen. Der Vorsitzende legte eilig die Gewichte auf ihre Stelle und öffnete die Tür.
»Verzeihen Sie«, sagte er.
In das Zimmer kam ein Gerichtsmitglied mit goldener Brille, ein nicht sehr großer Mann mit hochgezogenen Schultern und einem finsteren Gesicht.
»Wieder ist Matwej Nikititsch nicht da«, sagte das Gerichtsmitglied unzufrieden.
»Noch, nicht da?« antwortete der Vorsitzende, die Uniform anziehend. »Immer verspätet er sich.«
»Erstaunlich, schämt er sich denn gar nicht?« sagte das Mitglied und setzte sich voll Unwillen, indem es Zigaretten aus der Tasche holte.
Dieses Gerichtsmitglied, ein sehr pünktlicher Mann, hatte heute früh einen unangenehmen Zusammenstoß mit seiner Frau gehabt, weil sie das ihr für einen Monat gegebene Geld vorzeitig verbraucht hatte. Sie hatte ihn gebeten, ihr Vorschuß zu geben, aber er sagte, daß er sich nicht darauf einlassen könne. Es gab eine Szene. Die Frau sagte, wenn es so sei, so würde es auch nichts zu Mittag geben, er möge ja zu Hause kein Mittagessen erwarten. Damit fuhr er weg und fürchtete, daß sie ihre Drohung wahr machen werde, weil man bei ihr auf alles gefaßt sein mußte. »Da soll nun einer ein gutes, moralisches Leben führen«, dachte er, indem er den strahlenden, gesunden, munteren und gutmütigen Vorsitzenden ansah, der mit seinen schönen, weißen Händen, indem er die Ellbogen breit auseinanderstellte, seinen dichten, langen, ergrauenden Backenbart zu beiden Seiten des gestickten Kragens ausbreitete, »der ist immer zufrieden und lustig, ich aber quäle mich.«
Der Sekretär trat ein und brachte Prozeßakten mit.
»Meinen besten Dank«, sagte der Vorsitzende, und rauchte eine Zigarette an. »Welchen Prozeß nehmen wir zuerst?«
»Ich würde meinen, den Giftmord«, sagte scheinbar gleichgültig der Sekretär.
»Nun gut, nehmen wir zuerst den Giftmord vor«, sagte der Vorsitzende, nachdem er überlegt, daß dies ein Prozeß sei, den man bis vier Uhr beenden könne, um dann gleich wegzufahren. »Und ist Matwej Nikititsch noch nicht da?« »Immer noch nicht.«
»Und ist Herr Breve hier?«
»Jawohl«, antwortete der Sekretär.
»So sagen Sie ihm, wenn Sie ihn sehen, daß wir mit dem Giftmord anfangen.«
Breve war derjenige Staatsanwalt, welcher bei dieser Verhandlung die Anklage vertreten sollte.
Als er in den Korridor hinausging, traf der Sekretär Herrn Breve.
Mit hochgezogenen Schultern, in nicht zugeknöpfter Uniform, schritt er rasch, eine Aktenmappe unter dem Arm, fast laufend und mit den Absätzen klappernd, den Korridor entlang; dabei schwenkte er den freien Arm so, daß die Handfläche zu der Richtung seines Ganges senkrecht war.
»Michail Petrowitsch möchte wissen, ob Sie fertig sind?« fragte ihn der Sekretär.
»Versteht sich, ich bin immer fertig«, sagte der Staatsanwalt, »welcher Prozeß ist der erste.«
»Der Giftmord.«
»Das ist schön«, sagte der Staatsanwalt, aber er fand es gar nicht schön: er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Er war zu einem Abschiedsschmaus zu Ehren eines Kollegen gewesen, man hatte viel getrunken und bis zwei Uhr gespielt, und war nachher zu Frauen gefahren, in dasselbe Haus, in welchem noch vor sechs Monaten die Maslowa war, – so daß er gerade die Akten zu dem Giftmord noch nicht hatte lesen können, und sie jetzt erst flüchtig durchsehen wollte. Der Sekretär aber hatte absichtlich dem Vorsitzenden geraten, diesen Prozeß als ersten vorzunehmen, weil er wußte, daß jener die betreffenden Akten nicht gelesen hatte. Der Sekretär war von liberaler, ja fast radikaler Denkungsart. Breve aber war konservativ und sogar, wie alle in Rußland im Staatsdienst stehenden Deutschen, besonders streng orthodox, und der Sekretär hatte ihn nicht gern und beneidete ihn um seine Stellung.
»Nun, und wie ist es mit dem Prozeß der Skopzen?«
»Ich habe schon gesagt, daß ich den nicht nehmen kann,« sagte der Staatsanwalt, »weil die Zeugen fehlen, ich werde das auch dem Gericht erklären.«
»Aber es ist ganz gleich ...«
»Ich kann nicht«, sagte der Staatsanwalt und, auf die gewohnte Weise mit der Hand abwehrend, eilte er in sein Zimmer.
Er schob den Prozeß der Skopzen auf wegen der Abwesenheit eines gar nicht wichtigen und für den Prozeß nicht nötigen Zeugen, nur darum, weil dieser Prozeß, wenn er vor einem Gericht mit Geschworenen aus gebildeten Kreisen vor sich gehen würde, mit Freisprechung endigen konnte. Im Einverständnis mit dem Vorsitzenden sollte dieser Prozeß auf eine Session in einer Kreisstadt verlegt werden, wo es mehr Bauern und darum mehr Aussicht für eine Verurteilung geben würde.
Die Bewegung auf dem Korridor nahm immer noch zu. Am meisten Leute waren vor dem Saal der Zivilabteilung, wo die Verhandlung vor sich ging, von der der ansehnliche Herr, der Liebhaber von Gerichtssachen, den Geschworenen gesprochen hatte.
Während der Pause kam aus diesem Saal jene alte Dame, welcher der geniale Advokat so geschickt das Vermögen zugunsten des Profitmachers weggenommen hatte, der auf dieses Vermögen kein Recht hatte. Das wußten auch die Richter und noch mehr der Kläger und sein Advokat; aber der von ihnen ausgedachte Kniff war solcher Art, daß es unmöglich war, dem alten Mütterchen sein Vermögen nicht wegzunehmen und es dem Profitmacher nicht auszuliefern.
Die alte Dame war eine dicke Frau in einem prächtigen Kleide mit kolossalen Blumen auf dem Hute. Nachdem sie aus der Tür herausgekommen, blieb sie in dem Korridor stehen und, die dicken, kurzen Arme ausbreitend, wiederholte sie immer, sich an ihren Advokaten wendend: »Was soll denn das sein? Sein Sie doch so gut! Was heißt denn das?« Der Advokat betrachtete die Blumen auf ihrem Hut und hörte nicht zu, indem er etwas überlegte.
Gleich nach der Alten kam rasch aus der Tür des Saals der Zivilabteilung, mit dem Plastron in weit offener Weste und mit einem selbstzufriedenen Gesichte glänzend, eben jener berühmte Advokat heraus, der es so gewendet, daß das alte Mütterchen mit den Blumen das Nachsehen hatte, der Profitmacher aber, der ihm zehntausend Rubel gegeben, mehr als hunderttausend bekam. Alle Augen wandten sich auf den Advokaten; er fühlte das und sein ganzes Auftreten schien zu sagen: »es sind keine Äußerungen der Ergebenheit nötig«, und er ging rasch an allen vorbei.
7
Endlich traf auch Matwej Nikititsch ein, und der Gerichtskommissar, ein magerer Mensch mit langem Halse und schrägem Gang und mit ebenso schräg vorgeschobener Unterlippe trat in das Geschworenenzimmer. Dieser Gerichtskommissar war ein ehrlicher Mann mit Universitätsbildung, konnte sich aber nirgends auf seinem Posten behaupten, weil er periodisch trank. Vor drei Monaten hatte eine Gräfin, eine Gönnerin seiner Frau, ihm diese Stelle besorgt, und er hielt sich bis jetzt auf derselben und freute sich dessen.
»Wie ist's, meine Herren, sind alle versammelt?« sagte er, indem er seinen Zwicker aufsetzte und über denselben hinwegsah.
»Alle da, scheint es«, sagte der lustige Kaufmann.
»Wollen die Probe machen.« Der Gerichtskommissar holte aus der Tasche die Liste hervor und fing an, indem er die Aufgerufenen bald über, bald durch den Zwicker anblickte, aufzurufen.
»Staatsrat I. M. Nikiforow!«
»Hier«, sagte der ansehnliche Herr, der alle Gerichtssachen kannte.
»Oberst außer Diensten Iwan Semionowitsch Iwanow.«
»Hier!« gab der magere Mann in der Uniform der Abgedankten zur Antwort.
»Kaufmann der zweiten Gilde, Peter Baklaschow.«
»Hier ist er!« sagte der gutmütige Kaufmann, mit dem ganzen Munde lächelnd, »wir sind bereit!«
»Gardeleutnant Fürst Dmitrij Nechliudow.«
»Hier«, antwortete Nechliudow.
Der Gerichtskommissar verneigte sich besonders höflich und angenehm, indem er über den Zwicker hinweg blickte, als ob er ihn auf diese Weise vor den anderen auszeichnen wolle.
»Hauptmann Jurij Dmitrijewitsch Dantschenko,« »Kaufmann Grigorij Jefimowitsch Kuleschow« und so weiter. Alle, außer zweien, waren anwesend.
»Jetzt bitte, meine Herren, in den Saal einzutreten«, sagte der Gerichtskommissar, indem er mit einer höflichen Geste auf die Tür zeigte.
Alle rührten sich, gingen nacheinander durch die Tür in den Korridor hinaus und aus dem Korridor in den Verhandlungssaal.
Der Gerichtssaal war ein großer, langer Raum. Ein Ende desselben war von einer Erhöhung eingenommen, zu welcher drei Stufen hinaufführten. Auf der Erhöhung, in der Mitte, stand ein Tisch, bedeckt mit grünem Tuch, mit dunklerer grüner Franse.
Hinter dem Tisch standen drei Lehnstühle mit sehr hohen, eichenen, geschnitzten Rückenlehnen; dahinter hing in goldenem Rahmen ein in grellen Farben gemaltes Porträt des Kaisers in Lebensgröße, in Uniform und Ordensband mit vorgesetztem Fuß, die Hand am Degen. In der rechten Ecke hing ein Heiligenschrein mit dem Bilde Christi in der Dornenkrone, und stand ein Betpult; ebenfalls an der rechten Seite stand der Schreibtisch des Staatsanwalts. An der linken Seite, dem Schreibtisch gegenüber, war im Hintergrunde das Tischchen des Sekretärs, und näher zum Publikum, befand sich eine eichene gedrechselte Barriere; hinter derselben die noch nicht besetzte Bank der Angeklagten. Auf der rechten Seite, auf der Erhöhung, standen in zwei Reihen Stühle, gleichfalls mit hohen Rückenlehnen, für die Geschworenen, hinten die Tische für die Advokaten. Alles das war im vorderen Teil des Saales, welcher durch die Barriere in zwei Hälften geteilt wurde. Der hintere Teil war ganz mit Bänken besetzt, die reihenweise aufsteigend bis zur hinteren Wand reichten. In diesem hinteren Teil des Saales, auf den vorderen Bänken, saßen vier Frauen, anscheinend Fabrikarbeiterinnen oder Zimmermädchen, und zwei Männer, auch aus dem Arbeiterstande; sie schienen von der Großartigkeit der Saaleinrichtung wie erdrückt und flüsterten scheu miteinander.
Bald nach den Geschworenen trat der Gerichtskommissar mit seinem einseitigen Gang in die Mitte vor und rief mit lauter Stimme, als ob er damit die Anwesenden erschrecken wolle:
»Das Gericht kommt!«
Alle standen auf, und auf die Erhöhung des Saales traten die Richter: der Vorsitzende mit den Muskeln und dem schönen Backenbart; dann das finstere Gerichtsmitglied mit der goldenen Brille; der Mann war jetzt noch finsterer, weil es gerade vor der Sitzung seinen Schwager, den Gerichtskandidaten, getroffen hatte, der ihm mitteilte, er sei bei seiner Schwester gewesen, und sie habe ihm erklärt, es werde kein Mittagessen geben.
»Wir werden also wohl in die Kneipe gehen müssen«, sagte der Schwager lachend.
»Da ist gar nichts zu lachen«, sagte das finstere Gerichtsmitglied und wurde noch finsterer.
Endlich kam auch das dritte Gerichtsmitglied, derselbe Matwej Nikititsch, der sich immer verspätete; es war ein bärtiger Mann mit großen, nach unten gezogenen guten Augen. Dieses Gerichtsmitglied litt an Magenkatarrh und hatte vom heutigen Morgen ab auf den Rat des Doktors eine neue Diät begonnen. Und diese neue Diät hatte ihn heute noch länger als gewöhnlich zu Hause aufgehalten. Jetzt, als er die Erhöhung betrat, hatte er ein in sich gekehrtes Aussehen, da er die Gewohnheit hatte, bei allen Fragen, die er sich stellte, auf alle mögliche Weise ein Orakel zu befragen. Jetzt machte er bei sich aus: wenn die Zahl der Schritte von der Zimmertür bis zum Lehnstuhl ohne Rest durch drei teilbar sein wird, so wird die neue Diät ihn vom Katarrh heilen; wenn sie aber nicht teilbar ist, so wird sie nichts helfen. Es waren sechsundzwanzig Schritte, aber er machte einen kleinen Schritt, und mit dem siebenundzwanzigsten erreichte er den Lehnstuhl.
Die Gestalten des Vorsitzenden und der Mitglieder, die in ihren Uniformen mit den goldgestickten Kragen auf die Erhöhung traten, waren sehr imposant. Sie fühlten das selber, und alle drei, wie durch ihre eigene Herrlichkeit befangen, setzten sich, indes sie die Augen eilig und bescheiden sinken ließen, auf ihre geschnitzten Lehnstühle hinter dem mit grünem Tuch bedeckten Tische, auf welchem ein dreieckiges Instrument mit einem Adler, ferner Glasgefäße, wie man sie zur Aufbewahrung von Bonbons in Büfetts zu verwenden pflegt, und ein Tintenfaß standen, und Schreibfedern, reines Papier und neu gespitzte Bleistifte verschiedener Größe sich befanden. Gleichzeitig mit den Richtern kam auch der Staatsanwalt.
Er ging ebenso eilig mit der Aktenmappe unterm Arm und ebenso den Arm schwenkend zu seinem Platz am Fenster und versank sogleich in das Lesen und Durchsehen der Akten, jede Minute benutzend, um sich zum Prozesse vorzubereiten. Dieser Staatsanwalt vertrat zum vierten Male die Anklage. Er war sehr ehrgeizig und fest entschlossen, Karriere zu machen; daher hielt er es für notwendig, in allen Prozessen, wo er die öffentliche Anklage hatte, nach der Verurteilung zu streben. Das Wesentliche des Giftmordprozesses kannte er in allgemeinen Zügen, und den Plan seiner Rede hatte er schon gemacht; aber er brauchte noch einige Daten, und eben diese zog er sich jetzt eilig aus den Akten aus.
Der Sekretär saß am entgegengesetzten Ende der Erhöhung, und nachdem er alle diejenigen Papiere, welche vielleicht zum Vorlesen gebraucht werden konnten, bereitgelegt, sah er einen verbotenen politischen Artikel durch, den er sich gestern verschafft und gelesen hatte. Er wollte über diesen Artikel mit dem Gerichtsmitglied mit dem großen Bart sprechen, das seine Ansichten teilte; und vor dem Gespräch wollte er sich mit dem Inhalt vertraut machen.
8
Nachdem der Vorsitzende die Akten durchgesehen, stellte er einige Fragen an den Gerichtskommissar und an den Sekretär, und als er bejahende Antworten bekommen hatte, ordnete er die Vorführung der Angeklagten an.
Sogleich öffnete sich die Tür hinter der Barriere, es kamen zwei Gendarmen mit Mützen und bloßen Säbeln, und hinter ihnen zuerst der eine Angeklagte, ein rothaariger Mann mit Sommersprossen, und zwei Frauen. Der Mann trug einen für ihn zu weiten und zu langen Gefängniskaftan. Als er den Gerichtssaal betrat, hielt er seine Arme mit den ausgespreizten Daumen mit Anstrengung an den Hosennähten, indem er durch diese Haltung die zu lang herabhängenden Ärmel zurückhielt. Ohne die Richter und die Zuschauer anzusehen, betrachtete er aufmerksam die Bank, welche er umging. Nachdem er sie umgangen, setzte er sich auf dieselbe genau am Rande, um den anderen Platz zu lassen; das Auge auf den Vorsitzenden geheftet, fing er an, die Muskeln der Wangen zu bewegen, als ob er etwas flüstere. Nach ihm trat eine nicht junge Frau herein, auch in Gefängniskleidung. Der Kopf der Gefangenen war mit einem Arrestantenhalstuch umbunden, ihr Gesicht, ohne Augenbrauen und Wimpern, mit geröteten Augen war grauweiß. Die Frau schien vollständig ruhig.
Als sie auf ihren Platz ging, blieb ihr Rock an etwas hängen; sie löste ihn sorgfältig und ohne Eile ab und setzte sich.
Die dritte Angeklagte war die Maslowa.
Sobald sie hereintrat, wandten sich die Augen aller Männer, die im Saal waren, auf sie, und lange blieben sie auf ihrem weißen Gesicht mit den schwarzen, glänzenden Augen und auf ihrem unter dem Gewand hervortretenden hohen Busen haften. Sogar der Gendarm, an dem sie vorüber mußte, sah sie an, ohne die Augen von ihr abzuwenden, bis sie vorbei war und sich setzte, und dann, als sie saß, wandte er sich eilig ab, als ob er sich seiner Schuld bewußt würde und, sich schüttelnd, begann er das Fenster gerade gegenüber anzustarren.
Der Vorsitzende wartete, bis die Angeklagten ihre Plätze eingenommen hatten, und sobald die Maslowa saß, wandte er sich an den Sekretär.
Es begann die gewöhnliche Prozedur: das Zählen der Geschworenen, die Beratungen über die Nichterschienenen, die Belegung derselben mit Strafen, die Entscheidung über diejenigen, welche um Urlaub gebeten hatten, der Ersatz der fehlenden durch andere. Dann legte der Vorsitzende die Lose zusammen und in das Glasgefäß hinein und fing an, nachdem er die gestickten Ärmel der Uniform ein wenig heraufgestreift und seine stark behaarten Arme entblößt hatte, mit den Gesten eines Taschenspielers ein Zettelchen nach dem anderen herauszuziehen, zu entrollen und zu lesen. – Dann streifte er die Ärmel hinunter und forderte den Geistlichen auf, die Geschworenen zu vereidigen.
Der alte Geistliche mit dem aufgedunsenen, gelblichblassen Gesicht, in dem zimmetfarbigen Talar, mit einem goldenen Kreuz auf der Brust und noch einem kleinen Orden, der seitwärts am Talar angesteckt war, trat, langsam unter dem Talar seine angeschwollenen Beine bewegend, an das Betpult heran, welches unter dem Heiligenbilde stand.
Die Geschworenen standen auf und drängten sich in einem Haufen gegen das Betpult.
»Ich bitte«, sagte der Geistliche, die Annäherung aller Geschworenen abwartend, indem er mit der geschwollenen Hand sein Kreuz auf der Brust betastete.
Dieser Geistliche bekleidete sein Priesteramt seit sechsundvierzig Jahren und wollte nach vier Jahren sein Jubiläum feiern; so wie er das des Domoberpriesters neulich gefeiert. In dem Bezirksgericht aber wirkte er seit Einführung dieser Gerichte und war sehr stolz darauf, daß er einige zehntausend Menschen vereidigt, und daß er auch im vorgeschrittenen Alter fortfuhr, zum Wohle der Kirche, des Vaterlandes und der Familie zu arbeiten, welch letzterer er außer einem Hause ein Kapital von nicht weniger als dreißigtausend in Wertpapieren hinterlassen würde. Daß aber seine Arbeit im Gericht, welche darin bestand, die Leute aufs Evangelium, wo der Eid gerade verboten wird, zu vereidigen, keine gute Arbeit war, kam ihm nie in den Sinn, und er fühlte sich nicht nur durchaus nicht bedrückt, sondern liebte diese gewohnte Beschäftigung, da er oft dabei die Bekanntschaft vornehmer Herren machte. Jetzt hatte er nicht ohne Vergnügen die Bekanntschaft des berühmten Advokaten gemacht, welcher ihm große Achtung einflößte, da er nur für diesen einen Prozeß der alten Frau mit den kolossalen Blumen auf dem Hute zehntausend Rubel bekommen hatte.
Als alle Geschworenen die Stufen zur Erhöhung hinaufgegangen waren, neigte der Geistliche den kahlen, grauen Kopf zur Seite, schob ihn in das Loch seines schmutzigen Epitrachils und, nachdem er seine dünnen Haare geordnet, wandte er sich an die Geschworenen:
»Heben Sie die rechte Hand auf, und legen Sie die Finger auf diese Weise zusammen«, sprach er langsam mit greisenhafter Stimme, indem er seine geschwollene Hand mit den Grübchen auf allen Fingern erhob und diese Finger zusammenlegte. »Jetzt sprechen Sie mir nach«, sagte er und fing an: »Ich verspreche und schwöre bei Gott dem Allmächtigen, vor seinem heiligen Evangelium und vor dem lebenschaffenden Kreuz des Herrn, daß ich in dem Prozeß, in welchem ...« sprach er, mit Unterbrechungen nach jeder Phrase. »Lassen Sie Ihre Hand nicht sinken, halten Sie sie so«, wandte er sich an einen jungen Mann, der seine Hand sinken ließ, »daß ich in dem Prozeß, in welchem ...«
Der ansehnliche Herr mit dem Backenbart, der Oberst, der Kaufmann und andere hielten ihre Hände mit den zusammengelegten Fingern so wie es der Geistliche verlangte, und wie mit besonderem Vergnügen, sehr entschieden und hoch, die übrigen aber nur unwillig und unbestimmt. Die einen sprachen die Worte zu laut, mit Übereifer – und mit einem Ausdruck, welcher besagte: also, jetzt spreche ich; andere wieder flüsterten nur, blieben hinter dem Geistlichen zurück, und dann, wie erschrocken, holten sie zur unrechten Zeit nach; die einen hielten ihre zusammengelegten Finger herausfordernd so fest, als ob sie fürchteten etwas fallen zu lassen, andere ließen sie auseinander und taten sie wieder zusammen. Allen war es ungemütlich, nur der gute alte Geistliche allein war unzweifelhaft überzeugt, daß er eine sehr nützliche und wichtige Tat vollbringe. Nach der Vereidigung forderte der Vorsitzende die Geschworenen auf, einen Obmann zu wählen. Die Geschworenen standen auf und drängten sich in das Beratungszimmer, wo fast alle sogleich Zigaretten hervorholten und anfingen, zu rauchen. Jemand schlug als Obmann den ansehnlichen Herrn vor, und alle waren sogleich einverstanden; sie löschten die Zigaretten, warfen sie fort und kehrten in den Saal zurück. Der erwählte Obmann erklärte dem Vorsitzenden, daß er zum Obmann gewählt worden, und alle begaben sich, bemüht, einander nicht auf die Füße zu treten, wieder zu ihren Plätzen und setzten sich in zwei Reihen auf die Stühle mit den hohen Rückenlehnen.