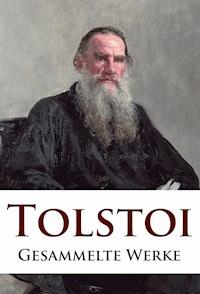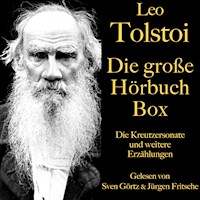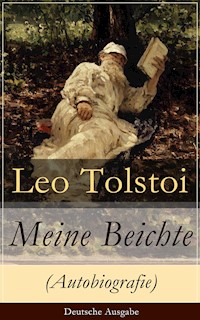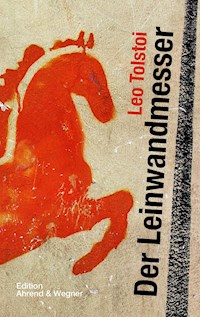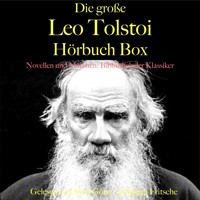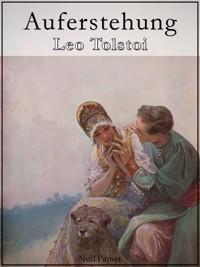
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein Gutsherr, als Geschworener bei Gericht, erkennt in der angeklagten Prostituierten ein in der Vergangenheit von ihm verführtes Mädchen wieder. Er fühlt sich mitschuldig an ihrem Schicksal und bemüht sich um eine Revision des Urteils. Tolstoi schildert die ganze Unvollkommenheit des damaligen Rechtssystems in Russland. Die Geschichte baut auf einem Gerichtsfall auf, von dem ihn ein Freund erzählt hat. Wie immer flechtet Tolstoi zahlreiche Nebenfiguren und Nebenhandlungen in seine Geschichte ein, sodass ein buntes Gesellschaftsbild der damaligen Zeit entsteht. »Auferstehung« ist nach »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina« der dritte und letzte Roman von Leo Tolstoi. Tolstoi schrieb mehr als zehn Jahre an dem Roman. Er wurde 1899 veröffentlicht, zwanzig Jahre nach Anna Karenina. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Leo Nikolajewitsch Tolstoi
Auferstehung
Vollständige Ausgabe
Leo Nikolajewitsch Tolstoi
Auferstehung
Vollständige Ausgabe
(Воскресение – Woskressenije)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Wilhelm Thal 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-38-6
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Autor und Werk
Vorwort des ersten Herausgebers
Vorwort des Übersetzers
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Dritter Teil -- Epilog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor und Werk
Leo Nikolajewitsch Tolstoi wird am 9. September 1828 in Jasnaja Poljana in eine russische Adelsfamilie hineingeboren. Weil er früh seine Eltern verliert, wird er von einer Tante erzogen. Zwischen 1844 und 1847 besucht er die Universität von Kasan, doch das Studium der Orientalistik und Rechtswissenschaft bricht er ohne Examen ab. Auch den ursprünglichen Plan, in den diplomatischen Dienst einzutreten, verwirft er.
Von den Ideen Rousseaus beflügelt, versucht er das System der Leibeigenschaft auf seinen Gütern abzuschaffen, was ihm jedoch nicht gelingt. Nach Jahren des Nichtstuns und angesichts angehäufter Spielschulden meldet er sich 1851 freiwillig zum Militärdienst. Er nimmt an den Kämpfen im Kaukasus und am Krimkrieg teil. Ab 1856 geht er auf zwei größere Europareisen.
Nach seiner Hochzeit mit der erst 18-jährigen Sofia Andrejewna Bers, mit der er 13 Kinder haben wird, lässt er sich 1862 an seinem Geburtsort nieder und verzeichnet erste kleine schriftstellerische Erfolge.
Ab 1869 erleidet Tolstoi eine tiefe Sinnkrise, nicht zuletzt, weil ihm die Widersprüche zwischen seinem eigenen Leben im Wohlstand und seinen politischen Überzeugungen unauflösbar erscheinen. Er liest Schopenhauer, was seine pessimistische Grundeinstellung noch weiter vertieft.
Seine Arbeit wird zunehmend von ethischen und religiösen Themen bestimmt. Unter diesen Vorzeichen entstehen auch seine großen Romane Krieg und Frieden (1868/69) und Anna Karenina (1875--1877).
1901 lehnt er den Nobelpreis für Literatur ab, weil ihm inzwischen jede Art von Organisation -- sogar soziale und kulturelle -- suspekt ist; auch die Exkommunikation aus der russisch-orthodoxen Kirche (er weigert sich u.a., die Dreieinigkeit Gottes anzuerkennen) im selben Jahr nimmt er gelassen hin. Im November 1910 versucht er seiner zunehmend zerrütteten Ehe durch eine heimliche Flucht zu entkommen und will künftig besitzlos und einsam leben. Auf der Bahnstation von Astapowo stirbt er noch im gleichen Monat, am 20. November 1910, an einer Lungenentzündung.
Drei berühmte Ehebrecherinnen kennt die europäische Literatur: die deutsche Effi Briest, die französische Madame Bovary und die russische Anna Karenina. Der Roman »Anna Karenina« von Leo N. Tolstoi wurde 1875-1877 zur Zeit des russischen Realismus veröffentlicht. In drei miteinander verwobenen Handlungssträngen wirft Tolstoi moralische Fragen zur Ehe, zum Ehebruch und zur Gesellschaftsordnung auf. Die Titelfigur Anna Karenina flüchtet aus einer freudlosen Ehe mit dem Staatsbeamten Alexej Karenin in eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu dem Grafen Wronskij, die in eine Katastrophe führt.
In seinem großartigen und detailreichen Werk dringt Tolstoi tief in die Psyche seiner Charaktere ein, ohne zu verurteilen oder sie ihrer Würde zu berauben. Sowohl die Hauptfiguren als auch die Nebenfiguren erscheinen als Suchende nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Unter Tolstois Romanen gilt Anna Karenina als künstlerisch vollkommenster.
Die Antworten, die der Autor uns durch den Verlauf der Handlung gibt, haben nichts Endgültiges. Sie sind aus seiner Zeit heraus zu verstehen, doch bleibt es den Lesern unbenommen, zu anderen Antworten zu gelangen.
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich.« Dieser erste Satz des Romans wird auch als »Anna-Karenina-Prinzip« bezeichnet, und hat ebenso wie andere Teile des Inhalts mehr als 130 Jahre nach seinem Erscheinen nicht an Gültigkeit verloren. »Anna Karenina« gilt mit Recht als ein Klassiker der Weltliteratur.
Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündiget, vergeben? Ist es genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzig mal siebenmal.(Ev. Matth. 18, 21--22.)
*
Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?(Ev. Matth. 7, 5.)
*
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.(Ev. Johannis 8, 7.)
*
Der Jünger ist nicht über seinen Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen.(Ev. Luc. 8, 40.)
Vorwort des ersten Herausgebers
Es erfüllt den Herausgeber von »Kürschners Bücherschatz« mit berechtigtem Stolze, das großartige Werk Leo Tolstois in W. Thals trefflicher Übersetzung hierdurch zuerst und in jeder Hinsicht weitesten Kreisen zugänglich machen zu können. Es geschieht im Vertrauen auf die Unbefangenheit und die Reife des Lesers, dem hier ein so vollständig Anderes entgegentritt, dass er auch eines anderen Maßstabes und vor allem eines freien und unbefangenen Blickes bedarf, um dem Ungewöhnlichen gegenüber den rechten Standpunkt zu gewinnen. Tolstoi schreibt mit der Wahrheit des großen und lauteren Charakters, voll Liebe für die Menschheit, als Vertreter heiligster Sache. Er zeigt dabei, was die Verhältnisse zu zeigen ihn zwingen, aber nur Böswilligkeit und Unlauterkeit des Herzens können daran Anstoß nehmen, kein Einsichtiger wird verkennen, dass gerade diese Wege gegangen werden mussten, um zu diesem Ende zu gelangen. Der Eisenbahnzug, den der Dichter im letzten Kapitel seines Werkes den Steppen Sibiriens entgegenrollen lässt, gemahnt an den Train, der am Schlusse eines der gewaltigen Rougon-Macquart-Romane Zolas führerlos der Grenze zueilt, aber während dieser seine Insassen sicherem Untergange zuführt, dämmert jenem das erlösende Morgenrot der Auferstehung entgegen!
Des Dichters Absicht ist, in einer Art von Epilog auch die letzten Einzelheiten dieser Auferstehung, zu dem das ganze Werk hinleitet, zu behandeln. Führt er sie aus, soll auch diese Arbeit des russischen Dichters und Apostels der Menschlichkeit den Lesern des Bücherschatzes nicht vorenthalten bleiben.
Joseph Kürschner.
Vorwort des Übersetzers
Die »Auferstehung«, das letzte Werk bei Grafen Leo Tolstoi, das wir in deutscher Übertragung dem Publikum bieten, darf wohl als eine Kulturtat unserer Jahrhundertwende bezeichnet werden, und wohl selten hat ein Werk schon vor seinem Erscheinen so viel Erregung hervorgerufen, wie gerade dieses. Selbst das Aufsehen, das die »Kreutzersonate« vor etwa zehn Jahren erregte, ist nicht damit zu vergleichen. Noch während damals die Meinungen vielfach geteilt waren und viele Bewunderer des Schriftstellers zu den Ausführungen des Philosophen und Moralisten den Kopf schüttelten, ist man wohl diesmal in der Beurteilung der »Auferstehung« so ziemlich einer Meinung, dass Tolstoi die Welt -- nicht nur sein engeres Vaterland -- mit einem Kunstwerk ersten Ranges beschenkt hat, das jeder Büchersammlung zur höchsten Ehre gereicht, Selbst der heikle Stoff kann nichts daran ändern, denn nur die dringendste Notwendigkeit hat den Dichter veranlasst, in die Nachtseiten des Lebens hinabzusteigen, und zudem behandelt er die heikelsten Dinge mit einem so sittlichen Ernste, einer mit größter Wahrheitsliebe Hand in Hand gehenden Dezenz,1 die ihn von vielen seiner großen Kollegen unterscheidet! Wie ganz anders hätte Zola, Annunzio oder ein deutscher Naturalist denselben Stoff behandelt! Unsere einsichtsvollen Leser werden es uns Dank wissen, dass wir nur geringe Milderungen vorgenommen und den Gedanken des Meisters nicht durch sinnlose Streichungen und Verbesserungen verballhornt haben! -- Ist doch das Werk Tolstois eine Meisterschöpfung, die der Bewunderung eines Jeden, würdig ist, und Bewunderung erfasst uns allein schon, wenn wir sehen, welche Fülle von Gebieten Tolstoi im Rahmen seines Romans behandelt! Alle Einrichtungen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens werden kritisch beleuchtet und mit unerbittlicher Sonde untersucht; die ganze überfirnisste Hohlheit der vornehmen Welt, die unvermeidlichen Schäden der russischen Gesetzgebung, die im Formelkram befangen, selbst die Rehabilitierung eines Unschuldigen nicht zulässt, sondern ihn eher nach Sibirien verschickt, als einen Fehler zugibt, die unmenschliche Behandlung der Gefangenen, dieser blutrote Faden, der sich seit Jahrhunderten durch die Geschichte Russlands zieht, die ungerechte Verteilung der Güter, die den Bauern zum willenlosen Sklaven des Feudalherrn herabdrückt und den russischen Muschik trotz der Aufhebung der Leibeigenschaft zum Werkzeug der »Herrschaft« macht und in Elend und Knechtschaft noch auf lange Zeit erhalten wird -- das alles findet in Tolstoi, der hier die Theorie Henry Georges zu der seinen gemacht hat, einen leidenschaftlichen Ankläger.
Aber man glaube nicht etwa, dass der Verfasser über der Tendenz das Werk selbst vernachlässigt hat. Im Gegenteil! Es ist eine bis in kleinste Detail spannende und hochinteressante Kriminalgeschichte, der Roman einer unschuldig zu Zwangsarbeit Verurteilten, und man kann sagen, dass Tolstoi, der Siebzigjährige, sich mit diesem Werke selbst übertroffen hat und dass die »Auferstehung« sogar »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina« in den Schatten stellt. Trotz aller Einfachheit des Stils hat er es verstanden, eine an dramatischen Szenen unendlich reiche Handlung zu erfinden oder vielmehr nicht zu erfinden, denn seine Heldin ist eine lebende Figur und ihre Geschichte leider nur zu wahr, und selbst Alexander Dumas und Eugène Sue, diese Meister der »spannenden Effekte«, haben nichts Interessanteres und Packenderes geboten, als dieses so unendlich einfache und natürliche Werk. Alle Figuren leben, sie sind wirklich gesehene Menschen, keine ins Übermäßige vergrößerte Edelgestalten oder titanenhaften Schurken, wie sie der Verfasser des »Monte Christo« und auch Victor Hugo in seinem »Glöckner von Notre Dame« schufen. Hier haben wir Typen vor uns, die uns jeden Tag auf der Straße begegnen, die uns gerade darum so ergreifen und rühren, weil ihre Schicksale, ihre Leiden und Freuden uns menschlich nahe gehen, weil wir sie verstehen und begreifen, wie sie der Dichter verstanden und begriffen hat. Mit diesem Werke hat sich Tolstoi -- unabhängig von seinen früheren Schriften -- ein unvergängliches Denkmal in der Literaturgeschichte geschaffen, und hätte er nichts weiter als die »Auferstehung« verfasst, es würde doch auf ihn das Wort des Dichters passen:
»Es wird die Spur von seinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen«
Der Übersetzer
Feingefühl, Zurückhaltung <<<
Erster Teil
Erstes Kapitel
Vergeblich bemühten sich einige hunderttausend Menschen, die auf kleinem Raum vereinigt waren, die Erde zu verstümmeln, auf der sie lebten; umsonst erdrückten sie die Erde unter Steinen, damit nichts aufkeimen konnte; umsonst rissen sie das kleinste Grashälmchen aus; umsonst verpesteten sie die Luft mit Petroleum und Steinkohle; umsonst beschnitten sie die Bäume; umsonst jagten sie die Tiere und Vögel fort; der Frühling war, selbst in der Stadt, immer noch der Frühling. Die Sonne strahlte; das Gras begann wie neubelebt wieder zu wachsen, nicht nur auf dem Rasen des Boulevards, sondern auch zwischen den Straßenrinnsteinen; die Birken, Pappeln und Maulbeerbäume entfalteten ihre feuchten und duftenden Blätter; die Linden zeigten ihre dicken, fast schon platzenden Knospen; die Krähen, Sperlinge und Tauben arbeiteten lustig an ihren Nestern; die Bienen und Fliegen summten an den Wänden und freuten, sich, dass die gute warme Sonne wiedergekehrt war. Alles war lustig, die Pflanzen, die Insekten, die Vögel, die Kinder. Nur die Menschen fuhren fort, sich und andere zu quälen und zu betrügen. Nur die Menschen meinten, nicht dieser Frühlingsmorgen, nicht diese himmlische Weltenschönheit, die zur Freude aller lebenden Wesen geschaffen war und sie alle zum Frieden, zur Eintracht und Zärtlichkeit zurückführen sollte, wäre wichtig und heilig, nein, wichtig und heilig wäre nur das, was sie selbst ersonnen, um sich gegenseitig zu quälen und zu betrügen.
So wurde es auch in dem Büro des Gouvernementsgefängnisses nicht für wichtig und heilig erachtet, dass die Freude und Wonne des Frühlings den Menschen beschieden war, sondern dass die Beamten dieses Büros am vorigen Abend ein mit einem Siegel verschlossenes, am Kopfe mit vielen Nummern versehenes Blatt erhalten hatten, das sie anwies, an demselben Morgen des 28. April 9 Uhr drei Angeklagte, zwei Frauen und einen Mann, jeden getrennt, nach dem Justizgebäude zu bringen, und zwar behufs ihrer Aburteilung. Dieser Anweisung zufolge trat am 28. April um 8 Uhr morgens ein alter Wärter in den düsteren und stinkenden Korridor der Frauenabteilung. Sofort eilte ihm die Aufseherin der Abteilung, ein Geschöpf von kränklichem Aussehen, das eine graue Nachtjacke und einen schwarzen Rock trug, entgegen und sagte:
»Sie wollen die Maslow holen?«
Dann ging sie mit dem Wärter auf eine der zahlreichen, auf den Korridor führenden Türen zu. Der Wärter steckte mit, lautem Klirren einen dicken Schlüssel in die Tür, die beim Öffnen einen noch grässlicheren Gestank aus dem Gange entströmen ließ und rief dann:
»Maslow! Nach dem Justizgebäude!«
Damit schloss er die Tür, blieb unbeweglich stehen und wartete auf die Frau, die er gerufen hatte.
Einige Schritte weiter, auf dem Gefängnishofe, konnte man eine reinere und belebendere Luft atmen, die der Frühlingswind von den Feldern hereintrug. Doch in dem Gefängniskorridor war die Luft drückend und ungesund, es roch nach Teer, Feuchtigkeit und Fäulnis, und niemand konnte diese Luft einatmen, ohne sofort eine düstere Traurigkeit zu empfinden. Das fühlte auch die Aufseherin der Abteilung, so sehr sie auch an diese verpestete Luft gewöhnt war. Sie kam vom Hofe und verspürte, als sie den Korridor kaum betreten hatte, ein Gemisch von Unbehagen und Müdigkeit.
Hinter der Tür, im Zimmer der Gefangenen, herrschte große Aufregung; man hörte Stimmen, Gelächter und Schritte nackter Füße.
»Na, vorwärts, tummle dich!«, rief der alte Wärter und öffnete von neuem die Tür.
Einen Augenblick später kam eine kleine, aber wohlgebaute, junge Frau schnell aus dem Zimmer. Sie trug einen grauen Leinenkittel über ihrer Nachtjacke und ihrem weißen Rock. An den Füßen hatte sie leinene Strümpfe und grobe Gefangenenschuhe. Ein weißes Tuch bedeckte ihren Kopf und ließ einige Locken sorgfältig frisierter schwarzer Haare sehen. Auf dem ganzen Gesicht der Frau lag jene eigentümliche Blässe, die man nur bei Personen bemerkt, die sich lange Zeit in einem geschlossenen Raum aufgehalten haben. Noch um so mehr trat in der matten Blässe der Haut der Glanz der beiden großen, schwarzen Augen hervor, von denen eines ein bisschen schielte; das Ganze machte den Eindruck einer freundlichen Anmut. Die junge Frau hielt sich sehr gerade, so dass ihre starke Brust hervortrat.
Auf dem Korridor neigte sie leicht den Kopf und sah dem alten Aufseher fest in die Augen; dann blieb sie stehen und schien bereit, jedem Befehle zu gehorchen. Indessen schickte sich der Wärter an, die Tür wieder zu schließen, als sich diese noch einmal öffnete und das düstere Gesicht eines alten Weibes erschien. Dasselbe hatte weiße Haare und war barhäuptig. Die Alte begann leise auf die Maslow einzusprechen; doch der Wärter stieß sie schnell in die Stube zurück und schloss die Tür. Nun näherte sich die Maslow einem in der Tür angebrachten Guckfenster; und das Gesicht des alten Weibes zeigte sich sofort auf der andern Seite. Man hörte durch die Tür eine heisere Stimme:
»Gib acht, und habe vor allen Dingen keine Furcht! Leugne alles; halt’ dich gut; das ist die Hauptsache!«
»Ah bah,« versetzte die Maslow kopfschüttelnd, »eins oder das andere, das ist alles eins! Es kann mir nichts Schlimmeres passieren, als was ich jetzt habe!«
»Na, gewiss ist es eins und nicht zwei,« sagte der alte Wärter, auf seine geistreiche Bemerkung äußerst stolz. »Na, vorwärts, folge mir!«
Der Kopf des alten Weibes verschwand von dem Guckfenster, und die Maslow betrat, mit leichtem Schritt hinter dem alten Wärter hergehend, den Korridor. Sie gingen die Steintreppe hinunter, an den stinkenden, lärmenden, Sälen der Männerabteilung vorbei, wo neugierige Blicke sie auf ihrem Wege durch die Türluken beobachteten, und kamen endlich in das Gefängnisbüro. Dort standen bereits zwei Soldaten, mit dem Gewehr im Arm, die auf die Gefangenen warteten, um sie nach dem Gerichtsgebäude zu bringen. Der Aktuar schrieb etwas ein und übergab einem Soldaten ein stark nach Tabak riechendes Blatt Papier. Der Soldat steckte es in den Ärmelaufschlag seines Mantels, blinzelte seinem Gefährten, auf die Maslow deutend, pfiffig zu und stellte sich zu ihrer Rechten, während der andere Soldat auf die linke Seite trat. So verließen sie das Büro, gingen durch den äußeren Hof des Gefängnisses, durchschritten das Gitter und standen bald auf dem Straßenpflaster der Stadt.
Die Kutscher, Ladenbesitzer, Arbeiter und Beamte blieben unterwegs stehen und betrachteten neugierig die Gefangene. Mehrere dachten kopfschüttelnd: »Das kommt vom schlechten Lebenswandel, wenn man nicht so brav ist, wie wir!« Auch, die Kinder blieben stehen, doch in ihre Neugier mischte sich eine gewisse Angst, und sie beruhigten sich kaum bei dem Gedanken, dass die Verbrecherin ja von Soldaten bewacht wurde, so dass sie nicht mehr schaden konnte. Ein Bauer, der auf der Straße Kohlen verkaufte, trat auf sie zu, machte das Zeichen des Kreuzes und wollte dem Weibe eine Kopeke geben; doch die Soldaten litten es nicht, weil sie nicht wussten, ob es gestattet war.
Die Maslow bemühte sich, so schnell zu gehen, wie es ihre des Gehens ungewohnten Füße, die von den schweren Gefängnisschuhen noch mehr gehindert wurden, gestatteten. Ohne den Kopf zu bewegen, beobachtete sie die Leute, die sie beim Vorübergehen ansahen, und freute sich, der Gegenstand so großer Aufmerksamkeit zu sein; sie sog auch mit Behagen die sanfte Frühlingsluft ein, als sie aus der ungesunden Gefängnisatmosphäre kam. Als sie an einem Mehlladen vorüberkam, vor dem einige Tauben herumstolzierten, stieß sie an eine blaue Holztaube mit dem Fuße an. Der Vogel flatterte auf und berührte das Gesicht des jungen Weibes, das den Hauch seiner Flügel auf ihrer Wange spürte. Sie lächelte, stieß aber gleich darauf einen Seufzer aus, als ihr das Gefühl ihrer traurigen Lage wieder in den Sinn kam.
Zweites Kapitel
Die Geschichte der Maslow war höchst alltäglich.
Sie war das natürliche Kind einer Bäuerin, die ihrer Mutter in einem Schloss beim Viehhüten half. Die Bäuerin, die nicht verheiratet war, brachte jedes Jahr ein Kind zur Welt; und wie es in solchem Falle oft passiert, wurden die Kinder sofort nach der Geburt getauft; ihre Mutter nährte sie nicht, weil sie unerwünscht zur Welt gekommen war und ihr bei ihrer Arbeit nur lästig fielen; deshalb starben die armen Kleinen auch bald vor Hunger.
Fünf Kinder waren schon auf diese Weise dahingegangen. Alle waren gleich nach der Geburt getauft worden, die Mutter nährte sie nicht, und sie waren gestorben. Das sechste Kind, das von einem herumziehenden Zigeuner stammte, war ein Mädchen; deshalb wäre ihr aber doch dasselbe Schicksal, wie den fünf ältesten, beschieden gewesen, hätte es der Zufall nicht gefügt, dass eine der beiden alten Damen, denen das Schloss gehörte, einen Augenblick in den Kuhstall trat, um ihre Mägde wegen der Sahne, die nach der Kuh schmeckte, auszuschelten. Im Kuhstall lag die Wöchnerin an der Erde und neben ihr ein schönes, lebensfähiges, gesundes Kind. Die alte Dame schalt die Mägde, weil sie die Sahne so schlecht zubereitet und eine Wöchnerin in den Kuhstall gelassen hatten; als sie aber das Kind bemerkte, ward sie milder und erbot sich sogar, Patenstelle zu vertreten. Dann empfand sie Mitleid mit dem kleinen Mädchen, ließ der Mutter Milch und etwas Geld verabreichen, damit sie es nähren sollte, und so blieb das Kind am Leben. Daher nannten sie die beiden alten Damen auch »die Gerettete«.
Das Kind war drei Jahre alt, als seine Mutter krank wurde und starb, und da die alte Großmutter nichts mit ihm anzufangen wusste, so nahmen es die beiden alten Damen zu sich ins Schloss. Es war mit seinen großen schwarzen Augen ein außergewöhnlich lebhaftes und niedliches Kind; und die beiden Alten hatten Wohlgefallen an ihm. Die jüngere der beiden, die auch die nachsichtigere war, hieß Sophie Iwanowna; das war des Kindes Pate. Die ältere, Marie Iwanowna, hatte mehr Anlage zu Strenge. Sophie Iwanowna putzte die Kleine, brachte ihr das Lesen bei und dachte, eine Gouvernante aus ihr zu machen. Marie Iwanowna dagegen wollte eine Magd, eine hübsche Kammerzofe aus ihr machen; infolgedessen war sie anspruchsvoller, gab dem Kinde Befehle und schlug es manchmal, wenn sie schlechter Laune war. So wuchs die Kleine unter der Einwirkung dieses Doppeleinflusses auf und wurde halb eine Kammerzofe, halb ein Fräulein. Selbst der Name, den man ihr gab, passte zu diesem Zwitterzustand; man nannte sie weder Katja, noch Katenka, sondern Katuscha. Sie nähte, brachte die Stuben in Ordnung, reinigte die Heiligenbilder mit Kreide, servierte den Kaffee, wusch die seine Wäsche und durfte ihren Gebieterinnen manchmal Gesellschaft leisten und vorlesen.
Man hatte wiederholt um sie angehalten, doch sie hatte stets Körbe ausgeteilt; verhätschelt, wie sie von dem ruhigen Schlossleben war, fühlte sie, es würde ihr schwer fallen, mit einem Arbeiter oder einem Diener zu leben.
So hatte sie bis zu ihrem siebzehnten Jahr gelebt. Sie trat in ihr neunzehntes, als ein Neffe der beiden Damen ins Schloss kam, der schon vorher einen ganzen Sommer bei seinen Tanten zu gebracht. In ihn hatte sich das junge Mädchen wahnsinnig verliebt. Er war Offizier und wollte sich ein paar Tage ausruhen, bevor er mit seinem Regiment in den Krieg gegen die Türken zog. Am dritten Tage, am Abend vor seinem Fortgange verführte er Katuscha, und zog am nächsten Morgen fort, nachdem er ihr einen Hundertrubelschein zugesteckt.
Seit diesem Augenblick wurde ihr alles lästig; sie dachte nur noch daran, wie sie der Schande, die sie erwartete, entgehen konnte; selbst ihre Gebieterinnen bediente sie nachlässig und widerwillig. Die beiden alten Damen bemerkten ihren Zustand bald. Maria Iwanowna schalt sie ein-, zweimal aus; doch schließlich sahen sie sich, wie sie selbst sagten, gezwungen, »sich von ihr zu trennen,« d.h., sie warfen sie hinaus. Als sie sie verließ, trat sie als Mädchen für alles bei einem Stanowoj1 in Dienst; doch hier konnte sie nur drei Monate bleiben, denn der Stanowoj, ein alter Mann von über 60 Jahren, begann ihr schon im zweiten Monat den Hof zu machen. Eines Tages, als er sich ganz besonders zudringlich zeigte, nannte sie ihn ein Vieh und einen alten Teufel, und wurde deshalb wegen Frechheit entlassen. Eine andere Stellung zu suchen, daran konnte sie nicht denken, deshalb ging sie in Pension zu einer ihrer Tanten, einer Witwe, die eine Kneipe hatte und außerdem Hebamme war. Ihre Entbindung ging leicht und glücklich von statten. Doch die Hebamme, die ins Dorf zu einer kranken Bäuerin gegangen war, steckte Katuscha mit dem Kindbettfieber an. Das Kind, ein kleiner Junge, wurde ebenfalls krank und in ein Krankenhaus gebracht, starb aber dort gleich unter den Augen der Frau, die ihn hingebracht hatte.
Katuschas ganzes Vermögen bestand in 127 Rubeln; 27, die sie sich verdient, und den 100 Rubeln, die ihr ihr Verführer gegeben hatte. Als sie von der Hebamme kam, blieben ihr sechs Rubel. Die Hebamme hatte ihr für ihre Pension auf zwei Monate 40 Rubel abgenommen; 28 Rubel hatte man für die Aufnahme des Kindes ins Hospital bezahlt; 40 Rubel hatte ihr die Hebamme noch als Darlehen abgenommen, um sich eine Kuh zu kaufen; was den Rest von 20 Rubel betraf, so hatte sie Katuscha -- sie wusste selbst nicht wie -- in unnützen Einkäufen und Geschenken ausgegeben, so dass sie bei ihrer Genesung ohne Geld dastand und sich eine Stelle suchen musste. Sie trat bei einem Forsthüter ein. Dieser Forsthüter war verheiratet; doch schon am ersten Tage begann er wie der Stanowoj der jungen Magd den Hof zu machen. Seine Frau bemerkte das bald, und als sie ihn eines Tages allein mit Katuscha in einem Zimmer traf, schlug sie ihr das Gesicht blutig und schickte sie fort, ohne ihr auch nur ihren Lohn zu bezahlen. Katuscha begab sich nun in die Stadt zu einer Base, deren Mann Buchbinder war; derselbe hatte früher gut dagestanden, aber er hatte seine Kundschaft verloren, war ein Trunkenbold geworden und gab alles Geld, das ihm in die Hände fiel, in der Kneipe aus. Seine Frau hatte eine kleine Plätterei, mit deren winzigem Verdienst sie ihre Kinder ernährte und ihren Trunkenbold von Mann erhielt. Sie machte Katuscha den Vorschlag, ihr Handwerk zu lernen. Doch als das junge Mädchen sah, welch’ anstrengendes Leben die Wäscherinnen führten, die bei ihrer Base arbeiteten, zögerte sie und wandte sich wegen einer Stellung als Dienstmädchen an ein Vermietungsbüro. Sie fand tatsächlich eine Stellung bei einer verwitweten Dame, die mit ihren beiden Söhnen zusammen lebte. Noch ungefähr eine Woche, nachdem sie in dieses Haus eingetreten war, vernachlässigte der älteste Sohn, ein Gymnasiast der sechsten Klasse, der schon einen Anflug von Schnurrbart hatte, seine Studien, um ihr den Hof zu machen. Die Mutter schob alle Schuld auf das hübsche Dienstmädchen und entließ sie.
Es bot sich keine neue Stellung, und als Katuscha eines Tages ins Vermittlungsbüro kam, traf sie dort eine Dame, deren Hände mit Ringen und Armbändern überladen waren. Als diese Dame die Lage der jungen Person erfuhr, gab sie ihr ihre Adresse und forderte sie auf, sie zu besuchen. Die Maslow ging zu ihr. Die Dame empfing sie sehr liebenswürdig, regalierte sie mit Kuchen und süßem Wein und hielt sie bis zum Abend fest. Abends sah Katuscha einen großen Mann mit grauem Bart und langen grauen Haaren ins Zimmer treten, der sich sogleich zu ihr setzte und mit leuchtenden Augen und lächelnden Lippen sie zu examinieren und mit ihr zu scherzen begann. Die Dame nahm ihn im Nebenzimmer einen Augenblick beiseite, dann rief sie sie selber, und sagte ihr, der alte Herr wäre ein Schriftsteller, er hätte viel Geld, und würde ihr alles geben, was sie wollte, wenn sie ihm nur zu gefallen verstünde. Sie gefiel ihm tatsächlich, und der Schriftsteller gab ihr 25 Rubel und versprach, sie oft zu besuchen. Dieses Geld wurde übrigens schnell ausgegeben; Katuscha gab einen Teil ihrer Base als Bezahlung für ihre Pension; für den Rest kaufte sie sich ein Kleid, einen Hut und Bänder. Einige Tage darauf bestimmte ihr der Schriftsteller von neuem ein Rendezvous, zu dem sie auch kam; er gab ihr wieder 25 Rubel und veranlasste sie, sich einzumieten. In dem Zimmer, das der Schriftsteller für sie genommen, machte die Maslow die Bekanntschaft eines Ladenkommis, eines lustigen Burschen, der in demselben Hofe wohnte. Sie verliebte sich in ihn, und gestand die Sache dem Schriftsteller, der sie sofort verließ; auch der Kommis, der ihr erst die Ehe versprochen, verließ sie bald. Die junge Person hätte gern weiter möbliert gewohnt, doch das wurde ihr nicht gestattet, und so kehrte sie denn zu ihrer Base zurück. Als diese sie in einem modernen Kleide, mit einem schönen Hut und einem Pelzmantel erblickte, empfing sie sie ehrfurchtsvoll und wagte gar nicht mehr, ihr vorzuschlagen, in ihre Plätterei einzutreten, sie glaubte, sie gehöre jetzt einer höheren Gesellschaftsklasse an. Was die Maslow übrigens selber betraf, so konnte für sie nicht mehr die Rede davon sein, in eine Plättanstalt einzutreten. Sie ging höchstens darauf ein, sich vorläufig in dem Zimmer ihrer Base aufzuhalten, und betrachtete mit verachtungsvollem Mitleid das Zuchthausleben, das die Wäscherinnen führten, die da bei dreißig Grad Wärme, bei Winter wie Sommer geöffneten Fenstern bis zur Erschöpfung rieben und plätteten.
Die Maslow hatte sich schon lange Zeit das Rauchen angewöhnt, und in der letzten Zeit ihrer Beziehungen zu dem Kommis hatte sie immer mehr zu trinken angefangen, Der Wein übte seine Anziehungskraft auf sie aus, nicht allein, weil er ihr angenehm schmeckte, sondern vor allem auch, weil er ihr eine Ablenkung bot, und die Stimme des Gewissens zum Schweigen brachte; denn nüchtern langweilte sie sich und schämte sich oft. Die Maslow hatte die Wahl zwischen einer demütigenden Dienstbotenstellung, in der sie aller Wahrscheinlichkeit nach die Nachstellungen der Männer zu erdulden hatte, und einer sicheren, ruhigen, vom Gesetz sogar geschützten Position.
Sie wählte das letztere, und hatte außerdem noch die Empfindung, sie räche sich auf diese Weise an dem Fürsten, der sie verführt, dem Kommis und allen Männern, über die sie sich zu beklagen hatte. Vor allem aber lockte sie -- und das trug hauptsächlich zu ihrem Entschlusse bei -- der Gedanke, dass sie sich von jetzt ab alle Kleider bestellen konnte, die ihr gefielen, aus Samt, Faille2 und Seide, wie auch Ballkleider, die Schultern und Arme frei ließen. Als sich die Maslow in Gedanken in einem dekolletierten, hellgelben Seidenkleid mit schwarzen Samtaufschlägen sah, konnte sie der Versuchung nicht länger widerstehen.
Von diesem Tage an begann für sie dieses Leben beständiger Verletzung der göttlichen und menschlichen Gesetze, das Hunderttausende von Frauen heute, nicht allein mit der Erlaubnis, sondern sogar unter dem tatsächlichen Schutze einer für das Wohlergehen ihrer Untergebenen besorgten gesetzlichen Macht führen; dieses herabwürdigende und ungeheuerliche Leben, das nach schrecklichen Leiden unter neun von zehn Malen mit einem vorzeitigen Verfall und Tod endet.
Die Maslow führte dieses Leben über sechs Jahre. Im siebenten Jahre -- sie zählte damals 26 Jahre -- vollzog sich das Ereignis, infolgedessen sie verhaftet wurde, und das sie nach einer mehrmonatlichen Untersuchungshaft in Gesellschaft von Geschöpfen, deren Beruf der Diebstahl und Mord war, vor die Geschworenen brachte.
Polizeibeamter <<<
Seidengewebe mit feinen Querrippen; Ripsseide <<<
Drittes Kapitel
Im Augenblick, da die Maslow in einer Zelle des Gerichtsgebäudes auf einer Bank saß und sich die Schuhe von den Füßen zog, die sie sich, auf dem Wege durch die Stadt wund gelaufen, erwachte derselbe Fürst Dimitri Iwanowitsch Nechludoff, der sie einst verführt hatte, in seinem großen, mit einem weichen Daunenkissen belegten Sprungfederbett. Er richtete sich in seinem, elegant auf der Brust in Fältchen gelegten Hemde aus holländischer Leinewand, nachlässig auf, zündete sich eine Zigarette an und dachte darüber nach, was er am vorigen Tage getan und was er an diesem tun wollte. Er erinnerte sich an den vorigen Abend, den er bei den Kortschagins zugebracht. Es war ein sehr reiches und sehr angesehenes Ehepaar, dessen Tochter er nach Ansicht aller heiraten musste. Diese Erinnerung entlockte ihm einen Seufzer; dann warf er die Zigarette fort und streckte die Hand nach einem silbernen Etui aus, um sich eine zweite zu nehmen, doch sofort besann er sich eines anderen, richtete mutig seinen noch müden Körper in die Höhe, streckte seine weißen, mit Haaren übersäten Beine aus dem Bette und zog seine Pantoffeln an. Dann bedeckte er seine breiten Schultern mit einem seidenen Schlafrock und ging mit schwerfälligem, aber doch lebhaftem Schritte in ein neben dem Schlafzimmer liegendes Toilettenkabinet.
Hier begann er sich zunächst sorgfältig mit einem Pulver seine an mehreren Stellen plombierten Zähne zu bürsten und spülte sie dann mit einem wohlriechenden Wasser aus; dann ging er zu der Marmortoilette und wusch sich mit einer parfümierten Seife die Hände, wobei er mit ganz besonderem Eifer seine langen Nägel reinigte und bürstete, hierauf öffnete er den Hahn der Wasserleitung und wusch sich Gesicht, Ohren und Hals. Darauf ging er in ein drittes Zimmer, in welchem ein Duschapparat angebracht war; der kalte Wasserstrahl erfrischte seinen muskulösen Körper, der bereits Fett ansetzte. Als er sich mit dem Frottierlaken abgetrocknet hatte, wechselte er das Hemd, zog seine Schuhe an, die wie ein Spiegel leuchteten, setzte sich vor einen Trumeau und begann mit Hilfe einer Doppelbürste zuerst seinen schwarzen Bart und dann seine auf dem Schädel schon recht spärlichen Haare glattzustreichen. Alle Gegenstände, die er bei seiner Toilette benutzte, Wäsche, Kleidungsstücke. Schuhwerk, Krawatte, Nadeln, Manschettenknöpfe, alles war prima Qualität, sehr einfach, durchaus nicht auffällig, sehr solid und sehr teuer.
Ohne sich zu beeilen, beendete Nechludoff seine Toilette; dann begab er sich in den Esssaal, ein langes Gemach, dessen Parkettboden drei Mann am vorigen Abend gebohnert hatten. In diesem Esszimmer stand ein ungeheuer großes Büffet aus Eichenholz und ein nicht weniger großer Ausziehtisch, ebenfalls aus Eiche, der mit seinen vier breit ausgedehnten, geschnitzten Füßen, die die Form von Löwenklauen hatten, einen etwas feierlichen Eindruck machte. Auf diesem Tisch, auf dem eine kleine, mit großem Monogramm verzierte Decke lag, hatte man eine silberne Kaffeekanne mit duftendem Kaffee, eine silberne Zuckerschale, ein Milchtöpfchen und einen Korb mit frischen Brötchen, Zwiebäcken und Biskuits gestellt. Endlich lag noch neben dem Gedeck die Morgenpost: Briefe, Zeitungen und eine Lieferung der »Revue des Deux Mondes«. Nechludoff schickte sich an, die Briefe zu öffnen, als durch die auf das Vorzimmer führende Tür eine dicke Frau reiferen Alters in schwarzem Kleide und einer Spitzenhaube auf dem Kopfe ins Zimmer trat. Das war Agrippina Petrowna, die Kammerfrau der alten Fürstin, Nechludoffs Mutter, die kurz vorher in demselben Hause gestorben war. Die Kammerfrau der Mutter war als Haushälterin bei dem Sohne geblieben.
Agrippina Petrowna hatte sich zu wiederholten Malen mit Nechludoffs Mutter längere Zeit im Auslande aufgehalten; sie hatte daher das Auftreten und die Manieren einer Dame. Sie wohnte seit ihrer Kindheit in dem Hause Nechludoff und hatte Dimitri Iwanowitsch gekannt, als er noch »Mitenko« genannt wurde.
»Guten Morgen, Dimitri Iwanowitsch!«
»Guten Morgen, Agrippina Petrowna! Was gibt’s?«, fragte Nechludoff.
»Da ist ein Brief für Sie. Die Zofe der Kortschagins hat ihn schon vor längerer Zeit gebracht; sie wartet in meinem Zimmer,« sagte Agrippina Petrowna und reichte ihm mit bedeutungsvollem Lächeln einen Brief.
»Es ist gut; gleich!«, sagte Nechludoff, den Brief nehmend. Noch er bemerkte, dass Agrippina Petrowna lächelte und zog die Stirn kraus.
Agrippina Petrownas Lächeln bedeutete, dass sie wusste, der Brief käme von der jungen Prinzessin Kortschagin, mit der sich ihr Herr, wie sie vermutete, verheiraten sollte, und diese Vermutung missfiel Nechludoff.
»Sagen Sie der Zofe, sie solle noch warten!«
Agrippina verließ das Zimmer, nachdem sie zuvor eine Tischbürste wieder an den richtigen Platz gehängt hatte.
Nechludoff zerriss das parfümierte Couvert, das ihm Agrippina Petrowna gebracht, und öffnete den Brief, der auf dickem, grauem Papier mit ungleichen Linien in englischer Schrift mit spitzen Buchstaben geschrieben war.
»Hiermit erfülle ich die Verpflichtung, die ich auf mich genommen, Ihnen als Gedächtnis zu dienen,« las er in diesem Briefe, »und erinnere Sie daran, dass Sie heute, am 28. April der Geschworenensitzung beiwohnen müssen und es Ihnen infolgedessen ganz unmöglich sein dürfte, mit uns und Kolossow die Galerie von Z. ... zu besichtigen, wie Sie es uns gestern mit Ihrer gewöhnlichen Leichtfertigkeit versprochen hatten, wenn Sie nicht dem Gericht die 300 Rubel Strafe bezahlen wollen, die Sie sich für Ihr Pferd nicht leisten. Ich habe gestern, als Sie fortgegangen waren, gleich daran gedacht. Vergessen Sie es also nicht!«
Auf der andern Seite stand:
»Mama lässt Ihnen sagen, dass Ihr Gedeck bis zur Nacht für Sie liegen bleibt. Kommen Sie auf jeden Fall, wann es auch sein mag!
M. K.«
Nechludoff zog die Stirn kraus. Dieses Billet1 war eine Fortsetzung des Feldzuges, den die Prinzessin Kortschagin schon seit zwei Monaten unternahm, um ihn in immer schwerer zu lösende Bande einzuschnüren. Andererseits aber hatte er außer der Unentschlossenheit, die an das Zölibat gewöhnte, nur wenig verliebte Männer reiferen Alters stets vor der Ehe empfinden, noch einen andern Grund, weshalb er sich, selbst wenn er zur Ehe entschlossen gewesen wäre, nicht in diesem Augenblick hätte entscheiden können. Dieser Grund hatte natürlich mit der Tatsache, dass Nechludoff Katuscha vor acht Jahren verführt und verlassen, nichts zu tun; er dachte nicht gern daran, und nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, hierin ein Hindernis zu seiner Heirat mit der jungen Prinzessin zu suchen. Der Grund war der, dass Nechludoff geheime Beziehungen zu einer verheirateten Frau unterhielt, die zu brechen er sich allerdings kürzlich entschlossen hatte.
Nechludoff war sehr schüchtern den Frauen gegenüber; und gerade diese Schüchternheit hatte Maria Wassiljewna, der Frau eines Adelsmarschalls, den Wunsch eingegeben, ihn zu ihrem Sklaven zu machen. Sie hatte ihn tatsächlich in eine Liaison verstrickt, die Nechludoff täglich mehr in Anspruch nahm und ihm tagtäglich drückender wurde. Noch zuerst hatte er der Verführung nicht widerstehen können, und später konnte er sich, weil er sich ihr gegenüber schuldig fühlte, nicht entschließen, die Fesseln zu brechen, ohne dass sie damit einverstanden war. Aber anstatt sich damit einverstanden zu erklären, sagte sie ihm, sie würde sich sofort töten, wenn er sie jetzt, da sie ihm alles geopfert, im Stiche ließe.
Unter Nechludoffs Post befand sich gerade an diesem Morgen ein Brief ihres Gatten; der Fürst erkannte die Handschrift und das Siegel. Er errötete und empfand jene Aufwallung, die er beim Nahen der Gefahr stets verspürte. Doch seine Erregung legte sich, als er den Brief geöffnet hatte. Maria Wassiljewnas Gatte, der Adelsmarschall des Bezirks, in welchem die hauptsächlichen Besitzungen der Familie Nechludoff lagen, schrieb dem Fürsten, gegen Ende Mai würde eine außerordentliche Sitzung des Rates, dem er präsidierte, abgehalten werden; er bitte ihn, derselben auf jeden Fall beizuwohnen und ihm »ein bisschen behilflich zu sein«; denn man wollte zwei sehr ernste Fragen beraten, die Schulfrage und die der Vizinalwege,2 und in beiden Punkten dürfte man sich auf eine lebhafte Opposition von Seiten der reaktionären Partei gefasst machen. Dieser Adelsmarschall war in der Tat liberal gesinnt; mit einigen anderen Liberalen derselben Art kämpfte er gegen die Reaktion, die immer stärker zu werden drohte; und dieser Kampf nahm ihn vollständig in Anspruch, so dass, er nicht einmal zu bemerken Zeit hatte, dass seine Frau ihn hinterging.
Nechludoff erinnerte sich, welche Angst er schon so oft durchgemacht; er erinnerte sich, wie er sich eines Tages eingebildet, der Mann habe alles entdeckt und sich auf ein Duell mit ihm vorbereitet, bei dem er die Absicht gehabt, in die Luft zu schießen; er durchlebte wieder die schreckliche Szene, die er mit der Frau an jenem Tage gehabt, als sie in ihrer Verzweiflung nach dem Garten gestürzt und auf den Teich zugelaufen war, um sich darin zu ertränken.
»Ich kann jetzt nicht hingehen und nichts unternehmen,« dachte er. Vor acht Tagen hatte er ihr einen Brief geschrieben, in welchem er sich schuldig bekannte und sich zu allem bereit erklärte, um seinen Fehler wieder gut zu machen, zum Schluss aber sagte er, ihre Beziehungen müssten im Interesse der jungen Frau auf immer aufhören. Auf diesen Brief erwartete er eine Antwort, die aber nicht kam. Das Ausbleiben der Antwort erschien ihm übrigens als ein gutes Zeichen. Wäre sie nicht auf den Bruch eingegangen, so hätte sie ihm schon lange geschrieben oder wäre selbst gekommen, wie sie es schon einmal getan hatte. Nechludoff hatte von einem Offizier gehört, der Maria Wassiljewna den Hof machte und der Gedanke an diesen Nebenbuhler bereitete ihm Qualen der Eifersucht. Gleichzeitig aber freute er sich darüber, denn er hatte dadurch die Hoffnung, sich endlich von einer ihn drückenden Lüge befreien zu können.
Ein anderer Brief, den Nechludoff unter seiner Post fand, war von dem ersten Inspektor der Güter seiner Mutter, die jetzt ihm gehörten. Dieser Inspektor schrieb, Nechludoff müsste um jeden Preis nach seinem Gute kommen, um die Bestätigung seiner Erbschaftsrechte in Empfang zu nehmen, wie auch, um die Frage zu entscheiden, in welcher Weise seine Güter in Zukunft geleitet werden sollten. Die Frage bestand darin, ob die Güter weiter so geleitet werden sollten, wie sie es zu Lebzeiten der verstorbenen Fürstin wurden, oder ob man, wie der Inspektor es dieser geraten und wie er es jetzt dem jungen Fürsten riet, nicht besser tat, die Verträge aufzulösen und den Bauern alle Güter, die man ihnen verpachtet hatte, wieder fortzunehmen. Der Inspektor behauptete, die direkte Ausbeutung der Güter würde bedeutend einträglicher sein. Er entschuldigte sich dann, dass er die Absendung der Rente von 3000 Rubel, die dem Fürsten zukam, etwas verzögert habe, er würde diese Summe mit der nächsten Post erhalten; die Verzögerung kam daher, dass der Inspektor die größte Mühe von der Welt hatte, das Geld von den Bauern einzubekommen, die ihre Gewissenlosigkeit so weit trieben, dass man, um sie zur Zahlung zu veranlassen, seine Zuflucht zur Gewalt nehmen musste.
Dieser Brief war Nechludoff gleichzeitig angenehm und unangenehm. Er empfand es als etwas Angenehmes, sich als Herrn eines Vermögens zu wissen, das sein bisheriges übertraf. Andererseits dagegen erinnerte er sich, dass er sich in seiner ersten Jugend mit der Großherzigkeit und Entschlossenheit seines Alters für die soziologischen Theorien von Spencer und Henry George begeistert hatte; er hatte nicht allein gedacht, erklärt und geschrieben, dass die Erde kein Gegenstand individuellen Eigentums sein dürfe, sondern hatte sogar den Bauern ein kleines Gut geschenkt, das er von seinem Vater ererbt, um seine Handlungen seinen Grundsätzen anzupassen. Jetzt aber, da der Tod seiner Mutter ihn zum Großgrundbesitzer gemacht, hatte er zwischen zwei Entschlüssen zu wählen. Er konnte entweder auf alle seine Güter verzichten, wie er es vor zehn Jahren bei den 200 Hektaren getan, die er von seinem Vater ererbt, oder er konnte, indem er von seinen Gütern Besitz nahm, die Grundsätze, die er einst aufrecht erhalten, stillschweigend, aber ausdrücklich, als falsch und lügnerisch hinstellen.
Den ersten dieser beiden Entschlüsse zu fassen, war ihm unmöglich, denn seine Besitzungen bildeten sein ganzes Vermögen. Wieder in den Dienst zu treten, hatte er nicht den Mut; und er war zu sehr an sein müßiges und luxuriöses Leben gewöhnt, um darauf verzichten zu können. Dann wäre das Opfer auch unnütz gewesen, denn Nechludoff fühlte nicht mehr die Kraft der Überzeugung und die Entschlossenheit, die er in der Jugend besessen hatte.
Doch der zweite Entschluss, die uneigennützigen und großherzigen Vorsätze, auf die er einst so stolz gewesen, ausdrücklich zu verleugnen, dieser Entschluss war ihm unangenehm, und deshalb berührte ihn der Brief seines Inspektors peinlich.
Als Nechludoff sein Frühstück beendet hatte, ging er in sein Kabinett. Er wollte aus der Vorladung ersehen, um wieviel Uhr er im Gerichtsgebäude sein musste, und außerdem hatte er auch der Prinzessin Kortschagin zu antworten. Er ging, um sich in sein Kabinett zu begeben, durch sein Atelier, wo ein angefangenes Gemälde auf einer Staffelei stand und verschiedene Studien an den Wänden hingen. Der Anblick dieses Bildes, an dem er seit zwei Jahren arbeitete, ohne es vollenden zu können, dieser Studien und des ganzen Ateliers belebte das unaufhörlich stärker werdende Gefühl seiner Ohnmacht, Fortschritte in der Malerei zu machen, und das Bewusstsein seines Talentmangels aufs neue. Er schrieb dieses Gefühl allerdings seinem übertrieben fein entwickelten künstlerischen Geschmack zu; doch er konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass er die Armee vor fünf Jahren verlassen hatte, weil er ein großes Talent als Maler in sich zu entdecken geglaubt.
So kam er denn in melancholischer Gemütsverfassung in sein ungeheuer großes Arbeitszimmer, das mit jedem möglichen Zierrat und allen Bequemlichkeiten versehen war. Er schritt auf einen großen Schreibtisch mit beschrifteten Schubladen zu, öffnete die Schublade, die die Bezeichnung »Vorladungen« trug und fand darin sofort die Anzeige, die er suchte. Diese Anzeige sagte ihm, dass er um 11 Uhr im Justizgebäude sein musste. Nechludoff setzte sich, schloss die Schublade und begann einen Brief, in dem er der Prinzessin sagen wollte, er danke ihr für ihre Einladung, und hoffe, am Nachmittag zum Diner kommen zu können. Nachdem er aber den Brief geschrieben, zerriss er ihn; er war zu intim. Der zweite, den er schrieb, war zu kühl, fast unhöflich, und er zerriss, ihn wieder. Er klingelte, und ein Lakai trat in das Zimmer, ein älterer Mann, mit ernster Miene und rasiertem Gesicht, der eine Schürze von grauem Kaliko trug.
»Lassen Sie mir einen Fiaker kommen.«
»Sofort, Exzellenz!«
»Und sagen Sie der Person, die noch wartet, es ist gut, ich danke, und würde kommen.«
»Es ist nicht sehr passend,« dachte Nechludoff, »aber ich kann nicht schreiben, jedenfalls werde ich sie heute sehen.«
Er kleidete sich an und trat auf die Freitreppe. Der Wagen, den er gewöhnlich nahm, ein eleganter Wagen mit Gummirädern, stand bereits da, und wartete, auf ihn. »Gestern Abend,« sagte der Kutscher, sich halb zu ihm wendend -- »waren Sie kaum von dem Fürsten Kortschagin weggegangen, als ich ankam. Der Portier meinte: ›Er ist eben fort.‹«
»Sogar die Kutscher kennen meine Beziehungen zu den Kortschagins,« dachte Nechludoff und legte sich von neuem die Frage vor, ob er sich mit der jungen Prinzessin verheiraten sollte oder nicht. Noch immer konnte er sich über diese Frage nicht entscheiden. Zwei Argumente sprachen zugunsten der Ehe im allgemeinen. Erstens sicherte ihm die Ehe mit der ruhigen Behaglichkeit des häuslichen Herdes ein anständiges, moralisches Leben; zweitens hoffte Nechludoff vor allen Dingen, eine Familie und Kinder würden seinem Leben ein Ziel geben, dem ein solches jetzt fehlte. Gegen die Ehe im allgemeinen sprach andererseits das Gefühl, das wir bereits erwähnt, die Furcht, die den Junggesellen in einem bestimmten Alter die Aussicht, ihre Freiheit zu verlieren, einflößt, sowie auch die unbewusste Angst vor dem Geheimnis, das eine Frauennatur stets umgibt.
Zugunsten der Ehe mit Missy im besonderen (Missy war der Beiname, den die junge Prinzessin Kortschagin, deren richtiger Name Marie war, in intimem Kreise trug) sprach zunächst der Umstand, dass das junge Mädchen aus guter Familie war und sich in allem, von ihren Toiletten angefangen bis zu der Art und Weise, wie sie sprach, ging und lachte, von den »gewöhnlichen« Frauen unterschied, und zwar nicht durch etwas Außergewöhnliches, sondern durch ihre »Vornehmheit«. Er fand keinen andern Ausdruck, um diese Eigenschaft zu bezeichnen, auf die er ganz besonderen Wert legte. Das zweite Argument bestand darin, dass die junge Prinzessin ihn besser zu schätzen wusste, als sonst jemand, und ihn besser verstand; und gerade in der Tatsache, dass sie ihn verstand, das heißt, seine hohen Vorzüge anerkannte, fand Nechludoff den Beweis ihrer Intelligenz und ihres sicheren Urteils. Doch es sprachen auch sehr ernste Argumente gegen die Heirat mit Missy im besonderen; erstens hätte Nechludoff aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes junges Mädchen finden können, das noch »vornehmer« als Missy war; zweitens zählte diese bereits 27 Jahre und hatte wahrscheinlich schon andere Männer geliebt. Dieser Gedanke aber war eine Qual für Nechludoff. Seine Eitelkeit konnte es nicht dulden, dass das junge Mädchen selbst früher einen andern als ihn geliebt hatte. Allerdings konnte er nicht verlangen, sie solle im voraus wissen, dass sie ihm eines Tages im Leben begegnen würde; doch schon der Gedanke, sie hätte einen andern Mann vor ihm lieben können, war für ihn eine Demütigung. So standen die Argumente für und wider gleich; und Buridan verglich sich lachend mit Buridans Esel. Doch trotzdem trieb er es genau so weiter, wie der Esel und wusste nicht, welchem der beiden Heubündel er sich zuwenden sollte.
»Außerdem kann ich ja, solange ich von Marie Wassiljewna keine Antwort erhalten habe und diese Angelegenheit nicht beendet ist, keine Verpflichtung eingehen,« dachte er, und das Gefühl der Notwendigkeit, seinen Entschluss noch hinauszuschieben, machte ihm Vergnügen.
»An all’ das werde ich später denken,« sagte er sich wieder, während sein Wagen geräuschlos über den Asphalt des Hofes des Justizgebäudes rollte. »Es handelt sich jetzt für mich darum, eine soziale Pflicht mit der mir eigenen Sorgfalt zu erfüllen. Außerdem sind diese Sitzungen auch oft sehr interessant.«
Briefchen <<<
Verbindungsweg zwischen zwei Orten <<<
Viertes Kapitel
Als Nechludoff das Gerichtsgebäude betrat, ging es auf den Korridoren schon sehr lebhaft zu. Aufseher liefen mit Papieren hin und her; andere gingen mit ernstem, langsamem Schritte, die Hände auf dem Rücken, auf und nieder. Die Nuntien, die Advokaten, die Anwälte spazierten hin und her, die Bittsteller und die auf freien Fuß belassenen Angeklagten drückten sich demütig an die Wand oder blieben wartend auf den Bänken sitzen.
»Das Bezirksgericht?«, fragte Nechludoff einen der Aufseher.
»Was für eins? Kriminal oder Zivil?«
»Ich bin Geschworener!«
»Dann handelt es sich um das Schwurgericht! Das hätten Sie gleich sagen sollen! Gehen Sie nach rechts und dann links die zweite Tür!«
Nechludoff trat in die Korridore.
Vor der Tür, die der Aufseher ihm bezeichnet hatte, standen zwei Männer in eifriger Unterhaltung begriffen. Der eine war ein dicker Kaufmann, der jedenfalls als Vorbereitung auf seine Aufgabe tüchtig gegessen und getrunken hatte; denn er schien in sehr lustiger Gemütsverfassung; der andere war ein Kommis jüdischer Herkunft. Die beiden Männer unterhielten sich von den Wollpreisen, als Nechludoff auf sie zutrat und sie fragte, ob sich hier die Geschworenen versammelten.
»Ja, hier, mein Herr; ganz recht hier! Sie sind jedenfalls auch ein Geschworener, einer unserer Kollegen?«, fügte der brave Kaufmann lächelnd und augenblinzelnd hinzu.
»Na, dann werden wir zusammen arbeiten,« fügte, er auf Nechludoffs bejahende Antwort hinzu. -- »Baklaschoff von der zweiten Gilde,« sagte er, dem Fürsten seine breite Hand reichend. »Und mit wem habe ich die Ehre?«
Nechludoff nannte seinen Namen und trat in das Geschworenenzimmer.
»Sein Vater war beim Kaiser attachiert,« murmelte der Jude.
»Er hat Vermögen?«, fragte der Kaufmann.
»Ein schwerreicher Mann!«
In dem kleinen Geschworenenzimmer waren zehn Männer aus allen Lebensstellungen versammelt. Alle waren eben erst gekommen; die einen saßen, die andern gingen auf und ab. Man betrachtete sich und knüpfte Bekanntschaft an. Da war ein pensionierter Oberst in Uniform, andere Geschworene waren im Gehrock, im Jackett; ein einziger hatte seinen Frack angezogen. Mehrere von ihnen hatten ihre Geschäfte im Stich lassen müssen, um ihre Geschworenenpflicht auszuüben, und beschwerten sich bitter darüber; dabei las man aber doch auf ihren Gesichtern eine stolze Genugtuung und das Bewusstsein, eine hohe soziale Pflicht zu erfüllen.
Als die erste Prüfung beendet war, war man in einfachen Gruppen zusammengetreten. Man unterhielt sich vom Wetter, von dem frühzeitigen Anbruch des Frühlings und den zur Verhandlung kommenden Fällen. Eine große Anzahl von Geschworenen drängte sich danach, mit dem Fürsten Nechludoff Bekanntschaft zu machen, denn sie waren augenscheinlich der Meinung, er wäre ein hervorragender Mensch. Nechludoff fand das berechtigt und natürlich, wie er es stets bei solchem Anlass tat. Hätte man ihn gefragt, warum er sich der Mehrzahl der Menschen überlegen betrachtete, er wäre außerstande gewesen, darauf zu antworten, denn sein Leben hatte in der letzten Zeit namentlich nichts sehr Verdienstliches aufzuweisen gehabt. Er konnte allerdings fließend englisch, französisch und deutsch sprechen; seine Wäsche, sein Anzug, seine Krawatten, seine Manschettenknöpfe kamen stets aus den ersten Geschäften, und waren stets die teuersten, die es gab; doch er selbst behauptete nicht, dass das genügend war, um sich als ein höheres Wesen aufzuspielen. Und doch war er von dem Bewusstsein seiner Bedeutung tief erfüllt; er war überzeugt, dass man ihm die Hochachtung, die man ihm entgegenbrachte, schuldig war, und die Vernachlässigung derselben verletzte ihn wie eine Schmach.
Eine Schmach dieser Art erwartete ihn gerade im Geschworenenzimmer. Unter den Geschworenen befand sich jemand, den er kannte, ein gewisser Peter Gerassimowitsch -- seinen Familiennamen hatte Nechludoff nie erfahren -- der bei den Kindern seiner Schwester Hauslehrer gewesen war. Dieser Peter Gerassimowitsch hatte inzwischen seine Studien beendet und war jetzt Gymnasiallehrer. Nechludoff hatte ihn wegen seiner Vertraulichkeit, seines selbstgefälligen Lächelns und seiner schlechten Manieren stets unausstehlich gefunden.
»Ach, das Los hat Sie also auch getroffen?«, sagte er zu Nechludoff und trat mit lautem Lachen auf ihn zu. »Und Sie haben sich nicht dispensieren lassen?«
»Nie hatte ich die Absicht, mich dispensieren zu lassen,« versetzte Nechludoff trocken.
»Na, das ist ein schöner Zug bürgerlichen Mutes. Sie werden sehen, wie Sie unter dem Hunger leiden werden! Und dabei kann man weder schlafen noch trinken!«, fuhr der Professor, noch lauter lachend, fort.
»Dieser Popensohn wird bald anfangen, mich zu duzen!«, dachte Nechludoff, gab seinem Gesicht einen so düstern Ausdruck, als hätte er eben den Tod eines seiner Verwandten erfahren, und drehte Peter Gerassimowitsch den Rücken, um sich einer Gruppe zu nähern, die sich um einen hochgewachsenen, glattrasierten, vornehm repräsentierenden Mann gebildet hatte, der etwas zu erzählen schien. Dieser Mann sprach von einem Prozess, der eben vor dem Zivilgericht verhandelt wurde; er sprach davon, wie ein Mann, der die Sache von Grund aus kennt, und nannte die Richter und Advokaten bei ihren Vornamen. Er erzählte unermüdlich, wie ein berühmter Advokat aus St. Petersburg, der Sache eine ganz andere Wendung gegeben, und eine alte Dame, die vollständig recht hatte, infolge seiner Tätigkeit nunmehr sicher verlieren musste.
»Ein genialer Mensch!«, rief er, als er von dem Advokaten sprach.
Man hörte ihm aufmerksam zu; und einzelne der Geschworenen versuchten, ihre Bemerkungen anzubringen, doch er unterbrach sie sofort, als wüsste nur er genau, wie es damit stände.
Obwohl Nechludoff verspätet ins Gerichtsgebäude gekommen war, musste er noch sehr lange in dem Geschworenenzimmer bleiben. Eins der Mitglieder des Tribunals war nicht gekommen, und man wartete auf dasselbe, um die Sitzung zu eröffnen.
Der Präsident des Schwurgerichts war dagegen sehr frühzeitig in den Palast gekommen. Dieser Präsident war ein großer, dicker Mann mit langem, grauem Backenbart. Er war verheiratet, führte aber ein sehr ausschweifendes Leben, und seine Frau tat dasselbe; sie hatten das Prinzip, sich gegenseitig nicht hinderlich zu sein. Am Morgen dieses Tages hatte der Präsident ein Billet von einer Schweizer Gouvernante erhalten, die früher bei ihm gewohnt hatte und auf der Durchreise nach St. Petersburg ihm schrieb, dass sie ihn zwischen drei und sechs Uhr im Hotel d’Italie erwarten würde. Daher hatte er es eilig, die Tagessitzung so schnell wie möglich anfangen und schließen zu können, um gegen sechs Uhr, zu dieser rothaarigen Klara zu eilen, mit der er im vorigen Sommer einen Roman angesponnen.
Er ging in sein Kabinett, verriegelte die Tür und nahm aus der Schublade eines Schrankes zwei Hanteln, mit denen er zwanzig Bewegungen nach vorn, nach hinten, nach der Seite, nach oben und nach unten machte; dann beugte er dreimal die Knie und hob die Hanteln über den Kopf.
»Nichts stärkt so sehr als die Hydrotherapie und die Gymnastik,« dachte er und fühlte mit der linken Hand, an der ein goldener Ring glänzte, nach dem Gelenk des rechten Armes. Er wollte eben wieder rollende Bewegungen machen -- er hatte sich gewöhnt, diese beiden Hebungen stets vor den etwas langen Sitzungen zu machen, als es an der Tür rüttelte. Es versuchte jemand, sie zu öffnen. Der Präsident versteckte schnell seine Hanteln, öffnete die Tür und sagte: »Entschuldigen Sie!«
Einer der Richter trat ins Zimmer, ein kleiner Mensch mit eckigen Schultern und traurigem Gesicht, der eine goldene Brille trug.
»Nun! es ist Zeit!«, sagte er mit scharfer Stimme.
»Ich bin bereit,« versetzte der Präsident und zog seine Amtstracht an. »Aber Mathias Nikitisch kommt noch immer nicht!«
»Er treibt die Gewissenlosigkeit wirklich zu weit,« sagte der Richter, setzte sich ärgerlich und steckte sich eine Zigarette an.
Dieser Richter, ein ungewöhnlich pünktlicher Mensch, hatte am Vormittag eine höchst unangenehme Szene mit seiner Frau gehabt, weil diese das Geld, das er ihr für den Monat gegeben, zu schnell ausgegeben hatte. Sie hatte einen Vorschuss verlangt, und er hatte ihn ihr abgeschlagen; daher die Szene. Die Frau hatte erklärt, unter solchen Umständen würde es kein Essen geben, und hatte ihm vorher erklärt, er habe nichts zu erwarten. Darauf war er fortgegangen und fürchtete nun, sie könne ihre Drohung zur Ausführung bringen, denn er wusste, dass sie zu allem fähig war. »Da soll man ein tadelloses und anständiges Leben führen,« sagte er sich und betrachtete den Präsidenten, diesen von Gesundheit und guter Laune strotzenden dicken Mann, der mit aufgestützten Ellenbogen mit seinen schönen weißen Händen die dichten und sorgfältig gebürsteten Haare seines Backenbartes glattstrich, um sie zu den beiden Seiten seines galonierten1 Kragens zu legen. »Er ist stets heiter und zufrieden, ich dagegen habe nur Unannehmlichkeiten!«
In diesem Augenblick trat der Gerichtsschreiber ein und brachte die Akten, die der Präsident verlangt hatte.
»Ich danke Ihnen,« sagte der Präsident und zündete sich ebenfalls eine Zigarette an. »Na, mit welcher Sache wollen wir anfangen?«
»Nun, mit dem Giftmordprozess -- wenn Sie die Reihenfolge nicht ändern wollen!«, versetzte der Gerichtsschreiber.
»Also gut, mit dem Giftmordprozess,« sagte der Präsident, welcher annahm, das wäre eine sehr einfache Sache, die bis vier Uhr beendet sein konnte, so dass er frei war, zu seiner Schweizerin zu eilen.
»Ist Breuer gekommen?«, fragte er den Gerichtsschreiber, der hinausgehen wollte.
»Ich glaube, ja!«
»Dann sagen Sie ihm, wenn Sie ihn treffen, wir fangen mit der Giftmordaffäre an.«
Breuer war der Staatsanwalt, der in dieser Schwurgerichtsperiode die Anklage vertreten sollte.
Tatsächlich traf ihn der Aktuar auf dem Korridor. Den Kopf vornüber geneigt, mit aufgeknöpftem Gehrock, die Aktenmappe unter dem Arm, ging er mit großen Schritten, lief fast, die Hacken zusammenschlagend und in fieberhafter Aufregung den Arm bewegend.
»Michel Petrowitsch fragt, ob Sie bereit sind?«, sagte der Aktuar, ihn aufhaltend.
»Natürlich! Ich bin stets bereit. Womit wird angefangen?«
»Mit dem Giftmord!«
»Es ist gut!«, versetzte der Staatsanwalt.
Noch tatsächlich fand er durchaus nicht, dass es gut war, er hatte die ganze Nacht in einem Wirtshaus mit andern jungen Leuten Karten gespielt; sie hatten einen Kameraden fortbegleitet; man hatte viel getrunken und bis fünf Uhr morgens gespielt, so dass der junge Staatsanwalt nicht einmal Zeit gefunden hatte, einen Blick in die Akten des Giftmordprozesses zu werfen, der verhandelt werden sollte, Der Aktuar wusste das, und absichtlich hatte er den Präsidenten veranlasst, mit dieser Sache zu beginnen, die zu studieren der Staatsanwalt keine Zeit gehabt hatte. Dieser Aktuar war ein Liberaler, um nicht zu sagen, ein Radikaler, was ihn aber nicht hinderte, in der Magistratur mit einer Pension von 1200 Rubeln zu dienen und sich sogar um einen Staatsanwaltsposten zu bemühen. Breuer dagegen war konservativ und ein ganz besonders eifriger Orthodoxer, wie die meisten Deutschen, die in Russland Beamte sind; deshalb hatte der Aktuar, abgesehen davon, dass er ihm seine Stellung beneidete, noch, eine persönliche Antipathie gegen ihn.
»Und die Anklage gegen die Skopzen?«2 fragte der Aktuar.
»Ich habe erklärt, dass die Verhandlung in Abwesenheit der Zeugen unmöglich ist,« versetzte der Staatsanwalt, »und werde das vor Gericht wiederholen.«
»Was tut das?«
»Unmöglich!«, erwiderte der Staatsanwalt, schüttelte den Arm und lief in sein Kabinett.
Er verschob die Klage gegen die Skopzen, nicht wegen der Abwesenheit einiger unbedeutender Zeugen, sondern weil dieser Fall, wenn man ihn in einer großen Stadt, wo die meisten Geschworenen den gebildeten Klassen angehörten, verhandelte, mit einer Freisprechung auszulaufen drohte; daher hatte er sich mit dem Präsidenten dahin verständigt, dass der Fall vor die Geschworenen einer kleinen Stadt gebracht werden sollte, wo die Jury zum großen Teile aus Bauern gebildet wurde und die Verurteilung deshalb leichter durchzusetzen war.
Inzwischen war das Treiben auf den Gängen noch stärker geworden. Die Menge drängte sich namentlich vor dem Zivilgerichtssaal, wo einer jener Fälle verhandelt wurde, die man gewöhnlich als interessant bezeichnet, derselbe, von dem die wichtig tuende Persönlichkeit im Geschworenenzimmer so eingehend gesprochen hatte. Ohne einen Schimmer von Verstand oder moralischem Recht, aber in streng gesetzmäßiger Weise hatte sich ein Advokat des ganzen Vermögens einer alten Dame bemächtigt. Die Klage der alten Frau war vollständig berechtigt. Die Richter wussten das, und noch mehr wussten es der Gegner und sein Advokat, doch dieser Advokat war so geschickt zu Werke gegangen, dass die alte Frau notgedrungen verlieren musste.
Im Augenblick, da der Aktuar in die Kanzlei hineingehen wollte, sah er gerade vor sich im Korridor die alte Dame, die eben in aller Form rechtens ihres Vermögens beraubt worden war. Es war eine dicke Frau mit ungeheuer großen Blumen auf dem Hut. Sie kam aus dem Sitzungssaal, streckte ihre Hände danach aus und wiederholte fortwährend: »Was soll daraus werden? Was soll daraus werden?« Dann fing sie an, eine sehr verwickelte Geschichte zu erzählen, die mit ihrer Sache gar nichts zu tun hatte. Der Advokat betrachtete die Blumen ihres Hutes, nickte zustimmend mit dem Kopfe und hörte augenscheinlich gar nicht auf sie.
Plötzlich öffnete sich eine kleine Tür und strahlend, sein steifes Hemd auf der tiefausgeschnittenen Weste zeigend, erschien schnellen Schrittes mit zufriedener Miene derselbe berühmte Advokat, der es bewirkt hatte, dass die alte Frau mit den Blumen ohne alle Mittel dastand, und dass der Gegner gegen Zahlung von 10.000 Rubeln, die er ihm für sein Plädoyer gegeben hatte, 100.000 erhielt, auf die er kein Anrecht hatte. Er ging an der alten Dame vorüber. Aller Augen wandten sich ihm respektvoll zu und er war sich dessen auch klar, doch seine ganze Persönlichkeit schien zu sagen: »Bitte, meine Herren, sparen Sie die Zeichen Ihrer Bewunderung!«
Endlich kam Mathias Nikitisch, der Richter, auf den man wartete. Sofort sahen die Geschworenen den Gerichtsnuntius, einen kleinen, mageren Mann mit zu langem Hals und ungleichmäßigem Gange, in das Zimmer treten, in welchem sie versammelt waren. Dieser Nuntius war übrigens ein braver Mann, der alle seine Studien auf der Universität absolviert hatte; doch er konnte es nirgends aushalten, weil er trank. Vor drei Monaten hatte ihm eine Gräfin, die sich für seine Frau interessierte, diese Stellung als Nuntius im Justizgebäude verschafft, und er hatte sich bis jetzt dort zu halten vermocht, worüber er sich wie über ein Wunder freute.
»Nun, meine Herren, sind alle da?«, fragte er, setzte sein Pincenez,3 bald darüber weg ansah.
»Ich glaube, ja,« versetzte der joviale Kaufmann.
»Wir wollen ’mal sehen,« sagte der Nuntius.
Er zog eine Liste aus der Tasche und begann die Namen aufzurufen, wobei er die Geschworenen, bald durch sein Pincenez auf und sah die Geschworenen an.