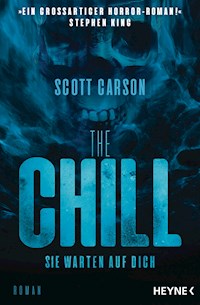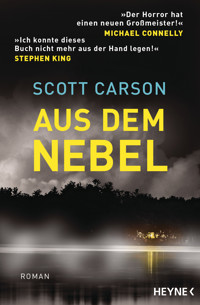
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Journalist Nick Bishop soll einen Artikel über das Startup Clarity, Inc. schreiben, das eine Mindfulness-App veröffentlichen will. Er kehrt in seine Heimatstadt in Maine zurück und quartiert sich im Sommerhaus seiner Familie ein. Beim Interview lässt sich Nick von Firmengründer Bryce überreden, die App zu testen. Nach Atemübungen und weißem Rauschen kommen die Schlaflieder: eine traurige Frauenstimme singt eine verstörende Ballade. Das Lied funktioniert, Nick fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Doch mit dem Schlaf kommen die Albträume, und schon bald kann Nick nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden. Ihm wird klar, dass Clarity, Inc. ihn gezielt als Testperson ausgewählt hat – und dass er das Geheimnis des Gesangs ergründen muss, wenn er sein Leben retten will ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Journalist Nick Bishop soll einen Artikel über das Start-up Clarity, Inc. schreiben, das eine Mindfulness-App entwickelt, die die Träume der Anwender beeinflussen kann. Nick ist skeptisch: Er hat noch nie etwas geträumt, oder zumindest kann er sich nicht an seine Träume erinnern. Beim Interview lässt er sich dennoch von Firmengründer Bryce überreden, die App zu testen. Nach Atemübungen und weißem Rauschen kommen die Schlaflieder: Eine traurige Frauenstimme singt eine verstörende Ballade. Das Lied funktioniert, Nick fällt sofort in einen tiefen Schlaf. Mit dem Schlaf kommen die Albträume, und schon bald kann Nick nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden. Ihm wird klar, dass Clarity Inc. ihn gezielt als Testperson ausgewählt hat – und dass er das Geheimnis des Gesangs ergründen muss, wenn er sein Leben retten will …
Der Autor
Scott Carson ist das Pseudonym eines New-York-Times-Bestsellerautors und Drehbuchschreibers. Er lebt in New England an den Ufern eines Stausees.
SCOTT CARSON
AUS DEMNEBEL
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Andreas Fliedner
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
WHERE THEY WAIT
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 06/2023
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2021 by Scott Carson
Copyright © 2023 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung von Motiven vonShutterstock / des Originalmotivs
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-29482-3V001
www.heyne.de
Für Kaleb Ryan,mit Dank für Deine Freundschaftund Unterstützung währendall der Jahre
ERSTER TEIL
HEIMKEHR
1
Ein Träumer war ich nie.
Ich meine, im allerbuchstäblichsten Sinne. Bildlich gesprochen habe ich natürlich Träume. Ehrgeiz zumindest. Bin ich Optimist? Bis zu einem gewissen Grad, auch wenn in meinem Beruf – Journalismus – eher ein gewisser Zynismus hilfreich ist. Wenn ich sage, dass ich nie ein Träumer war, dann meine ich damit nachts, in den Tiefen des Schlafs.
Keine Träume. Ich hatte schlicht keine. Weder schöne noch schlechte, weder glückliche noch traurige.
Ich schlief trotzdem gut. Ja, ich habe gut geschlafen. Schwer vorstellbar heutzutage, aber ich weiß, dass es einmal so war.
Die Leute reden ständig über ihre Träume. Ich war ein paar Jahre mit einer Frau zusammen, die morgens aufwachte und mir die seltsamen, abenteuerlichen Geschichten erzählte, die sie nachts erlebt hatte. Manchmal war ich in Versuchung, so zu tun, als ob ich wüsste, wovon sie sprach. Träumen scheint doch etwas ganz Normales zu sein, oder? Etwas, das wir eigentlich alle tun sollten. Und doch wissen wir trotz all unserer Forschungen und psychologischen Theorien wenig über die Mechanik der Träume. Wir vermuten, dass Träume mit dem Gedächtnis zusammenhängen, dass wir im REM-Schlaf unsere Erinnerungen archivieren. Wir glauben, dass Träume auf verdrängte Gefühle hinweisen oder vielleicht Krankheiten ankündigen, die noch keine körperlichen Symptome ausgebildet haben. Warnungen. Botschaften von den Toten. Von Gott. Wir glauben all diese Dinge und noch mehr, aber das Einzige, was wir sicher wissen, ist: Bis heute haben wir nicht vollständig verstanden, was Träume sind. Sie kommen und gehen.
Bei den meisten Menschen zumindest.
Bis ich in jenem Herbst nach Hammel, Maine, zurückkehrte, nachdem ich bei meiner Zeitung entlassen worden war, schlief ich tief und ungestört. Vielleicht nicht lang, aber genug. Fünf oder sechs Stunden waren schon eine Menge.
Whitney, meine Ex, träumte jede Nacht, und mein traumloser Schlaf schien sie zu beunruhigen. Als ich damals aus Afghanistan zurückkehrte, wo ich eine Zeit lang als eingebetteter Korrespondent unsere Truppen bei Rückzugsbewegungen begleitet hatte, erwartete sie, glaube ich, Albträume, eine posttraumatische Belastungsstörung, Schweißausbrüche. Nichts dergleichen stellte sich ein. Die Bilder aus dem Kriegsgebiet, die mich heimsuchten, waren – und sind – schlicht und einfach Erinnerungen.
Einmal bat sie mich, ihr zu erklären, wie sich ein Schlaf ohne Träume anfühlt. Wir lagen im Bett in unserer Wohnung in Tampa, das Fenster stand offen, und ein schwüler Frühlingswind wehte durch die Insektengitter herein. Auf den Nachttischen wurden die Kaffeetassen kalt: ein geruhsamer Samstagmorgen. Sie hatte mir gerade von dem letzten Traumspektakel berichtet, das sie Schlaf nannte, und kam zu der Frage zurück, ob ich in jener Nacht auch geträumt hätte.
»Möglicherweise«, antwortete ich. »Ich erinnere mich bloß nicht an meine Träume, das ist alles. Ich bin nicht wie du.«
»Jeder Mensch erinnert sich an irgendetwas aus seinen Träumen«, erwiderte sie und strich das dunkelblonde Haar zurück, das ihr übers Gesicht gefallen war.
»Frag mich das nächste Mal vor dem Aufwachen«, sagte ich. Ein fader Witz, den ich nur machte, um das Thema zu wechseln. Sie hatte im Nebenfach Psychologie studiert und spekulierte gern über die Bedeutung von Träumen, hörte gern meine Meinung darüber, was ihr Unterbewusstsein oder ihr Unbewusstes ihr mitteilen wollte. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum sie sich nicht mit der Leere in den Archiven meiner Nächte abfinden konnte – es gab darin nichts zu analysieren.
»Also, wie fühlt es sich an?«, fragte sie.
»Wie es sich anfühlt, nicht zu träumen?«
Sie nickte. Wieder fiel das Haar über ihr Gesicht, wieder strich sie es zurück. Whitney und ihr Haar führten jeden Morgen Krieg und sie kapitulierte stets als Erste. Aber am Samstagmorgen wogte die Schlacht oft eine ganze Weile hin und her.
»Es fühlt sich überhaupt nicht wie irgendwas an«, sagte ich.
»Komm schon, Schreiberling. Das kannst du besser. Du schläfst ein, du wachst auf, und es fühlt sich an wie …«
Sie ließ den unvollendeten Satz in der Luft stehen und wartete darauf, dass ich ihn mit etwas ergänzte, was die Sache erklärte. Ich merkte, dass sie es ernst meinte, also versuchte ich, eine ehrliche Antwort zu geben.
»Schwärze«, sagte ich. »So einfach ist das. Die Welt ist schwarz, und dann krieche ich aus der Schwärze heraus – gleite heraus, wenn kein Wecker klingelt –, und die Welt ist wieder hell.« Ich spürte ihre Enttäuschung und zuckte die Achseln. »Ich habe mein Bestes gegeben. Tut mir leid.«
»Das hört sich traurig an«, sagte sie und klang dabei so unglücklich, dass ich lachen musste.
»Wenigstens wache ich wieder auf«, sagte ich und beugte mich zu ihr hinüber, um sie zu küssen. »Besser als die Alternative.«
Sie zog eine Augenbraue hoch und sah mich mit einem ironisch prüfenden Blick an. »Irgendetwas muss doch nachts hinter dieser Stirn vorgehen. Es muss einfach.«
»Tagsüber meinst du dasselbe und auch da irrst du dich.«
»Falsch. Ich habe nie behauptet, dass dein Gehirn tagsüber aktiv ist.« Sie stützte sich auf einen Ellenbogen auf und sah mich forschend an. »Versprichst du mir, dass du sie mir nicht verschweigst?«
»Dass ich meine Träume nicht verschweige?«
Sie nickte. »Ich will wissen, was du träumst. Selbst wenn du jede Nacht von der Zicke aus Chicago träumst, mit der du damals zusammen warst …«
»Das ist jetzt nicht nett.«
»Ich will es wissen. Oder nein, sag mir nicht, wenn du von ihr träumst. Mach irgendetwas Interessanteres aus ihr, bitte.«
Ich lachte, und sie stimmte in das Lachen ein, aber dann erlosch ihr Lächeln. »Wenn du dich erinnerst, sagst du es mir, ja, Nick? Selbst wenn es schlechte Träume sind.«
»Ich werde es dir sagen«, antwortete ich, und in jenem Moment meinte ich es so.
Wirklich.
Und mir war auch klar, dass es nicht meine buchstäbliche Unfähigkeit zu träumen war, die sich wie eine Mauer zwischen uns schob. Doch als der Moment kam und wir uns trennten, musste ich unwillkürlich daran denken. Ich erinnerte mich an die Mischung aus Misstrauen und Besorgnis in ihrem Blick, als sie jene Fragen stellte, erinnerte mich, wie nachdrücklich sie darauf bestanden hatte, dass jeder Mensch irgendwann irgendetwas träumt, und ich fragte mich, was sie in meinen Augen gesehen hatte, als ich darauf beharrte, dass ich eine Ausnahme sei. Ob sie dort etwas gesehen hatte, das ihr Angst einflößte.
Unsinn, oder? Es war gedankenloses Geplauder gewesen, in einer Liebesbeziehung, die schlicht an ihr Ende gelangt war. Zwischen uns war eine Kluft entstanden, und dann tut man das, was man in einer festen Beziehung in einer solchen Situation tut: Man geht auf den Abgrund zu, wägt ab zwischen dem Risiko und dem, was einen auf der anderen Seite erwartet, und dann trifft man seine Entscheidung: Springt man oder tritt man den Rückzug an?
Sie hatte sich zurückgezogen und war andere Wege gegangen. Als ich das letzte Mal etwas von ihr hörte, war sie mit einem Mann zusammen, der ein Segelboot besaß, und sie überlegten, ein Jahr frei zu nehmen und die Welt zu umsegeln, ganz ungebunden.
Vermutlich hatte der Typ Träume, die einen ergiebigen Gesprächsstoff abgaben.
Jedenfalls besser als Schwärze.
Ich weiß nicht, ob das glückliche Paar je die Anker gelichtet hat. Whitney und ich verloren uns aus den Augen, wie das so geht. Nur, dass ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt geht. »Was macht deine Ex? Keine Ahnung. Hab seit Jahren nichts von ihr gehört.« Aber es gibt Tage, da denke ich an Leute, mit denen ich seit langer Zeit keinen Kontakt mehr hatte, und habe die beinahe körperliche Gewissheit, dass sie ebenfalls an mich denken, genau in diesem Moment, als ob ein elektrischer Strom durch die Luft fließt und sich zwischen uns ein Stromkreis schließt. Das ist immer ein gutes Gefühl, wie eine sanfte Berührung.
Nicht schlecht für jemanden, der nicht träumen kann, oder?
Ich kehrte aus dem gleichen Grund nach Hause zurück wie die meisten Leute: Weil mir nichts anderes übrig blieb.
Es war kein offizieller Umzug. Bloß ein Besuch. Die Art von Besuch mit offenem Ende, die man nur machen kann, wenn man viel Zeit hat. Ich war arbeitslos und tat, was man als Arbeitsloser so tut – Leute um einen Gefallen bitten, denen man selbst mal einen getan hat, Tipps nachgehen. Netzwerken, vornehm ausgedrückt. Anfühlen tut es sich wie betteln.
Ich fing mit den Chefredakteuren an und durchkämmte dann meine Kontakte in einer Branche, die am Boden war. Selbst die optimistischeren Kollegen, mit denen ich sprach, machten mir wenig Hoffnung. Ich arbeitete mich in der Hierarchie weiter nach unten, von den Auslandsbüros über die Redaktionsleiter bei den großen Tageszeitungen bis zu Patrick Ryan, meinem ältesten Freund, der im weitesten Sinne etwas mit Journalismus zu tun hatte. Pat war für die Öffentlichkeitsarbeit am Hammel College zuständig, einem jener kleinen, noblen Colleges in Neuengland, die ihre schwindelerregenden Studiengebühren mit ihrer altehrwürdigen Geschichte begründen.
Ich hatte damals für mein Studium in Hammel eine Ermäßigung erhalten, weil meine Mutter dort unterrichtete. Die Raten für den Studienkredit entsprachen trotzdem noch denen für ein Einfamilienhaus, aber immerhin hatte ich einen Abschluss in Journalismus auf der Habenseite – nicht nur ein aussterbender Beruf, sondern auch ein notorisch schlecht bezahlter. (Ich habe die Theorie, dass es schon auf der Highschool ein Unterrichtsfach geben sollte, in dem den Schülern ein paar grundlegende Finanzkenntnisse vermittelt werden. Allerdings ist das eine Erkenntnis, die man meistens erst mit Ende zwanzig gewinnt.)
Aber ich liebte das Schreiben, ich liebte Zeitungen, liebte die Knochenmühle der aktuellen Berichterstattung, »die Rohfassung der Geschichte«, wie es so schön heißt. Pat hatte das Journalismusstudium mit mir gemeinsam begonnen, aber die Zukunftsaussichten der Branche realistischer eingeschätzt als ich, und war zu einem Abschluss in Volkskunde umgeschwenkt – was, wie er behauptete, praktisch auf dasselbe hinauslief. Dabei legte er seinen Studienschwerpunkt vor allem darauf, gute Kontakte zu jedem und jeder aufzubauen, die ihm vielleicht irgendwann einen Job verschaffen konnten. Am Ende musste er nicht in die weite Welt hinausziehen, sondern blieb in Hammel, um sich in das Abenteuer der Öffentlichkeitsarbeit für ein College zu stürzen. Gähn. Aber gute Sozialleistungen und jede Menge Extras.
Pat war aus dem Osten gekommen, aus Montana, um in Hammel aufs College zu gehen, und obwohl ich technisch gesehen ein Einheimischer war, lebte ich erst seit zwei Jahren in der Stadt. Wir waren nach dem Tod meines Vaters hergezogen, und als das College begann, fühlte ich mich immer noch wie ein Außenseiter. Daran war ich allerdings gewöhnt. Während der akademische Stern meiner Mutter aufgegangen war, hatten wir häufig umziehen müssen. Es gab immer ein neues College, das ihr weniger Unterrichtsstunden und mehr Forschungszeit versprach. Zwischen meinem achten und achtzehnten Lebensjahr hatte ich vier unterschiedliche Schulen in vier verschiedenen Städten besucht, daher war es keine große Umstellung, in ein Wohnheim mit Studenten aus anderen Bundesstaaten oder dem Ausland zu ziehen. Neu anzufangen war der Standard-Betriebsmodus unserer Familie.
Pat Ryan und ich freundeten uns im ersten Studienjahr an. Wir hatten zwei gemeinsame Interessen: Bier und Besserwisserei. Bei Letzterem handelte es sich zumeist um endlose Diskussionen über die jeweiligen charakterlichen Vorzüge der Einwohner von Maine oder Montana. Er war ein hochaufgeschossener, schlaksiger irischer Junge, der sich schnell einen Sonnenbrand holte – was in Maine etwas heißen will – und sich fürs Fliegenfischen, Wandern und Segeln begeisterte. Während unserer College-Zeit kaufte er drei Segelboote, von denen eins billiger als das andere war. Wenn man weiß, dass das erste ihn knapp fünfzehnhundert Dollar kostete, kann man sich vorstellen, wie seetüchtig die Kähne waren. Ich war an jenem Freitagabend am Telefon, als der Hafenmeister anrief, ein knurriger alter Yankee namens Bobby Beauchamp – der sich außerhalb der Saison um das Sommerhaus meiner Mutter kümmerte –, und uns mitteilte, dass das Boot, das Pat SS Money Pit – sein Groschengrab – getauft hatte, soeben gesunken war.
Pat war viel zu betrunken, um zum Hafen zu fahren und irgendetwas zu unternehmen, und erklärte, dass das Boot nicht schwer zu finden sein würde, da es ja immer noch an der Anlegeboje vertäut sei, die Anlegeboje sich noch über Wasser befinde und er schließlich für den Liegeplatz bezahlt habe. Ob sein Boot über oder unter Wasser sei, ändere nichts an seinen Rechten als Mieter.
Scheiß drauf, trinken wir noch ein Bier und kümmern uns morgen früh um das Boot, sagte er, und das taten wir.
Unnötig zu erwähnen, dass sein Verhältnis zum Hafenmeister danach ein wenig angespannt war.
Als Pat mir den Job anbot, der mich nach Maine zurückführte, hatte er seine wilden Zeiten längst hinter sich und war ein respektierter Mitarbeiter an einem angesehenen College, der fest genug im Sattel saß, um mir einen Job auf Honorarbasis anbieten zu können.
»Fünf Riesen für einen Gefälligkeitsartikel«, sagte er. »Nick, da kannst du nicht Nein sagen.«
»Ich brauche einen richtigen Job, kein Trostpflaster.«
»Ein Pflaster kann einen manchmal vorm Verbluten retten.«
Wo er recht hatte, hatte er recht.
»Wir erstatten dir sogar die Reisekosten«, sagte er, und erst da wurde mir klar, dass er von mir erwartete, leibhaftig nach Maine zu kommen. Ich hatte mir vorgestellt, das Ganze per Telefon erledigen zu können, eine Vor-Ort-Reportage über das Hammel College aus meiner Wohnung in Tampa. So lief es üblicherweise, da niemand mehr über ein Reisekostenbudget verfügte.
»Ich bin in Tampa. Wenn ich nach Maine kommen soll, muss ich fliegen.«
»Ja, das wird schwierig, Bruderherz. Aber vielleicht kann ich dir den Hinflug spendieren. Ich zweige es aus dem Praktikantenbudget ab. Die kleinen Scheißer brauchen das Geld nicht. Auf nach Norden! Ein bisschen leben! Ernsthaft, wir haben Sommer. Willst du wirklich in Florida bleiben? Was ist aus meinem alten Kumpel aus dem stolzen Maine geworden?«
Ich wollte den Sommer tatsächlich nicht in Florida verbringen. Ich hatte genug von der erstickenden Hitze, der allgemeinen Lähmung, die sich für mich mit der sommerlichen Luft in Tampa verband – verdammt, ich hatte genug von Tampa. Außerdem war ich seit Jahren nicht mehr zu Hause gewesen, und schon bei dem bloßen Gedanken an Maine hätte ich einen Moment lang schwören können, Kiefern und klares Wasser zu riechen.
»Es würde dir guttun, uns hier oben zu besuchen«, drängte Pat, als ob er meinen Anflug von Heimweh gespürt hätte. »Wäre auch eine Gelegenheit, deine Mutter zu besuchen.«
Ich bekam sofort ein schlechtes Gewissen, wenn auch nur ein bisschen. Ich telefonierte zweimal in der Woche mit meiner Mutter, und doch hatte ich seit über einem Jahr kein echtes Gespräch mehr mit ihr geführt. Seit dem, was der Schlaganfall in ihrem Kopf angerichtet hatte. Sie redete viel, aber sie kommunizierte nicht. Ihr Verstand glich einer Waschmaschine, in deren Trommel sich die immergleiche Wäscheladung drehte: Die Wäschestücke wurden wieder und wieder durcheinandergewirbelt, aber es kam kein neues dazu. Für viele von uns wird das Ende der Reise so aussehen, sei es durch einen Schlaganfall, Alzheimer oder Demenz, und ich glaube, das ist eine der großen Ängste meiner Generation. Schließlich sind wir besessen von der Vorstellung, immer mit dem Rest der Welt verbunden zu sein, und narzisstisch genug, um zu glauben, dass der Rest der Welt das von uns verlangt.
Für meine Mutter war es allerdings nicht nur eine private Tragödie. Alice Jane Bishop war eine Koryphäe auf dem Gebiet der Gedächtnisforschung gewesen. Sie hatte in den führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht und auf Konferenzen rund um den Globus gesprochen. Sie kannte die Feinheiten und Geheimnisse des menschlichen Gedächtnisses wie kein anderer – bis sie selbst ihr Gedächtnis verlor.
Hört sich wie ein schlechter Scherz an? Die Welt ist schlecht, Kinder.
Sie war allein in den Camden Hills gewandert, auf einem ihrer Lieblingswege am Mount Megunticook. Als sie den Schlaganfall erlitt, war sie gefallen und zwischen die Felsen gestürzt. Es war Anfang Dezember und es herrschte leichtes Schneetreiben – nach örtlichen Maßstäben kein schlechtes Wetter, aber immer noch kalt genug, um eine Nacht im Freien nicht zu überleben. Meine Mutter trug beim Wandern immer eine Stirnlampe – eine Angewohnheit, mit der ich sie oft aufgezogen hatte –, und diese Stirnlampe rettete ihr das Leben. Es gelang ihr nicht nur, die Lampe anzuschalten, sondern auch den rotblinkenden Notfallmodus zu aktivieren. Der letzte Wanderer, der an jenem Abend aus dem State Park zurückkehrte, fand sie. Er kletterte zwischen den Felsen hinunter, um nachzusehen, woher das Licht kam.
Als der erste Anruf aus dem Krankenhaus kam, war ich optimistisch. Meine Mutter war am Leben, aber desorientiert, sagte der Arzt. Bloß desorientiert. Dann wurden die Tage zu Wochen und die Wochen zu Monaten, und es wurde klar, dass die Alice Bishop, die an jenem Morgen zum Mount Megunticook aufgebrochen war, nicht mehr zu uns zurückkehren würde.
»Dann komm einfach her, um mich zu treffen«, sagte Pat Ryan jetzt. Vielleicht war ihm bewusst geworden, dass es für mich keine besonders attraktive Aussicht war, meiner Mutter gegenüberzusitzen. »Was ich dir anbiete, ist im Grunde ein bezahlter Urlaub.«
»Das lässt es nur noch schlimmer klingen, Pat. Tun wir wenigstens so, als ob es ein Job wäre.«
»Wunderbar. Es ist ein Job. Unersetzliche Arbeit.«
»Was muss ich tun?«
»Ich habe hier ein Firmenprofil für das Alumni-Magazin, das sich nicht von selbst schreibt.«
Ein Firmenprofil für das Ehemaligen-Blättchen. Vor zwei Jahren hatte ich für mehrere internationale Zeitungen aus Kabul berichtet. Wie schnell mitunter alles aus den Fugen gerät.
»Und was für eine atemberaubende Erfolgsgeschichte haben wir heute?«, fragte ich und versuchte, einen scherzhaften Ton anzuschlagen, Pat nicht spüren zu lassen, wie demütigend das alles für mich war. Immerhin tat er mir einen Gefallen.
»Du wirst die Geschichte mögen«, sagte er. »Ein junger Computerfreak, der …«
»Oh, nein.«
»… ein bisschen Wagniskapital bekommen hat …«
»Hilfe.«
»… und hier bei uns in Hammel ein aufregendes kleines Start-Up auf die Beine gestellt hat, das …«
»Unmittelbar vor einem Milliarden-Dollar-Börsengang steht?«
»Nicht ganz. Lass ihnen noch einen Monat Zeit. Dein Artikel wird den Ball ins Rollen bringen! Bloomberg und Wired und sogar unsere gestrengen Freunde vom Wall Street Journal werden vor Neid platzen.«
»Großartig.« Ich öffnete eine Flasche Blanton’s Bourbon. »Was hat dein Wunderkind denn erfunden? Einen Küchenmixer, der in Echtzeit erfasst, was die Leute in ihm zerkleinern, und die Daten an den Supermarkt übermittelt?«
»Das ist nächstes Jahr dran. Dieses Jahr arbeitet er zum Wohle der Menschheit!«
»Ich hatte nichts anderes erwartet.«
»Ernsthaft. Er hat eine App entwickelt …«
Ich hielt das Telefon direkt neben das Glas, während ich den Bourbon eingoss, und konnte Pat lachen hören.
Ich nahm es wieder ans Ohr. »Erzähl weiter.«
»Ganz im Ernst. Die App dient dem Wohle der Menschheit.«
»Hurra.«
»Es ist eine Achtsamkeits-App.«
»Gibt es da nicht schon Hunderte von? Ich sehe überall Werbung dafür. ›Ausgeglichenheit für den Geist, Ruhe für die Seele … und alles to go!‹«
»Ja, ich weiß. Aber sie sind die einzigen in der Branche, die ihren Firmensitz in der alten Hefron-Papiermühle haben. Sie haben mächtig in den Schuppen investiert.«
Zu unserer Studentenzeit war das Hefron-Papierwerk ein weitläufiger, düsterer Backsteinkomplex am Ufer des Beaumont River gewesen, eine ehemalige Papiermühle, die vor langer Zeit den Betrieb eingestellt hatte und deren erkaltete Schornsteine trist hinter dem schmucken College-Campus aufragten.
»Großspender mögen solche Revitalisierungsprojekte«, bemerkte ich und nahm einen Schluck Bourbon.
»Genau. Und du erhältst ein fürstliches Honorar dafür, dass du den jungen Titanen in deiner farbigen, aber präzisen Prosa abkonterfeist. Das nennt man eine Win-win-Situation.«
»Fünf Riesen.«
»Fünf Riesen mehr, als du diese Woche verdient hast, vermute ich?«
Da hatte er recht.
»Ein Kinderspiel«, sagte Pat und ich musste lachen.
»Was gibt es da zu lachen?«, protestierte er.
»Ich muss nur daran denken, wie oft du das gesagt hast, und dann bin ich hinterher nur knapp dem Tod oder dem Gefängnis entronnen.«
»Und du würdest es trotzdem jedes Mal wieder tun.«
Das stimmte. Ich konnte Maine vor mir sehen, die dunklen Kiefern, das blaue Wasser, den metallisch-grauen Novemberhimmel und die Nebelbänke, die wie dicke Bettlaken an Land trieben. Ich konnte das alles vor mir sehen und ich hatte Heimweh. Schlimmes Heimweh.
Außerdem brauchte ich das Geld, und es war eine Gelegenheit, meine Mutter zu sehen.
»Einverstanden«, sagte ich. »Und danke. Ernsthaft.«
»Ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, dich wiederzusehen.«
»Ganz meinerseits.«
Dann wurde er plötzlich ernst. »Der Typ ist wirklich interessant. Er hat ein sehr talentiertes Team im Rücken und ein paar große Namen aus der Neurowissenschaft als Berater.«
»Was bringt ein Neurowissenschaftler mit außer seinem guten Ruf?«
»Das gewisse Etwas, das ihr Baby von allen anderen unterscheidet. Das braucht man doch, oder?«
»Und was ist das für ein gewisses Etwas?«
»Sie verändern deine Träume.«
Ich lachte auf.
»Nein, ernsthaft«, sagte Pat. »Das ist der Gag. Damit wollen sie sich von der Konkurrenz abheben.«
Ich stellte mein Glas ab.
»Sie verändern deine Träume?«
»Jup. Stell dir vor, wie sich deine Lebensqualität verbessern würde, wenn du alle Albträume durch schöne Träume ersetzen könntest. Wie sich das auf Ängste, Stress, Blutdruck und so weiter auswirken würde. Kannst du dir das auch nur ansatzweise vorstellen?«
»Nein«, erwiderte ich.
Als jemand, der niemals träumte, konnte ich es tatsächlich nicht. Und dann passierte etwas Seltsames, während ich in meiner Küche stand, Bourbon trank und mit meinem alten Freund telefonierte: Die angenehmen Erinnerungen an die Küste von Maine verschwanden, und blitzartig sah ich Whitneys Gesicht vor mir, ihren beunruhigten Blick, als sie mich bat, ihr zu erklären, wie sich mein traumloser Schlaf anfühlte.
Schwärze.
War sie damals vor mir zurückgewichen? Nein, auf keinen Fall. Es war einfach unbedeutendes Geplauder gewesen.
Aber die Idee hätte ihr gefallen. Deine Träume zu verändern. Sie hätte die App heruntergeladen, auch ohne kostenlosen Probemonat.
Ich bedankte mich nochmals bei Pat und versprach ihm, dass wir uns bald wiedersehen würden. Dann ging ich hinaus auf den Balkon und die Hitze Floridas umfing mich. Ich dachte an Maine, an meine Mutter und an meine Freunde und wartete auf einen kühlenden Windhauch, der nicht kam, während ich mir eine blonde Frau auf einem Segelboot vorstellte, das unter dem Sternenhimmel von einem auffrischenden Wind vorangetrieben wurde.
Dann ging ich hinein und legte mich ins Bett. Der Schlaf kam und ging. Die Schwärze stieg auf und ebbte wieder ab.
Zuverlässig wie die Gezeiten. So war es damals.
Ich vermisse diese Nächte.
2
In der letzten Oktoberwoche kehrte ich nach Maine zurück.
Als ich nach Norden aufbrach, war es fast vier Monate her, seit ich meinen Job verloren hatte, und ich spürte keine Bitterkeit mehr. Ich fühlte mich gut, als ob ich wüsste, in welche Richtung es jetzt ging. Weil ich einen Plan hatte. Ich würde nach Maine fahren, ein paar Wochen dort bleiben und mit mir ins Reine kommen. Meine Möglichkeiten für die Zukunft neu durchdenken und Kräfte sammeln. Was zur Hölle blieb mir sonst übrig? Wenn es dich umhaut, stehst du am besten gleich wieder auf.
Ich war wieder aufgestanden. Als ich die Brücke über den Piscataqua River zwischen Portsmouth und Kittery überquerte – und unter dem Schild Welcome to Maine salutierte –, fühlte ich mich richtig gut. Irgendwo entlang der Ostküste waren mir die Podcasts und Playlists ausgegangen, und das Radio lief, das echte Radio, das ich nie hörte, und bei WCLZ spielten sie Tom Petty, »Runnin’ Down a Dream«, und wie konnte man da nicht lachen? Ein bisschen dick aufgetragen vielleicht? Aber da war Tom, zur Stelle, wenn man ihn brauchte.
I felt so good, like anything was possible …
Wie sollte ich das nicht auf mich beziehen? Ich fühlte mich tatsächlich gut und mir standen alle Möglichkeiten offen. Ich war vielleicht pleite, aber ich war jung, und ich hatte einen Plan und war hart im Nehmen. Das spürte ich in jeder Faser meines Körpers.
There’s something good waitin’ down this road …
Ja, da wartete tatsächlich etwas Gutes auf mich, am Ende dieser Straße.
Ruhe in Frieden, Tom Petty.
Der Song war vor der Mautstation in York zu Ende, aber meine gute Stimmung hielt noch die ganze Strecke den Maine Turnpike hinauf an. Im Rückspiegel verpasste ich nichts Wichtiges. Mein Job war weg, ich war Single, ich hatte genug von Florida, und vielleicht war meine Entlassung genau der Schubs gewesen, den ich gebraucht hatte. Wenn nicht etwas Bedeutsameres: ein echtes Zeichen, oder wie meine Mutter gesagt hätte: »Dein Schutzengel hat dir gerade einen kräftigen Tritt in den Hintern verpasst.«
Bei ihren Gardinenpredigten pflegte meine Mutter einen ganz besonderen Stil. Ich war innerlich auf das Wiedersehen mit ihr vorbereitet – oder mit dem, was von ihr übrig war. Selbst wenn sie mich nicht erkannte, würde es guttun, ihr Gesicht zu sehen. Mein Vater war schon lange tot, gestorben, als ich sechzehn war. Blitzeis auf der Interstate 295 direkt nördlich des Flughafens von Portland. Er hatte sich beeilt, um einen Flug zu erwischen, der bereits gestrichen war, ohne dass er es wusste. Ich glaube, er hätte darüber gelacht. Das Weinen übernahm ich, aber ich glaube, mein Vater hätte gelacht, und der Gedanke ließ mich nur noch heftiger weinen. Der Freund, der auch an schlechten Tagen noch ein Lachen zustande bringt, ist schließlich der, den man am meisten braucht.
Bis zu seinem Tod hatten wir in Camden, Maine, gelebt, von Hammel ein paar Meilen die Küste hinauf, und meine Mutter war zum College gependelt. Sie hatte die Fahrt gemocht, besonders im Winter – kein Verkehr, die Bucht von Penobscot auf der einen, niedrige, schneebekrönte Berge auf der anderen Seite. Nach dem Autounfall waren ihr die kurvigen Straßen im Winter allerdings verleidet. Wir verkauften das Haus und zogen nach Hammel. Anfangs wohnten wir in unserem alten Sommerhaus am Ufer des Rosewater Pond, und dann zogen wir in ein Haus in der Nähe des Campus. Ich beendete in Hammel die Highschool, eineinhalb Jahre, die ich wie in einem Nebel durchlebte, und dann zog ich ins Studentenwohnheim. In unserem Haus in Hammel war ich nie wirklich heimisch geworden, und als die Rechnungen für die Behandlung meiner Mutter kamen, verkaufte ich es ohne zu zögern. Aber ich hatte in Maine immer noch ein Dach über dem Kopf, das ich vor allem aus Sentimentalität und nicht zuletzt aus schlechtem Gewissen behalten hatte: Mir gehörte noch unser Blockhaus am Rosewater Pond, auch wenn ich jetzt nicht mehr dorthin kam, ebenso wenig wie meine Mutter … natürlich.
Aber das Gehirn ist ein merkwürdiges Ding. Obwohl meine Mutter sich nicht mehr an unser Haus in Hammel erinnern konnte, hatte sie das Blockhaus in Rosewater noch in allen Einzelheiten vor Augen. Bei unseren Telefongesprächen kam sie immer wieder darauf zurück, verlor sich in Details, fragte mich, ob ich daran gedacht hatte, Desinfektionsmittel in den Wassertank zu kippen oder ob die Lampe über der Spüle immer noch kaputt wäre. Ihr Haus, ihr Mann und ihr Sohn waren aus ihrem Gedächtnis verschwunden, aber die Erinnerung an das Blockhaus blieb. Das war ein schlechter Grund, das Haus zu behalten, insbesondere da ich nichts in seinen Erhalt investierte, aber ich konnte mich nie dazu durchringen, es zum Verkauf anzubieten.
Bei meiner triumphalen Rückkehr nach Hammel würde ich also direkt am Wasser residieren. Das klingt beeindruckend, bis man sich eine Landkarte von Maine ansieht und einem klar wird, wie viel Wasser es dort gibt. Überall anders würde der Rosewater Pond als See durchgehen, aber in Maine braucht man schon ziemlich viel Wasser, falls man mehr als ein Teich sein will. Bei Sonnenuntergang, wenn das Licht zwischen den Granitfelsen der Schlucht an seinem Westufer im richtigen Winkel aufs Wasser fiel und ihm einen rubinroten Schimmer verlieh, machte der Rosewater Pond seinem Namen Ehre. Tagsüber hingegen hatte das Wasser meist eine stumpfe metallisch-graue Farbe wie unpoliertes Zinn.
Das Blockhaus gehörte seit zwei Generationen der Familie meiner Mutter. Wir hatten dort während meiner Kindheit glückliche Wochenenden verbracht und, nachdem mein Vater gestorben war, ein weniger glückliches Frühjahr und einen ebensolchen Sommer. Vielleicht hatte diese Zeit es mir verleidet, denn nach dem College hörte ich auf, dorthin zu fahren. Ich sorgte dafür, dass die Grundsteuer bezahlt und das Haus einigermaßen instand gehalten wurde. Letzteres erledigte Bob Beauchamp, der ehemalige Hafenmeister und Gegenspieler von Pat Ryan, der längst im Ruhestand war. Trotz Beauchamps Bemühungen war es ein altes Blockhaus in einer Gegend, in der die Winter lang waren, und es sah ziemlich heruntergekommen aus, als ich im letzten Abendlicht ankam. Wolken verdeckten die Sonne und kein rosenfarbener Schimmer glänzte auf dem See.
Das Blockhaus lag geschützt in einer kleinen Bucht und war von Kiefern und Birken umstanden. Früher war seine Farbe tiefrot gewesen, der Anstrich inzwischen jedoch zu einer Rostfarbe verblichen, die mit den herabgefallenen Kiefernnadeln verschmolz, die den massiven Felsen bedeckten, auf dem das Haus stand. Ich parkte meinen Ford Ranger in der zerfurchten Einfahrt und lud aus, wobei ich mich gegen einen ersten Moskitoangriff zur Wehr setzen musste. Der Ersatzschlüssel war immer noch mit Klebeband unter dem Propangastank befestigt, der Herd und Heizung mit Gas versorgte. Der Schlüssel war verrostet, aber er funktionierte.
Drinnen roch es überall wie auf einem Dachboden, der Geruch von weggesperrten Erinnerungen. Ich öffnete alle Fenster, die noch ein Insektengitter hatten, zündete ein paar alte Kerzen an und ging nach draußen, um in der Dunkelheit auf dem morschen Bootsanlegesteg zu sitzen. Es war ein seltsames Gefühl, wieder zurück zu sein, aber auf der anderen Seite des Sees ließ ein Eistaucher seinen wunderbar traurigen Ruf erklingen, und das Geräusch weckte in mir so viele schöne Erinnerungen, dass es mir wie ein Willkommensgruß schien.
Rosewater.
Ich war wieder daheim.
Ich saß lange Zeit auf dem Steg und wurde nachdrücklich daran erinnert, dass Citronella gegen die Moskitos von Maine wenig ausrichtet. Nach dem konstanten Hintergrund menschlicher Geräusche in Tampa waren Einsamkeit und Stille überwältigend. Zu meiner Rechten, auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht, stand ein Blockhaus, das früher den Hollands gehört hatte. Ich war damals schrecklich in ihre Tochter verliebt gewesen. Jetzt lag das gelb gestrichene Gebäude düster und still da. Dahinter erhob sich dasjenige der Häuser am See, das ich am wenigsten mochte, ein weitläufiges postmodernes Monstrum. Die Rasenfläche, die an einer Steinmauer endete, sah wie ein Golfplatz aus. Ein langer Steg ragte vor dem Haus ins Wasser, und zwei übergroße grüne Reflektoren markierten den Anlegeplatz für ein Boot, das nie kam. Niemand wusste, warum sie ausgerechnet grün waren, aber die Kombination aus grünem Licht und dem extravaganten Haus brachte meinen Vater auf den Gedanken, ihm den Spitznamen Gatsby-Haus zu verleihen, zu Ehren von F. Scott Fitzgerald.
Gegenüber dem Gatsby-Haus befand sich ein Blockhaus mit jägergrünem Metalldach, das sich kaum vor den Kiefern abhob. Die Blumenbeete davor waren mit Holzscheiten umrandet, die Hauswände bestanden aus Baumstämmen, und es gab sogar einen Baumstamm als Fahnenmast. Herr über dieses hölzerne Paradies war niemand anders als Bobby Beauchamp. Beauchamp kümmerte sich praktisch um die Hälfte der Häuser am See. Er war etwas verschroben, aber verlässlich und nicht teuer – Eigenschaften, die nicht allzu oft in einer Person vereint sind.
Während ich auf dem Steg saß, kam Bobbys alter Dodge Ram die Zufahrt entlanggerumpelt (die natürlich mit Baumstämmen begrenzt war und an einer Reihe von Holzblöcken als Parkmarkierungen endete. Bobby hatte ein wirklich intimes Verhältnis zum Holz). Die Wagentür ging auf und der Hafenmeister im Ruhestand stieg aus. Er hatte eine Papiertüte in der einen und einen Sixpack Pabst in der anderen Hand und starrte zu mir herüber. Ich hob die Hand und winkte.
Er starrte stur weiter. »Schauen Sie nach dem Bishop-Haus, oder hat der Junge es Ihnen vermietet?«
»Ich bin der Junge, Mr. Beauchamp«, rief ich zurück. »Ich bin es, Nick.«
»Hätte Sie gleich erkennen müssen«, bellte er, auch wenn er mich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, gute fünfzig Meter von mir entfernt stand und es praktisch dunkel war. Das Sehvermögen eines Hafenmeisters muss offensichtlich auf dem Niveau einer Superkraft liegen.
»Schön, wieder hier zu sein«, sagte ich. »Geht’s Ihnen gut?«
»Natürlich geht’s mir gut«, erwiderte er, als hätte ich ihn beleidigt, indem ich wagte, sein Wohlbefinden in Frage zu stellen.
»Freut mich.« Ich stand auf. Vielleicht könnten wir ein bisschen plaudern, und ich würde von ihm erfahren, was sich rund um den Rosewater Pond so alles getan hatte. Er unterbrach mich.
»Die Einkäufe müssen in den Kühlschrank«, rief er und schwenkte ohne erkennbare Ironie das Sixpack. »Ich komme morgen rüber, und dann können wir reden. Da sind ein paar tote Bäume bei euch, die gefällt werden müssen. Ich kann das machen, aber nicht für umsonst.«
Willkommen in Maine.
»Danke«, sagte ich. »Wir reden morgen drüber.«
»Das Haus müsste auch neu lasiert werden«, sagte er. »Ich kann das übernehmen, aber …«
»Nicht für umsonst«, ergänzte ich. »Sicher. Danke, Mr. Beauchamp. Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen.«
Warum ich es selbst jetzt, nach all den Jahren, nicht fertigbrachte, ihn Bob zu nennen, konnte ich nicht sagen. Er grunzte, klapperte mit dem Sixpack, was möglicherweise eine Verabschiedung darstellen sollte, und verschwand in seinem Blockhaus. Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Ich ahnte, dass die Liste der dringend notwendigen Arbeiten nicht mit dem Fällen der Bäume und Anstreichen zu Ende sein würde. Ich musste gleich am Anfang des Gesprächs darauf hinweisen, dass ich meinen Job verloren hatte, bevor es teuer wurde.
Nachdem ich den Moskitos für einen Abend genug Blut gespendet hatte, ging ich ins Haus und fand einen Bezug für das alte Doppelbett mit den quietschenden Federn. Ich hatte gerade das Bett gemacht, als mein Smartphone brummend eine eingehende SMS signalisierte. Es war eine unbekannte Nummer, aber mit der Vorwahl 207 – also irgendwo in Maine. Ich öffnete die Nachricht.
Hallo, Mr. Bishop! Ich bin Renee von Clarity Inc. Pat Ryan vom Hammel College hat mir Ihre Nummer gegeben. Wir freuen uns, Sie morgen zu einer Führung durch unseren neuen Firmensitz in der Papierfabrik zu empfangen. Bitte bestätigen Sie Ihre Ankunft, dann kann ich Ihnen einen Parkplatz zuweisen.
Clarity Inc.? Parkplatz zuweisen? Als ich das letzte Mal bei der alten Papiermühle gewesen war, gab es dort genug leeren Asphalt, um seinen Wagen längs oder quer zu parken und wochenlang stehen zu lassen. Außerdem hätte ich mir gern ein oder zwei Tage Zeit gelassen, um anzukommen, meine Mutter zu besuchen und Pat zu treffen, bevor ich ein Interview machte. Aber was soll’s, dachte ich. Ich war hergekommen, um einen Job zu erledigen, und je früher ich anfing, desto früher hatte ich den Scheck in der Hand.
Danke Ihnen, Renee, tippte ich. Ich freue mich ebenfalls. Wäre Ihnen vormittags 10:00 Uhr recht?
Die Antwort kam binnen Sekunden:
Perfekt! Parken Sie bitte im Parkhaus an der Ames Street. Das Ausfahrticket bekommen Sie von uns. Kein Aufnahmegerät und kein Mobiltelefon bitte. Pat hat uns versichert, dass Sie mit Stift und Papier umgehen können. ;-)
Ich saß da mit dem Smartphone in der Hand, sog den Geruch des kühlen, staubigen Hauses um mich herum ein und versuchte, mich nicht über den Sicherheitsfimmel irgendeines Programmierer-Wunderkinds zu ärgern. Versuchte, den Impuls zu unterdrücken, zurückzuschreiben, dass ich eine Sicherheitsfreigabe des Verteidigungsministeriums hatte, die den Anforderungen von Clarity Inc. wohl genügen würde.
Allerdings war die Freigabe aus Washington nicht mehr ganz aktuell, und ich hatte keinen Grund, mich anzustellen. Also antwortete ich stattdessen Wird gemacht und ließ es dabei bewenden. Mir fiel ein, dass Pat noch gar nicht wusste, dass ich zurück in Maine war. Ich hatte vorgehabt, ihn am nächsten Morgen anzurufen. Aber egal. Die App-Entwickler waren scharf auf die Reklame. Gut so. Quellen, die scharf darauf sind zu reden, machen einem als Reporter das Leben leichter.
Ich löschte das Licht, lag mit dem Kopf auf einem flachen, muffigen Kissen und wartete auf den Schlaf. Ich musste lange warten. Die Eistaucher waren unterwegs, und sie waren laut. Zwei oder vielleicht drei von ihnen unterhielten sich mit einem krächzenden Schnattern, das keine Ähnlichkeit mit ihrem typischen klagenden Ruf aufwies. Das aufgeregte, kreischende Hin und Her deutete darauf hin, dass irgendetwas sie aufgescheucht hatte oder bedrohte, höchstwahrscheinlich irgendein Tier, das es auf ihr Nest abgesehen hatte. Der charakteristische Ruf des Eistauchers ist ein einzelner Schrei. Ein geisterhafter Ruf von unbestreitbarer Schönheit mit einem klagenden Unterton. Er kündet von der friedlichen Einsamkeit des Nordens, der Henry Thoreau unter den Vögeln.
Der Ruf täuscht jedoch. Eistaucher sind weder Einzelgänger noch friedlich. Ihr Dasein ist von Gewalt geprägt. Die Vögel hacken mit ihren Schnäbeln aufeinander ein, schlagen sich mit ihren Schwingen und drücken sich gegenseitig unter Wasser. Der mitternächtliche Ruf, bei dem man an Thoreau am Walden Pond denkt, ist alles andere als friedvoll.
Ich war mir nicht sicher, was die Auseinandersetzung zwischen den Vögeln auf dem Wasser ausgelöst hatte und was sie beendete, aber irgendwann gab es einen Waffenstillstand, und am Rosewater Pond kehrte wieder Stille ein.
Dann schlief ich.
3
Die alte Hefron-Papiermühle hatte sich so sehr verändert, dass ich am nächsten Morgen fast vorbeigefahren wäre, hätte ich das Gebäude nicht an seiner schieren Größe erkannt.
Das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, war die Fabrik ein Flickenteppich aus verwittertem, stumpf gewordenem rotem Backstein und Beton gewesen, die Fenster eingeschlagen oder mit Brettern vernagelt, die Mauern bedeckt mit den halbherzigen Graffiti gelangweilter Highschool-Kids. Im Verlaufe der Jahre hatte es einige Versuche gegeben, das Gelände neu zu nutzen, aber keiner davon war erfolgreich ausgefallen. Welche Firma in Maine brauchte schon 30000 Quadratmeter Fabrikhallen? Die Stadt versuchte in regelmäßigen Abständen, das Gelände dem College zu »schenken«, und mit nichts konnte man den Stiftungsrat des Hammel College schneller in die Flucht schlagen als mit einem solchen Angebot.
Jetzt aber stand es in neuer Pracht da, mit einem sauberen crèmefarbenen Anstrich, gegen den sich die gestuften, mit rosafarbenen Apfelrosen bepflanzten Blumenbeete, die man davor angelegt hatte, effektvoll abhoben. Als neuer Eingang diente ein zweistöckiger Glasvorbau. Eine Terrasse und eine von Blumenkästen gesäumte Fußgängerbrücke führten über den Beaumont River und die donnernden Wasserfälle, die früher die Papiermühle angetrieben hatten. Auf der anderen Seite befand sich ein frisch asphaltierter, eingezäunter Parkplatz. Dort standen fünf Autos, und auf der Straße vor dem Eingang gab es zwanzig leere Parkplätze. Sinnvoll ausgegebenes Geld.
Ich parkte auf der Straße.
Zum ersten Mal, seit Pat die Geschichte erwähnt hatte, spürte ich echte Neugier. Nicht wegen der App, sondern des Geldes wegen. Wie hatten diese Leute mit einem noch in der Entwicklungsphase steckenden Produkt auf einem bereits überfüllten Markt derart viel Risikokapital zusammenbringen können?
Ein Reporter mit einer Frage ist ein glücklicher Mensch. Es war eine unbedeutende Frage für eine Geschichte der Provinzliga, aber es fühlte sich trotzdem ziemlich gut an.
Ich überquerte die neue Fußgängerbrücke, während der Wasserfall zu meiner Linken donnerte und rechts von mir die Blumenrabatten dufteten, und ging auf den Haupteingang zu. Zog an einer der riesigen Glastüren.
Sie war verschlossen.
Ach ja, das Sicherheitsprotokoll. Ich hatte meine Anweisungen vergessen. Pflichtschuldig drückte ich den Summer an der Gegensprechanlage, und eine fröhliche Frauenstimme antwortete.
»Lieferung?«
Ich nannte meinen Namen und den Grund meines Besuchs.
»Ah, natürlich. Ich sehe gerade Renee im Korridor. Ich schicke sie runter.«
Ich stand da und wartete und genoss den Morgen. Der Hafen – wo einst der junge Patrick Ryan ein Segelboot, das dort ankerte, an die Fluten verloren hatte – lag direkt am Fuß der Anhöhe, die dem Fluss auf seinem Weg hinab in die Bucht folgte. An klaren Tagen konnte man von dort die Inseln sehen und hatte einen Blick über die Küstenstädte am Highway 1, von Rockland über Camden und Belfast bis nach Bar Harbor, Mount Desert Island und Acadia im Norden.
Hinter mir öffnete sich die Glastür der wieder zum Leben erweckten Papiermühle, und eine lächelnde junge Frau mit dunkelrotem Haar und grünen Augen streckte mir ihre Hand entgegen.
»Mr. Bishop. Ich bin Renee.«
»Schön, Sie kennen …«, begann ich und unterbrach mich. »Moment mal! Renee!«
Ihr Lächeln wurde breiter, und einen Augenblick lang erwartete ich, der Händedruck würde in eine Umarmung übergehen, aber das geschah nicht. Stattdessen standen wir nur da und grinsten uns an. Renee Holland war mein erster echter Freund in Hammel und einen Sommer lang unsere Nachbarin am Rosewater Pond gewesen, bevor sich die Sommergäste Anfang September zerstreuten. Sie war zwei Jahre älter als ich, Crossläuferin, die mit größter Ernsthaftigkeit philosophische Bücher las, und eine Autorität, wenn es um Gangsta-Rap ging. Der Prototyp der geheimnisvollen Achtzehnjährigen.
Da sie zwei Jahre älter war als ich, wäre sie normalerweise zu erwachsen gewesen, um mit mir abzuhängen, aber im Sommer gelten andere Gesetze. Wir hatten uns über die Musik angefreundet und dann angefangen, an den feuchtheißen Nachmittagen Querfeldeinläufe zu unternehmen. In ihrem Keller hörten wir stundenlang Nas und Tupac und Dr. Dre und stritten uns leidenschaftlich über die Verdienste von Eminem. Für Renee produzierten praktisch alle aktuellen Rapper bloß triviale Popmusik. Nur die Vergangenheit faszinierte sie. Ich war entsetzlich in sie verliebt, aber wie die meisten Sommerlieben blieb auch diese reine Schwärmerei. Sie ging zurück aufs College und wechselte dann auf eine Universität in einem anderen Bundesstaat, Indiana oder Iowa.
»Du hast mich nicht erkannt!«, sagte sie jetzt spöttisch. »Unglaublich.«
»Du hast dich verkleidet. Was soll das rote Haar?«
Sie lachte. »Ich weiß, ich weiß. Es ist ein bisschen übertrieben.«
»Nein. Es sieht toll aus.«
»Das sagst du nur, weil du musst.«
»Ich würde dich nie anlügen.«
»Log er.«
Ich lächelte. »Warum hast du gestern Abend nicht gesagt, dass du es bist? Du warst so förmlich: ›Hier ist Renee von Clarity wegen dem Parkticket.‹«
Sie grinste. »Dann wäre ja der ganze Spaß weg gewesen. Eine Überraschung ist immer besser, wenn man dabei das Gesicht sieht.«
»Das ist sie«, stimmte ich zu, und es war tatsächlich besser so. Bei ihrem Anblick fühlte ich mich auf eine Art und Weise zu Hause, wie ich es bei meiner Ankunft in Rosewater nicht getan hatte. Heimat hat immer mehr mit Menschen als mit Orten zu tun.
»Komm rein«, sagte sie. »Ich zeige dir unser Reich.«
Wir betraten eine Rotunde mit gebohnertem Fußboden und leuchtend weißen Wänden. Alles war weiß, fast zu intensiv. Es wirkte nicht mehr hell und freundlich, sondern abweisend.
»Ihr habt eine Menge Geld in den Laden investiert«, sagte ich.
»Nun, das ist nicht alles für Clarity. Wir sind nur das Zugpferd. Sie hoffen natürlich auf viele weitere Mieter. Es soll so eine Art Gründerzentrum werden: Start-Ups, High-Tech-Jobs, alles, was den Braindrain aus Maine stoppt.«
Sie wedelte mit einer Schlüsselkarte vor einem Sensor neben dem Aufzug. Die Türen öffneten sich. Wir stiegen ein.
»Bryce wird dir den Rest erklären«, sagte sie. »Es ist sein Baby.«
Bryce. Ich versuchte, keine Grimasse zu schneiden. Wie sollte er auch anders heißen: Sohn reicher Eltern, kein College-Abschluss, jetzt pausbäckiger CEO eines überbewerteten Tech-Unternehmens.
Wir fuhren ein, zwei, drei Etagen nach oben, dann hielt der Aufzug an. In der Kabine gab es keine Knöpfe, außer einem Schalter für die Notrufanlage. Die Schlüsselkarte ließ den Aufzug automatisch auf der richtigen Etage halten. Neuester Stand der Technik. Und teuer.
Die Aufzugtüren öffneten sich, wir stiegen aus, und ein leises Klingeln ertönte. Sofort drehte sich Renee zu mir um.
»Oho«, sagte sie in scherzhaft mahnendem Tonfall. »Ich dachte, wir wären uns einig, dass kein Smartphone erlaubt ist?«
»Ich werde es nicht benutzen.«
»Das glaube ich dir, aber wir dürfen es aus Sicherheitsgründen nicht hier drin haben. Warte.« Sie durchquerte den Raum, eine offene Fabriketage mit freiliegendem Mauerwerk und Rohren und schwarzen Einbauten, die mit abgeschliffenen Holzböden kontrastierten. Alles ein paar Jahre hinterher auf der Coolnessskala. Trennwände aus Holz und Glas unterteilten den Raum in separate Arbeitsplätze. In einer Ecke sah ich schwarze Designersessel, ein Whiteboard und zusammengerollte Yogamatten – das Büro einer Tech-Firma, das von einem Innenarchitekten gestaltet war, der seine Vorstellung vom Silicon Valley aus einer alten HBO-Serie hatte. Es fehlten nur die Tischtennisplatten und die Smoothie-Bar, aber sonst war alles ziemlich komplett. Vielleicht waren die ja auf dem Dach.
Renee Holland kam mit einem kleinen schwarzen Kästchen in der Hand zurück. Als sie den Deckel aufklappte, sah ich, dass es mit Filz ausgeschlagen war. Es sah aus wie ein winziger Sarg.
»Wenn Sie die Güte hätten, Ihr Mobiltelefon hier hineinzulegen, mein Herr, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie es beim Abschied zurückerhalten.«
Ich blickte noch einmal zum Aufzug und begriff erst jetzt, was geschehen war.
»Es gibt einen Sensor?«
»Wie bitte?«
»Das Klingeln, als wir ausgestiegen sind. Daran hast du gemerkt, dass ich ein Smartphone dabeihatte.«
»Du bist offenbar wirklich ein investigativer Journalist. Ich hatte gedacht, Pat schwindelt mir etwas vor. Ja, es gibt einen Sensor.« Sie lächelte strahlend, als ob es sich um eine großartige Neuerung handelte. Ich fand es eher beunruhigend.
»Ziemlich scharfe Sicherheitsvorkehrungen«, bemerkte ich, während ich mein Smartphone in den Miniatursarg legte, den sie umgehend zuschnappen ließ und auf den Tisch zurückstellte.
»Wissen Sie, wie hoch Calm bewertet wurde?«, fragte eine Stimme rechts von mir.
Ich drehte mich um und erblickte einen Mann, der vielleicht ein paar Jahre älter war als ich, irgendwo in seinen frühen Dreißigern, mit einem unregelmäßig gestutzten Bart, der ein rundliches Gesicht verdeckte.
»Darf ich vorstellen, Bryce Lermond«, sagte Renee.
Er trug ausgeblichene Jeans und eine Fleece-Weste über einem Langarmshirt, als hätte er sich nicht entscheiden können, ob er eine Wandertour in den Appalachen unternehmen oder ein Tech-Start-Up gründen wollte. Das einzige Problem an seinem zerknitterten Look bildete ein Paar Stiefel, die so neu waren, dass ich mich wunderte, warum man nicht das Leder roch.
»Eine Milliarde Dollar«, beantwortete er seine Frage selbst. »Ob ich also auf Sicherheit achte?« Er lachte. »Es schmeichelt zumindest dem eigenen Ego, wenn man sich einbildet, dass irgendjemand es auf unsere geniale Erfindung abgesehen haben könnte.«
Sein Lächeln war immerhin warm und echt, sein Händedruck entspannt und nicht übertrieben fest.
»Ich bin hier, um über Ihre geniale Erfindung zu schreiben«, versicherte ich ihm, »nicht, um sie zu stehlen.«
»Ich weiß, ich weiß.« Er blickte zu Renee und lächelte. »Ich habe gehört, Sie kennen unseren Chief Operating Officer schon etwas länger.«
Also gehörte Renee Holland zur Geschäftsführung von Clarity. Ein überraschender Karriereschritt für das Mädchen, das ich gekannt hatte, die angehende Philosophin und Teilzeit-Rapperin. Ich hatte damit gerechnet, dass sie an einer Universität oder bei einem Verlag landete. Oder eine Marihuana-Farm aufziehen würde.
»Ein ganzes Stück die Memory Lane runter«, sagte ich.
Das war ihr Lieblingstrack von Nas gewesen. Sie lächelte, zum Zeichen, dass sie die Anspielung verstanden hatte, aber nur leicht. Sie hatte wahrscheinlich nicht vor, ihrem Boss eine Kostprobe ihres Flows zu geben. Schade eigentlich.
»Wollen wir uns setzen?« Bryce Lermond deutete mit einem Nicken auf eine der abgeteilten Arbeitsnischen. Sie war geräumiger als die anderen, es gab jedoch keine Tür oder irgendeinen anderen Hinweis, dass es sich um das Büro des CEOs handelte. Er musste sich allerdings auch keine großen Sorgen um Diskretion machen. Außer ihm und Renee war niemand zu sehen.
Ich setzte mich in einen der Ledersessel, die vor seinem Schreibtisch standen, einer schlichten Massivholzplatte. Renee setzte sich in den Sessel neben meinem.
»Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind«, begann Bryce Lermond. »Das College ist ein wertvoller Partner für uns. Und es ist uns wichtig, darüber ein paar Worte zu sagen.«
»Wunderbar.« Ich war weitaus neugieriger darauf, was Renee hierherverschlagen hatte, als auf das, was Bryce zu sagen hatte, aber ich musste meine Rolle spielen. »Einverstanden, wenn ich einfach mit ein paar Fragen loslege, um den Ball ins Rollen zu bringen?«
»Unbedingt.«
Also fingen wir an. Ich erfuhr, dass Bryce Lermond eigentlich aus Boston stammte und kurz das Hammel College besucht hatte, bevor er einen Abschluss an der Lowell University in Massachusetts gemacht hatte. Dass er kurz damit geliebäugelt hatte, einen Doktor in Psychologie anzustreben, bevor er einen Job als Programmierer bei einer Cloud-Computing-Firma annahm. Dass er angefangen hatte, sich für die Idee einer Achtsamkeits-App zu interessieren, während er sich mit Meditation beschäftigte. Dass seine Firma im Moment aus insgesamt fünf Mitarbeitern bestand, von denen nur drei in Maine lebten – die anderen waren Programmierer, die in New York und Seattle saßen –, sie aber große Pläne hegten: In Zukunft wollten sie bis zu fünfzig Mitarbeiter an ihrem Firmensitz in der wundervollen alten Hefron-Papiermühle beschäftigen, die aufgrund ihrer Geschichte ein ungeheuer inspirierender Ort war, bla, bla, bla.
Ich war gerade bei der Frage angelangt, wie man die jährliche Abwanderung junger Talente aus Maine stoppen könne, ein Thema, mit dem potenzielle Stifter für das College umgarnt werden sollten, als Bryce Lermond mich unterbrach.
»Sie glauben nicht daran, oder?«, fragte er lächelnd.
»Was meinen Sie? Woran?«
»An uns. An unsere Idee. Ihr Potential.« Sein Lächeln schien echt. Nicht unfreundlich und nicht überrascht.
»Doch, natürlich.«
Er lachte leise. »Kommen Sie schon.«
Ich sah hinüber zu Renee. Sie beobachtete mich, und sie lächelte nicht. Sie sah irgendwie enttäuscht aus.
»Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt«, sagte ich und wandte mich wieder Lermond zu.
»Und für Sie sollte es auch keine Rolle spielen. Mein Job ist es, den Leuten Ihre Firma vorzustellen – was Sie machen und welche Verbindungen Sie zum Hammel College unterhalten. Ich würde gern so tun, als ob es mir mehr bedeuten würde, aber das tut es nicht.«
»Aber für mich bedeutet es mehr«, sagte er und beugte sich vor, wobei seine blauen Augen ernst über den Bart blickten, in dem sich erste graue Haare zeigten. »Ich meine, ich verstehe Ihren Standpunkt, aber immer, wenn ich über das spreche, was ich mache, bin ich neugierig auf die Reaktionen. Und Sie …« Er drohte mir scherzhaft mit dem Finger. »Sie sind nicht überzeugt.«
Es war nicht meine Aufgabe, Werbung für seine Firma zu machen, und genauso wenig, Bryce Lermonds Behauptungen ungeprüft zu akzeptieren, aber trotzdem verspürte ich ein schlechtes Gewissen. Er schien ein anständiger Kerl zu sein, Renee war das auf jeden Fall, und sie hatten große Pläne. Kein Grund, sie zynisch zu behandeln.
»Es tut mir leid«, sagte ich. »Reporter sind von Natur aus skeptisch.«
»Und das heißt?«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »Das heißt … was?«
»Ernsthaft, Nick – darf ich Sie Nick nennen?« Nachdem ich eine bejahende Kopfbewegung gemacht hatte, fuhr er fort. »Natürlich bin ich zum jetzigen Zeitpunkt froh über jede Zeile, die über uns geschrieben wird. Aber noch mehr interessiert mich, was Sie denken.«
»Warum?«
»Weil ich mir überlegen muss, wie ich mein Produkt verkaufe«, antwortete er unverblümt. Sein Lächeln verschwand, und er sah verletzlich aus. Seine Augen wanderten kurz zu Renee und dann zurück zu mir, als ob er bereute, sich vor ihr diese Blöße gegeben zu haben. Unternehmer müssen Selbstvertrauen ausstrahlen. Das konnte man von Bryce Lermond nicht gerade behaupten.
»Ich bin mir sicher, das wird Ihnen nicht schwerfallen«, sagte ich.
»Blödsinn«, antwortete er und schob dann rasch nach: »Entschuldigung. Aber während Sie dieses Gespräch als Interview betrachten, sehe ich es als Testlauf. Können Sie mir folgen?«
»Vermutlich. Aber Sie haben doch schon jede Menge Geld eingesammelt. Für mich sieht es so aus, als ob Ihr Produkt schon bei wichtigeren Leuten als mir den Test bestanden hat.«
Das Lächeln kehrte auf sein Gesicht zurück, ein fast entschuldigendes Lächeln diesmal. »Meine Mutter«, begann er, und Renee rutschte in ihrem Stuhl hin und her, schlug die Beine übereinander und strich ihre schwarze Hose glatt. Ich musste sie nicht ansehen, um zu wissen, dass ihr die Richtung unseres Gesprächs nicht gefiel. Sie schien kurz davor, ihn anzuschreien, er solle den Mund halten.
»Ihre Mutter gehört zu den Investoren?«, fragte ich.
»Sie war der einzige Investor.«
Ich versuchte, meine Überraschung zu verbergen, doch er sah mich prüfend an und nickte dann, zufrieden, in meinem Gesicht genau das zu lesen, was er erwartet hatte.
»Nicht gerade ideal, was? Wir haben einen Vorstand und alles, wir haben Input von erstklassigen Leuten, aber was das Geld angeht, nur eine Quelle.«
»Sie muss eine Menge davon haben«, sagte ich.
Er lachte auf. »Weil sie riskiert, es in ein so idiotisches Projekt zu stecken?«
»Das habe ich nicht gemeint.«
»Aber ich fürchte, das wird genau das sein, was die Leute denken werden. Aber, ja, sie hatte eine Menge Geld. Das lässt sich nicht abstreiten. Und jetzt, wo sie tot ist, bedeutet das, dass ich viel Geld habe. Und die Leute betrachten das mit …«
»Skepsis«, ergänzte ich, da er offenkundig wollte, dass ich seinen Satz zu Ende brachte.
»Verachtung«, sagte er. »Glauben Sie mir, das ist mehr als Skepsis. Mir macht es nichts aus. Aber wenn ich mit Ihnen über die Technik rede, über die Idee, die dahintersteckt, die Magie, das Potential, dann habe ich das Gefühl, dass Sie nur deshalb nicht gähnen, weil Sie ein höflicher Mensch sind.« Er unterbrach sich. »Genau genommen haben Sie einmal gegähnt.«
Er hatte recht.
»Schauen Sie, Mr. Lermond, ich gehöre vielleicht nicht zu Ihrer idealen Zielgruppe. Ich habe es nicht so mit Computern.«
»Aber genau darum geht es!«, sagte er mit erhobener Stimme. »Ich will das Ding nicht an Computernerds verkaufen. Ich will es der ganzen verdammten Welt verkaufen. Also sagen Sie mir, bitte, warum spricht es Sie nicht an?«
Sein Gesichtsausdruck war so ernst, die Frage so flehend gestellt, dass ich beschloss, ihm eine ehrliche Antwort zu geben. Renee sah ich dabei nicht an.
»Mir kommt es so vor, als ob es Ihre App schon gibt«, sagte ich. »Calm, Headspace, Ten Percent Happier und so weiter. Ich schätze, ich habe das Gefühl, dass sie einfach nichts Neues ist.«
Er schien aus allen Wolken zu fallen. Als ich zu Renee hinüberblickte, starrte sie mich an, als ob ich gerade im selben Atemzug ihrem Welpen einen Tritt gegeben und ihren Nachwuchs darüber aufgeklärt hätte, dass es keinen Weihnachtsmann gibt.
»Aber um es noch einmal zu wiederholen«, sagte ich, mehr zu ihr als zu ihm, und hob beschwichtigend die Hände, »Ich bin nicht die ideale Zielgruppe.«
Bryce Lermond stieß sich vom Schreibtisch ab und kippelte mit seinem Stuhl hin und her, immer noch mit der gleichen niedergeschlagenen Miene.
»Es ist eine Herausforderung«, murmelte er. »Das bestreite ich nicht. Es ist ein umkämpfter Markt.«
Sie sahen beide so entsetzlich enttäuscht aus, dass ich das Gefühl hatte, sie irgendwie aufmuntern zu müssen. Verdammt, ich war doch nicht hier, um einen echten Bericht über ihr Unternehmen zu verfassen. Meine Aufgabe war, ihr Image ein bisschen aufzupolieren und ihre alte Alma Mater stolz auf ihre Absolventen zu machen. Es wäre nicht gerade ein Zeichen von Dankbarkeit gegenüber Pat Ryan, wenn diese Absolventen ihn hinterher in Tränen aufgelöst anriefen. Und wenn ich mir Bryce Lermond ansah, dann schien mir das plötzlich nicht besonders weit hergeholt.
»Ich fand die Sache mit den Träumen interessant«, sagte ich. »Sie haben das nicht einmal erwähnt.«
Es war, als ginge die Sonne auf und sogleich wieder unter: Seine Züge erhellten sich, nur um sich augenblicklich wieder zu verdüstern, und er sah mit missmutigem Gesichtsausdruck zur Decke.
»Hat Pat Ryan Ihnen davon erzählt?«
»Ja. Es kam mir sehr … sehr spannend vor. Dass man damit Träume verändern kann.«
Sein Blick kehrte zu mir zurück. »Das glauben Sie aber auch nicht, oder?«
»Ich finde die Idee spannend«, wiederholte ich.
Wo um Himmels willen war ich da hineingeraten? Ich brauchte einfach nur ein paar Zitate darüber, wie Bryce Lermond in den heiligen Hallen des Hammel College Erleuchtung gefunden hatte, und jetzt sollte ich dem Typen Händchen halten.
Er nickte geistesabwesend, zupfte an seinem Bart und starrte vor sich hin. Ich wollte gerade das Schweigen brechen, als er sagte: »Würden Sie es ausprobieren?«
»Wie bitte?«
»Die App. Als Beta-Tester.«
»Bryce«, sagte Renee, aber er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Nein, nein. Er muss alles unterschreiben, die Verzichtserklärung, die Vertraulichkeitsvereinbarung und alles.«
»Nicht, wenn es in meine Geschichte soll«, sagte ich, während mein Reporterinstinkt erwachte. Gefälligkeits-Artikel hin oder her, ich würde keine Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben. Mein Job war es, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen.
Dann erinnerte ich mich daran, dass ich für ein Alumni-Magazin schrieb, das von Bryces gutem Willen abhängig war. Es ging nicht um Journalismus, sondern um Public Relations.
»Vergessen Sie’s«, sagte ich. »Ich unterschreibe, was nötig ist.«
Er wandte sich Renee zu. »Wir brauchen doch Beta-Tester.«
»Und wir haben ein Auswahlverfahren dafür«, sagte sie, erkennbar bemüht, nicht zu explodieren.
»Gibt es irgendeinen Grund, der gegen ihn spricht?«
Sie hätte ihm offensichtlich gern die Meinung gesagt, entschied sich aber dagegen. Stattdessen betrachtete sie mit plötzlichem Interesse ihre Fingernägel.
»Wollen Sie’s versuchen?«, fragte er mich. »Zwei Wochen. Jeden Tag. Meine einzige Bedingung ist, dass Sie den Prompts und der Benutzerführung folgen. Nicht einfach durchwischen. Das wäre keine gute Idee. Das Produkt ist für Mikrodosierung konzipiert.«
»Mikrodosierung? Ich dachte, das macht man mit LSD?«
Weder Bryce Lermond noch Renee lachten.
»Gleiches Konzept«, sagte er. »Deshalb haben wir eine Benutzerführung mit klaren Eingabeaufforderungen. Die grafischen Benutzeroberflächen sind noch nicht fertig, aber der Content ist da. Die geführten Meditationen, die Atemübungen, die Schlafgesänge.«
»Schlafgesänge?«
Er nickte, und ein Anflug von Begeisterung kehrte zurück. »Sie sind so cool«, sagte er. »So verdammt cool. Unsere Gehirne reagieren auf Gesang, wissen Sie. Geschichten und Gesang. Man verbindet beides und …« Er schlug mit Wucht seine Fäuste zusammen, um seinen wiedergefundenen Enthusiasmus auszudrücken, aber es sah aus wie ein schmerzhafter Frontalzusammenstoß.
»Wirkungsvoll«, sagte ich.
»Ja, wirkungsvoll. Darauf können Sie Gift nehmen! Wollen Sie es ausprobieren?«
»Sicher«, sagte ich. »Warum nicht?« Inzwischen wollte ich nur noch aus dem Büro rauskommen, ohne ihn zum Weinen gebracht zu haben.
»Großartig!«, sagte er und versetzte seinem Schreibtisch einen entzückten Faustschlag. Neben mir vertiefte sich Renee immer mehr in ihre Fingernägel. Es wirkte, als würde sie sie zum ersten Mal bemerken.
»Renee, er hatte doch ein Smartphone«, sagte Bryce. »Kannst du es mir bitte holen?«
»Wieso weiß hier jeder, dass ich ein Smartphone mitgebracht habe?«, fragte ich.
Er sah aus, als hätte ich ihn bei etwas Verbotenem erwischt. »Es ist ruhig hier drin, und die Klingel …«
»Ach, richtig. Verdammt zuverlässiger Sensor. Wird er vom Handysignal ausgelöst?«
»Genau. Echt cool. Brauchen wir das wirklich? Nein. Aber ich dachte, es ist echt cool.«
Echt cool. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich gerade eine Strickleiter hochgeklettert und in einem Baumhaus für Zwölfjährige gelandet.
»Wer stellt so was her?«
»Zu blöd, ich erinnere mich nicht mehr.« Er vollführte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir können die Beta-Version der App auf Ihr Smartphone laden, und Sie sagen uns, was Sie davon halten. Nur: Zeigen Sie die App niemandem. Einverstanden?«
»Ich werde Ihre App niemandem zeigen«, antwortete ich. »Das kann ich Ihnen versprechen.«
»Bitte schön«, sagte Bryce begeistert. »Wir haben einen Beta-Tester, Renee. Und noch dazu ist er ein alter Freund von dir. Bleibt alles in der Familie – na ja, fast. So machen wir’s!«
Er trommelte grinsend auf den Schreibtisch.
Renee holte tief Luft – sie sog den Atem durch die Nase ein und stieß ihn durch den Mund aus – und stand auf, um mein Smartphone zu holen und den Papierkram vorzubereiten, mit dem schriftlich festgehalten wurde, dass man mich direkt ins Jenseits klagen würde, wenn ich das Vertrauen von Clarity Inc. missbrauchte. Die Wiedersehensfreude, die ich unten am Eingang an ihr bemerkt hatte, war längst verflogen. Ihr war vermutlich klar, dass ihre Firma weit davon entfernt war, das nächste große Ding zu landen, und es war ihr peinlich, dass ein alter Freund das ebenfalls begriffen hatte.