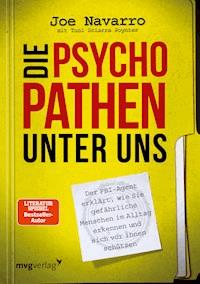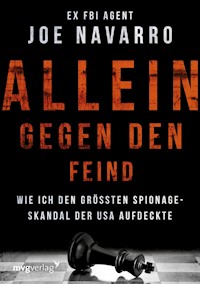18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was macht außergewöhnliche Menschen zu dem, was sie sind – einflussreich, effektiv, vorbildlich und führungsbegabt? Die Eigenschaften, die sie zu etwas Besonderem machen, haben nichts mit Bildung, Einkommen oder Talent zu tun. Joe Navarro, internationaler Bestsellerautor mit Millionenauflage, verbrachte ein Vierteljahrhundert beim FBI und führte mehr als 10 000 Gespräche mit Zeugen und Verdächtigen. Dank seiner lebenslangen Erfahrung in der Analyse von menschlichem Verhalten konnte Navarro fünf Prinzipien definieren, nach denen herausragende Persönlichkeiten leben: -Selbstdisziplin – denn wer andere führen möchte, muss zunächst sich selbst führen können. -Beobachtungsgabe – nur wer jede Situation schnell und genau einschätzen kann, kann auch sofort reagieren. -Kommunikation – wer verbale und nonverbale Interaktion beherrscht, kann überzeugen, motivieren und inspirieren. -Handeln – nur wer selbst Hand anlegt, kann als gutes Beispiel vorangehen. -Psychologisches Wohlbefinden – das besondere Geheimnis erfolgreicher Personen. Joe Navarro verwebt meisterhaft historische Biografien mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über nonverbale Kommunikation und Überzeugung und seine eigenen fesselnden Erfahrungen zu einem Rahmen, der jedem helfen kann, wirklich außergewöhnlich zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JOE NAVARRO
MIT TONI SCIARRA POYNTER
AUSSERGEWÖHNLICH
JOE NAVARRO
MIT TONI SCIARRA POYNTER
AUSSERGEWÖHNLICH
Ein FBI-Agent enthüllt die 5 Eigenschaften, die Menschen erfolgreich machen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2021
© 2021 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die englische Originalausgabe erschien 2021 bei William Morrow, einem Imprint der HarperCollins Publishers, LLC unter dem Titel Be Exceptional. © 2021 by Joe Navarro. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Elisabeth Liebl
Redaktion: Silke Panten
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: shutterstock/Foxstudio
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-475-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-904-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-905-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
In liebendem Gedenkenan meinen Vater Albert
Achte auf deine Gedanken – denn Gedanken werden Worte.
Achte auf deine Worte – denn aus Worten werden Taten.
Achte auf deine Taten – denn Taten werden zu Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten – denn Gewohnheiten bilden den Charakter.
Achte auf deinen Charakter – denn der Charakter bestimmt dein Schicksal.
Frei nach Laozi
Sei außergewöhnlich!
Inhalt
Bevor wir anfangen
Die fünf Grundpfeiler des Außergewöhnlichen
Kapitel 1 – Selbstdisziplin
Was ist Selbstdisziplin?
Das Selbststudium: Das Rüstzeug des Wissens erwerben
Emotionale Balance: Das Rüstzeug der Stabilität
Selbstdisziplin: Das Rüstzeug zum Erfolg
Ordnung und Prioritäten
Der Lohn der Selbstdisziplin
Selbststudium
Emotionale Ausgeglichenheit
Gewissenhaftigkeit
Ohne Schranken
Dämonologie
Selbstdisziplin
Ordnung und Prioritäten
Übung, Übung, Übung (Myelinisierung)
Beharrlichkeit
Kapitel 2 – Beobachtungsgabe
Beobachtung: Wie aus Informationen Einsichten werden
Eine angeborene Fähigkeit zurückerobern
Das limbische System und die Achtsamkeit
Situative Wahrnehmung: Beobachtung trifft auf Erfahrung
Schritte zu einem außergewöhnlichen Leben
Erleuchtetes Gewahrsein: Der Pfad zu außergewöhnlichem Verständnis
Neugier: Das Tor zum erleuchteten Gewahrsein
Die Beobachtung nonverbaler Signale
Übungen, um Ihre Beobachtungsgabe zu schärfen
Übung: Wie weit reicht Ihr Gesichtsfeld?
Übung: Scannen
Übung: Farbordnungsspiel
Übung: Beobachten, ohne zu sehen
Freundliche Beobachtung
Kapitel 3 – Kommunikation
Wir kommunizieren ständig
Zuwendung
Bestätigung
Rechtschaffenheit
Das Prinzip der Emotionen
Beziehungen aufbauen: Die Macht des Einklangs
Präsent sein
Zehn Möglichkeiten, mehr zu sagen, als mit Worten möglich ist
Die Methode des Heilers
Kapitel 4 – Handeln
Unsere Taten definieren, wer wir sind
Der ethische Aktionsplan
Bereit zu außergewöhnlichen Taten
Was heute Helden ausmacht
Kapitel 5 – Psychologisches Wohlbefinden
Psychologisches Wohlbefinden: ein Grundbedürfnis
Sich kümmern: Die Brücke zum psychologischen Wohlbefinden
Das empathische Modell sozialer Interaktion
Schlüsselfragen zur Einschätzung einer Situation
Wichtig für den richtigen Beziehungsaufbau
Wie man Ängste abbaut: Eine Pflicht, der außergewöhnliche Menschen sich gerne beugen
Zu guter Letzt
Danksagung
Bibliografie
Bevor wir anfangen
Denke nicht, dass das, was dir Schwierigkeiten bereitet, für Menschen nicht möglich ist. Und wenn es das Menschenmögliche ist, dann kannst auch du es schaffen.
Marcus Aurelius
Was macht einen außergewöhnlichen Menschen aus? Über diese Frage habe ich lange nachgedacht, und Sie vielleicht auch. Ich habe mich über 40 Jahre mit menschlichem Verhalten beschäftigt (davon 25 Jahre beim FBI, wo ich als eines der Gründungsmitglieder des National Security Behavioral Analysis Program, einer Eliteeinheit der Abteilung für Innere Sicherheit, mehr als 10 000 Gespräche mit Zeugen oder Verdächtigen führte; dazu kommen viele Jahre, die ausgefüllt waren von meiner Tätigkeit als Berater für zahlreiche Organisationen weltweit, sowie Recherchearbeiten für meine Bücher über Verhalten und Leistung), und in diesen Jahren hat nichts mich mehr fasziniert als jene Menschen, die außergewöhnliche Charakterzüge zeigen. Solche Personen geben einem das Gefühl, selbst etwas Besonderes zu sein. Ihre Güte, ihre Fürsorge nimmt einen sofort für sie ein. Sie strahlen eine unglaubliche Energie aus, die aus Weisheit und Empathie erwächst. Wenn man sich wieder von ihnen verabschiedet, fühlt man sich stets besser als vor der Begegnung mit ihnen. Und man wünscht sich inständig, sie zum Freund zu haben, zum Nachbarn, Kollegen oder Mentor. Und natürlich wünscht man sich solche Menschen als Lehrer, Vorgesetzte, Vereinsvorstände oder Politiker.
Was aber macht sie zu dem, was sie sind – nämlich einflussreich, effektiv, vorbildlich und führungsbegabt? Die Eigenschaften, die sie zu etwas ganz Besonderem machen, haben nichts mit Bildung, Einkommen oder Talenten zu tun – ob nun im Sport, in der Kunst oder im Geschäftsleben. Nein, was diese Menschen außergewöhnlich macht, ist eine Eigenschaft, die wirklich zählt: Sie scheinen immer zu wissen, was sie sagen und tun müssen, um das Vertrauen bzw. die Achtung anderer Menschen zu gewinnen, um selbst noch die Ausgelaugtesten unter ihnen mit neuer Kraft zu erfüllen und zu inspirieren.
Meine Recherchearbeiten für dieses Buch begannen – eher unabsichtlich – vor mehr als zehn Jahren, als ich an meinem Buch Die Psychopathen unter uns arbeitete. Darin untersuchte ich die Eigenschaften von Menschen, die sich und andere enttäuschen, weil sie sich unmöglich verhalten, unkluge Entscheidungen treffen, falsche Prioritäten setzen, ihre Emotionen nicht im Griff haben oder einfach, weil sie sich keinen Deut für andere Menschen interessieren.
Es war ein seltener Glücksfall, dass ich, als ich die charakterlichen Merkmale von Psychopathen untersuchte, auf jene Qualitäten stieß, die deren Gegenstück auszeichnen: die Eigenschaften jener Menschen nämlich, die ihr Leben und das ihrer Mitmenschen einfach besser machen. Jene eindeutige Erkenntnis sowie die Abertausend Beobachtungen, die ich bei meiner Tätigkeit fürs FBI und als Berater machte, fanden schließlich ihren Weg in dieses Buch.
Was also macht Menschen außergewöhnlich? Tatsächlich sind es nur fünf Charakterzüge, durch die sich diese bemerkenswerten Individuen von anderen Menschen unterscheiden. Nur fünf, aber dafür höchst durchschlagende Qualitäten. Ich nenne sie die fünf Grundpfeiler des Außergewöhnlichen.
Die fünf Grundpfeiler des Außergewöhnlichen
Selbstdisziplin: Das Herzstück dessen, außergewöhnlich zu sein
Wir legen die Fundamente für ein Leben als außergewöhnliche Menschen, indem wir unser Studium selbst in die Hand nehmen, uns durch ehrliche Selbsterforschung besser verstehen lernen und grundlegende Gewohnheiten entwickeln, die zu persönlicher Leistungsfähigkeit führen.
Beobachtungsgabe: Sehen, was zählt
Indem wir lernen, die Bedürfnisse, Vorlieben, Absichten und Wünsche anderer Menschen, aber auch ihre Ängste und Sorgen besser zu erkennen, werden wir fähig, Menschen und Situationen schnell und korrekt einzuschätzen. Das gibt uns die nötige Klarheit, um auf die beste, wirkungsvollste und angemessenste Weise zu handeln.
Kommunikation: Von der Information zur Transformation
Unsere verbalen und nonverbalen Ausdrucksmittel erlauben uns, unsere Gedanken so zu artikulieren, dass sie auf bestmögliche Weise sagen, was wir wollen; dass sie Herz und Geist anderer Menschen ansprechen und Bande knüpfen, die auf Vertrauen, Loyalität und sozialer Harmonie beruhen.
Handeln: Rechtzeitig, ethisch und sozial
Wenn wir um die ethischen und sozialen Aspekte des richtigen Handelns wissen, können wir lernen, das Rechte zur rechten Zeit zu tun, wie außergewöhnliche Menschen das machen.
Psychologisches Wohlbefinden: Die größte Stärke, die der Mensch besitzt
Sobald wir die grundlegende Wahrheit erkannt haben, dass der Mensch stets nach Geborgenheit strebt, haben wir erkannt, was alle außergewöhnlichen Menschen ohnehin wissen: Am Ende ist immer der erfolgreich, der anderen Menschen durch mitfühlende Zuwendung ebendieses Wohlbefinden vermittelt.
In den folgenden Kapiteln werde ich praxiserprobte Erkenntnisse, Fallgeschichten und Anekdoten aus meiner langjährigen Erfahrung in Verhaltensanalyse und Unternehmensberatung mit Ihnen teilen, um Ihnen diese fünf Grundpfeiler nahezubringen. Anhand von Beispielen, die ebenso der Geschichte wie der Gegenwart und unserem Alltagsleben entnommen sind, werde ich Ihnen erläutern, wie Sie mithilfe dieser fünf Grundpfeiler Ihr Leben verbessern und sich von anderen abheben können. Vor allem aber werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mitmenschen auf Ihrem Weg zu einem empathischeren und ethischeren Leben positiv beeinflussen können – einem Leben, das für außergewöhnliche Menschen ganz selbstverständlich Alltag ist.
Das Außergewöhnliche lernen – das funktioniert letztlich nur, wenn wir uns von außergewöhnlichen Menschen beeinflussen lassen, die uns Tag für Tag vor Augen führen, dass man, um außergewöhnlich zu sein, Außergewöhnliches tun muss. Diese fünf lebensverändernden Eigenschaften sind alles, was Sie brauchen, um selbst ein außergewöhnlicher Mensch zu werden. Sobald Sie damit beginnen, diese Eigenschaften in Ihren Alltag zu integrieren, werden Sie ihre Wirkung spüren. Sie werden eher fähig sein, andere positiv zu beeinflussen, und Sie werden zweifellos zu einem besseren Menschen werden – und zu einer erfolgreicheren Führungspersönlichkeit, die nicht nur dann Führung bieten kann, wenn die Umstände günstig sind, sondern die sich dauerhaft als der Führung würdig erweist.
Also begleiten Sie mich auf dieser Entdeckungsreise zu dem, was wir sind und was wir sein können. Lassen Sie uns diesen speziellen Bereich erkunden, der jenen Menschen gehört, die wir für ehrenhaft, vertrauenswürdig, entschlossen und unerschütterlich halten. Menschen eben, die außergewöhnlich sind.
KAPITEL 1
Selbstdisziplin
Das Herzstück dessen, außergewöhnlich zu sein
Wir legen die Fundamente für ein Leben als außergewöhnliche Menschen, indem wir unser Studium selbst in die Hand nehmen, uns durch ehrliche Selbsterforschung besser verstehen lernen und grundlegende Gewohnheiten entwickeln, die zu persönlicher Leistungsfähigkeit führen.
Jeder will die Menschheit verbessern, aber niemand denkt daran, sich selbst zu verändern.
Leo Tolstoi
Eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich als Leiter eines SWAT-Teams zu treffen hatte, wurde mir vor dem eigentlichen Einsatz abverlangt.
Als Kommandant einer Spezialeinheit ist man für den Einsatzplan verantwortlich und für seine kompetente und sichere Umsetzung. Sobald man für eine Operation grünes Licht hat und voll gerüstet ist mit geladener, wenn auch gesicherter Waffe, sobald man »I have control« sagt – in der Pilotensprache das Signal, dass man am Steuer ist –, verlassen sich eine Menge Menschen darauf, dass man mit dem Kopf ganz bei der Sache ist. Das erwarten die Öffentlichkeit, die Vorgesetzten und natürlich die Mitglieder des SWAT-Teams: Die eigenen Gedanken müssen glasklar sein und so scharf wie ein Laserstrahl, da sowohl die persönliche Sicherheit aller Beteiligten als auch der Erfolg der Operation davon abhängt.
Die Ereignisse überschlugen sich bei dieser Operation – ein bewaffneter Flüchtiger hatte seine Freundin als Geisel genommen und sich in einem heruntergekommenen Motel in den Außenbezirken von Haines City in Florida verschanzt. Er schwor, sich nicht lebendig zu ergeben. Bei Geiselnahmen sind es im Normalfall die Verhandlungsführer, die bei solchen Operationen das Sagen haben. Hier aber brauchte die Geisel dringend medizinische Hilfe, von der ihr Leben abhing. Es war also keine Zeit mehr zu verlieren, was die Atmosphäre noch mehr aufheizte, und der Flüchtige zeigte sich zu keiner Kooperation bereit. Das Letzte, was ich in dieser Situation brauchte, war, dass einer der Einsatzkräfte seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Und der Mann, den ich diesbezüglich speziell im Blick hatte, war nicht so bei der Sache wie sonst. Seine Fragen kamen zu langsam, er klärte die entscheidenden Details nicht mit der üblichen Schnelligkeit. Normalerweise würde er gezielt bestimmte Punkte ansprechen: wie das Gebäude lag (um zu checken, wo ein eventueller Querschläger landen konnte); ob die Tür zum fraglichen Raum nach innen oder außen aufging (was wichtig war, um zu klären, wie wir die Tür aufbrechen und welche Werkzeuge wir dafür brauchen würden); wie nahe wir einen Rettungswagen heranbringen konnten, ohne dass er gesehen wurde; wo die nächste Unfallklinik lag. Und so weiter. Doch all diese Fragen blieben ungestellt. Es war völlig klar, dass er nicht voll konzentriert war. Schließlich sagte ich mir: »Du musst das ansprechen, und zwar schnell.« Es war nicht genug Zeit, um erst lange Ursachenforschung zu betreiben. Ich wusste einfach, dass irgendetwas Merkwürdiges in ihm vorging, und ich musste darauf reagieren.
Meine Vorgesetzten hatten im Eifer des Gefechts davon nichts bemerkt, denn sie waren vollauf mit anderen Dingen beschäftigt – Abstimmung mit dem Hauptquartier des FBI, Änderungen in letzter Minute, die örtlichen Polizeibehörden informieren –, obwohl wir im gleichen Raum waren. Ich aber war der Leiter des Einsatzkommandos, ich konnte das nicht einfach ignorieren. Der SWAT-Operator war einfach nicht er selbst. Das war jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um irgendwelche persönlichen Probleme zu wälzen – vielleicht würde keiner was bemerken, solange ich den Mund hielt und die Operation glattlief. Aber ich hatte nun mal bemerkt, dass der Mann nicht er selbst war, und ich musste reagieren. Ich konnte nicht zulassen, dass einer aus dem Einsatzteam seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Nicht bei einer Operation, bei der es in einer städtischen Umgebung höchstwahrscheinlich zu einem Schusswechsel kommen würde und schnelle Entscheidungen getroffen werden mussten. Als Führungskraft kann man andere nicht einem Risiko aussetzen, das leicht hätte vermieden werden können. Dabei ist es völlig nebensächlich, ob der Betreffende unbedingt Teil dieser Operation sein wollte oder – wie in diesem Fall – eine entscheidende Rolle spielte bei der Planung einer komplexen Operation, bei der es darum ging, einen Flüchtigen festzunehmen und eine junge Frau zu retten, die laut Aussage ihrer Familie gegen ihren Willen festgehalten wurde.
Also ging ich zu dem FBI-Beamten, der das Oberkommando über diese Operation hatte. Er informierte gerade das Hauptquartier über die aktuelle Lage. Ich sprach ihn an: »Ich möchte, dass einer unserer Einsatzkräfte aus der Planung herausgenommen wird.« In dem Moment, als ich das sagte, wurde mir bewusst, dass ich in meinen 20 Jahren beim SWAT-Team noch nie eine solche Situation erlebt hatte.
»Sie tun, was Sie für das Beste erachten«, sagte er, und damit war die Sache entschieden. Er vertraute mir, er kannte mich seit Jahren. Dann spürte er vermutlich, dass ich noch mehr zu sagen hatte, denn er nickte mir zu. In diesem Moment sagte ich: »Ich bin derjenige, der aus dieser Operation herausgenommen werden muss, Sir.«
Anfangs starrte er mich eine Sekunde lang nur an, wie um sich zu vergewissern, dass er sich nicht verhört hatte. Er legte die Hand übers Telefon und ließ Washington warten. Er ließ seinen Blick über mein Gesicht wandern. In diesem Augenblick wurde ihm vermutlich klar, was ich an jenem Tag schon alles mitgemacht hatte.
Er hakte nach, ob ich mir sicher sei. Ich sagte Ja. »Tun Sie, was Sie für richtig halten. Tun Sie, was Ihnen als das Beste erscheint«, wiederholte er, ohne zu zögern. »Ich vertraue Ihrem Urteil.«
Und so nahm ich mich ganz aus einer wichtigen SWAT-Operation heraus. Das war keine einfache Entscheidung, denn mein Stellvertreter musste nun meine Rolle übernehmen. Und ich wusste, dass einige aus dem SWAT-Team sich jetzt fragten, was da los war. Trotz alledem war es das, was nötig war. Und als Leiter des Einsatzkommandos war es meine Pflicht gewesen, diese Entscheidung zu treffen.
Die Operation verlief ohne Zwischenfall. Niemand wurde verletzt.
Was war mit mir los gewesen? Nach einigen Momenten der Introspektion kam an die Oberfläche, was mir eigentlich sofort hätte klar sein sollen. Meine Großmutter war erst eine Woche zuvor gestorben, und dieser schwere Verlust belastete mich immer noch. Ich trauerte, ich spürte immer noch diesen Schmerz – obwohl ich gedacht hatte, dass ich damit schon zurechtkommen würde. Auf andere wirkte ich vielleicht ein wenig stoischer als üblich, machte weniger Witze. Aber wenn wir voll gefordert sind, übersehen wir manchmal, was andere emotional gerade durchleben. Meine Gefühle beeinträchtigten meine gedankliche Schärfe. Glücklicherweise hatte ich das noch rechtzeitig bemerkt.
Und der FBI-Beamte, der die Operation leitete, hatte einen wichtigen Punkt angesprochen: »Tun Sie, was Sie für das Beste halten.« Wie aber finden wir heraus, was das Beste ist? Und wie setzen wir es dann um? Das alles beginnt mit der Kunst der Selbstbeherrschung.
Was ist Selbstdisziplin?
Häufig ist die Rede von einer Disziplin, die wir beherrschen. Damit sind letztlich bestimmte Fähigkeiten gemeint. Zu etwas fähig zu sein heißt, dass wir beispielsweise eine Geige von der Qualität einer Stradivari bauen oder eine wunderbare Statue aus einem Holzklotz schnitzen können. Diese Art von Disziplin ist hier jedoch nicht gemeint.
Um in etwas richtig gut zu werden, müssen Sie sich dieser Sache widmen, wie groß die Herausforderung auch immer sein mag. Der entscheidende Punkt dabei ist aber die Kunst der Selbstdisziplin: Konzentration, Hingabe, Fleiß, Neugier, Anpassungsfähigkeit, Selbstwahrnehmung und Entschlossenheit. Und das sind nur einige der Eigenschaften, die zur Selbstdisziplin gehören.
Ich fange mit der Kunst der Selbstdisziplin an, weil sie das Fundament abgibt für die anderen vier Grundpfeiler, die außergewöhnliche Menschen zu etwas Besonderem machen. Das Schöne an der Selbstdisziplin ist, dass sie keineswegs unmöglich ist. Wir können unser Gehirn so umprogrammieren, dass wir alle großen und kleinen Aufgaben im Alltag als bessere Version unser selbst angehen können.
Wenn, wie ich glaube, unser Leben von unserem Denken und Fühlen bestimmt wird – von unseren geistigen Einstellungen und Haltungen, von den Kenntnissen, die wir erworben haben, von den Dingen, die wir Tag für Tag tun –, dann können wir ohne Selbstdisziplin unser volles Potenzial nicht ausleben.
Selbstdisziplin allein bezwingt keine Berge, aber fehlt sie, werden Sie den Aufstieg nie schaffen. Usain Bolt, der schnellste Mensch, der je gelebt hat, verdankt seine Leistung nicht allein seiner sportlichen Begabung. Er hat sie vielmehr durch Selbstdisziplin erbracht: Er lernte, er brachte Opfer, er trainierte fleißig und blieb dabei ständig voll konzentriert. Und dasselbe gilt auch für Michael Jordan, den größten Basketballspieler aller Zeiten. Das sind die notwendigen Voraussetzungen, um jenes Elite-Niveau zu erreichen, das außergewöhnliche Menschen auszeichnet.
Aber zur Selbstdisziplin gehört auch, dass wir uns über unsere Emotionen im Klaren sind, über unsere Stärken und – noch wichtiger – über unsere Schwächen. Wenn wir uns selbst kennen, wissen wir, wann wir besser das Heft aus der Hand geben, weil das einfach nicht unser Tag ist (wie das bei mir bei jener Geiselbefreiung der Fall war), weil wir eine Dosis Demut brauchen. Weil wir uns unseren Dämonen stellen müssen oder mit anderen Mitteln die Kraft unseres besseren Selbst aufrufen. Und genau das ist es, was Selbstdisziplin uns ermöglicht – eine bewusste und ehrliche Selbsteinschätzung, die uns dazu bringt, uns noch mehr anzustrengen und jene feinsten Nuancen des Gewahrseins zu registrieren, die den Unterschied zwischen Versagen und Erfolg ausmachen.
In diesem Kapitel werden wir uns mit der Frage befassen, wie Sie Ihr Leben in den Griff bekommen, indem Sie tägliche Gewohnheiten und Verhaltensweisen einüben und sich darauf konzentrieren, wie Sie die Stufen zur Selbstdisziplin der Reihe nach erklimmen können. Den Abschluss bildet ein Fragenkatalog, der Ihnen hilft, sich selbst einzuschätzen und den Weg hin zu dieser ganz entscheidenden Eigenschaft zu meistern. Sie möchten Ihr volles Potenzial entfalten, mehr Einfluss haben und sich als Marke unverwechselbar machen? Dann müssen Sie die Kunst der Selbstdisziplin erlernen.
Das Selbststudium: Das Rüstzeug des Wissens erwerben
Irgendwann während meiner Highschool-Zeit hatte ich eine ernüchternde Erkenntnis, die mir keineswegs von anderen vermittelt wurde. Niemand hatte sich mit mir hingesetzt und mir diese Dinge erklärt. Es war eher eine sehr private Unterhaltung mit mir selbst, im Laufe derer mein jugendlicher Verstand einsah, dass sich etwas ändern musste.
Mit acht Jahren war ich nach der Revolution in Kuba in die Vereinigten Staaten geflohen, was sich bald als echtes Problem herausstellte. Ich sprach kein Wort Englisch. Ich verstand dieses neue Umfeld mit seinen ungewohnten Regeln, Gepflogenheiten und Normen nicht. Ich war total verwirrt und hinkte überall hinterher. Diese neue Welt war mir immer mehrere Schritte voraus. Darüber hinaus waren wir ohne einen Cent nach Amerika gekommen. (Dafür hatten die kubanischen Soldaten am Flughafen gesorgt.) Nach der gewaltsamen kommunistischen Revolution waren wir zutiefst traumatisiert. Ich musste mich also meiner neuen Umgebung anpassen. Aber das Einzige, was ich mit den amerikanischen Kindern in meinem Alter gemein hatte, war, dass ich gerne lernte und Sport liebte. Meine Altersgenossen sprachen kein Spanisch und ich kein Englisch. Sie hatten keine verdammte Revolution hinter sich. Sie hatten nicht wie ich während der Invasion in der Schweinebucht draußen auf der Straße gestanden. Sie hatten nicht stundenlang die Schüsse an der paredón (Mauer) gehört, vor der die Revolutionäre einfache Bürger aufstellten, um sie zu erschießen, weil sie gegen Fidel Castro waren. Die amerikanischen Kinder kannten Tinkerbell, Bugs Bunny, Road Runner, Disneyland und den Mickey Mouse Club. Für mich hatten diese Namen keine Bedeutung. Ich war gewohnt, in der Schule eine Uniform zu tragen. Die Kids hier hatten Jeans und T-Shirts an. In meiner alten Heimat wurden wir den ganzen Tag lang nur von einem Lehrer unterrichtet. Hier wanderten wir alle 55 Minuten von einem Klassenzimmer zum anderen. Warum das so war, wurde mir nie ganz klar. Ich kannte die Baseballregeln, einen Basketball hatte ich dagegen noch nie gesehen. Ich fand Völkerball toll, aber ich hasste es, wenn der Lehrer mich an die Tafel holte, um eine Matheaufgabe zu lösen.
Das war der klassische Kulturschock, wie der Futurologe Alvin Toffler ihn definiert hatte. Ich gab mir Mühe, all die neuen sozialen Regeln zu erlernen, die hier galten: Man plauderte nicht, wenn man gemeinsam irgendwo in der Schlange stand. Man hielt sich an der Hand, wenn man die Straße überquerte, aber sonst gab es keinerlei Körperkontakt. Man durfte anderen nicht zu nah kommen, nicht herumgestikulieren und nicht zu laut reden. Wenn man aufs Klo musste, hob man die rechte Hand und fragte. Und wenn der Lehrer einen rügte, sah man ihm direkt in die Augen. (Das war ganz das Gegenteil von dem, was ich auf Kuba gelernt hatte. Dort senkte man den Blick, vermied jeden Augenkontakt und bemühte sich um eine zerknirschte Miene.) Eine gewaltige Menge Unterschiede, die ich alle erlernen musste, wenn ich mich anpassen wollte. Und dann war da ja noch der Lernstoff. Während der Revolution war der Schulbesuch nicht sicher und der Schulweg furchterregend, also war ich beim Stoff ohnehin schon hinterher, als wir Kuba verließen. Und nun begriff ich nicht ein Wort von dem, was der Lehrer sagte, einfach weil er Englisch sprach.
Aus reiner Sturheit und schierer Notwendigkeit schaffte ich es irgendwie, innerhalb eines Jahres fließend Englisch zu sprechen. Es geht nichts über Kontakte mit anderen Menschen, wenn man eine Sprache erlernen will. Man hatte mich eine Klasse zurückgestuft, damit ich den Stoff wiederholen konnte. In diesem einen Jahr schaffte ich zwei Klassen auf einmal. Aber das war nur der Anfang.
Da war immer noch die Sache mit meinem Akzent. Ich musste mich mächtig anstrengen, um ihn abzulegen, denn eines war mir schnell klar: Wer in Amerika mit Akzent spricht, fällt auf, und ich wollte doch unbedingt dazugehören. Schließlich hatte ich keinen Akzent mehr, aber eines blieb mir: Die Wirklichkeit um mich herum bestand aus lauter Dingen, die meine Klassenkameraden kannten und ich nicht – all das, was wir von Kindesbeinen an lernen, auf dem Spielplatz, beim Fernsehen, beim Besuch der gleichen Schulen und durch Jahre der Sozialisierung in einer bestimmten Kultur.
Ich kannte zum Beispiel keine Abzählreime, keine Lieder, die man auf dem Spielplatz sang. Wir hatten gut ein Jahr lang kein Radio und keinen Fernseher zu Hause, und so war das einzige Lied, das ich lernte, die Nationalhymne der USA, die wir jeden Morgen in der Schule sangen.
Als ich in die Highschool kam, hatten meine Mitschüler Shakespeare längst gelesen. Ich aber kannte Miguel de Cervantes. Sie lasen Steinbeck, ich Federico García Lorca. Sie kannten Bob Hope, ich den Komiker Cantinflas. Ich wusste die Namen aller Inseln in der Karibik, sie hatten keine Ahnung, wo der Golf von Mexiko lag. Die Kommunisten in Kuba hatten uns Begriffe eingetrichtert wie »Proletariat« oder »Bourgeoisie«. Meine Schulkameraden glaubten, ich würde mir all diese Wörter nur ausdenken. Ich hingegen wusste nicht, was ein Blue-Collar-Worker, also ein Fabrikarbeiter war.
Lange Zeit bildete ich mir fälschlicherweise ein, die anderen Kinder seien einfach klüger als ich. Erst mit der Zeit bekam ich mit, dass sie nicht intelligenter waren. Sie kannten einfach nur viele Dinge besser als ich, weil sie damit regelmäßig zu tun hatten. Es störte mich, dass ich so vieles verpasst hatte. Und ich merkte: Bei dem Tempo, das wir in der Schule vorlegten, würde sich das auch so schnell nicht ändern.
Schnell wurde mir klar, dass ich in der Schule nur lernte, was auf dem Lehrplan stand. Sie brachte mir nicht bei, was mir fehlte oder was ich unbedingt lernen wollte – und das war mehr, als das Schulsystem im Dade County mir bieten konnte. Ich wollte mich nicht in Selbstmitleid suhlen und wusste irgendwie, dass ich die Dinge selbst in die Hand nehmen musste. Ich musste mich meiner persönlichen Wirklichkeit stellen. Und so steckte ich schon als Teenager die Umrisse für mein persönliches Selbststudium ab.
Nehmen Sie sich nun einen Moment lang Zeit, um darüber nachzudenken, was außergewöhnliche Menschen, ob sie Ihnen nun persönlich oder nur aus den Medien bekannt sind, auszeichnet. Wer würde die atemberaubende Sportlichkeit der Turnerin und Rekord-Goldmedaillengewinnerin Simone Biles oder der Basketballlegende Michael Jordan nicht bewundern? Oder das Investmentgenie Warren Buffett, auch bekannt als das Orakel von Omaha? Wäre es nicht toll, zu den großartigen Gesangskünstlern zu gehören wie Frank Sinatra oder Adele, deren Stimmen dir schlicht das Herz brechen können? All diese Menschen sind auf ihre ganz besondere Weise einzigartig. Aber was ist mit uns? Ich werde nie ein Spitzensportler werden oder an der Spitze eines Multi-Millionen-Dollar-Unternehmens stehen. Meine Gesangskünste bewegen nur schlafende Tiere, und zwar zur Flucht. Aber wir können auf andere Weise außergewöhnlich sein. Wir können in dem Geschäft gut werden, in dem wir alle tätig sind: im Umgang mit Menschen. Wie können wir hierin Meister werden und wahrhaft Außergewöhnliches vollbringen?
Indem wir uns selbst bilden: Wir investieren in unser Wissen, unser Wachstum und unser Potenzial, wie alle großen Menschen dies getan haben.
Manche Menschen finden es einfacher, andere wertzuschätzen und sich um sie zu kümmern. Doch so wie wir andere unterstützen können, eine bessere Version ihrer selbst zu werden, müssen wir uns auch dieser Verantwortung uns selbst gegenüberstellen. Sobald Sie akzeptieren, dass die beste Möglichkeit zur Selbstwertschätzung darin besteht, dass Sie mit Eifer daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden, sind Sie auf dem besten Weg, auch ein außergewöhnlicher Mensch zu werden.
Wann immer ich von Menschen lese, die mit über 80 Jahren noch einen Universitätsabschluss machen oder von Giuseppe Paternò, der mit 96 Jahren seinen Collegeabschluss nachholte, weiß ich, dass ich es hier mit jemandem zu tun habe, dessen ursprüngliche Pläne möglicherweise durch Arbeit, Verpflichtungen oder schlicht widrige Umstände durchkreuzt wurden, der aber trotzdem am Ball blieb. Solche Menschen investieren in ihre Ausbildung, weil sie sich selbst zu schätzen wissen. Und das ist ein ganz wunderbares Beispiel für uns alle.
Es ist nie zu spät, sich selbst am Riemen zu reißen und sich um die volle Entfaltung des eigenen Potenzials zu bemühen, um jene Charakterzüge und Verhaltensweisen zu entwickeln, die außergewöhnlichen Menschen eigen sind. Wenn Sie das tun, werden Sie nicht nur ein besseres, erfüllteres Leben führen. Sie werden, wenn es an der Zeit ist, nicht nur zur Führungspersönlichkeit heranreifen. Sie werden vielmehr würdig sein, solch eine Rolle zu übernehmen.
Es heißt ja immer wieder, wir sollten uns Mentoren suchen – bewundernswerte Individuen, die uns auf dem Pfad anleiten, der uns zu unseren Zielen führt. Solch ein Mentor ist eine tolle Sache. Nur findet man sie gar nicht so leicht, und wenn, dann haben sie häufig nicht genug Zeit für uns.
Um außergewöhnlich zu werden und vollkommene Selbstdisziplin zu erlangen, müssen wir uns meiner Ansicht nach selbst ein Mentor sein und die Verantwortung für unsere Ausbildung übernehmen.
Die Geschichte liefert uns hier ein wunderbares Vorbild: die Renaissance, jene dynamische Zeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert, in der Wissenschaften und Künste in Europa aufblühten. Um ein Handwerk zu lernen, schlossen sich junge Männer wie Michelangelo (der später die berühmten Fresken der Sixtinischen Kapelle schaffen sollte) den Besten ihres Faches an. In Michelangelos Fall waren dies Maler und Bildhauer. Die Zünfte brachten die besten Maler, Bildhauer, Zeichner, Kalligrafen, Farbenspezialisten, Töpfer, Architekten, Holzbildhauer, Gießer, Goldschmiede und so weiter zusammen.
Studienaufenthalte waren keineswegs Ferienlager. Die Lehrlinge hatten prall gefüllte Stundenpläne. Ihr Tag war angefüllt mit disziplinierter Konzentration auf ihre jeweilige Aufgabe. Viele lernten ihr Handwerk schon sehr jung. Sie verdienten sich Kost und Logis durch ihre Arbeit, während sie gleichzeitig die für ihr Metier nötigen Fähigkeiten erwarben. Sie wussten schon in jungen Jahren, dass sie für ihr Leben und ihre Arbeit selbst verantwortlich waren. Mit der Zeit vervollkommneten sie ihre Gaben, erwarben Erfahrung und entwickelten einen eigenen Stil. Die harte Lehrzeit stählte sie und zog eine neue Generation von Meistern heran, deren Kunstfertigkeit wir noch heute bewundern.
Das Konzept einer so schwierigen formellen Lehrzeit wird heute so nicht mehr gepflegt, von einigen wenigen Berufen einmal abgesehen. Ärzte brauchen heute eine Ausbildung, die in manchen Fachgebieten 12 bis 16 Jahre dauert, bis sie die komplexen Prozesse der Diagnose und Heilung menschlicher Krankheiten beherrschen. Eine meiner Lektorinnen erzählte mir einmal, ihr Weg in der Verlagswelt hätte mindestens ebenso lange gedauert: zuerst das Studium, dann der Blick über die Schulter der älteren Lektoren, die Buchprojekte kauften und ihnen ihren Stempel aufdrückten, bis sie schließlich nach Jahren selbst solche Projekte bearbeiten durfte. Natürlich durchlaufen Klempner und Elektriker immer noch eine Lehre, aber diese dauert gewöhnlich nicht so lange und konzentriert sich auf ein eng begrenztes Spektrum zu erwerbender Fähigkeiten.
Wenn Sie sich aber einmal gründlich mit außergewöhnlichen Menschen beschäftigen, werden Sie schnell merken, dass diese ihre Lehrzeit selbst gestaltet haben. Freilich müssen auch sie Hilfe suchen und das Fachwissen anderer Menschen zurate ziehen, aber sie übernehmen aktiv Verantwortung für ihren Weg zur Selbstverbesserung. Sie wissen, was uns niemand je lehrt: dass wir, um außergewöhnlich sein zu können, uns selbst in die Lehre begeben müssen.
Dieses Selbststudium kann unzählige verschiedene Formen annehmen – manche offiziell und förmlich, andere eher zwanglos. Manche dieser Wege werden aus schierer Notwendigkeit eingeschlagen, andere aus lodernder Leidenschaft. Und in jedem einzelnen Fall finden diese Menschen ihren Weg, durch Geduld und Willenskraft, durch Versuch und Irrtum, durch harte Arbeit neben anderen Verpflichtungen, zwischen zwei Arbeitsstellen oder gar abends nach der beruflichen Tätigkeit.
Ich, der ich mich seit jeher für das menschliche Verhalten interessierte, fing bereits als Jugendlicher an, ein Tagebuch über Verhaltensweisen zu führen, die ich nicht verstand. Mit der Zeit lernte ich, durch eigene Erfahrungen und Nachforschungen diese Verhaltensweisen zu verstehen. Das machte mich zu einem besseren Beobachter. Etwa um die gleiche Zeit machte ich, noch vor meinem Highschool-Abschluss, den Pilotenschein. Warum ich all das tat? Darauf weiß ich keine andere Antwort als die, dass ich einfach unglaublich neugierig war. Ich glaubte, dass all diese Aktivitäten mir später im Leben zugutekommen würden, und das taten sie tatsächlich. Aber das wusste ich damals noch nicht. Das grundlegende Studium menschlicher Verhaltensweisen, das ich als 15-Jähriger begann, rettete mir in meiner Zeit beim FBI so manches Mal das Leben, wenn ich mit Kriminellen zu tun hatte. Und der Pilotenschein erlaubte mir, meinen Dienst bei der Luftüberwachung von Terroristen zu leisten. Als Junge wusste ich nicht, dass beides Teil meiner Zukunft sein würde. Aber mein Selbststudienprogramm kam mir noch Jahre später zugute.
In jedem einzelnen Fall, den ich studierte, machten außergewöhnliche Menschen es sich zur Gewohnheit, sich Zeit für die Arbeit an sich selbst zu nehmen. Der Drang, besser zu werden, zu lernen und sich mehr Erfahrung anzueignen, war in ihren Augen ein lohnendes, ja unverzichtbares Unterfangen.
Mary Temple Grandin ist berühmt für ihren zutiefst menschlichen Umgang mit Tieren, vor allem solchen, die zum Schlachthof gebracht werden. Dabei stellte man bei ihr schon in jungen Jahren eine Autismus-Spektrum-Störung fest. Heute versteht man diese spezielle Veranlagung besser, in den 1950er-Jahren hingegen blieb diesen Menschen eine Ausbildung meist verwehrt. Gar ein Studium traute man ihnen schlicht nicht zu. Gewöhnlich übten sie nur niedrige Arbeiten aus.
Grandin hingegen entwickelte ihr eigenes Studienprogramm, das auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten war, aber vor allem die ganze Breite ihrer vielfältigen Interessen abdecken sollte. Sie brachte sich die Dinge so bei, wie sie unterrichtet werden wollte, auf ihre ganz persönliche Weise, in ihrer ureigensten Lerngeschwindigkeit. So machte sie zuerst ihren Master, dann den Doktor. Aber Grandin wollte noch mehr, und dafür musste sie das Klassenzimmer hinter sich lassen. Sie hatte eine Vision von dem, was sie für sich wollte, und eignete sich an, was sie dafür brauchte. Sie entwickelte ein eigenes Lernprogramm, das ihr half, das Verhalten und die Physiologie von Tieren zu studieren. Sie beschäftigte sich mit dem Autismus, damit sie ihre eigenen Bedürfnisse besser verstand. Das half ihr auch, andere Wesen besser zu begreifen. Sie studierte Psychologie, unter anderem die Auswirkung, die Farben auf Mensch und Tier haben. Sie lernte technisches Zeichnen und setzte sich mit Ingenieurwissenschaften auseinander, weil sie den Tieren bessere Haltungsbedingungen verschaffen wollte. Ihre Beobachtungsgabe half ihr zu erkennen, wo die Probleme lagen, wann immer sie einen Hof betrat, auf dem Tiere zum Schlachter geführt wurden. Sie wurde sich selbst zur Mentorin, und dieser Prozess hörte niemals auf. Sie übertraf sich immer wieder selbst, weil sie andere Menschen beeinflussen wollte. Und sie führte ihre Studien fort: auf dem Gebiet des Marketings, des Social Engineering, der Verkaufstechnik, der Pressearbeit, der Verhandlungsführung, der Markenbildung und so weiter.
Im Laufe ihres Lebens ging Grandin nicht bei einem Mentor oder einer bestimmten Denkschule in die Lehre, sondern einzig bei sich selbst. Sie bahnte sich ihren eigenen Pfad, wie das viele außergewöhnliche Menschen tun – ganz egal, wie viele Hürden sich vor ihnen auftun mögen. Und so wurde sie nicht nur zur Vorkämpferin für die bessere Behandlung von Schlachttieren, sondern auch zur Expertin für Autismusformen.
Mehr als 200 Jahre, bevor Grandin sich ihre eigene Nische schuf, begab sich ein Junge in Boston auf seinen Weg zu Wissen und Einfluss. Lange bevor sein Land zu einer Nation zusammenwuchs, zeigte Amerikas berühmtester Unternehmer und Influencer nicht nur seiner, sondern allen nachfolgenden Generationen, was wir zustande bringen können, wenn wir anfangen, uns selbst zu unterrichten.
Benjamin Franklins Vater wollte, dass der Junge Geistlicher wurde, doch Benjamin hatte schon als Kind ganz andere Vorstellungen. Bereits in jungen Jahren beobachtete er seine Umwelt ganz genau. Er sah, wie man bestimmte Dinge erledigte und was nötig war, um erfolgreich zu sein. Seiner Ansicht nach war Bildung der entscheidende Faktor, aber keine Schule in Amerika konnte ihm beibringen, was er suchte und brauchte. Also schuf er sich ein Programm zum Selbststudium in dem unerbittlichen Labor, das wir Leben nennen.
Er verschlang alle Bücher, die er in die Finger bekam. Bald war er ein so guter Schriftsteller, dass seine Werke immer wieder in den Lokalzeitungen abgedruckt wurden. Natürlich musste er dabei als Erwachsener auftreten und ersann deshalb eine ganze Reihe von Pseudonymen. Unter anderem gab er sich als eine Dame mittleren Alters aus.
Mit zwölf Jahren begann er seine Lehre bei seinem Bruder James, der im Druckgewerbe tätig war. Er lernte Schriftsetzen, Buchbinderei, Marketing und alles, was mit dem Verlagswesen zusammenhing. Dabei ging es ihm keineswegs nur darum, irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen – er lernte, um die wichtigste Kommunikationsplattform seiner Zeit zu meistern. Als Setzer erlangte er bald Meisterschaft. Er erfand neue Formeln für Tinte und arbeitete mit Druckmaschinen jeder Marke. Er redigierte Manuskripte, schrieb bissige Artikel und machte »Trendthemen« aus, um auf die Menschen einzuwirken und in die Politik einzugreifen. Er las alles, was in die Druckerei kam, wodurch er seine schriftstellerische Begabung weiter perfektionierte. Zu jener Zeit waren Bücher unglaublich teuer, also trieb er einen regen Tauschhandel mit allem, was lesbar war. Niemand trug ihm auf, all diese Dinge zu lesen. Er tat das ganz von selbst. Das aber ist der Kern der Selbstausbildung. Interessanterweise war es eben das Problem, das er als junger Mann hatte, nämlich an genug Lesestoff zu kommen, das ihn später dazu veranlasste, die erste Leihbücherei der Vereinigten Staaten zu gründen.
Nach fünf Jahren hatte Franklin genug gelernt, um sich in diesem Metier selbstständig zu machen. Doch es verlangte ihn nach mehr. Es heißt, er habe mit 15 Cents in der Tasche Boston verlassen und sei nach Philadelphia gegangen, wo andere Druckereien begierig auf seine Fähigkeiten waren. Körperliche Arbeit war zu jener Zeit billig zu haben. Gründliche Kenntnisse und Geschick aber waren, wie Franklin schnell begriff, wirklich gesucht und nicht allzu verbreitet.
Franklin wusste auch um die positiven Auswirkungen dessen, was wir heute »Netzwerken« nennen. Dazu gehörte auch, dass er Charakterzüge und Gewohnheiten von Menschen nachahmte, die Macht besaßen, Einfluss oder Autorität. Auf diese Weise konnte er sich anpassen und bei diesen Menschen gut ankommen. (Heute nennt man das »Mirroring«, aber dazu später mehr.) So wie die Verhaltensstudien, die ich als Teenager betrieben hatte, mir später beim FBI zugutekamen, konnte Franklin als erster Botschafter Amerikas in Frankreich auf sein feines Gespür für Manieren, Sitten und Gebräuche zurückgreifen.
Mit seiner unglaublichen Neugier, seinen Fähigkeiten und seiner Willenskraft dehnte er seinen Einfluss so weit aus, dass er noch als junger Mann den Gouverneur von Pennsylvania so beeindruckte, dass dieser ihn nach London schickte, um dort seine Ausbildung fortzusetzen. Franklin hatte das Geheimnis des Erfolgs entdeckt: Wissen, Neugier, Anpassungsfähigkeit, Fleiß und die Lust auf noch mehr Wissen können unser Leben entscheidend verbessern.
Als Benjamin Franklin 1790 im Alter von 84 Jahren starb, hatte diese Persönlichkeit, deren formale Ausbildung im Alter von zehn Jahren beendet war, so unglaublich viele Dinge getan und angestoßen, dass es unser Vorstellungsvermögen beinahe übersteigt. Er gehörte zu den Erstunterzeichnern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Er übte entscheidenden Einfluss bei der Formulierung der amerikanischen Verfassung aus. Er beriet Thomas Jefferson bei der Abfassung der Grundprinzipien, die die Vereinigten Staaten prägen sollten. Als Botschafter in Frankreich meisterte er zur Zeit des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges die Nuancen französischer Sprache und Lebensart so gut, dass er Frankreich dazu brachte, die noch junge Nation der Amerikaner in ihren Unabhängigkeitsbestrebungen von England finanziell zu unterstützen. Allein diese Hilfeleistung wäre schon mehr als genug gewesen. Doch Franklin erreichte noch mehr.
Er war nicht nur Autor, Zeitungsverleger, Drucker und Kämpfer für die Unabhängigkeit, ein Diplomat von unerreichter Begabung und dazu noch der Mann, der den Blitzableiter erfand. Er war darüber hinaus auch Humorist, Satiriker, Freimaurer, Wissenschaftler, Erfinder, Lehrer, Vorkämpfer bürgerschaftlicher Teilhabe, Forscher, Redner und Begründer der ersten Feuerwehr in Philadelphia und der Akademie von Philadelphia, aus der später die Universität von Philadelphia hervorgehen sollte. Er war auch Staatsmann und Architekt des ersten Kommunikationsnetzwerkes, das die britischen Kolonien in Amerika miteinander verband: Er richtete ein Postsystem ein. Wie Walter Isaacson in seiner Franklin-Biografie schreibt, war er der begabteste und einflussreichste Amerikaner seines Alters. Er war es, der das Denken der Amerikaner seiner Zeit maßgeblich beeinflusste – ein Influencer und Selbsthilfeguru ante litteram. Hätte es damals schon TED-Talks gegeben, hätte man sich ein paar Monate Zeit nehmen müssen, um sich all seine Beiträge in einem TED-Marathon anzusehen.
All das erreichte er nur durch eine einzige Gabe, die ihm eigen war: Selbstdisziplin. Er besorgte sich das Rüstzeug des Wissens, erwarb eine Stärke nach der anderen und schrieb sich ein Studienprogramm, das ihn aufgrund seiner unglaublichen Neugier immer weiter nach vorne brachte. Viele hochgebildete Menschen hatten Zugang zu dem, was Franklin unbedingt lernen wollte, und doch sticht er aus allen heraus, weil er entschlossen war, alles zu lernen. Er besorgte sich eine vielseitige und gründliche Ausbildung, die es ihm erlaubte, all diese großartigen Dinge zu vollbringen. Keine Schule, heute wie damals, hätte ihn all das lehren können, wofür er heute bekannt ist.
Franklin war schon zu seinen Lebzeiten eine Legende, und die Welt verdankt ihm viel. Sein bedeutsamstes Erbe ist aber vermutlich das Vorbild, das er für uns alle ist: Ganz egal, aus welch einfachen Verhältnissen Sie stammen, Sie bestimmen Ihr eigenes Leben, Ihre Leidenschaften, Ihren Lernerfolg. Und für all das gibt es keine Grenzen.
Sobald wir die Verantwortung übernehmen, unser Leben umzuwandeln, indem wir unsere Ausbildung selbst in die Hand nehmen, geschehen Zeichen und Wunder.
Als Joseph Campbell in seinem bahnbrechenden Buch The Power of Myth davon sprach, man solle seiner Seligkeit folgen, meinte er nicht, dass dazu keine Anstrengung nötig wäre oder alles von selbst gehen würde. Er wollte vielmehr sagen, dass wir unserer Leidenschaft, unserer Liebe, unserer Sehnsucht folgen sollen, ganz egal, welche Schwierigkeiten sich dabei einstellen mögen. Wenn Sie das tun, so Campbell, schlagen Sie einen Pfad ein, der Ihnen die ganze Zeit schon offenstand, der auf Sie wartete und Ihnen das Leben schenken wird, das Sie leben sollen.
Wenn Sie bereit sind, sich dieser Selbstausbildung zu unterziehen, so Campbell, setzen Sie eine Eigendynamik in Gang, die mit der Zeit immer stärker wird. Campbell zufolge lernen Sie plötzlich Leute kennen, die in dem von Ihnen gewünschten Bereich tätig sind. Plötzlich läuft alles. Campbell mahnt daher: Folgen Sie Ihrer Glückseligkeit und fürchten Sie sich nicht. Denn dann werden sich Türen öffnen, die Sie vorher gar nicht gesehen haben. Zumindest war dies so für Benjamin Franklin und Mary Temple Grandin. Auch für mich war es so. Und es wird auch für Sie so sein. Jemand sagte mal, dass Glück das Ergebnis von Fleiß ist. Ich würde eher sagen, dass Glück das Ergebnis der Mühe ist, die wir auf unser Selbststudium verwenden.
1971, als ich im ersten Semester an der Brigham Young University war, gab es nur einige wenige Bücher über Körpersprache. Selbst als Studienfach spielte das Thema kaum eine Rolle. Auf jeden Fall konnte man es nicht als Hauptfach belegen. Aber es war nun mal meine Leidenschaft, weil ich wusste, wie nützlich solche Kenntnisse waren, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt trat. Ich hatte das in meiner Jugend erkannt, als ich in die USA kam, ohne auch nur ein Wort Englisch zu sprechen. Als ich meinen Uni-Abschluss machte, schwor ich mir, alles herauszufinden, was es über nonverbale Kommunikation zu wissen gab.
Am Tag meines Abschlusses gönnte ich mir zur Feier des Tages eine Belohnung: Ich ging – ausgerechnet – in die Stadtbücherei und beantragte einen Bibliotheksausweis. Da ich nicht mehr studierte, konnte ich jetzt lesen, was immer ich wollte, nicht nur das, was ich lesen musste. Ich entwickelte meinen Lehrplan über Körpersprache. Am einen Tag studierte ich die Körpersprache der Bewohner der Trobriand-Inseln, am nächsten die Grußgesten der Ureinwohner von Alaska. Die Gesten, die die Konquistadoren beobachteten, als sie Südamerika eroberten, interessierten mich ebenso wie die Farben, die König Heinrich VIII. seine Höflinge tragen ließ. Was Sir Richard Burton über die Körpersprache der afrikanischen Völker schrieb, während er nach dem Ursprung des Nils suchte, faszinierte mich ebenso wie die Sitten und Gebräuche, denen der mittelalterliche Entdecker Ibn Battuta auf seiner 30-jährigen Reise begegnete, die ihn 75 000 Meilen durch Afrika, den Nahen Osten, Indien und Asien führte. Was ich in keinem Seminar hatte lernen dürfen, brachte ich mir nun selbst bei.
Ich studierte alles, was es über Körpersprache und nonverbale Kommunikation zu wissen gab, ob nun auf dem Gebiet der Psychologie, Zoologie, Verhaltensforschung, Anthropologie, Medizin, Ethnologie, Kunst, Fotografie, Primatenforschung, Bildhauerei oder Anatomie. Dieses Programm zum Selbststudium reichte in seiner Wirkung weiter, als ich mir je hatte träumen lassen – und veränderte dabei so ganz nebenher mein Leben. Es kam mir bei den verschiedensten beruflichen Tätigkeiten zugute, zum Beispiel als ich ein international tätiges Unternehmen aufzog. Und ich schloss dabei in den unterschiedlichsten Bereichen die interessantesten Bekanntschaften, die mein Leben bereicherten und mir zahllose Einsichten in die menschliche Natur vermittelten.
Als ich mir den Bibliotheksausweise ausstellen ließ und auf diese Weise den Einstieg in mein Selbststudium der nonverbalen Kommunikation wagte, wusste ich nicht, dass ich einmal die Besten dieses Faches kennenlernen würde: Paul Ekman, Bella DePaulo, Judee Burgoon, Mark Frank, David Givens, Joe Kulis, Amy Cuddy und viele andere. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einmal vom FBI rekrutiert werden und mein Wissen einsetzen würde, um Spione, Terroristen und Kidnapper zu fangen. Oder dass ich mehr als ein Dutzend Bücher über menschliches Verhalten schreiben würde, Jahr für Jahr Vorträge an der Harvard Business School halten und Videos online stellen würde, die tatsächlich 35 Millionen Mal aufgerufen werden sollten. Oder dass ich Organisationen und Regierungen in aller Welt beraten würde. Mein Selbststudium, mit dem ich meiner Neigung folgte, öffnete mir Türen, genau wie Joseph Campbell dies vorhergesagt hatte. Türen, von denen ich nicht einmal gewusst hatte, dass es sie gab.
Das war mit viel Anstrengung verbunden. Ich hatte mir geschworen, alles zu lernen, was es über nonverbale Kommunikation zu wissen gab – und diesem Schwur bin ich heute noch treu. Aber sich anzustrengen ist nun einmal der Preis für dieses Geschenk, das wir uns machen, wenn wir unserer Neigung folgen.
Und das Beste daran: Wenn wir unsere Seligkeit gefunden haben, sind wir nicht die Einzigen, die davon profitieren.
Sie müssen nicht versuchen, die Welt und ihre Geschöpfe zu bessern oder zu retten, um sich selbst an eine bessere Art des Daseins und des Lebens zu gewöhnen. Ich denke gerne an den jungen Mann, der im Schwimmbad meines Heimatortes im Becken neben mir seine Bahnen zog. Er übte sich darin, einen möglichst effektiven Schwimmstil wie ein Kampfschwimmer zu entwickeln: seitlich ins Wasser tauchen, die Arme nicht über die Wasseroberfläche heben, um jedes Spritzen zu vermeiden, sich zwischen den Schwimmstößen tragen zu lassen und im Atemrhythmus nur den Mund aus dem Wasser zu heben. Aus dem Internet hatte er sich ein Video heruntergeladen, in dem dieser Schwimmstil genau erklärt wird, weil er unbedingt bei den Navy SEALs aufgenommen werden wollte. Oder an William, einen Mann Anfang 40, der weiß, dass er zu schnell spricht, wenn er aufgeregt ist. Er weiß es, seine Frau weiß es und seine Vorgesetzten wissen es auch, weshalb sie ihn gebeten haben, »doch einen Gang herunterzuschalten«. Also setzt William sich samstagnachmittags hin und spricht in ein Aufnahmegerät. Er hält eine Rede, ruhig, beinahe psalmodierend, wie es Prediger tun. Auf diese Weise bringt er sich selbst bei, wie er seinem Vortrag einen anderen Rhythmus geben kann, damit seine Zuhörer seinen Gedankengängen folgen können. William ist ein erfolgreicher Manager, aber er will eben noch besser sein. Während seine Freunde im Fernsehen Formel-1-Rennen angucken, arbeitet er daran, sich selbst zu verbessern, Vortrag für Vortrag.
Das Selbststudium füllt den Quell unseres Wissens auf. So werden wir besser darin, unsere Optionen abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Das aber sind entscheidende Fähigkeiten, wenn wir Informationen sammeln oder neue Projekte anfangen. Sie schenken uns das Selbstvertrauen, dass wir alles lernen können, was wir brauchen, um im Leben vorwärtszukommen.
Das Selbststudium erfordert Zeit, aber nicht unbedingt Geld. Für mich war die örtliche Bibliothek jahrelang meine wichtigste Ressource beim Studium nonverbaler Kommunikationsformen. Das Internet eröffnet uns heute Zugang zu einem ganzen Universum von Informationen – das reicht von leicht verständlichen Tutorials über kluge Artikel bis hin zu interessanten Podcasts. Wenn du Leute in den sozialen Medien erzählst, wofür du dich interessierst, erhältst du eine Fülle spannender Tipps.
Worin wollen Sie besser werden? Diese Frage ist aufregend, und wir können sie uns zu jeder Zeit stellen. Wenn Sie Ihr eigener Mentor werden, ist das ein Geschenk an Sie selbst. Diese Frage verleiht Ihnen den Schwung, der Sie vorwärtsträgt von Entdeckung zu Entdeckung. Sie bahnen sich Ihren Weg, formen Ihren Charakter und entscheiden, wer Sie sein wollen und wofür Sie stehen.
Wenn Sie wahrhaft außergewöhnlich werden wollen, fangen Sie noch heute mit Ihrer Ausbildung an. Fangen Sie an, sich das Rüstzeug des erforderlichen Wissens zusammenzustellen. Und dann vollziehen Sie den ersten Schritt. Sie übernehmen die Kontrolle! Genießen Sie es herauszufinden, was Sie wissen wollen und müssen und wie Sie sich diese Kenntnisse aneignen können. Es gibt so grenzenlos viele Möglichkeiten des Lernens: lesen, mit anderen Menschen reden, die sich mit einer Materie auskennen, die Ihnen noch nicht so vertraut ist, Podcasts, Video-Tutorials, Volkshochschulkurse, Onlineschulen, E-Learning. Erfreuen Sie sich an dem, wohin Ihre Suche Sie führt. Vertrauen Sie darauf, dass Sie – wie Joseph Campbell schreibt – offene Türen finden werden, von deren Existenz Sie bislang nichts wussten. Werden Sie Ihr eigener Lehrherr. Wenn Sie das tun, werden außergewöhnliche Menschen Sie willkommen heißen, weil sie Ihr Engagement verstehen und respektieren.
Emotionale Balance: Das Rüstzeug der Stabilität
Eine der besten FBI-Agentinnen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, war Terry Halverson Moody. Das Büro konnte in hellem Aufruhr sein – Staatsanwälte, die dies oder jenes wollten, ständig neue Anrufe vom Hauptquartier, Medienanfragen, die sensible Operationen gefährdeten, Bosse, die einem in alles hineinkommandierten, Interviews, die unbedingt geführt werden mussten – Terry aber blieb stets ruhig und gelassen. Ich bewunderte sie dafür und für ihre Fähigkeit, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Als Ehefrau, Mutter, Special Agent beim FBI und meine dortige Partnerin (was an sich schon nicht leicht war) schien sie schon früh im Leben gelernt zu haben, was allen außergewöhnlichen Menschen gemeinsam ist. Ihr Geheimnis? Emotionen müssen immer im Gleichgewicht sein. Entweder kontrollierst du deine Gefühle oder sie kontrollieren dich.
Obwohl Special Agent Moody zehn Dienstjahre weniger auf dem Buckel hatte als ich, war sie mir doch um Längen voraus, wenn es darum ging, den stressigen FBI-Alltag mit seinen Anforderungen wegzustecken. Der ständige Hochdruck peitscht die Emotionen derart auf, dass wir jederzeit in Aktion treten können. Gleichzeitig aber heißt das auch, dass wir schnell gereizt, hibbelig und manchmal unüberlegt reagieren.
Paradoxerweise wurde ich unter starkem Druck immer ruhiger. Bei Spezialeinsätzen war ich immer gefasst und konzentriert. Ich verließ mich auf mein Training – und schob sämtliche Emotionen beiseite. Ein Flugzeug brannte in 100 Metern Höhe? Kein Problem: Stell die Benzinpumpe ab, schalte auf Schutzfrequenz (121,5), setz einen Notruf ab, leg den Hauptschalter für die Elektrizität um, schau dich nach einem Platz für die Notlandung um, behalte den richtigen Neigungswinkel bei, platziere den Feuerlöscher in der Nähe der Beine (weil dort das Feuer am ehesten durchschlägt), steuere den nächsten Flughafen an, gib alternative Landemöglichkeiten durch (Autobahnen, Zuckerrohrfelder), entriegele die Türen, falls ein Rettungsteam rein muss, achte auf andere Flugzeuge, halte Ausschau nach den Lichtsignalen des Flughafens, die dir einen sicheren Anflug signalisieren – und steuere das Flugzeug so gut du kannst auf eine sichere Landebahn. Das konnte ich, das habe ich getan, als ich in Puerto Rico einen schrecklichen Nachtflug hinter mich brachte. Es war vielmehr der Stress des Tagesgeschäfts, der mich fertigmachte: all die Ärgernisse, Störungen, Ablenkungen und die anstrengende Bürokratie des Alltags. In diesem Umfeld veränderten meine Emotionen den Menschen, der ich war. Sie setzten meine eigenen Verhaltensnormen außer Kraft und machten aus mir einen nicht so angenehmen Zeitgenossen, dem scharfe Worte leicht von den Lippen gingen, wenn man ihm auf den Geist ging. Ich war weniger geduldig. Die Tatsache, dass das Hauptquartier etwas von mir wollte, genügte schon, um mich auf die Palme zu treiben. Das forderte seinen Tribut – von mir und in meinen Beziehungen zu anderen.
Glücklicherweise erschien Special Agent Moody gerade zur rechten Zeit auf der Bühne. Sie saß mir gegenüber und sagte: »Atme erst mal lange aus, bevor du ans Telefon gehst.« Oder: »Konzentrier dich darauf, wie du das Problem lösen kannst, auch wenn der Anrufer ein A****loch ist.« Wenn ich mich aufregte, weil jemand vollkommen unsinnige Dinge von mir verlangte, gab sie mir ein Handzeichen, mit dem sie mir bedeutete: Leiser! Wenn ich dann den Hörer aufgelegt hatte, meinte sie: »Und jetzt atme ganz langsam aus. Und noch einmal, noch langsamer.« Und dann: »Jetzt machst du das noch mal.« Und während ich ihr erzählte, was sich da am Telefon abgespielt hatte, ermahnte sie mich: »Hör auf zu fluchen.« Oder: »Steh auf und streck dich mal.« Und: »Komm, gehen wir erst ein paar Schritte spazieren, bevor du mir alles erzählst.«
Wenn sie spürte, dass ich immer noch auf hundertachtzig war, schenkte sie mir einen mütterlichen Blick und sagte: »Joe, bitte geh laufen. Ich rede mit dir erst, wenn du wieder da bist.« Und ich befolgte ihren Rat. Ich kehrte immer viel ruhiger zurück, als ich losgerannt war. Selbst beim Mittagessen spürte sie, dass ich unbedingt zurück an den Schreibtisch wollte. Dann meinte sie: »Dein Mund ist zum Essen da, nicht zum Häckseln von Nahrung.«
Wenn all ihre Ermahnungen bei mir auf taube Ohren stießen, sagte sie nur, sie würde mich nicht wiederbeleben, falls ich einen Herzanfall bekäme, weil ich nicht auf sie hören wollte – ganz unerbittlich. Daher schaltete ich gern einen Gang runter oder auch zwei.
Ich wusste, dass meine Emotionen mich zu übermannen drohten und dass das so ungesund wie unproduktiv war. Ich machte den Menschen in meiner Umgebung das Leben immer nur noch schwerer. Ja, ich arbeitete an einem der größten Spionagefälle in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der sich über zehn Jahre hinziehen sollte, aber gerade deshalb konnte ich mir nicht erlauben, emotional von der Rolle zu sein. Andernfalls würde ich den Preis dafür bezahlen müssen, was dann tatsächlich der Fall war. (Mehr dazu in meinem Buch Allein gegen den Feind). Drei Tage nachdem in diesem Fall die erste Verhaftung auf US-Boden stattfand, streikte mein Körper. Mein Immunsystem war dermaßen am Ende, dass sich das Epstein-Barr-Virus ungehindert ausbreiten konnte. Ich musste ins Krankenhaus und litt danach unter Angstzuständen und Depressionen, die fast ein Jahr andauerten.
Warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle? Zur Warnung. Sie soll Sie daran erinnern, dass wir zwar wichtige, spannende Projekte umsetzen können, die Leben retten oder die Welt verändern – doch wenn wir unsere Emotionen nicht im Griff haben, werden sie uns im günstigsten Fall negativ beeinflussen, im schlimmsten aber auffressen. Wir könnten alle eine Terry Moody brauchen, die uns gute Ratschläge gibt und uns an der Hand nimmt, bevor wir ins Stolpern geraten. Die Erfahrung, die mich ins Krankenhaus brachte, war nicht mein erster Weckruf. Agent Moody hatte mich ja mehr als einmal gewarnt. Aber diese Episode lehrte mich eines: dass ich auf emotionaler Ebene besser mit mir umgehen musste.
So viel in unserem Leben dreht sich um unsere Gefühle. Ich bin wirklich erstaunt, dass wir dem Thema »Emotionen« so wenig Beachtung schenken, vor allem in den Bereichen zwischenmenschliche Beziehungen und Arbeit, die den Großteil unseres Lebens ausmachen.
Wenn wir jung sind, schleift sich emotional rüpelhaftes Benehmen leicht ein, falls es nicht gelingt, das abzustellen. Wir alle kennen ja Kinder oder unzivilisierte Erwachsene, die keinerlei Kontrolle über ihre Emotionen haben. Wutausbrüche, Missgunst, kleinlicher Neid, impulsives Verhalten, absichtliche Zusammenbrüche, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und weitere toxische Verhaltensweisen, die wir anderen Menschen zumuten, können schnell zur Gewohnheit werden. Und diese Gewohnheiten verschlimmern sich oft noch, bis sie schließlich zu Mobbing, zu verbaler und vielleicht sogar physischer Gewalt führen.
Vermutlich kennen Sie oder einer Ihrer Bekannten jemanden, der sich im beruflichen Umfeld aufführt wie ein Kleinkind. Doch diese Einschätzung ist falsch. Solche Menschen benehmen sich vielmehr wie Erwachsene, die nicht gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Die kleinliche Art, die Wutausbrüche, die Schikanen, die diese Leute anderen zumuten, haben ihre Wurzeln in mangelnder Selbstkontrolle.
Wenn wir das Erwachsenenalter erreicht haben, haben die meisten von uns gelernt, ihre Gefühle im Zaum zu halten – mithilfe unserer Eltern und anderer Bezugspersonen wie Lehrer und so weiter. Aber sogar dann steigen manchmal heftige Emotionen an die Oberfläche, wenn wir nicht aktiv gegensteuern. Falls wir nicht aufpassen, überwältigen sie uns – auch wenn wir instinktiv wissen, dass es besser wäre, das nicht zuzulassen. Unsere Emotionen können und werden uns geistig und körperlich beeinträchtigen. Sie beeinflussen unsere persönlichen Beziehungen ebenso wie unsere Leistung und die zwischenmenschlichen Kontakte im Beruf.
Aber warum haben Emotionen diese Macht? Wie wir auf die Außenwelt und auf unsere eigenen Gedanken und Sorgen reagieren, wird gewöhnlich vom limbischen System gesteuert – und diese Gehirnregion ist auch für unsere Emotionen verantwortlich, wie ich in meinem Buch Menschen lesen erklärt habe. Dieses unglaublich elegante System, das blitzartig unser Umfeld abcheckt und darauf reagiert, ohne dass wir groß nachdenken müssten, ist ganz darauf programmiert, unser Überleben zu sicherzustellen. Es gehört zu den evolutionär ältesten Bereichen des Gehirns, und wir teilen es mit allen Säugetieren. Es kann augenblicklich auf Bedrohungen reagieren; was aber die Langzeitfolgen dieser Reaktion angeht, hat es seine Grenzen.
Sind wir einer akuten Bedrohung ausgesetzt, schaltet sich das limbische System ein. Zunächst erstarren wir, wodurch wir für Beutegreifer nicht mehr so gut wahrnehmbar sind. Gleichzeitig bewerten wir blitzartig die Lage, um sogleich in den Schutz- und Verteidigungsmodus zu schalten, also zu fliehen oder zu kämpfen.
Angesichts einer derartigen Anspannung – ob sie nun von einem Raubtier verursacht wird oder von einem fremden Menschen, der uns Angst einjagt, von schlechten Nachrichten oder einem launischen Chef – werden unbewusst die physiologischen Ressourcen, die uns das sympathische Nervensystem zur Verfügung stellt, aufgerufen. In Sekundenbruchteilen werden Adrenalin und Glukose ausgeschüttet, was unserem Körper einen Energieschub gibt. Cortisol sorgt dafür, dass unser Blut leichter gerinnt, falls wir gebissen oder sonst wie verletzt werden. Darüber müssen wir nicht groß nachdenken. Es passiert einfach. Gleichzeitig versetzt uns diese Erregung in die Lage, zu brüllen, zu kreischen, zu fauchen und zu kämpfen – es ist also ein emotional total aufgepeitschter Zustand.
Hunderttausende von Jahren waren wir Menschen auf das limbische System angewiesen, um zu überleben. Zorn, Anspannung, Angst, ja Raserei sind nützlich, wenn wir einem Raubtier gegenüberstehen. Im richtigen Moment helfen uns diese extremen Erregungszustände, in einer Welt voller Gefahren am Leben zu bleiben.