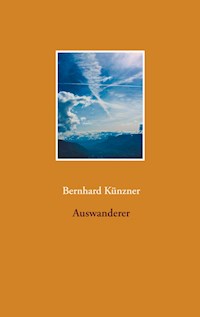
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, suchen ihr Glück in einem kleinen Ort in Kanada. Ihre Motive und Charaktere könnten kaum unterschiedlicher sein. Erst in der Ferne lernen sie, dass es lebensnotwendig ist, an einem Strang zu ziehen. Als der beschauliche Ort durch die Baupläne skrupelloser Spekulanten bedroht wird, ist jeder Einzelne gefordert, seine Fähigkeiten einzusetzen, um eine Katastrophe abzuwenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter zuckte zusammen. Das Telefon im Flur läutete, schrill und unnachgiebig. Es war ein altes, analog betriebenes Gerät, bei dem man den Klingelton nicht verändern konnte, aber selbst der süßeste Flötenton hätte einen Anruf zur Unzeit nicht besser gemacht. Für einen Moment dachte Dieter darüber nach, nicht abzuheben. Doch dann besann er sich. Wenn er jetzt nicht ranginge, würde es in einigen Minuten wieder läuten. Besser, er erledigte das jetzt und hatte ein für alle Mal seine Ruhe vor dieser unwillkommenen Störung seiner Privatsphäre.
„Kaufmann?“ Seine Stimme klang heiser; es war Sonntagabend, und er hatte sie den ganzen Tag noch nicht benützt. Vom anderen Ende der Leitung war nur ein schwaches Knistern zu hören.
„Hallo? Hier Kaufmann!“, sagte Dieter unwirsch.
Ein lauteres Knacken, dann eine brüchige Stimme, die vermutlich einer älteren Dame gehörte: „Wer ist dort?“
„Hier Kaufmann – Dieter Kaufmann.“
„Ist da nicht Gudrun Scholz?“
„Nein, hier ist Dieter Kaufmann.“
„Ach so – “
Ein erneutes Knacken – die Dame hatte das Gespräch beendet.
Dieter schüttelte den Kopf. Ein unhöfliches Verhalten, einfach aufzulegen, ohne Entschuldigung, aber er war darüber nicht verärgert. Vielmehr war er erleichtert, dass sich die Sache mit dem Anruf für ihn in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Er hätte wenig Lust gehabt, um acht Uhr noch ein unangenehmes Telefonat zu führen, denn um Viertel nach Acht wollte er seine Lieblingsserie „Der Bergdoktor“ im Fernsehen schauen. Als er den Hörer auf die Gabel legte, fiel ihm auf, dass das spiralige Kabel in sich verdreht und verheddert war; höchste Zeit, es einmal wieder zu entwirren. Wenn man es in diesem Zustand ließ, würde es sich jedes Mal von Neuem verknoten und war nicht mehr zu gebrauchen. Dieter wollte sein altes Telefon noch lange benützen, denn auf eines dieser neuen strahlungsintensiven Geräte hatte er wahrlich keine Lust. Er nahm das Kabel hoch und ließ den Hörer sich so lange ein paar Mal um die eigene Achse drehen, bis es sich nicht mehr von selbst einrollte. Dann legte er den Hörer zurück auf die Gabel.
‚Es ist mein freier Tag‘, sagte sich Dieter. ‚Da kann man doch mal für sich in Anspruch nehmen, zu tun und zu lassen, was man will. Wenn es jetzt an der Wohnungstür klingeln würde, würde ich auch nicht aufmachen. Genauso ist es mit dem Telefon. Im Grunde sind die Leute, die einen anrufen, ungebetene Gäste, auch wenn sie sich nur verwählt haben.‘
Er öffnete eine Flasche Bier und stellte sie zusammen mit einer Tüte Kartoffelchips auf den Couchtisch. Für Dieter war es der Gipfel an Gemütlichkeit, sich auf die Couch zu lümmeln, einen guten oder wenigstens unterhaltsamen Film anzukucken, sich genüsslich Chips einzuverleiben und den salzigen Geschmack bei Bedarf mit einem Schluck Bier abzulöschen. Hier war er ganz für sich, in seiner Welt und gleichzeitig auch in der Welt seines Idols, dem „Bergdoktor“. Ein Unbeteiligter mochte diese Art, sein Leben zu verbringen, als primitiv oder einfältig aburteilen, aber das war sie beileibe nicht. Zu Dieters Lebensphilosophie gehörte das Recht, unter vielen möglichen Welten zu wählen. Wenn ihn diese Welt, die er mit seinen fünf Sinnen wahrnahm, nicht zufrieden stellte, durfte er sich doch in Gedanken in eine andere, in eine Fantasiewelt begeben, die ihm mehr Freude bereitete. Was kümmerte es andere, auf welche Art und Weise er sein Glück fand? Und dass der „Bergdoktor“ eine heile Welt vorgaukelte, die es so in der realen Welt nicht gab – was kümmerte es ihn, solange es ihm dabei gut ging? Mochten die anderen sich mit der traurigen, erbarmungslosen, realen Alltagswelt auseinandersetzen und dort ihre Verteilungskämpfe ausfechten, er, Dieter Kaufmann, hatte keine Lust, in diesen Alltag mehr Energie zu stecken als unbedingt notwendig.
Die Episode kam in Fahrt. Dieter freute sich an den schönen Panoramabildern aus der Tiroler Bergwelt. Gleichzeitig entwickelte sich eine rührende Geschichte um eine hübsche junge Frau, die ihrem Freund verschwieg, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Doch da! Schon wieder dieses nervtötende Telefon! Wütend knallte Dieter die Bierflasche auf den Tisch und riss den Hörer von der Gabel.
„Ja!? – Ach… Nein, ich habe niemand anderen erwartet. … Ich weiß schon, wegen der Rolle. Also eigentlich … Ach so. … Mhm. … Ich habe aber am Dienstag und Donnerstag definitiv keine Zeit! … Na gut. Also dann! … Ja, wird bestimmt lustig. Tschüss!“
Jetzt war es um Dieters Feierabendstimmung geschehen. Frustriert ließ er sich auf die Couch plumpsen und starrte fassungslos auf den Bildschirm. War ja logisch! Wegen dieses dämlichen Telefonats hatte er die entscheidende Szene verpasst, wo der Bergdoktor mit dem verantwortungslosen Verlobten zusammentraf; bestimmt hatte er ihm ordentlich die Leviten gelesen. Nicht plump oder bösartig, sondern mit Respekt und Einfühlungsvermögen und so souverän, dass der gar keine andere Wahl hatte, als sein Verhalten zu überdenken. So oder so ähnlich wird es sich abgespielt haben; gerne hätte er das miterlebt. Aber jetzt konnte er sich ohnehin nicht mehr auf den Film konzentrieren. Sein Kopf war mit etwas anderem beschäftigt, was ihn erbarmungslos in der Realwelt festhielt. Er hatte soeben eingewilligt, eine Rolle in dem neuen Stück seiner Theatergruppe zu übernehmen, eine Entscheidung, die er aufgeschoben hatte, solange es ging. Und das, obwohl er fest entschlossen war, in diesem Jahr nicht zu spielen. Die vielen abendlichen Proben über drei Monate hinweg zwei bis dreimal in der Woche, das war ihm einfach zu viel nach all dem Stress im Büro. Da sollten sich mal die Jüngeren mehr engagieren! Der Regisseur, ja, der hatte abends nie etwas vor, der lebte ja von solchen Regieaufträgen und konnte am nächsten Tag ausschlafen. Dem war es egal, ob die Probe um zehn, elf oder zwölf Uhr zu Ende war. Der konnte nicht verstehen, wie das ist, wenn man sowas nur hobbymäßig machte. Der glaubte doch tatsächlich, dass seine Laiendarsteller für das Theater dieselbe Leidenschaft wie er empfanden. Es war schwer bis unmöglich, ihn davon zu überzeugen, dass man manchmal einfach keine Lust hatte, Theater zu spielen. Anstatt sich auf das Geschehen auf dem Bildschirm zu konzentrierten, galoppierten seine Gedanken ungebremst davon.
Dieter trank die Bierflasche leer und holte sich gleich noch eine. Heute war es schon egal. Irgendwie musste er runterkommen, müde werden, das Denken verlangsamen, sonst grübelte er die ganze Nacht darüber nach, was er hätte sagen sollen, um die Rolle erfolgreich abzulehnen. Der „Bergdoktor“ kam eben spätnachts nach Hause, wo seine Mutter mit dem aufgewärmten Essen auf ihn wartete. ‚Gemütlich!‘, dachte Dieter. ‚Er hat viel zu tun, aber er macht es mit ganzem Herzen. So ein Leben müsste man haben! Nicht so wie ich, der hauptsächlich das tut, wozu er überredet worden ist. Es ist höchste Zeit, daran etwas zu ändern.‘
Elke blickte durch die bis zum Boden reichende Fensterscheibe nach draußen. Sie kannte viele der Leute, die am Café vorübergingen, persönlich. Zum Teil hatte sie beruflich mit ihnen zu tun; sie war Chefsekretärin bei Elektrofix, einer großen Firma für Elektrogeräte. Jeder hier im Ort hatte früher oder später mit dieser Firma zu tun, Elektroartikel brauchte jeder, und wenn es nur eine Sicherung oder eine spezielle Glühbirne war. Ab und zu gingen auch Paare vorbei, überwiegend ältere, solche, die höchstwahrscheinlich schon das Rentenalter erreicht hatten und jetzt gemeinsam ihren Ruhestand genießen durften. ‚Beneidenswert!‘, dachte Elke.
„Elke? Hörst du mir überhaupt zu?“
Elke sah in das stark geschminkte Gesicht ihrer Freundin Olga, die tatsächlich für einige Sekunden aufgehört hatte zu reden. ‚Sie sieht wirklich furchtbar aus!‘, dachte Elke. Unter einem Turban aus tiefschwarz gefärbten Haaren sah ihr bleiches Gesicht nahezu gespenstisch aus. Die dick aufgetragene Abdeckcreme konnte die Spuren des Alters nicht auslöschen. Die Haut an Stirn und Mundwinkeln war schlaff und welk, das konnte sie nicht verheimlichen. ‚Wir sind gleich alt‘, dachte Elke. ‚Ob man mir meine vierzig Jahre auch so deutlich ansieht?‘ Sie deutete auf ihre eigenen Augen, um Olga anzudeuten, dass sich der Eyeliner durch die Tränen verwässert und schwarze Striche auf ihren Wangen hinterlassen hatte. Olga unterdrückte einen erneuten Heulanfall und tupfte mit einem zerknüllten Papiertaschentuch die Augenlider ab, was ihr Aussehen nicht verbesserte.
„Kannst du meine Situation jetzt verstehen?“, fragte Olga, und ehe Elke antworten konnte, fuhr sie fort: „Bestimmt denkst du jetzt, ich sei eine hysterische Ziege, die eigentlich den Himmel auf Erden hätte – “
‚Gut erkannt!‘, dachte Elke, sagte aber stattdessen: „Aber nein! Du steckst wirklich in einer üblen Zwickmühle. Du liebst deinen Mann nicht mehr, aber da du weißt, dass er ohne dich nicht sein könnte, hast du Skrupel, ihn zu verlassen.“
Olga schaute sie verwundert an. „Ja, das ist richtig! Wie du das in nur einem einzigen Satz auf den Punkt gebracht hast! Da erkennt man wieder einmal die erfahrene Chefsekretärin in dir.“ Sie versuchte zu lachen. „Aber was soll ich denn jetzt tun? Ich erwarte ja auch gar nicht, dass du das Problem für mich löst – “ ‚Tust du doch!‘, dachte Elke, „ – aber ein kleiner Tipp einer guten Freundin wäre jetzt echt hilfreich. Ich meine, Horst kann doch nicht von mir erwarten, dass ich ihm zuliebe auf alle sinnlichen Freuden verzichte. Da kann ich ja gleich in ein Kloster gehen. Ach, manchmal glaube ich, mein Zuhause ist ein Kloster. Ich bin schließlich in einem Alter, in dem man als Frau durchaus noch Chancen hat, wenn du weißt, was ich meine.“
Jetzt versuchte Elke zu lachen. „Du sprichst von einer offenen Beziehung?“
„Offene Beziehung?“ Olga dachte nach und sprach dann mit hörbarer Begeisterung weiter. „Ja! An so etwas habe ich auch gedacht. Du kannst wirklich meine Gedanken lesen. Also – man ist verheiratet, erlaubt sich aber gegenseitig den einen oder anderen Seitensprung, oder?“
„Ja, so machen das manche Paare.“
Elke sah auf die Uhr. Ihre Mittagspause war beinahe zu Ende. Sie musste sich jetzt sputen, um pünktlich im Büro zu erscheinen.
„Du, Olga, ich muss jetzt dringend los. Hier! Darf ich dir das Geld dalassen, zum Bezahlen?“
„Kommt gar nicht in Frage! Du bist natürlich eingeladen. Elke?“
„Ja, Olga?“
„Ganz ehrlich - meinst du, ich kann das dem Horst ruhig so sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben?“
Elke stand schon in der Tür, als sie diese Frage erreichte. Irgendwie wusste sie, dass alles, was sie jetzt antwortete, falsch verstanden würde. Trotzdem, nur um einen Abschluss zu erwirken, sagte sie: „Du darfst alles tun, was dich glücklich macht.“ Dann beeilte sie sich, außer Hörweite zu kommen.
Eilig lief sie die Stufen zur Tiefgarage hinunter und stieg in ihr Alfa Romeo-Oldtimer-Cabrio. Wie es in Situationen, in denen die Zeit knapp ist, regelmäßig geschieht, sprang der Motor erst beim dritten Versuch an. Mit quietschenden Reifen rauschte Elke die Auffahrt hoch und musste zerknirscht feststellen, dass sie oben an der Straße in einen Stau einfädelte. Ein Polizist stand an der Straße und deutete den Autofahrern an, dass sie umkehren sollten; es hatte einen Unfall gegeben und die Straße war nun gesperrt. Die Umleitung kostete Elke fünf wertvolle Minuten; sie würde es nicht schaffen, rechtzeitig an ihrem Arbeitsplatz zu sein. Nun ärgerte sie sich noch mehr, dass sie Olga zuliebe ihre wertvolle Mittagspause geopfert hatte.
Sie waren zusammen in die Realschule gegangen, aber kurz darauf hatten sich ihre Wege getrennt. Sie hatte gleich nach dem Abschluss eine Ausbildung bei der ortsansässigen Firma Elektrofix begonnen, während Olga, wie man so sagt, eine gute Partie gemacht hatte. Sie heiratete den Bauunternehmer Horst Waldschmidt und brauchte künftig nichts weiter zu tun, als ihm als Begleiterin bei repräsentativen Veranstaltungen zur Seite zu stehen. Für den Haushalt standen ihr eine Köchin und eine Haushälterin zur Verfügung, Kinder hatten sie keine bekommen. Das war jetzt über zwanzig Jahre her. Elke stellte sich vor, wie sich Frau Waldschmidt in diesem Augenblick ihren Pelzmantel reichen ließ und mit der Attitüde einer Grande Dame durch die offen gehaltene Tür stolzierte, während die Cafébesitzerin herbeieilte, um sie persönlich mit den Worten: „Beehren Sie uns bald wieder, Frau Waldschmidt!“, zu verabschieden. Wahrscheinlich würde sie sich anschließend zum nächsten Treffen mit einer „guten Freundin“ begeben und ihr dieselbe abartige Geschichte aufdrängen; vom harten Leben einer Geschäftsfrau, die doch so gerne noch einmal Schmetterlinge im Bauch hätte. Lachhaft!
Elke Meister hatte ganz andere Probleme. Sie hatte sich vorgenommen, zur Vorstandssitzung am Nachmittag bestens vorbereitet zu erscheinen. Sie wusste, dass es bei diesem Meeting für ihren Chef um sehr viel ging. Es waren Gerüchte im Umlauf, die besagten, dass unter den Aktionären die Meinung herrschte, die Verkaufsabteilung könnte effektiver arbeiten, wenn sie direkt der Produktionsabteilung unterstellt würde. Allerdings hätte das für ihren Chef eine Herabstufung zum stellvertretenden Abteilungsleiter zur Folge, was die Aktionäre reichlich wenig kümmerte, für ihn, Fritz Bremer, jedoch eine mittlere Katastrophe darstellte. Darum, und natürlich auch, weil sie dann den Job einer Chefsekretärin verlieren würde, hatte Elke Meister ihr Möglichstes getan, um Zahlen und Fakten zusammenzusuchen, die geeignet waren, um die Notwendigkeit einer eigenständigen Verkaufsabteilung zu untermauern. Nach einem kurzen Blick in ihren Handspiegel trat sie reuig in das Büro ihres Chefs und musste ihm erklären, warum sie fünf Minuten zu spät kam.
„Ein Unfall auf der Siemensstraße. Tut mir leid.“
Nervös und ohne eine Miene zu verziehen, schaute Fritz Bremer auf seine Armbanduhr.
„13 Uhr 15. Wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Sie haben vielleicht Nerven.“
„Tut mir echt leid. Aber ich habe gestern schon alles vorbereitet.“
Eilig fischte sie einen Ordner aus der Schreibtischschublade.
„Hier! Das ist eine Liste, aus der unsere Kontakte zu den Kunden in chronologischer Reihenfolge zu ersehen sind. Daraus kann man schließen, dass in unserer Abteilung nicht nur Däumchen gedreht werden. War gar nicht so einfach, diese Daten zu erhalten. Aber die IT-Leute waren mir noch einen Gefallen schuldig. Und hier sind die Zahlen über die geschätzten Bestellungen unsere wichtigsten Kunden in Bezug zu den tatsächlichen Bestellungen; wie Sie sehen, haben wir hier eine 90prozentige Übereinstimmung. Wenn wir nicht in ständigem Kontakt mit diesen Leuten wären, könnten die von der Produktion den Bedarf nur schätzen, was naturgemäß zu erheblichen Problemen, Lieferengpässen bzw. Überkapazitäten führen würde. Aber so ein gegenseitiger Kontakt ist zeitintensiv und mit weniger Personal nicht zu schaffen. Unsere Kunden verlassen sich seit Jahren darauf, dass sie ihre Ware ohne nennenswerte Verzögerung bekommen. Das sollte so bleiben. In diesem Zusammenhang habe ich schon vor Wochen bei unseren Kunden herumgefragt, was sie am meisten an Elektrofix schätzen. Sie werden sich freuen, das Ergebnis zu hören: es ist unsere Zuverlässigkeit hinsichtlich Qualität und kurzfristiger Lieferung, noch vor Preisstabilität und Innovation. Das alles kann nur gewährleistet werden, wenn wir unsere Organisation beibehalten wie bisher.“
Fritz Bremer räusperte sich und zog seine Stirn faltig. Wortlos holte er seine Brille aus der Tasche seines Jacketts und putzte sie mit dem beiliegenden Softtuch. Dann setzte er sie auf und sah sich die Zahlen seiner Sekretärin in aller Ausführlichkeit an. Schließlich nahm er die Brille wieder ab und steckte sie in die Tasche zurück. Er räusperte sich erneut, sah auf die Uhr und sagte: „Auf in den Kampf!“
Elke ging voraus und hielt ihrem Chef die Tür auf. Sie war erleichtert und zufrieden. Ein anerkennendes Wort hatte sie ohnehin nicht erwartet; so etwas gab es bei Fritz Bremer nicht. Eine wortlose Prüfung ohne Einspruch war mehr, als sie zu hoffen gewagt hatte. Sie hatte mehr getan, als ihr Chef von ihr erwartet hatte; nun war es an ihm. Es war sein Job, den Vorstandsmitgliedern die aufbereiteten Zahlen so zu verkaufen, dass sie ihr Vorhaben, die Abteilung aufzulösen, zumindest noch einmal überdachten.
Das Ehepaar Erwin und Erika Westerstedt ging Hand in Hand über den Bürgerpark. Oder nein! Doch nicht Hand in Hand, es sah nur so aus. Tatsächlich hatte Herr Westerstedt seine Hand in der Manteltasche verborgen und seine Gattin hielt sich an seinem Arm fest. Auf diese Weise drückten sie enge Zusammengehörigkeit aus, ohne eine würdelose Verliebtheit zur Schau zu stellen, so wie es die jungen Leute heutzutage machten, wenn sie sich an den Händen fassten, als würden sie dabei Lust empfinden. So oder so ähnlich mochten die Westerstedts gedacht haben, als sie vor etwa 30 Jahren in ihre Neubauwohnung gezogen waren und mit dem wöchentlichen Ritual des gemeinsamen Sonntagsspaziergangs durch den Park begonnen hatten. Herr Westerstedt vertrat die Auffassung, es gehöre sich, dass man sich in der Öffentlichkeit, dort, wo man sein Zuhause hat, auch sehen lässt, man habe ja nichts zu verbergen. Er war jetzt 63 Jahre alt, großgewachsen und immer noch schlank, seine Gattin war ein Jahr jünger, zart gebaut und zwei Köpfe kleiner. Er war Ingenieur bei der Firma Elektrofix, und das seit fast 40 Jahren. Zwar hätte er in diesem Jahr die Rente beantragen können, aber er legte großen Wert darauf, nicht aufs Altenteil geschoben zu werden. Er fühlte sich für „seine Firma“, wie er zu sagen pflegte, verantwortlich. Daran würde sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Frau Westerstedt hingegen war gelernte Einzelhandelskauffrau, die ihren Kindern zuliebe ihre Arbeitsstelle aufgegeben hatte und seither keine Notwendigkeit sah, sich wieder eine Arbeit zu suchen. Das Einkommen ihres Mannes reichte voll und ganz aus, um sich ein schönes Leben zu machen. Außerdem waren die Pflichten, die sie als treusorgende Hausfrau zu verrichten hatte, keineswegs unbedeutend. Es verstand sich von selbst, dass man dem Ehemann den Rücken von lästigen Alltagsaufgaben freihalten musste.
Während also die Westerstedts die vereisten Wege entlangmarschierten, die seit der vorübergehenden Schneeschmelze und anschließendem Frost kaum begehbar waren, drehten sich ihre Gedanken sicher nicht um ihre beruflichen Werdegänge oder ihren Status innerhalb der Familienhierarchie; das war alles festgeschrieben und unverrückbar. Vielmehr erfreuten sie sich an dem herrlichen Winterwetter und bestimmt auch an ihrer trauten Zweisamkeit.
„Jetzt sind wir schon 35 Jahre verheiratet und es verging kein Sonntag, an dem wir unseren sonntäglichen Spaziergang ausfallen ließen. Weißt du das, Schatz?“
„Das stimmt nicht ganz, Erwin. Unser Dominik ist an einem Sonntag geboren. Damals hatte ich wenig Lust an einem Spaziergang.“
„Ja, das – “
„Und vor fünf, nein, sechs Jahren lagst du mit einer Grippe im Bett. Da war an einen Spaziergang nicht zu denken.“
„Gut, das – “
„Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir heute gesund und rüstig genug sind, um aus dem Haus gehen zu können. Wenn ich da an die Hubers denke!“
„Ähm? Welche Hubers?“
„Robert und Margit! Du kennst die doch! Wir waren im Sommer gemeinsam im Biergarten am Mühlenbach.“
„Ach die Hubers!“
„Und jetzt hat sie nen Gehirntumor. So schnell kann’s gehen. Die arme Frau!“
Herr Westerstedt schüttelte den Kopf. „Th, th, th…“
„Darum sag ich dir auch immer wieder, dass du zur Vorsorge gehen sollst! In deinem Alter – “
Schlagartig hielt sie inne. Als sie weitersprach, hatte sich ihre Stimme deutlich verändert. Erwin Westerstedt erkannte aufgrund jahrelanger Erfahrung, dass eine spontane Senkung der Lautstärke ein Warnsignal für eine akute Bedrohung war.
„Guck mal! Da kommt die Dings – wie heißt sie nochmal?“
„Wer?“
„Ach komm‘, Erwin! Tu doch nicht so! Du hast sie doch schon längst gesehen. Ist doch kein Geheimnis, dass du auf sie stehst.“
Herr Westerstedt errötete. Er wusste, dass das seine Frau bemerkte und seine anschließende Bemerkung somit unglaubwürdig klingen musste.
„Unsinn! Was du dir alles so einbildest! Sie ist eine Kollegin, eine entfernte Kollegin, mehr nicht. Ich hätte sie jetzt gar nicht gekannt, mit Mütze und so…“
Dass in diesem Augenblick Elke Meister freundlich grüßte, worauf Herr Westerstedt unbewusst breit zurücklächelte, erhärtete den Verdacht, den seine Frau schon lange hegte. Nicht etwa, dass sie ihm zutraute, eine Affäre mit ihr zu haben, dazu fehlte ihrem Gatten ihrer Einschätzung nach der Mumm, sondern dass diese junge Frau der Grund für unerklärliche abendliche Überstunden in der Firma war.
„Eine entfernte Kollegin also… Sie ist doch in derselben Abteilung, oder irre ich mich?“
„Die Abteilung ist groß.“
„Ich kenn doch die ganzen Fotos von Betriebsfeiern und Betriebsausflügen. Überall ist sie mit drauf. Ich bin doch nicht blöd!“
Frau Westerstedt hatte sich nun richtig in Rage geredet. Ein weiterer Grund für ihren Mann, rot anzulaufen. Eine Minute zuvor waren die Westerstedts für die anderen Spaziergänger im Bürgerpark ein einträchtig flanierendes altes Ehepaar, jetzt erweckten sie zweifelsohne den Anschein eines Paares, das an die gegenseitigen Keifereien so gut gewöhnt war, dass ihnen die Peinlichkeit ihres Verhaltens gar nicht mehr bewusst war.
„Ihr Männer seid doch alle gleich!“, wetterte Erika Westerstedt weiter. „Kaum sehen sie einen kurzen Rock, einen Ausschnitt und lange blonde Haare, dann setzt das Gehirn aus.“
„Aber Schatz! Ich gehör‘ bestimmt nicht zu dieser Art Männer.“
„Aber auch nur, weil du für einen Seitensprung zu feige bist. Ich möchte gar nicht wissen, was du in Gedanken mit dieser Schlampe schon alles getrieben hast.“
„Jetzt gehst du aber zu weit. Frau Meister ist eine grundanständige Person.“
„Ach ja? Warum hat sie dann noch keinen Mann abgekriegt? Wie nennt man gleich wieder solche Frau, die jeder ins Bett haben möchte, aber keiner als Ehefrau?“
Und so ging das Gezänk weiter, bis sie ihre sonntägliche Pflichtrunde erledigt hatten und die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel. Dann endete der Streit. Herr Westerstedt zog sich in sein kleines Büro zurück und erledigte einige berufliche Dinge, um für den Montag gerüstet zu sein, Frau Westerstedt schaltete den Fernseher ein und zappte zwischen den Programmen hin und her, bis ihre Lieblingsserie begann. Dann war sie ohnehin für niemanden mehr zu sprechen.
So wie die Westerstedts schlossen sich in diesen Tagen viele Ehepaare, Familien und Singles in ihren Wohnungen ein, denn es war ein sehr kalter Januar. Sobald es dunkel wurde, sank die Temperatur auf bis zu 12 Grad unter Null. Dann kam die Zeit, in der immer mehr Lichter angeknipst wurden, um den Tag noch ein wenig zu verlängern. Die größeren Straßen waren beinahe taghell erleuchtet, Autoscheinwerfer tauchten ganze Straßenzüge in Licht. Aus den Kaminen stieg warmer Dampf und Rauch. Aus der Ferne betrachtet war es eine kleine zerbrechliche Welt, die sich die hart arbeitenden Menschen aufgebaut hatten, eine Kleinstadt nannte man so etwas, einen Lebensraum für etwa 15.000 Menschen, in dem alles reibungslos funktionierte; jeder hatte seinen Platz, seine Aufgabe, seinen geschützten Privatbereich. Alles war darauf ausgerichtet, Wohlstand zu erlangen. Würde ein Riese auf diese eigenartige Ansammlung von unterschiedlichsten Bauten herabschauen, müsste er wohl denken: „Hoppla! Beinahe wäre ich draufgetreten! Was sind das bloß für emsige Menschlein, die tagaus, tagein ihre Aufgaben verrichten und nicht im Traum daran denken, dass ihre Welt vom Erdboden hinweggefegt würde, wenn ich nur ein einziges Mal kräftig nießen würde. Sie wären verloren ohne den Schutz ihrer winzigen beheizten Höhlen, sie würden jämmerlich erfrieren und niemandem würde es auffallen. Man muss sie einfach liebhaben.“
Zur selben Zeit blätterte ein alleinstehender Motelbesitzer in einer kleinen Ortschaft im westlichen Kanada in einem alten Buch, das er in einem Antiquariat gefunden hatte. Der Titel „Mensch und Natur – ewige Wahrheiten“ hatte ihn angesprochen. Nun saß er in seinem Ohrensessel und betastete den abgenutzten Einbanddeckel mit der kunstvollen eingeprägten Schrift. Das holzige Papier war am Rand vergilbt, auf den Innenseiten jedoch wie neu. Er schlug wahllos eine Seite auf und begann zu lesen:
Vermutlich ist jedes andere Lebewesen dem Menschen überlegen. Wieviel robuster und effektiver allein ein Ameisenhaufen ist, perfekt eingebunden in die biologischen Nahrungskreisläufe, verglichen mit den künstlich am Leben erhaltenen Menschensiedlungen, wieviel freier die Tiere sind, da sie nicht an einen Ort gebunden sind und in kurzer Zeit auf veränderte Lebensbedingungen reagieren können! Die Große Mutter Natur breitet ihre Gaben vor allen aus, auf dass jeder satt werden solle. Doch die Menschen vertrauen ihr nicht. Wie wenig sie doch verstanden haben, dass sie meinen, ihre Nahrungsquellen der Natur entreißen zu müssen, wo ihnen doch die Trauben beinahe in den Mund wachsen? Und wenn sie dann haben, was sie unbedingt wollten, entbrennt ein Bruderkrieg um das, was ihnen geschenkt worden ist. Jeder sieht seinen „Wohlstand“ bedroht. Was ist das wohl für ein Wohlstand, der von der ständigen Furcht begleitet ist, geringer zu sein als im Vorjahr? Was ist das für eine unerklärbare Furcht, die im Grunde nur dem Neid entspringt, der andere könnte mehr haben als man selbst? Alles, was die Menschen auf diese Weise mühsam errungen haben, muss folglich bis aufs Messer verteidigt werden, das ist die Ideologie, nach der Menschen leben. Wen wundert’s also, dass an den Orten, wo sich die Menschen ausbreiten, die Natur im Rückzug ist, und an den anderen, menschenfreien Orten alles im Überfluss wächst und gedeiht? Wie kann es den Menschen noch deutlicher vor Augen gehalten werden, dass sie auf dem Irrweg sind?
An dieser Stelle hielt er inne und dachte über sein Leben nach. ‚Es ist gut so, wie es ist‘, dachte er. ‚Ich bin dem Herrgott dankbar dafür, dass er mich an diesen Ort geführt hat.‘
Der Montagmorgen begann mit einem Paukenschlag. Wie an jedem Morgen um acht Uhr betrat Elke das Büro ihres Chefs, um ihm seine Tasse Kaffee zu bringen. Das war seit über zehn Jahren ein festes Ritual. Wenn, so wie an diesem Tag, Herr Bremer nicht anwesend war, hatte das nichts Gutes zu bedeuten. Elke stellte die Tasse auf seinen Schreibtisch und bemerkte, dass seit Freitagabend nichts daran verändert wurde; sie hatte ein Gedächtnis für solche Sachen, wenn etwa die Kugelschreiber nicht in der Ablage waren oder auf der Notizunterlage herumgekritzelt wurde oder die Armlehnen des Luxusledersessels die Schreibtischkante nicht berührten, dann war das ein untrügliches Zeichen, dass der Chef noch nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war. Doch heute war alles genauso ordentlich wie vor zwei Tagen, als sie das Licht ausschaltete und die Bürotür abschloss. Niemals hätte sie Herr Bremer im Falle einer Erkrankung im Unklaren gelassen, sondern sie mittels SMS oder E-Mail zeitnah davon in Kenntnis gesetzt. Ein unangenehmes Kribbeln im Rücken bewirkte, dass sie unwillkürlich Schultern und Nacken anspannte. Eine düstere Vorahnung schwebte über ihr, als sie in den Flur hinausging und im Nachbarbüro klopfte, wo Walter Finsmaier, der stellvertretende Abteilungsleiter, residierte.
„Herein!“
„Guten Morgen, Herr Finsmaier – “
„Frau Meister! Guten Morgen! Ich dachte schon, dass Sie kommen. Herr Bremer hat sich heute krankgemeldet.“
„Das ist sehr untypisch für ihn. Warum hat er mir nicht Bescheid gesagt? Das tut er sonst immer.“
Finsmaier sah sie auf eine Art an, die nichts Gutes verhieß. Elke deutete seinen Blick als ein stummes Wie-soll-ich’s-dir-schonend-beibringen?
„Sie sind eben erst gekommen, oder? Die Sache ist die, dass Herr Bremer heute Morgen kurz hier war, dann wurde ihm die Entscheidung des Vorstands mitgeteilt…“
Er sagte das, ohne Elke ins Gesicht zu sehen, was ihre böse Vorahnung bestätigte.
„Was? Der Vorstand hat schon entschieden? Es hieß doch, bis Ende der Woche – “
„Ja, hieß es. Aber dann ging alles ganz schnell. Der Vorstand hat einstimmig dafür plädiert, die Abteilungen Verkauf und Produktion zusammenzulegen.“
Elke öffnete den Mund, um ihre Bestürzung auszudrücken, aber sie fand keine Vokabeln, die ihrem Gefühl entsprochen hätten.
„Die Entscheidungen des Vorstands müssen schnellstmöglich umgesetzt werden. Herr Bremer – äh… wurde sozusagen eiskalt erwischt.“
„Das ist kein Grund, so blöd zu grinsen!“
Kaum hatte Elke diesen Satz ausgesprochen, hielt sie sich die Hand vor den Mund. Aber das kam natürlich zu spät. Während sie wie in Zeitlupe beobachtete, wie Walter Finsmaier zuerst erbleichte und dann rote Flecken auf Gesicht und Hals bekam, wurde ihr das ganze Ausmaß der Vorstandsentscheidung bewusst. Der Umstand, dass Finsmaier als stellvertretender Abteilungsleiter an seinem Schreibtisch saß, der Abteilungsleiter der ehemaligen Abteilung Verkauf jedoch nicht, war Beweis genug, dass für Fritz Bremer – zumindest vorerst – kein Platz mehr in der Firma war. Offenbar hatte Finsmaier in der Vorstandsetage die besseren Karten, sprich: er hatte Beziehungen zu dem einen oder anderen Vorstandsmitglied, die ihm eine führende Rolle in der neuen Gesamtabteilung sicherte. Was aber geschah mit der Sekretärin des fallengelassenen Abteilungsleiters? Hätte man gewollt, dass Elke Meister im neuen Team eine tragende Rolle spielt, wäre sie rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt worden. Dass sie von den Umwälzungen in der Firma erst auf eine Anfrage beim Untergebenen ihres Chefs hin erfuhr, war ein deutliches Indiz dafür, dass man sie für ersetzbar oder gar ihre Stelle für verzichtbar hielt.
„Frau Meister!“, brüllte indes Finsmaier. „Sie vergessen sich! Ein wenig mehr Contenance würde Ihnen guttun. Jedenfalls wenn Sie vorhaben, weiterhin bei Elektrofix Ihre Brötchen zu verdienen. Ein Wort von mir und Sie stehen auf der Straße! Das ist Ihnen schon klar?“
„Tu ich das nicht sowieso? Ich bin mir sicher, dass alle wichtigen Positionen in der neuen Superabteilung bereits besetzt sind. Habe ich recht?“
„Nicht ganz. Wir bräuchten noch jemanden im Empfang. Eine nicht unbedeutende Stelle. Sie hätten das Aussehen und – wenn Sie sich Mühe geben – auch das Auftreten, um die Abteilung für Besucher auf den ersten Blick – ähm… attraktiv erscheinen zu lassen. Ich könnte da ein gutes Wort für Sie einlegen.“
Das unbewusste Nervensystem ist eine sinnvolle Einrichtung, um das bewusste Gehirn von schwierigen Entscheidungsfindungen zu entlasten. Es reagiert viel schneller als der analysierende Verstand, weil es sofort erkennt, ob ein Ereignis einem vergangenen Erlebnis ähnelt, das für die Psyche unerträglich gewesen wäre. Damit das in Extremsituationen nicht geschieht, wird der Körper durch blitzartige Nervenimpulse lahmgelegt und dadurch geschützt, noch ehe das Bewusstsein begreift, was überhaupt passiert. So geschah es an diesem Morgen mit Elke Meister. Dabei kamen mehrere Faktoren zusammen, die ihre Psyche so sehr reizten, dass von einem kleinen Teil in ihrem Mittelgehirn, dem limbischen System, die Notbremse ausgelöst wurde. Sie sah geraume Zeit in Finsmaiers selbstzufriedenes Gesicht, seine kleinen, gierigen Augen, seine fettigen, schuppigen Haare, sein überhebliches Lächeln, sie roch sein aufdringliches Parfum und hörte seine unreine, bellende Stimme. Zugleich erschienen Bilder vor ihrem geistigen Auge – von Fritz Bremer, ihrem Chef, dem sie vertraut hatte, wie er unter dem Schock der unerwarteten Entscheidung zusammenbrach und in eine Depression fiel, und von ihr selbst, der ehemaligen Chefsekretärin, die genug verdiente, um sich teure Urlaube in USA und Südamerika und einen Luxussportwagen leisten zu können, und nun arbeitslos war. Hinzu kam eine Wut, die in ihr heraufzog wie ein Gewittersturm; es tobte ein Unwetter in ihr, das sie in sich einschließen musste, sodass die Blitze, die, wenn sie sie freigelassen hätte, Schlimmes angerichtet hätten, nun auf sie selbst herniedergingen. Das kostete sie den Rest an „Contenance“, den sie noch aufbringen konnte. Urplötzlich hatte sie Tränen in den Augen. Kurz darauf verkrampfte sich ihr Magen so heftig, dass sie sich über Finsmaiers Schreibtisch übergab. Wie in Trance schlug sie die Tür hinter sich zu und verließ das Firmengelände für immer.
Fred Sussman stützte sich mit den Händen auf seinen Knien ab und machte einige tiefe, keuchende Atemzüge. Dann richtete er sich auf, streckte die Arme in die Höhe und sah zufrieden hinüber zur schneebedeckten Kuppe des über 2000 Meter hohen Hagwilget Peak. Heute war er nur seine übliche Schneeschuh-Runde gelaufen, die etwa eine Stunde dauerte, aber im Sommer war er schon öfter bis ganz nach oben auf den Gipfel gewandert. Der Hagwilget Trail war eine kraftraubende Tour, für die man einen ganzen Tag einplanen musste, aber der Ausblick von dort war bei klarem Wetter atemberaubend. Südlich vom Gipfel erstreckte sich die endlos scheinende Gebirgskette der Rocky Mountains mit dem imposanten, 2500 Meter hohen Brian Boru Peak, während im Westen jenseits des Küstengebirges die glänzende blaue Silhouette des Pazifiks die Grenze des nordamerikanischen Kontinents markierte. Dazwischen schlängelte sich, ganzjährlich vom Schmelzwasser der hohen Gipfel gespeist, der Skeena River, der Nebelfluss, der jetzt, im Januar, tatsächlich meist unter Nebeln verborgen lag, weil sein Wasser wärmer war als die Luft in jenem engen Tal, in dem Freds neue Heimat Hazelton lag. Genauer gesagt, wohnte er in South Hazelton, wo er ein Motel betrieb; es gab auch noch ein New Hazelton, aber im Grunde reichte es aus, wenn man von Hazelton sprach, denn die ganze Gemeinde hatte nicht mehr als 250 Einwohner. Während die Bevölkerung in British Columbia in den letzten zwanzig Jahren stetig wuchs, hatte Hazelton einen Bevölkerungsschwund zu verzeichnen. Dass der Ort seit dem Ende des Goldrauschs überhaupt noch eine Einnahmequelle hatte, war den indianischen Ureinwohnern zu verdanken, die Gitxsan, was so viel wie „Volk vom Nebelfluss“ heißt. Ihre Kultur ist viele tausend Jahre alt. Darum hatte man in Old Hazelton ein Museumsdorf mit sieben Stammeshäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert errichtet, auf der Landzunge, wo sich der wilde Bulkley River in den ruhigeren, breiteren Skeena River ergießt. Das Museum präsentierte über 600 Exponate aus allen Lebensbereichen, darunter zeremonielle Masken, Insignien von Schamanen sowie antike Angel- und Jagdausrüstung. Auf dem Gelände gab es eine Schnitzschule, einen Souvenirladen, Totempfähle und Langhäuser, also genügend, um etliche Touristen nach Hazelton zu locken, oder Gitanmaax in der Sprache der Ureinwohner, was so viel wie „Volk der Birkenrinde-Fackel“ heißt. Ihr traditionelles Stammesgebiet umfasste ca. 33000 Quadratkilometer im Einzugsgebiet des Middle Skeena River von seinem Quellgebiet bis zu den nördlichen Nebenflüssen. Heute gibt es zwar ein Reservat für die First Nation, aber die Hälfte der Ureinwohner lebt außerhalb des Reservats. Darum herrscht seit längerem ein Rechtsstreit darüber, ob die Gitxsan dem Indian Act unterstehen müssen oder ihre Sprache und Kultur unbeschränkt ausüben dürfen.
Es gab für Fred keinen Ort, an dem er sich freier gefühlt hätte als auf diesem Aussichtsberg, aber nun war es Zeit, sich auf den Rückweg zu machen, da sich für den Nachmittag neue Gäste angekündigt hatten. Sein kleines Motel war im Winter selten ausgebucht, derzeit waren nur zwei der fünf Zimmer belegt, wie immer um diese Jahreszeit von Rucksacktouristen, Trampern mit monströsen Rucksäcken, schmutzig, verschwitzt und unrasiert. Sie waren froh um ein heißes Bad, so wie er, Fred, froh über jede Art von Gast war, selbst wenn es nur für eine Nacht war. Im Sommer und Herbst kamen relativ viele Gäste, nicht nur wegen des Freilichtmuseums, sondern wegen der unberührten Natur und der zahlreichen Wanderwege. Dafür hatte Fred im Winter mehr Zeit für seine eigenen Hobbys, Wandern, Laufen, Yoga, Meditieren. Wenn die Temperaturen auf unter zehn Grad minus fielen, blieb Fred auch gerne mal im Haus und las stundenlang alle möglichen Bücher, meist solche mit spirituellem Inhalt. Während er darüber nachdachte, wie er den neuen Gästen einen längeren Aufenthalt schmackhaft machen könnte, stapfte er zügig über seine eigenen Spuren vom Aufstieg bergab, entlang des halb verwilderten Pfades, der zwischen turmhohen Hemlocktannen und Douglasien ins Tal führte. Es war sehr kalt, der Reif an den Nadeln verlieh den Bäumen edle, strahlendweiße und glitzernde Hochzeitskleider und es war so still, dass Fred ab und zu stehenblieb und seinen Atem zurückhielt, um die Stille nicht zu zerstören. Er genoss es, seinem Körper wieder etwas abverlangen zu können. Mit seinen 42 Jahren konnten seine Beine solch einen Marsch in der Kälte locker wegstecken, ohne am nächsten Morgen einen Muskelkater zu beklagen. Das war nicht immer so.
Drei Jahre zuvor leitete Fred, damals hieß er noch Alfred Süßmann, eine eigene Software-Firma, die sich auf Programme für Kleinunternehmer spezialisiert hatte. Sie lief hervorragend, doch Fred hatte nicht damit gerechnet, dass der Support der Kunden zeitaufwändiger war als die Entwicklung der Software. Die Firma florierte und warf einen hohen Gewinn ab, doch der Preis, den Fred dafür bezahlen musste, war hoch. Bald wurde aus seinem 10-Stunden-Tag ein 16-Stunden-Tag. Auch das bewältigte er tapfer, bis ihm sein Körper die Grenzen aufzeigte. Er erlitt einen Burn-Out und fiel ein halbes Jahr aus. Als er sich wieder einigermaßen erholt hatte, folgte er dem Rat seines Arztes. Er verkaufte die Firma und ließ alles, was sich irgendwie nach Stress anfühlte, hinter sich. Er suchte nach alternativen Lebensweisen und stolperte über die Schriften des Paramahansa Yogananda, der vor einem halben Jahrhundert die Amerikaner mit seinen Vorträgen über das Kriya-Yoga begeisterte. Fred war von der Lebensweise des indischen Gurus begeistert und beschäftigte sich eingehend mit den hinduistischen Werken, den Veden und der Baghavad Gita. Er begriff, dass die Gier nach Reichtum, von der auch sein früheres Leben geprägt war, in eine Sackgasse führen musste. ‚Im Grunde‘, sagte sich Fred, ‚ist es egal, was ich tue und wo ich es tue, weil ich den wahren Reichtum nur in mir selbst finden kann. Also werde ich mir etwas suchen, was mir Spaß macht. Hauptsache, ich gerate nicht wieder in denselben Abwärtssog, dem ich soeben entkommen bin. Lassen wir den Zufall entscheiden!‘ Er holte seinen alten Schul-Globus vom Dachboden, gab ihm ordentlich Schwung, bis die Welt vor seinen Augen verschwamm, und stoppte ihn mit dem Zeigefinger: Kanada! Damit war es entschieden.
Mit dem Erlös aus den Firmenanteilen erkaufte er sich eine Arbeitserlaubnis. Dann buchte er einen One-way-Flug nach Vancouver. Dort mietete er sich einen Wagen und fuhr auf dem Sea-to-Sky-Highway Richtung Norden, zuerst an der Pazifik-Küste entlang, dann in die Berge, vorbei an klingenden Namen wie Brandywine Falls, Whistler Mountain, Mount Brew, dann weiter auf dem British Columbia Highway 97, der auch mit dem viel schöneren Namen Caribu Highway bezeichnet wird. Die endlosen, menschenleeren Wälder und die beeindruckende Bergwelt schenkten seiner geschundenen Seele genau das Gefühl von Freiheit, nach dem er sich in Deutschland vergebens gesehnt hatte. Je weiter er nach Norden vordrang, desto einsamer wurde die Gegend. Doch das störte Fred wenig, im Gegenteil, es spornte ihn sogar an. Er hätte ewig so weiterfahren können, mit gemächlichen 55 Meilen, während der V8-Motor seines Dodge Challenger bei niedrigen Drehzahlen schnurrte wie eine Katze auf der Ofenbank. Als es Abend wurde, leuchteten in der Ferne die Lichter einer Stadt auf. „Prince Georg“, las Fred auf der Ortstafel. Es war eine saubere Stadt mit hübschen Häusern. Es gab einen großen Supermarkt, ein Museum und sogar einen kleinen Flughafen. Fred suchte sich ein Hotel, aß mit großem Appetit zu Abend und schlief wie ein Stein. Als er am nächsten Tag die Gardinen an den Fenstern seines Hotelzimmers zur Seite zog, war er ein bisschen enttäuscht. Das hektische Treiben und der Verkehrslärm erinnerten ihn zu sehr an Deutschland. Außerdem schien die Stadt viel größer zu sein, als es nachts den Anschein hatte. Sofort war ihm klar, dass er sich wieder in das Auto setzen und seine Reise fortsetzen würde. An der nächsten großen Straßenkreuzung musste er erneut eine Entscheidung treffen. Auf dem Highway 27, der nach Westen führte, war deutlich weniger Verkehr als auf dem 97; das war ein Hinweis darauf, wohin seine Reise führen sollte, weit weg von Menschenansammlungen, dorthin, wo es so still war, dass man den eigenen Herzschlag wieder hören konnte. So fuhr er noch einige Stunden weiter, immer tiefer in die nördlichen Rocky Mountains hinein. Irgendwann fiel ihm auf, dass er seit etwa einer Stunde allein auf der Straße war. Während er die Fenster seines Autos herunterkurbelte und die kühle, reine, nach Tannenharz duftende Luft einsog, sagte er sich: ‚Bei der nächsten Ortschaft halte ich an und – so Gott will – lasse ich mich dort nieder.‘
Der Yellowhead Highway führte ihn an Hazelton vorbei, einer Siedlung, die so nichtssagend und unbedeutend war, wie es sich Fred seit seiner Erkrankung immer gewünscht hatte; sein Unterbewusstsein schützte ihn davor, auch nur annähernd mit einer Atmosphäre von Druck und Stress in Berührung zu kommen, wie es tags zuvor in Prince George geschehen war. Hier jedoch gab es nichts, was seinen inneren Frieden störte.
Er parkte seinen Wagen vor einem Haushaltswarengeschäft und erkundigte sich nach Wohnungen oder Häusern. Wie es der Zufall wollte, war der Besitzer eines Motels in South Hazelton kürzlich gestorben, und das Haus suchte einen Nachfolger. Niemals zuvor hatte sich Fred mit dem Gedanken getragen, ein Motel zu betreiben, und doch hatte er in diesem Augenblick nicht den geringsten Zweifel, dass es genau das war, was er gesucht hatte. Seine neue Existenz war ihm quasi in den Schoß gefallen. In einer Gemeinde mit negativer Bevölkerungsentwicklung ist der Bürgermeister in der Regel um jeden neuen Bürger dankbar, sodass es auch keinerlei bürokratische Barrieren gab. In wenigen Tagen war der Verkauf abgewickelt und Alfred Süßmann erhielt unter dem Namen Fred Sussman eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Seine Englischkenntnisse waren gut genug, um sich mit den Einheimischen anzufreunden, und da Fred kein Mensch mit hohen Ansprüchen war, wurden ihm von niemandem Steine in den Weg gelegt. Um das Motel betreiben zu dürfen, war es erforderlich, dass er dem Touristenverband beitrat. Das kostete ihn ein paar Dollar im Monat, aber auf diese Weise brauchte er sich nicht um Werbung zu kümmern. Ein weiterer Pluspunkt, der ihm besonders entgegenkam, war, dass dadurch Konkurrenz zu anderen Motelbetreibern von vorneherein ausgeschlossen war, weil die freien Betten von der Tourismuszentrale vergeben wurden.
Als er schweißnass an seinem Motel ankam, einem schlichten eingeschossigen Holzhaus mit rotem Ziegeldach und einem dekorativen, aus Naturstein gemauerten Kamin, stand bereits ein Wagen davor. Aus der Ferne konnte er zwei Insassen ausmachen. Zwar war er eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin um 14 Uhr zurückgekehrt, aber es war nicht ungewöhnlich, dass die Gäste vor der Zeit ankamen.
‚Was soll’s?‘, dachte Fred, ‚sie werden es überleben, mich in Sportkleidung zu sehen.‘
Mit seiner freundlichsten Miene trat er auf das Auto zu. Die Tür sprang auf und ein indianisch aussehender Herr mittleren Alters stieg aus.
„Mister Fred?“, fragte er.
„Ja, das bin ich. Fred Sussman.“
„Mein Name ist Theodore Smith. Ich bin der Cousin von Francis Smith.“
„Francis Smith? Hmm… Egal! Ich glaube, wir kennen uns. Ihnen gehört die Pinewood Ranch im Osten, nicht wahr? Ein herrliches Fleckchen Erde!“
Der Mann lachte verschmitzt.
„Oh ja! Das stimmt. Aber Sie kennen meinen Cousin ganz sicher. Er arbeitet im Tourismusbüro. Sie haben schon oft mit ihm gesprochen.“





























