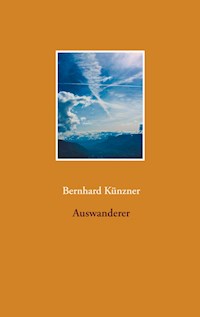4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du erwachst an einem Ort, den du nicht kennst, du bist verletzt und hast keine Erklärung dafür und du kannst dich nicht einmal mehr an deinen Namen erinnern. Ein Albtraum? Vielleicht. Vielleicht aber auch eine Möglichkeit, dich völlig neu zu erfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erwachen
Erste Kontakte
Meditation
Die Vergangenheit
Die Entscheidung
Träume
Bedrohungen und Leichtigkeit
Die Vernehmung
Remote Viewing
Epilog
I. Erwachen
Ich konnte dieses fremdartige Geräusch nicht zuordnen; ein rhythmisches Schnarren und Krächzen, dazwischen abgehackte Töne, die dem Aneinanderreiben zweier rostiger Eisenrohre ähnelten. Liebend gerne hätte ich weitergeschlafen, aber dieser Lärm drängte sich zu vehement und nachdringlich in mein Bewusstsein. Ein lichter Schleier vor meinen Augen zeigte mir an, dass ich im Begriff war, meine Augenlider zu öffnen. Zunächst wehrte ich mich dagegen, da ich befürchtete, dass die Welt, die mir meine fünf Sinne zeigten, weit weniger sanft und schonend sein würde als die Welt der Träume. Nach einem tiefen Atemzug wagte ich einen Blick in die Umgebung. Ich lag auf staubigen Holzdielen. Über mir erstreckte sich eine aufwändige Konstruktion aus kunstvoll ineinandergefügten, sich gegenseitig stützenden Balken, die ein schuppenförmiges Dach aus Tonschindeln trugen. Der Raum lag größtenteils im Dunkel, aber, soweit ich das erkennen konnte, bestanden die Wände aus grauem Tuffstein. Er besaß nur ein Fenster, das die Form eines gotischen Spitzbogens hatte. Nachdem sich meine Augen an den hellen Sonnenkorridor gewöhnt hatten, der durch das Fenster in den Raum ragte, von den Staubpartikeln in der Luft reflektiert wurde und einem soliden Quader glich, während der übrige Raum im Halbschatten blieb, sah ich mich in einem kahlen Dachzimmer von etwa je vier Metern Länge und Breite. An einer Ecke wies der Dielenboden eine Öffnung auf, die einer steilen Treppe Einlass bot, darüber war eine Nische in der Mauer mit einer Holztür.
Ich setzte mich langsam auf, was mir einige Beschwerden verursachte. Mein ganzer Körper schien zerkratzt, geprellt und verschrammt zu sein. Vor allem mein Kopf schmerzte bei der kleinsten Bewegung. Meine Kleidung war recht ordentlich, ich trug eine feine Hose und ein hellblaues Hemd, darüber eine Strickjacke. Leider war alles schmutzig und zerschunden, meine Hände machten davon keine Ausnahme. Der linke Ärmel war aufgerissen und blutbefleckt. Ein Blick auf meinen Arm offenbarte eine tiefe Wunde, die an den Rändern schwarz war, so, als ob die Haut durch einen heißen Gegenstand versengt worden wäre. Da ich es nicht besser wusste, ging ich davon aus, dass solch eine Wunde nur durch einen Streifschuss hervorgerufen werden konnte. Ich tastete mein Gesicht ab und entdeckte zahllose Kratzer und Abschürfungen. Über meinem rechten Auge fühlte ich eine nässende Wunde. Zudem war die Stirn an dieser Stelle arg geschwollen. Selbst die kleinste Berührung verursachte einen stechenden Schmerz. Nachdem ich mich, meiner allgemeinen Steifigkeit zum Trotz, endlich aufgerichtet hatte und einige Schritte gegangen war, war ich erst einmal beruhigt; mein Körper wies keinerlei ernsthafte Blessuren auf, die mich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt hätten. Eine Sache jedoch machte mir Sorgen. Wie üblich erwartete ich, dass meine Erinnerung mit meinem Erwachen zurückkommen würde, schleichend vielleicht, zäh, wie der Übergang vom Schlaf in den Wachzustand, doch so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte mich nicht entsinnen, wie ich hierhergekommen war.
Das Fenster war nicht verglast, sondern durch eine Längs- und zwei eiserne Querstangen gesichert. Draußen sah ich eine Wiese und ein Getreidefeld, die durch einen schmalen Pfad voneinander getrennt waren. Dahinter, etwa 200 Meter weiter, war ein bewaldeter Streifen, am Horizont eine niedrige Hügelkette. Unmittelbar zu meiner Linken verwehrte die schroffe Mauer eines Kirchturms die Sicht, zu meiner Rechten entdeckte ich, tief unter mir, einen verwilderten Garten mit Büschen und alten Obstbäumen, sowie eine windschiefe Scheune. Ich sah und hörte keinen Menschen, doch wenn ich mich weit nach vorne beugte und die Stelle am Fuße der Mauer beobachtete, entdeckte ich die Ursache des seltsamen Geräuschs, das mich geweckt hatte; es waren Hühner, die dort nach Nahrung pickten und dabei unentwegt gackerten, schnarrten und krächzten.
Ich setze mich wieder auf den Boden und versuchte meine wenigen Informationen zusammenzusetzen, in der Hoffnung, meine Erinnerung möge dadurch zurückkommen. Der Wunde an meinem Arm zufolge war möglicherweise von jemandem angeschossen worden. Das würde bedeuten, dass jemand aus einiger Entfernung auf mich geschossen hatte, sonst hätte er besser getroffen. Ich war also auf der Flucht vor jemandem. Ich war gelaufen, vermutlich nachts durch den Wald, daher die ganzen Kratzer auf meinem Körper. Schließlich habe ich Zuflucht in diesem Gebäude, wohl eine alte Dorfkirche, gesucht, war die steile Treppe hochgestiegen und hier oben gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen. Ja, so könnte es gewesen sein. Aber warum sollte mich jemand verfolgen und auf mich schießen? Hatte ich ein Verbrechen begangen? Hatte ich selbst jemanden verletzt oder gar getötet? Ob diese Personen immer noch nach mir suchten?
Ich schloss meine Augen, weil ich hoffte, mich dadurch besser zu konzentrieren und an Einzelheiten erinnern zu können. Ich musste doch noch wissen, wie ich diese steile Treppe hochgestiegen war! Ich musste mich doch wenigstens an meinen Namen erinnern! Wie alt war ich? Woher kam ich? Die Erkenntnis, ein Unbekannter in einem unbekannten Leib zu sein, erschreckte mich. Mein Herz schlug heftig gegen meine Brust. Ich konnte nicht einmal sagen, in welchem Jahr wir lebten. Eine Folge meiner Kopfverletzung zweifellos! Partielle Amnesie. So etwas gibt sich mit der Zeit. Wieso konnte ich mich verdammt nochmal an diesen Begriff erinnern, aber nicht an meinen Namen? Nicht an das, was gestern war oder vorgestern? War ich ein Psychopath, eine Gefahr für meine Umgebung, aus einem Hochsicherheitstrakt entflohen? Oder umgekehrt ein ganz normaler Bürger, der von einem Psychopathen gejagt wurde? Ich suchte meine Kleidung nach Taschen ab, um darin einen Hinweis auf meine Identität zu finden, und ertastete einen kleinen Schlüssel, der an einem Band um meinen Hals hing; immerhin etwas. Solche Schlüssel waren bei Vorhängeschlössern üblich. Nun wusste ich wenigstens, dass ich etwas besaß, was gegen einen Einbruch gesichert werden musste. Die Taschen meiner Hose und meiner Jacke waren allesamt leer. Damit war klar: Ich musste hier weg, wenn ich etwas über mich herausfinden wollte. Aber was, wenn ich meinem Verfolger in die Arme lief? Was, wenn öffentlich nach mir gefahndet wurde und überall in der Gegend Plakate mit meinem Gesicht hingen? Wie auch immer, ich konnte nicht ewig hier oben bleiben. Ich musste etwas essen und trinken. Außerdem hatte ich ein dringendes Bedürfnis, das ich nicht hier oben erledigen konnte.
Langsam, Schritt für Schritt, so leise wie möglich, stieg ich die steile Treppe hinab, immer vorsichtig um die nächste Ecke spähend und nach Stimmen lauschend. Die nächste Ebene entsprach hinsichtlich der Größe meinem Raum – ein Fenster, eine Tür, die übernächste ebenso. Dann kam ich in einen größeren Bereich, von dem zwei Flure abgingen. Ich folgte dem einen und gelangte auf eine ausladende Empore, die einen Blick in das Kirchenschiff offenbarte. Mir fiel als Erstes auf, dass alle Bänke entfernt worden waren, vermutlich wurde das Holz anderweitig benötigt. Die einst bunten Bleiglasfenster waren stumpf geworden oder zerbrochen. In einem ähnlichen Zustand war der Altar, der aus einem großen Ölgemälde bestand, welches in einen vergoldeten Holzrahmen gespannt war und den Heiligen Georg darstellte, wie er dem Lindwurm den tödlichen Stoß versetzte. Das einst wohl farbenprächtige Gemälde war aber im Laufe der Jahre fast bis zu vollkommener Schwärze nachgedunkelt und glich auf den ersten Blick eher einer Abbildung von Dantes Inferno. Hinter mir ragten die Pfeifen einer Orgel auf, die ordentlich in Reih und Glied standen und die Zeiten unbeschadet überdauert hatten. Eine dicke Staubschicht auf den Tasten des Manuals ließ darauf schließen, dass sie seit vielen Jahren nicht mehr gespielt worden war.
Von Neuem schloss ich die Augen in der Hoffnung, meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Ja, ich erinnerte mich daran, dass es verschiedene Baustile gab, Romanik, Gotik, Barock, und auch daran, dass in der Gegend, aus der ich stammte, in fast jedem kleinen Ort eine gotische Kirche stand. Spontan fielen mir die Namen der Heiligen ein, die in Bildern und Skulpturen dargestellt waren, aber meines eigenen Namens konnte ich mich nicht entsinnen. Ich vertraute darauf, dass dies nur ein vorübergehender Zustand war und es nur einer geeigneten Assoziation bedurfte, um die Erinnerungslücken zu füllen.
Da die Kirche offensichtlich menschenleer war, traute ich mich, die steinerne Treppe hinunterzusteigen, die zum Eingangstor führte. Mit einiger Anstrengung schaffte ich es, einen der schweren Eichenholzflügel aufzuziehen. Die Wärme, die mich draußen empfing, überraschte mich. Sogar im Schatten war es angenehm warm. Ich schützte meine Augen vor dem gleißend hellen Sonnenlicht, indem ich den Kopf nach unten neigte.
In diesem Moment geschah etwas Außergewöhnliches. Als ich meinen Blick senkte, sah ich Grashalme zu meinen Füßen, die leicht im Wind hin und her schwankten. Einige Sekunden lang beobachtete ich die aufgeregten, zitternden Bewegungen der Halme, dann überfiel mich eine nie gekannte, unermessliche Ruhe und die Zeit schien still zu stehen. Einen Atemzug lang galt meine ganze Aufmerksamkeit, mein ganzes Sehnen und meine ganze Liebe diesem zarten Gewächs. Gleichzeitig sah ich mich als unendlich glücklichen Menschen ohne jedes Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob dieser Zauber von den Grashalmen her rührte oder von dem ganzen Bildausschnitt vor meinen Augen oder von der Komposition aus Licht, Wärme, Luft und Bewegung, jedenfalls war es, als ich wieder anfing zu denken, mein größtes Bestreben, diesen Moment einzufangen und für alle Zeit in meinem Gedächtnis aufzubewahren. Dazu bedurfte es eines Gefühls, das als Anker für meine Erinnerung dienen sollte. Noch einmal durchlebte ich es bewusst in seiner ganzen Tiefe. Um es für immer zu speichern, brauchte es einen Namen. Ich nannte es „absolutes Glück“. Ich wartete noch lange, ehe ich mich von diesem Ort löste, in Würde und Wertschätzung, um diese heilige Empfindung nicht allzu schnell zu verlieren. Noch Minuten danach bewegte ich mich überaus vorsichtig und behutsam, weil ich die Kostbarkeit allen Lebens, meines eingeschlossen, begriffen hatte und fürchtete, sie mit einer unbedachten Handlung zu verletzen.
Wieder war es das Geschrei der Hühner, das mich aus meiner übersinnlichen Gedankenwelt riss. Zugleich erinnerte ich mich daran, dass ich Hunger hatte. Ein banales Bedürfnis angesichts der heiligen Weihe, die ich soeben empfangen hatte! Ich folgte dem Gackern der Hühner bis zu ihrem Stall und suchte nach Eiern. Es war nicht schwer; in ihren Gelegen fand ich ein Dutzend Eier und nahm mir drei davon. An der Kirchenmauer entlang, dann geduckt, wie es eben ein Dieb macht, schlich ich mich zu den Obstbäumen und schnappte mir ein paar Äpfel und Mirabellen. Von hier aus sah ich auch, dass die Wiese in etwa fünfzig Metern Entfernung an einen Wald grenzte. Das Gras war in der Nähe des Waldes nicht mehr gemäht worden. Daher lief ich in geduckter Haltung weiter, weil ich hoffte, hier noch Beeren oder Nüsse zu finden. Doch stattdessen entdeckte ich etwas viel Besseres! Direkt am Waldrand ließ mich ein munteres Glucksen und Plätschern innehalten; eine Quelle floss in einem steinigen Bett an den mächtigen Stämmen der Fichten vorbei, als hätte ich sie gerufen. Ich beugte mich hinunter und schlürfte genussvoll das kühle, klare Wasser.
Wenig später saß ich wieder in meinem Dachzimmer und erfreute mich an meinem erfrischenden, nahrhaften Mahl. Natürlich kostete es mich ein wenig Überwindung, die Eier roh zu essen, weniger aus Ekel denn aus der Erinnerung an den Duft von gekochten oder gebratenen Eiern. Auch das Salz vermisste ich. Ich wusste das alles, aber ich konnte mich nicht entsinnen, wo ich dergleichen gegessen hatte. Ich hätte darüber in Panik ausbrechen können, aber nun nistete sich ein neues Gefühl in mein Bewusstsein ein. Ich hatte erfahren, dass ich unabhängig von einer Identität glücklich sein konnte. Diese Erkenntnis wirkte in mir fort und veränderte mich. Tatsächlich war nun die Unruhe, die mich beim Aufwachen gepackt hatte, wie weggeblasen. Während ich meinen Blick wieder in die Ferne schweifen ließ, bis zu den Hügeln unter dem Horizont, erfasste mich erneut ein Gefühl tiefster Zufriedenheit – absolutes Glück. Lange stand ich da und betrachtete den Zug der Wolken am Himmel. Die Schwalben flogen tief und von Westen her nahte eine dunkle Regenfront. Eine Zeit lang genoss ich noch die wärmende Mittagssonne auf Gesicht und Armen, dann schoben sich die ersten Ausläufer der feuchtschweren Wolken davor und es wurde merklich kühler. Kurz darauf zeigten Windböen an, dass nun kältere Luftschichten das Wetter bestimmten. Als die ersten Tropfen vom Himmel fielen, wollte ich instinktiv das Fenster schließen, aber das war natürlich nicht möglich. Daher musste ich zusehen, wie der Boden vor dem Fenster zuerst feucht wurde und sich schließlich eine Pfütze bildete. Man bräuchte ein Gefäß, um das Wasser zu sammeln, dachte ich. Wasser braucht man für viele Dinge, ohne Wasser kann man nicht überleben! Schnell stieg ich die Stufen hinunter bis vor das Kirchenportal, wo es noch regenschützt war, und blickte mich um. Ich beschloss, zu dem alten Schuppen zu laufen, dort würde sich finden, was ich suchte. Dieser war nur etwa zwanzig Meter entfernt, doch als ich dort ankam, war ich bereits völlig durchnässt. Glücklicherweise war die Tür offen. Es dauerte einige Sekunden, ehe ich in der Dunkelheit etwas erkennen konnte. Dann sah ich schemenhaft einen Heukarren, einen alten Traktor und verschiedene landwirtschaftliche Geräte. Darunter waren auch ein paar Strohballen, eine Decke und so etwas wie ein Schweinetrog, alles Gegenstände, die ich gut gebrauchen konnte, um mir meinen Aufenthaltsort bequemer zu gestalten. Als ich die Decke packte, löste sich eine Wolke aus Staub und Stroh, die mich zwang, die Augen zu schließen. Auch der Geruch, der sich dabei löste, war wenig einladend, aber ich tröstete mich damit, dass ich die Decke ohnehin zuerst vom Regenwasser waschen ließ.
Ich lud die Decke und einen Strohballen in den Trog und hievte ihn hoch. Es war schwerer als ich dachte. Mit Mühe schaffte ich es, alles in die Kirche zu schaffen. Zuerst trug ich den Strohballen nach oben, dann die anderen Gegenstände. Bei besserem Licht betrachtet entpuppte sich der Schweinetrog als Kinderwiege, die sogar bunt bemalt war. Ich stellte sie vor das Fenster, in der Hoffnung, sie würde sich mit Regenwasser füllen. Die Decke schüttelte ich am Fenster erst einmal richtig aus. Der Strohballen war feucht und voller Ungeziefer. Wenn ich wollte, dass er rasch trocknete, musste ich ihn vollständig auseinanderreißen und das Stroh über den Boden in meiner Kammer verteilen. Mehr konnte ich im Augenblick nicht tun. Ich setzte mich an eine einigermaßen windgeschützte Ecke und legte mir die Decke um die Schultern, da ich in meinen nassen Kleidern zu frieren begann. Von dort aus beobachtete ich die Wiege und wartete geduldig darauf, dass sich der Regen darin ergießen möge. Doch inzwischen hatten der Wind und der Regen nachgelassen und nur noch vereinzelt jagte ein böiger Schauer ein paar Tropfen in meine Kammer. Der Boden der Wiege war nass geworden, aber es reichte nicht annähernd aus, um als Trinkwasserreservoir zu dienen. Während ich etwas trübsinnig vor mich hin dachte, kam mir plötzlich ein beunruhigender Gedanke. Ich hatte die Reste meines Mahls – Eierschalen und Obstkerne – achtlos aus dem Fenster geworfen. Wenn dort unten jemand vorüberging, der nach einem Flüchtigen suchte, brauchte er nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu begreifen, dass sich hier in unmittelbarer Nähe ein Mensch befand. Eilig erhob ich mich und stieg hinunter, um die Reste einzusammeln. Als ich dort unten im Gras kniete, fiel mir aber etwas anderes auf. Es gab eine Stelle am Boden, an der sich eine große Pfütze gebildet hatte. Ich vermutete, dass dort lehmiger Boden war, sodass das Wasser nicht tief ins Erdreich dringen konnte. Wenn ich meine Wiege schräg in die Pfütze tauchte und sie als Schöpfkelle verwendete, könnte ich gut zwei bis drei Liter damit schöpfen. So müsste ich nicht mit der schweren Wiege den Weg bis zur Quelle am Waldrand gehen und riskieren, dabei von jemandem beobachtet zu werden.
Also ging ich noch einmal mit der Wiege drei Stockwerke nach unten. Doch als ich die Torflügel öffnete, erschrak ich heftig. Drüben am Schuppen stand ein alter Mann. Die Tür war geöffnet und er sah hinein und kratzte sich am Kopf, als hätte er vergessen, was er dort suchen wollte. Rasch schloss ich den Torflügel wieder. Der Mann stand seitlich zur Kirche, also sollte er mich nicht bemerkt haben. Aber gewiss war ihm aufgefallen, dass jemand in seinem Schuppen war und etwas daraus entwendet hatte. Ich hatte vom Haupteingang der Kirche aus keine Möglichkeit, ihn weiter zu beobachten, also eilte ich mit großen Schritten wieder hinauf in die Dachkammer und lugte aus dem Fenster. Doch inzwischen war die Tür zum Schuppen wieder geschlossen und der Mann war nicht mehr zu sehen. Wenn er nun nach mir suchte? Zum Glück hatte ich die Essensreste kurz zuvor entfernt, auch hatte ich das Gras nirgendwo niedergetreten, sodass er nicht darauf schließen musste, dass jemand von der Kirche aus in seinen Schuppen eingedrungen war. Aber wenn er derjenige war, der mich gestern verfolgt und angeschossen hatte, dann würde er stutzig werden, da er mich ja genau in dieser Umgebung aus den Augen verloren hatte. Womöglich war er in diesem Augenblick schon auf der Suche nach mir! Er würde die Kirche ganz genau durchsuchen und jeden Stein umdrehen, um mich zu finden. Fieberhaft überlegte ich, ob ich die Türe zu meiner Kammer versperren konnte, aber mir fiel nichts Besseres ein, als mich direkt mit dem Rücken gegen die Türe zu lehnen und darauf zu hoffen, dass er sie für verschlossen hielt und seine Suche aufgab. Ich drückte mein Ohr gegen die Tür und horchte, ob ich nicht etwa seine Schritte auf den Treppen hören würde, aber es blieb still. Lediglich die Hühner gaben ihre monotonen Gackergeräusche von sich, als wäre nichts geschehen. Ich harrte so lange an der Tür aus, bis ich sicher sein konnte, dass niemand mehr nach mir suchte. Ich versuchte mich damit zu beruhigen, dass ich mir einredete, er sei rein zufällig vor dem Schuppen gestanden. Dort drinnen war es so dunkel, dass er das Fehlen solch unbedeutender Gegenstände wie einer alten, verstaubten Wiege kaum bemerken konnte. Langsam entspannte ich mich wieder. Aber ich nahm mir, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Vor allem durfte ich mein Versteck tagsüber nicht mehr verlassen. Ich stellte die Wiege wieder an ihren Platz unter dem Fenster und begann damit, das inzwischen getrocknete Stroh so auf dem Boden zu verteilen, dass es eine einigermaßen bequeme Lagerstatt bildete.
Während ich auf meinem behelfsmäßigen Bett lag und meine Situation überdachte, hörte ich ein sehr leises Geräusch, das mir bisher noch nicht aufgefallen war, ein sanftes, aber hastiges Kratzen und Tappen. Ich konzentrierte mich darauf und blickte in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Und schon hatte ich den Verursacher gefunden: Es war eine Maus, die von den wenigen im Stroh verbliebenen Körnern angelockt worden war. Sie war nur eine Armlänge von mir entfernt, sodass ich sie gut beobachten konnte. Ich blieb ganz still liegen, um sie nicht zu verscheuchen. Intensiv schnuppernd bewegte sie sich zwischen den Strohhalmen hin und her, immer wieder innehaltend und nach allen Richtungen spähend, ob nicht von irgendwoher Gefahr drohte. Sobald sie ein Korn gefunden hatte, nagte sie daran herum, fraß aber offenbar nicht das ganze Korn auf, sondern lief damit in Windeseile zu einem Versteck in der Wand oder unter dem Fußboden. Das wiederholte sich einige Male, dann wurde sie mutiger und wagte sich noch näher an mich heran. Sie hatte die Reste meines Essens gewittert, Eierschalen und Obstkerne, und untersuchte sie auf Verwertbarkeit. Ich verhielt mich so still wie möglich.
Vorsichtig bewegte ich meinen Kopf, um sie weiterhin mit den Augen verfolgen zu können, doch das war der Maus dann doch zu gefährlich und wie der Blitz sausten ihre kleinen Beine über die Holzdielen und sie verschwand in ihrem Versteck. Ich stellte mir vor, dass dort ihre Jungen in einem Nest auf ihr Futter warteten und sich nun gierig auf die vorgekauten Körner stürzten. Ich bemerkte, dass ich bei dem Gedanken lächelte. Ich freute mich tatsächlich darüber, dass ich nicht alleine hier oben wohnen musste, sondern possierliche Mitbewohner hatte. Ich nahm mir vor, in Zukunft bei der Suche nach Nahrung an die Mäusefamilie zu denken.
Doch ein anderer Gedanke bemächtigte sich nun meiner so unvermutet, wie sich an einem wolkenlosen Himmel innerhalb von Minuten ohne Vorwarnung Gewitterwolken auftürmten. Ergab es überhaupt einen Sinn, sich hier häuslich niederzulassen? Wäre es nicht vernünftiger, so weit wie möglich von hier zu verschwinden, um meine Verfolger abzuschütteln? Meine Finger ertasteten den kleinen Schlüssel, den ich um den Hals trug. Wenn ich diese Gegend hier verließ, würde es mir noch schwerer fallen, mich zu erinnern, wer ich war und woher ich kam. Ich müsste wahrscheinlich aufgeben, was in dem verschlossenen Fach, zu dem der Schlüssel passte, aufbewahrt war. Ich grübelte und grübelte, bis mich die Dämmerung umfing, für mich das Zeichen, nach Essbarem zu suchen.
Mein erster Weg führte mich zum Hühnerstall. Ich ahnte, dass die Hühner bereits in Schlafstarre auf ihrer Stange saßen und suchte im Heu nach Eiern. Und richtig: Wieder fand ich welche und nahm fünf Stück, ohne dass die Hühner lautstark dagegen protestierten. Weiter schlich ich mich zu den Obstbäumen, pflückte mir wieder Äpfel und Mirabellen. Auf dem Rückweg trat ich in die große Pfütze an der Kirchenmauer. Mir fiel auf, dass mein Mund völlig ausgetrocknet war und dass ich den ganzen Tag noch nichts getrunken hatte. Bis zur Quelle wagte ich mich nicht mehr vor. Der Ort war von allen Seiten aus einsehbar. Da ich kein Gefäß hatte, um Wasser mit in meine Kammer zu nehmen, legte ich mich auf den Boden und schöpfte mit meinem Händen Wasser aus der Pfütze. Es war angenehm kühl, aber es schmeckte erdig und abgestanden. Trotzdem trank ich so viel, wie mir zuträglich schien. Wie konnte ich sicher sein, dass die Pfütze nicht morgen wieder versiegt war? Zu guter Letzt ging ich bis an den Rand des nahen Getreidefeldes und riss einige der fast reifen Ähren ab. Dann trug ich meine kostbaren Schätze nach oben. Ein Ei und einen Apfel verschlang ich sofort, den Rest hob ich mir für den kommenden Tag auf. Die Getreidehalme legte ich an die Stelle, an der die Maus ein- und ausgegangen war. Nachdem ich meine Decke ausgeschüttelt und das wenige Stroh, das mir als Matratze diente, durchlüftet und wieder zu einer weichen Unterlage zusammengeschoben hatte, kam auch mein kleiner langschwänziger Mitbewohner aus seinem Loch und holte seine Abendmahlzeit ab. Es erfüllte mich mit Freude, dass ich etwas von meinen Vorräten abgeben durfte.
An diesem Abend sah es nicht mehr nach Regen aus, im Gegenteil, der Himmel war wolkenfrei und zeigte mir seine ganze Sternenpracht. Ich legte mich unter das Fenster und ließ mich von der unfassbaren Pracht verzaubern. Vielleicht hätte der eine oder andere angesichts der unendlichen Weite des Nachthimmels verzagt und sich klein und unbedeutend gefühlt, gleich einem Spielball unbekannter Mächte, nicht wertvoller als ein Sandkorn am Grunde des Ozeans. Ich aber fühlte etwas anderes. Ich konnte die Sterne als Engel wahrnehmen, die neugierig und liebevoll auf mich herabsahen. So wie ich interessiert und angetan von ihrer Niedlichkeit meine Maus betrachtete, stellte ich mir am Firmament eine Engelschar vor, die in das zerbrechliche Menschenkind unten auf diesem winzigen Planeten verliebt war, das emsig nach Nahrung und Schutz suchte und mit großen, verständnislosen Augen zu ihnen hochblickte. Ich war mir sicher, dass sie nicht zuließen, dass mir etwas zustoßen könnte.
Doch schon eine Stunde später war es um meine Zuversicht geschehen. Ich war schnell eingeschlafen, aber ein schmerzhaftes Leibzwicken hatte mich unsanft wieder geweckt. Mein Bauch war so stark aufgebläht, dass ich fürchtete, etwas könnte zerplatzen, wenn ich nicht unverzüglich losließ, was sich in meinen Gedärmen zusammengebraut hatte. Ich erhob mich gekrümmt vor Krämpfen und wollte zur Tür eilen, doch ein schneidender Schmerz zwang mich dazu, meine Zurückhaltung aufzugeben. Wehrlos gegen den übermächtigen Druck in meinem Bauch musste ich zulassen, dass ich in meine Kammer kotete. Zuerst war ich erleichtert, da der Schmerz nachließ. Doch dann wurde mir bewusst, was ich getan hatte, und es ekelte mich vor mir selbst. Ich hatte keine Möglichkeit, meinen Körper zu reinigen, außer vielleicht mit meiner eigenen Kleidung. Also zog ich meine Strickweste und mein Hemd aus und opferte mein Unterhemd, das aus feinem Baumwollstoff bestand und daher zur Reinigung geeignet war. Mit der linken Hand hielt ich mir die Nase zu, während ich mit der rechten den weichen Kot notdürftig zusammenwischte. Danach wollte sofort wieder zum Kirchenportal hinabsteigen, um das Hemd zu leeren und in der Pfütze abzuwaschen, doch in der Dunkelheit stieg ich zu allem Überdruss in meinen eigenen Kot; ich hatte eine Stelle übersehen. Ich stieß einige deftige Flüche aus, wofür ich mich sogleich zutiefst schämte, denn die Maus saß daneben und schaute mir zu, als wolle sie sagen: „Wie kann man nur sein eigenes Nest beschmutzen?“ Bebend vor Wut nahm ich nun auch noch mein feines Hemd, um mir den Kot vom Fuß zu wischen. Um die Exkremente loszuwerden, blieb mir nichts anderes übrig, als zu versuchen, möglichst viel davon in meine Hemden zu packen. Ich hielt die Luft an und atmete erst ein, wenn es unbedingt nötig war, und machte ich mich auf den Weg nach unten. Doch schon nach der ersten Treppe spielten meine Gedärme erneut verrückt und zwangen mich dazu, mich noch einmal zu entleeren. Daraufhin fühlte ich mich so schwach, dass ich für eine Weile auf der Treppe liegen blieb. Ein übler Geruch stieg mir in die Nase, sodass sich auch noch mein Magen verkrampfte. Nur mit Mühe konnte ich den aufkommenden Brechreiz verdrängen. Der Weg nach unten erschien mir plötzlich unendlich weit. Schlagartig war mir so kalt, dass ich zu zittern begann. Ich ließ die verschmutzten Hemden liegen und kroch auf allen Vieren zurück in meine Kammer. Dort zog ich die Decke über meinen Körper und schlief auf der Stelle ein.
Ich erwachte früh, weil mich der abscheuliche Gestank in meiner Kammer weckte. Nicht einmal die Maus ließ sich blicken. Außerdem hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Meine Zunge klebte am Gaumen, ich musste unbedingt etwas trinken. Aber was? Enttäuscht sah ich in die Wiege; sie war staubtrocken, es hatte wieder nicht geregnet. Keinesfalls durfte ich noch einmal aus der Regenpfütze trinken. Bestimmt war sie mit Keimen verunreinigt, die meinen Durchfall verursacht hatten. Obwohl ich keinen Appetit hatte, zwang ich mich, einen Apfel zu essen. Danach fühlte ich mich ein wenig besser. Ich dachte nach…
II. Erste Kontakte
Ich durfte meine Gesundheit nicht noch einmal so leichtsinnig aufs Spiel setzen. Ich wusste zwar nicht, wer ich war und woher ich kam, aber ich war im Wesentlichen gesund, jung und kräftig und mein Verstand funktioniert leidlich gut. Darauf musste ich aufbauen. Es war meiner Gesundheit sicherlich nicht zuträglich, hier in diesem stinkenden Loch zu leben. Auch wenn ich nichts besaß außer den Kleidern an meinem Leib, so wollte ich dennoch eine gewisse Würde bewahren und mich nicht zu einem verkommenen Subjekt entwickeln, um das jeder, der es von Weitem sieht, einen Bogen macht. Daher machte ich mich als Erstes daran, die Spuren meines nächtlichen Missgeschicks zu beseitigen. Hätte ich nur ein wenig Wasser gehabt, wäre es im Handumdrehen geschehen. Mein ausgetrockneter Mund gab nicht einen Tropfen Speichel her. Da ich aber nicht noch ein Kleidungsstück opfern wollte, versuchte ich, die angetrockneten Exkremente mit Stroh von den hölzernen Stufen zu reiben. Zusätzlich verwendete ich den Saft eines Apfels dafür, die harten Krusten zu lösen. Das Ergebnis war mäßig, aber ich war zufrieden damit. Als Nächstes musste ich meine verschmutzten Hemden los werden. Ich plante, sie in dem nahegelegenen Wäldchen unter Laub zu vergraben, und ging wieder die drei Stockwerke hinunter. Doch als ich am Eingang der Kirche stand, hörte ich Stimmen. Ich versteckte mich rasch in einer Nische und verhielt mich so ruhig wie möglich. Verstehen konnte ich nichts von dem Gespräch, aber es dauerte länger als ich gehofft hatte. Ich wollte nicht mehr warten, darum suchte ich nach einem anderen Ausgang. Ich ging an der Wand entlang, bis ich an eine Seitentür kam, doch die war verschlossen. Ich fand den Zugang zur Sakristei offen, doch von dort aus ging ebenfalls keine Tür nach draußen. Während ich mit meinen stinkenden, ekligen Hemden vor dem Altar stand, drang vom Haupteingang her ein Lichtstrahl in die Kirche. Eilig versteckte ich mich hinter dem Altar. Ein Mann trat ein und ging mit schnellen Schritten auf mich zu. Ob er mich gesehen hat?
Doch kurz vor dem Altar ging er nach rechts zur Treppe. Ob er von meinem geheimen Aufenthaltsort wusste? Ich wagte nicht, aus meinem Versteck herauszukommen, da inzwischen noch weitere Stimmen in unmittelbarer Nähe zu hören waren. Ängstlich blieb ich in hockender Haltung sitzen. Dann wurde mir klar, was der Mann in der Kirche zu suchen hatte. Er läutete die Glocken! Ihr mächtiger Klang dröhnte durch die Kirche, dass sogar der Altar zu vibrieren begann. Währenddessen wurde das Portal weit geöffnet und die Gläubigen traten andächtig ein. Ein ganzer Menschenstrom erfüllte die Kirche und als die Glocken aufhörten zu schlagen, waren bestimmt an die einhundert Menschen gekommen. Ich befand mich in einer misslichen Lage. Ich konnte mein Versteck nicht verlassen, ohne gesehen zu werden. Aber wenn nur ein Mensch einen Blick hinter den Altar werfen würde, musste er mich sehen; so wie der Pfarrer, der als letzter eintrat und nun vor dem Altar niederkniete. Ich betete darum, dass er meinen Gestank nicht riechen möge und nahm dankbar zur Kenntnis, dass er sich sogleich an die Gläubigen wandte.
Den Eingangsworten des Pfarrers nach zu urteilen, war die Kirche ein bekannter Wallfahrtsort, in dem nur in Ausnahmefällen gepredigt wurde. Ich entspannte mich ein wenig, da ich nur das Ende der Messe abwarten musste und die Kirche wieder für mich allein in Anspruch nehmen konnte, sobald sie der letzte Wallfahrer verlassen hatte. Doch dann kam der Mesner, der eben die Glocken geläutet hatte, unvermutet auf mich zu. Er hatte die heiligen Gegenstände für die Eucharistie bei sich, und wollte sie offenbar in der Nähe des Altars abstellen. Ich konnte nichts anderes tun, als zu warten, wie er reagieren würde, wenn er mich entdeckte.
„Was machen Sie denn hier?“, fragte er erstaunt. Ich wusste keine Antwort. Ich hockte vor ihm wie ein armer Büßer und schüttelte den Kopf. Der Mesner schwieg einen Moment; bestimmt dachte er, dass es klüger wäre, kein Aufsehen zu erregen und dadurch die Messe zu stören. So sagte er nur: „Sie warten hier!“ Dann nahm er seinen Platz ein und setzte eine fromme Miene auf. Ab und zu drehte er seinen Kopf zu mir und sah mich streng an, wolle er sagen: „Du kommst auch noch dran!“