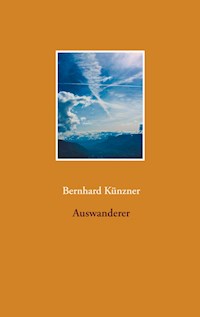9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Heinrich Kramer, 40, ist mit seinem durchschnittlichen Leben zufrieden. Seine Frau Nelly sieht das anders. Er hofft, seine Ehe mit oberflächlichen Schönheitskorrekturen zu retten, muss aber erkennen, dass er auf diese Weise den Ansprüchen seiner Frau nicht genügen kann. Unverhofft erscheint ihm ein Wesen aus einer anderen Dimension, ein 15jähriges Mädchen, Maria Soginow, geisterhaft und doch real. Heinrich hat Angst vor ihr und will sie loswerden, doch ausgerechnet Nelly lässt sich von Maria in die geistige Welt hineinziehen und beobachtet fasziniert, wie sie die Geschicke der Vergangenheit mit ihren eigenen Gedanken verändern kann. Heinrichs Leben wird durcheinandergewirbelt. Er steht vor der Wahl, sich ängstlich zurückzuziehen oder sich mit der Zwischenwelt auseinanderzusetzen. Als er erkennt, dass ihn jede Begegnung mit der geistigen Welt zu einer wegweisenden Entscheidung drängt, beginnt er zu begreifen, dass er dem Geheimnis eines erfüllten Lebens auf der Spur ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernhard Künzner
Besuch aus der Zwischenwelt
© 2023 Bernhard Künzner
ISBN
Softcover:
978-3-347-89307-8
ISBN
Hardcover:
978-3-347-89308-5
ISBN
E-Book:
978-3-347-89311-5
ISBN Großschrift: 978-3-347-89312-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Besuch aus der Zwischenwelt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Besuch aus der Zwischenwelt
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
Ich war hochkonzentriert, obwohl es mir nicht leichtfiel, meine fünf Sinne beieinander zu halten. Wie so oft in feuchtfröhlicher Gesellschaft war der Zeitpunkt gekommen, an dem mir klar war, dass ich zu viel getrunken hatte. Aus Trotz, um mir zu beweisen, dass ich mich den Wirkungen des Alkohols nicht einfach so ergab, setzte ich mich gegen den Nebel in meinem Kopf zur Wehr. Meine Frau Nelly war an diesem absurden Verhalten nicht unschuldig. Ich wusste, dass sie mich umso aufmerksamer kontrollierte, je betrunkener ich war. Also bemühte ich mich nach Leibeskräften, ihr durch reflektierte Äußerungen zu beweisen, dass ich noch klar im Kopf war. Jetzt war die Chance dazu gekommen! Ich könnte das Spiel gewinnen!
Ungeduldig blickte ich auf die Karten in meiner Hand, eine gelbe Acht und eine blaue Acht. Wenn mein Vordermann Roland nun eine Karte mit der Farbe Gelb oder Blau ausspielte, hätte ich den Sieg in der Tasche. Gleich war er am Zug. Alle schauten gespannt auf den leeren Platz auf dem Tisch, auf den er seine Karte legen würde. Ich war bereit, meine beiden Karten blitzartig auf den Tisch zu werfen und die Worte „Uno“, beziehungsweise „Uno Uno“ zu sprechen. Denn, wer vergisst, diese Worte auszusprechen, muss seine Karten behalten. Roland sah mich mit einem leichten Grinsen an. Was hatte er vor? Er wusste doch nicht, welche Karten ich in meiner Hand hielt. ‚Er wird doch nicht etwa…?‘, ging es mir durch den Kopf. ‚Verdammt! Das ist die dämlichste aller Karten!‘ Auf diese Karte hin mussten alle Spieler ihre Karten an den linken Spieler weitergeben. Das bedeutete, dass ich einen ganzen Packen unbrauchbarer Karten von Roland erhielt. Und Gerhard, der links von mir saß, hatte nun statt meiner die besten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Als ich die desaströse Wechselkarte vor mir sah, entfuhr mir ein derber Fluch, nicht zu Nellys Wohlgefallen. Die anderen taten es mir nach – ausgenommen Gerhard. Nach einer weiteren Runde war das Spiel entschieden. Gerhard hatte gewonnen.
Ich hob mein Bierglas und rief: „Auf das beschissenste Spiel des Abends!“
Die anderen stießen mit mir an und lachten.
„Noch jemand was zu trinken?“, fragte ich. „Die Nacht ist noch jung.“
Tatsächlich war es schon weit nach Mitternacht. Ich warf einen Blick in die Runde und beobachtete, wie Hans breit grinsend sein leeres Glas hob, um mich um eine neue Füllung zu bitten. Doch ein kurzer Zischlaut aus dem Mund seiner Frau reichte aus, um sich eines Besseren zu besinnen. Stattdessen setzte er sein leeres Glas ab, erhob er sich und hielt, wie man es von ihm kannte, noch eine kurze Abschiedsrede.
„Leute! Für mich ist es Zeit! Es war mir ein Genuss, mit euch diesen Abend zu verbringen. Ihr seid mir die Allerliebsten! Lasst euch umarmen!“
Theatralisch umarmte er jeden einzelnen von uns. Als die Runde an meiner Frau war, versuchte er, besonders galant zu sein, nahm ihre Hand und drückte einen Kuss darauf.
„Ein ganz besonderes Dankeschön an die charmante Gastgeberin.“
Bei der allgemeinen Umarmerei waren alle unsere Gäste aufgestanden und machten es Hans nach, so gut sie es in ihrem betrunkenen Zustand noch vermochten. Es wurde allerhand Unsinn geredet und gelallt, irgendetwas von „allerbeste Freunde“, „müssen wir öfter machen“, „Brauchst du noch Hilfe beim Aufräumen?“ Aber auf den genauen Wortlaut der Abschieds- und Dankesformeln achtete um diese Zeit ohnehin niemand mehr. In wenigen Minuten stand ich mit Nelly an der Tür und winkte dem letzten Gast zu.
Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, herrschte eine eigenartige Stille. Ich hatte irgendwie gehofft, Nelly würde zu mir etwas sagen wie: „War doch ein schöner Abend, oder?“ oder wenigstens „Ist ganz schön spät geworden.“ Stattdessen schwieg sie und würdigte mich keines Blickes. Um das bedrohliche Schweigen zu unterbrechen, rieb ich meine Hände und sagte fröhlich: „So! Dann haben wir das also auch erledigt. War doch ganz okay, oder?“
Ich spielte darauf an, dass wir uns darauf geeinigt hatten, meinen vierzigsten Geburtstag bei uns zu Hause zu feiern, auch wenn es möglicherweise mehr Arbeit bedeuten würde, als in ein Lokal zu gehen. Einerseits hatten wir uns dadurch Geld gespart, andererseits empfanden wir es als gemütlicher und ungezwungener.
Ohne mich eines Blickes zu würdigen, entgegnete Nelly: „Ich weiß nicht, was du vorhast, aber habe heute echt keine Lust mehr, die Küche aufzuräumen. Ich bin hundemüde und will nur noch ins Bett.“
Mit diesen Worten ließ sie mich stehen und ging die Treppe nach oben, wo unser Schlafzimmer und das Bad waren.
„Ja, in Ordnung“‘, erwiderte ich. „Dann werde ich noch ein bisschen – “
„Untersteh dich! Glaubst du, ich kann schlafen, während du hier unten mit den Gläsern und Flaschen klimperst?“
Mit diesen Worten war sie im Badezimmer verschwunden.
Ich musste einsehen, dass es in der Tat wenig Sinn machte, jetzt mit dem Aufräumen zu beginnen, wenngleich mir davor graute, morgen früh mit einem Kater aufzustehen und als Erstes das ganze dreckige, klebrige und übelriechende Geschirr in die Spülmaschine zu räumen. Ein Blick auf den Spieltisch offenbarte mir das ganze Ausmaß an Schmutz und Chaos, das unsere Gäste hinterlassen hatten. Flaschen, leer oder halbvoll, Kronkorken, Verschüttetes und Eingetrocknetes, zerknülltes Wischpapier, Plastikverpackungen, zerbröseltes Knabberzeug und so weiter. Bei diesem Anblick schoss bleierne Müdigkeit in meine Glieder. Ich bezweifelte, dass ich morgen früh große Lust verspüren würde, alles wegzuräumen und zu reinigen. Aber es hatte keinen Sinn, sich jetzt noch darüber Gedanken zu machen. Die Frau hatte gesprochen, darum hieß es, einfach den Mund zu halten und so leise wie möglich ins Bett zu gehen.
Ich traf Nelly im Badezimmer an, aber sie behandelte mich, als wäre ich Luft. Vielleicht – versuchte ich mir einzureden – weil sie vollauf damit beschäftigt war, sich abzuschminken, oder weil es einfach gerade nichts zu sagen gab. Eine Minute später verließ sie das Badezimmer, ohne meine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. Als ich die Tür zum Schlafzimmer leise öffnete, sah ich, dass sie schon tief und fest schlief, oder vorgab, tief und fest zu schlafen. Peinlich darauf bedacht, jedes Rascheln oder Knarzen zu vermeiden, legte ich mich im Zeitlupentempo ins Bett und deckte mich zu. Kaum jedoch lag ich in der Horizontale, begann sich in meinem Kopf ein Karussell zu drehen. Ich hatte mit etwas Ähnlichem gerechnet, da ich nicht wenig getrunken hatte, aber die erste Reaktion fiel heftiger aus als erwartet. Die Halsschlagadern machten ordentlich Lärm, ich hörte den stoßweisen Blutstrom so deutlich unter meinen Schläfen, als würde ich über ein Mikrophon ins Innere meines Körpers horchen. Ich sprach in Gedanken die Hoffnung aus, am nächsten Morgen nicht allzu sehr leiden zu müssen, dann übermannte mich die Müdigkeit und ich schlief ein.
Ich erwachte viel zu früh, geweckt durch klapperndes Porzellan und klirrendes Geschirr. Nelly war schon aufgestanden und hatte sich über das Tohuwabohu in der Küche hergemacht. Damit war klar, dass ich nicht weiterschlafen konnte, egal, wie schwer sich mein Kopf und wie elend sich mein Magen anfühlten. Ich meinem ausgetrockneten Mund entdeckte ich den Geschmack von altem Fett und abgestandenem Bier. Als ich mich im Bett aufrichtete, glaubte ich, jemand hätte just in diesem Moment ein Pfund Schlagsahne in meinen Magen gepumpt. Gleichzeitig stand mir kalter Schweiß auf der Stirn. Ich ließ mich auf mein Kissen zurückfallen, um zu verhindern, dass ich mich übergab. Was hätte ich darum gegeben, jetzt so lange liegenbleiben zu können, bis sich mein Körper wieder normal anfühlte! Doch das hätte einen nicht wieder gut zu machenden Fauxpas bedeutet. Nach Nellys gestriger Demonstration schneidender emotionaler Schärfe war klar, dass mir tagelang nur noch Eiseskälte ins Gesicht blasen würde, wenn ich mich jetzt vor der Arbeit drückte. Ich nahm einen tiefen Atemzug, straffte meinen Körper, ignorierte Übelkeit und Schwäche und taumelte ins Badezimmer. Nach einem entsetzten Blick in den Spiegel, der mir das Gesicht eines 60jährigen Lebemanns zeigte, stellte ich mich unter die Dusche in der naiven Hoffnung, mit Wasser und Seife würden sich alle Verfehlungen des vergangenen Abends abwaschen. Tatsächlich fühlte ich mich danach ein wenig besser. Doch schon während ich die Treppe hinunterging, stand mir erneut kalter Schweiß auf der Stirn. Mir leuchtete ein, dass ich auf Nelly einen denkbar schlechten Eindruck machen würde. Ich tröstete mich mit der Vorstellung, dass ich gegenwärtig die Talsohle durchlebte und es im Laufe des Tages nur noch aufwärts gehen konnte.
Als ich die Küche betrat, stellte ich beschämt fest, dass Nelly schon die halbe Arbeit getan hatte. Die Spülmaschine lief, das restliche Geschirr mit den eingetrockneten Speiseresten wusch sie soeben von Hand in der Spüle.
„Guten Morgen!“, sagte ich. „Du bist schon so früh aufgestanden? Ich wollte nicht, dass du die ganze Arbeit alleine machst.“
„Du kannst die leeren Flaschen einsammeln und in die Kästen stellen. Den Tisch muss auch noch jemand wischen.“
Während sie das sagte, sah sie mich sogar kurz an. Ihr halb verachtender, halb spöttischer Blick sagte deutlich: „In deinem Zustand wärst du sowieso keine große Hilfe gewesen.“
„Ja, natürlich. Mach ich.“
Ich schleppte die Kästen vom Keller in die Küche und füllte sie mit den Flaschen. Den Inhalt der Flaschen, die nicht leer waren, schüttete ich in den Ausguss. Dabei musste ich mehrfach einen Würgereiz unterdrücken. Ich war froh, dass Nelly die Fenster weit geöffnet hatte, um die Räume zu lüften. Dann stellte ich die Kästen vor die Tür. Anschließend wischte ich den Tisch sauber. Nach dieser Arbeit, die in weniger als fünfzehn Minuten erledigt war, war ich schweißgebadet und hatte nur ein einziges Bedürfnis: mich ins Bett zu verkriechen und den ganzen restlichen Tag dort zu bleiben. Doch auf diese Weise wollte ich den Sonntag nicht verbringen. Dafür war mir meine Ehe zu wertvoll. Um gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sagte ich zu Nelly: „Soll ich schon mal das Frühstück richten? Ein Kaffee wäre jetzt genau das Richtige, hm?“
Nelly hatte sich ein Sweatshirt übergezogen und trug eine von diesen Destroyed Jeans, über dich ich mich üblicherweise lustig machte. Doch ihr stand sie ausgezeichnet. Sie hatte makellose Beine. Unter normalen Umständen hätte ich ihr jetzt ein Kompliment gemacht, aber die Stimmung und der Zeitpunkt hätten nicht ungünstiger sein können. Sie sah müde aus, aber bei weitem weniger kaputt als ich. Vielleicht lag es an meinem Aussehen, dass sie mir aus dem Weg ging – oder an meinem Geruch? Nein – ich wusste, dass dies nur die halbe Wahrheit war.
„Ich habe keinen Hunger“, antwortete Nelly. „Außerdem hab ich noch Wäsche im Keller.“
Sie kehrte mir den Rücken zu und ging die Kellertreppe hinunter. Ich vermied es, ihr meine Hilfe anzubieten. Es war offensichtlich, dass sie wütend war und nicht mit mir kommunizieren wollte. So, wie die Dinge lagen, entschloss ich mich, meinen körperlichen Bedürfnissen nachzugeben und wieder ins Bett zu gehen. Ich hoffte, wenn ich mich nachher besser fühlte, wäre auch Nellys Wut verraucht und die Welt würde wieder anders aussehen.
Ich schlief länger als beabsichtigt. Der Wecker auf meinem Nachttisch zeigte 15:25 an, als ich meine schweren Augenlider öffnete. Wenigstens war mir nicht mehr übel, im Gegenteil, ich hatte einen Bärenhunger. Ich entschied mich, noch einmal unter die Dusche zu gehen. Dieses Mal wollte ich meiner Frau wieder im Normalzustand unter die Augen treten. Ich seifte mich gründlich ein, um allen Dreck, der aus meinen Poren getreten war und wie eine Schleimschicht auf meiner Haut klebte, abzuwaschen. Danach rasierte ich mich, gurgelte ausgiebig meine Mundspülung und zog mir frische Kleidung an. Als ich, bereit, den Tag noch einmal unter anderen Vorzeichen zu beginnen, die Treppe ins Erdgeschoss hinunterging, hörte ich eine fremde Stimme. Hatte Nelly Besuch? Ich ging den Flur entlang und lauschte an der Tür. Ich erkannte diese tiefe, dunkle Frauenstimme sofort. Es war Marina, eine frühere Nachbarin. Sie hatte mit ihrer Familie zwei Jahre in dem Haus neben unserem gewohnt. Wir hatten uns immer ganz gut verstanden, das heißt, eigentlich bekam ich sie nur selten zu Gesicht, man sah sich eben ab und zu vor der Haustür, aber Nelly hatte sie öfter eingeladen. Soviel ich weiß, gab es dann und wann ein munteres Kaffeekränzchen, zu dem sich noch andere Damen gesellten. Ich war froh, bei diesen Treffen nicht dabei sein zu müssen. Die Gesprächsthemen langweilten mich. Ich konnte überhaupt nie verstehen, wie Frauen über meines Erachtens absolut belanglose Dinge stundenlang reden konnten. Aber nun war Marina schon mal da, und ich hatte Hunger! Also musste ich wohl oder übel zum Kühlschrank gehen und mich den Damen zeigen.
„Hallo, Marina!“, sagte ich so freundlich, wie ich konnte. „Habt ihr heute ein – äh – Kaffeekränzchen?“
„Nein“, antwortete Nelly kühl. „Sie hat mich einfach so besucht. das kommt unter Freundinnen vor. Was machst du hier?“
Was machst du hier??? Genauso gut hätte sie sagen können: Wir können dich hier nicht brauchen.
„Ich würde gerne etwas essen. Ich habe nämlich heute noch gar nichts – “
„Er hat gestern zu viel getrunken“, schnitt mir Nelly das Wort ab. Ich hörte den Triumph in ihrer Stimme sehr wohl heraus.
„Eine Geburtstagsfeier!“, entgegnete ich an Marina gewandt. „Es waren viele Freunde da, und es wurde etwas später, wie das so ist bei Geburtstagsfeiern. Man wird ja nicht alle Tage vierzig.“
„Du hattest Geburtstag!“, Marina war ein Licht aufgegangen. „Na, dann nachträglich alles Gute.“
Sie drückte mir ihre Hand und sagte: „Vierzig Jahre? Kaum zu glauben!“
„Ich finde auch, er schaut wesentlich älter aus“, ätzte Nelly.
„Ach was! Was du nur wieder sagst“, erwiderte Marina. „Ich finde, er hat sich gut gehalten.“
„Gut gehalten!“ Das hörte sich an wie „Noch ganz rüstig“!
Für einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, mich ganz still in die Küche zurückzuziehen und die beiden nicht zu stören. Doch dann entschied ich mich anders. Schließlich war das hier auch mein Haus – genaugenommen war es sogar zu drei Vierteln mein Haus, denn ich hatte zur Finanzierung die größere Summe hineingesteckt – und in meinem Haus wollte ich es nicht so weit kommen lassen, mich vor fremden Leuten verstecken zu müssen. Ich toastete ein paar Scheiben Weißbrot und belegte sie mit Wurst und Käse. In der Mikrowelle erhitzte ich sie so lange, bis der Käse anfing zu verlaufen. Etwas Salz und Pfeffer und obendrauf je ein Salatblatt, und schon war mein verspätetes Mittagessen fertig. Mit einer fröhlichen Miene nahm ich meinen Teller und setzte mich zu Nelly und Marina an den Tisch.
„Das sieht ja lecker aus!“, sagte Marina, während Nellys Augen tödliche Giftpfeile auf mich abschossen.
„Möchtest du auch etwas haben?“, fragte ich. „Mache ich gerne. Es ist noch genug davon da.“
„Ja, natürlich“, sagte nun auch Nelly. Ich wusste, dass sie wusste, dass es unhöflich gewirkt hätte, wenn sie nicht nachgefragt hätte. „Wir können gerne noch etwas Deftiges essen. Bestimmt bist du von dem bisschen Kuchen nicht satt geworden.“
„Nein, vielen Dank! Das würde ich bereuen, ganz sicher. Außerdem muss ich dann auch heim und das Essen für Robert richten.“
„Jetzt schon?“, fragte Nelly. „Es ist erst vier.“
„Er hatte Frühschicht. Da kommt er schon früher nach Hause.“
„Ach so.“
Marina sah sich unsicher um und stand schließlich auf.
„Ja, also… Ich muss dann mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Das müssen wir bald mal wiederholen!“
„Wahnsinnig gerne!“, sagte Nelly lächelnd und begleitete sie zur Tür. Als sie wieder zurückkam, war von ihrer Freundlichkeit nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil – sie hatte einen hochroten Kopf und eine Falte zwischen den Augenbrauen.
„Bist du jetzt völlig übergeschnappt!“, schrie sie mich an. „Reicht es dir nicht, mit deinen Saufkumpanen die Nacht durchzumachen? Musst du dich auch noch in meine Freundschaften einmischen?“
„Ich weiß gar nicht, was du hast? Ich darf doch wohl noch in meinem Haus essen, wann ich will.“
„Stell dich nicht dümmer als du bist! Du wusstest, dass ich nichts weiter wollte, als mich mal ein Stunde mit einer Freundin in Ruhe zu unterhalten. Und das hast du mir zerstört. Absichtlich!“
„Nein, das stimmt nicht! Ich wollte mich nur zu euch setzen, freundlich sein… Was hätte es für einen Eindruck gemacht, wenn ich verschämt in der Küche geblieben wäre? Also ob ich Angst vor unserem Besuch hätte! Ich hätte euch doch nicht gestört. Kein Wort hätte ich gesagt.“
„Du hättest zugehört und mir hinterher deine Meinung darüber aufs Auge gedrückt. So, wie du es immer tust. Ich will aber deine Meinung nicht hören! Hast du das verstanden? Ich will einfach nur über Dinge reden, die mich interessieren. Ich will mir meine eigenen Gedanken machen, ohne von dir kritisiert zu werden.“
„Als ob ich jemals – “
„Hast du! Immer wieder! Du denkst, deine Welt und deine Gedanken seien das Nonplusultra! Glaubst du im Ernst, mich würde interessieren, was deine tollen Freunde im Rausch faseln? Glaubst du, es sei die Erfüllung meiner Träume, dir dabei zuzusehen, wie du dir dein Gehirn kaputtsäufst und dir dabei gefällst, denselben Unsinn wieder und wieder zu erzählen?“ Etwas milder fügte sie an: „Hast du denn nicht das Bedürfnis, etwas aus deinem Leben zu machen?“
Eigentlich hatte ich in diesem Moment nur ein Bedürfnis: Nelly in den Arm zu nehmen und mich bei ihr zu entschuldigen. Ich sah ja, dass sie den Tränen nahe war. Es geschah aus Stolz und Sturheit, dass ich den Streit mit halbseidenen Argumenten fortsetzte.
„Also, jetzt mach aber mal einen Punkt! Stell mich doch nicht so hin, als wäre ich eine gescheiterte Existenz! Ich bin in meinem Beruf erfolgreich, ich schaffe das ganze Geld nach Hause, damit wir ein schönes Leben haben.“
„Und das wars dann? Oder kommt da noch irgendwas?“ Demonstrativ blickte sie nach oben als würde sie nachdenken. „Ich meine, regelmäßig mit mittelmäßig intelligenten Leuten zusammenzukommen und sich zu betrinken, ist jetzt nicht gerade das, was ich mir unter einem schönen Leben vorstelle. Wenn du damit zufrieden bist, na gut! Ist deine Sache. Das darfst du dann aber ohne mich machen. Ich bin mir dafür zu schade.“
Mit diesen Worten knallte sie die Tür hinter sich so schwungvoll zu, dass ich fürchtete, die Zarge würde aus der Wand fliegen. Ich hatte nicht mit einer so heftigen Reaktion gerechnet. und war für einen Augenblick wie gelähmt. Mein Hals war zugeschnürt und mein Herz klopfte so stark, dass sich meine zitternden Hände im Rhythmus des Pulses bewegten. In meinem Kopf summte es, als hätte sich dort ein Bienenschwarm eingenistet. Als sich die Erstarrung nach einer Minute löste, wusste ich nicht, ob ich wütend, verletzt oder traurig war. Ich bemühte mich, Nellys Tirade noch einmal in Gedanken zu wiederholen, doch ich konnte mich an kein einziges Wort erinnern. Das Einzige, was sich als unumstößliche Tatsache in meinem Bewusstsein festgesetzt hatte, war: Ich hatte einen gewaltigen Schuss vor den Bug bekommen, und wenn ich nicht schnellstens angemessen reagierte, würde mich der nächste Schuss mit zerstörerischer Kraft treffen. Ich musste mit Nelly reden, ihr sagen, dass es mir leidtat. Ich atmete tief durch und ging nach oben. Eben wollte ich an die Schlafzimmertür klopfen, da hörte ich sie weinen. Ausgerechnet in diesem Augenblick fiel mein Blick auf das Schild, das an unserem Hochzeitswagen angebracht war – Heinrich Nelly, eine Erinnerung an eine Welt voller Optimismus. Alles schien damals zu passen, ein Tag, wie man sich ihn erträumt: Sonnenschein, ein Meer von roten Rosen, fröhliche Gäste, Musik, Tanz, Essen und die Tickets für die Hochzeitsreise nach Griechenland bereits in der Tasche. Wir waren bereit für das Leben. Was auch immer sich uns in den Weg stellen sollte, würden wir gemeinsam beseitigen.
Irgendwie hatten wir von Jahr zu Jahr ein weiteres Stück von unserem Optimismus verloren. Wir mussten einsehen, dass wir nicht immer am selben Strang zogen, sondern in einigen Dingen unterschiedlicher Meinung waren. Manche Gewohnheiten, die wir zu Beginn der Beziehung gar nicht beachtet hatten, entwickelten plötzlich ein gefährliches Konfliktpotenzial. Und der Alltag tat das Übrige dazu, um uns müde zu machen und unsere Leidenschaft füreinander zu ersticken.
Ich hätte mir gerne eingeredet, dass Nelly heute einen schlechten Tag hatte, vielleicht ihre „Tage“, oder dass sie einfach den ganzen Weltschmerz in sich spürte, und dass ihr das Weinen helfen würde, einen inneren Konflikt zu lösen. Aber das wäre eine Lüge gewesen. Sie weinte nicht nur, sie schluchzte gotterbärmlich. So hatte ich sie noch nie erlebt. Diese Traurigkeit war mit gutem Zureden und einer Fußmassage nicht zu vertreiben. Es brauchte mehr als das, um diese Krise zu meistern.
Auf leisen Sohlen ging ich die Treppe wieder hinunter und setzte mich ganz still ins Wohnzimmer. Stilles Nichtstun hatte mir schon oft geholfen, wirre Gedanken zu ordnen und so eine Lösung für ein Problem zu finden. Ich richtete meine Augen auf ein Bild an der gegenüberliegenden Wand und stellte sie unscharf. Auf diese Weise hoffte ich, eine nützliche Eingebung zu erhalten. Doch sobald eine verheißungsvolle Idee in mein Bewusstsein flog, entwischte sie mir wie ein Stück nasse Seife und andere, problembehaftete Gedanken nahmen ihren Platz ein. Ich strengte mich noch mehr an, schließlich ging es um eine existenzielle Angelegenheit. Ohne meine Frau war ich ein Niemand. Ich wollte sie auf keinen Fall verlieren. Ich musste etwas tun! Ich musste eine Lösung finden, auch wenn sie im Augenblick außer Reichweite war. Ich nahm einen Zettel und einen Stift zur Hand und begann damit, die entscheidenden Eckpunkte zu notieren. Da waren wir beide, Nelly und ich – ich malte ein Pärchen in die Mitte des Blattes. Dann gab es meinen Arbeitsplatz, meine Freunde, Nellys Halbtagsjob und ihre Freunde – ich malte weitere Symbole auf das Blatt. Und irgendwie hatten wir Ziele für unser Leben. Ich zeichnete über unsere Figuren zwei Kreise, die ich mit Inhalt füllen wollte, aber mir fiel nichts ein. Die Kreise blieben leer. Lag es also daran, dass unser Leben in eine Sackgasse geraten war? Ich hatte doch Ziele, oder? Jeder Mensch hat Ziele, die er erreichen will. Nun gut, ich hatte einen Beruf, eine Ehefrau, ein Haus… Kinder wollten wir beide nicht, darin waren wir uns einig… Zugegeben – wir hatten es ein paar Jahre lang versucht, doch irgendwie wollte es nicht klappen. Um einem von uns die Schmach zu ersparen, sich von einem Arzt Unfruchtbarkeit bescheinigen zu lassen, hielten wir es für klüger, der Natur ihren Lauf zu lassen und unter Umständen später ein Kind zu adoptieren. Sollte Nellys Kinderwunsch doch intensiver sein, als sie zugab? Unschlüssig führte ich meinen Bleistift in den Kreis über Nellys Figur und begann, ein Baby zu zeichnen. Aber nein! Ein Kind sollte nicht dafür herhalten müssen, die Leere im Leben seiner Eltern zu füllen.
Ich dachte noch eine Weile nach, dann warf ich den Stift auf den Tisch. „Ist doch alles Unsinn!“, sagte ich zu mir. „Jeder Mensch möchte Spaß im Leben haben. Jeder möchte Freunde haben und das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und wenn man Geld übrighat, um mal wegzufahren, ans Meer oder in die Berge, um was von der Welt zu sehen, dann hat man doch alles, was man braucht, oder nicht?“
Es war Ende November. Um fünf Uhr dämmerte es bereits. Heute war Sonntag. Morgen würde der Alltag wieder beginnen. Im Allgemeinen versuchten wir den Sonntagabend bewusst zu genießen, ein ausgedehntes Abendessen, dazu ein Gläschen Wein, einen romantischen Film anschauen oder eine Sportübertragung, Fußball, Formel I, je nachdem, was Nelly so vorhatte. Doch heute war ich auf mich allein angewiesen. Und die traurige Wahrheit war, dass ich es ohne Nelly nicht schaffte, mich in eine genussvolle Stimmung zu versetzen. Im Gegenteil – mit jeder Minute erreichte mein Kummer eine neue, noch schmerzhaftere Dimension. Es würde über meine Kräfte gehen, noch einen Tag in dieser Stimmung ertragen zu müssen. Wie ein Tiger im Käfig ging ich im Wohnzimmer hin und her. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Diese Ratlosigkeit brachte mich an den Rand des Wahnsinns. Meine schriftliche Analyse lag zerknüllt auf dem Fußboden. Wenigstens war mir eines klar geworden: Ich musste jetzt etwas tun! Was sollte es mir nützen, wenn mir ein Lebensziel offenbart würde, das ich erst in zehn oder zwanzig Jahren erreichen würde? Jetzt, in diesem Augenblick, lag meine Frau verzweifelt in ihrem Bett und überlegte vermutlich, ob Sie sich von mir trennen oder sich oder mich ermorden sollte. Ich sah ein, dass es keinen Zweck hatte, hier weiterhin die Krise zu zelebrieren, ich musste mich öffnen, alles aussprechen, was mich bewegte, nur so konnte ich etwas in Bewegung bringen. Ich schloss die Augen, atmete tief ein und aus und machte mich auf den Weg zu Nelly.
In diesem Augenblick knipste jemand das Licht in der Küche an.
„Was machst denn du hier im Dunkeln?“, fragte Nelly und drückte auf den Lichtschalter fürs Wohnzimmer. Wie eine Elfe stand sie in der Tür. Sie sah so leicht aus, fast durchsichtig, irgendwie übernatürlich. Ich wagte nicht, ihr in die Augen zu sehen. Ich bemerkte nur ein zerknülltes Taschentuch in ihrer Hand.
„Ich? Äh… Ich musste über so vieles nachdenken. Da habe ich gar nicht bemerkt, dass es dunkel geworden ist.“
„Willst du heute gar nichts mehr essen? Es sind noch Tomaten mit Mozzarella im Kühlschrank. Vom Kartoffelsalat ist auch noch was übrig.“
Ihre Stimme klang noch weicher als sonst. Beinahe zart wie die eines jungen Mädchens.
„Doch. Schon…“
Ganz vorsichtig, als würde ich einen Blick auf Medusa riskieren, sah ich in Nellys Gesicht. Sie sah aus wie immer. Keine Spur davon, dass sie geweint hatte, keine verschwollenen Augenlider, sie sah sogar beinahe freundlich aus. Ich war völlig perplex. Hieß das für mich, sie hatte mir vergeben? Sollte ich das Thema noch einmal ansprechen und sie um Verzeihung bitten oder wäre das ungeschickt? Vielleicht hatte sie beschlossen, das Thema kurz und bündig aus der Welt zu schaffen, oder sie sah ein, dass sie überreagiert hatte. Wie auch immer, ich war mir sicher, nur ein Narr würde diese Chance ungenutzt verstreichen lassen. Daher lächelte ich zurück.
„Ja, natürlich. Setz dich doch! Ich decke schon mal den Tisch. Soll ich Würstchen zum Kartoffelsalat warm machen?“
„Ja, das wäre gut.“
Ich tat mein Möglichstes, um das zarte Pflänzchen der Versöhnung in seinem Wachstum zu unterstützen, und gab mir Mühe, das Essen liebevoll auf die Teller zu arrangieren. Ich war heilfroh, dass Nelly ihrerseits den Part der Unterhaltung übernahm. Ab und zu traute ich mich, ihr in die Augen zu sehen, und entdeckte keinen Groll darin.
„Kannst du mir das Salz geben?“
Eine harmlose Frage, aber ich konnte nicht verhindern, dass meine Hände zitterten, als ich ihr den Salzstreuer reichte. Irgendwie hatte ich Angst davor, unsere Finger könnten sich dabei berühren. Ich wusste, dass Nelly mein Zittern bemerkte und ich glaubte, die Andeutung eines Lächelns in ihren Augen zu bemerken.
„Hast du morgen viel Arbeit?“
„Ich fürchte schon. Ein langweiliger Besprechungstermin gleich um neun. Meistens bleibt dann die wichtige Arbeit liegen. Und bei dir?“
„Montag ist immer die Hölle los. Aber das geht vorbei. Ich habe gelernt, die Wutanfälle meines Chefs zu ignorieren.“
War das nur so daher gesagt, oder ein versteckter Tipp an mich, um mit ihren Wutanfällen besser umzugehen?
„Sehr gut!“, sagte ich. „Das können die Wenigsten. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Meine Kollegen meinen zwar immer, ich sei die Ruhe selbst, aber wenn sie wüssten, wie es manchmal in mir kocht, würden sie anders denken.“
„Tatsächlich? Ist das so?“
Warum fragte sie jetzt nach? Ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie mit dieser Art Fragen etwas aus mir herauskitzeln möchte.
„Ja. Leider. Wenn ich mich über eine herablassende Bemerkung meines Chefs ärgern muss, dann dauert es zwei Tage – Minimum! – ehe ich mich wieder beruhigt habe.“
„Das ist nicht gut. Du schadest dir damit nur selbst.“
„Ich weiß. Das Problem ist, dass ich meinem Chef nicht sagen kann, was ich denke. Wer kann das schon? Man spuckt ja nicht in die Hand, die einen füttert. Doch wenn man so viel zurückhalten muss, kostet das viel Energie.“
„Warum kannst du ihm nicht sagen, was du denkst?“
„Warum?!“ Ich war lauter geworden, als beabsichtigt, und mäßigte meinen Tonfall sofort. „Weil ich ihn damit beleidigen würde, und das würde mir meinen Job kosten.“
„Bist du dir sicher? Vielleicht würde dein Chef deine Offenheit schätzen.“
„Nein! Der nicht! Du kennst ihn nicht! Das ist kein Mensch, der mit Kritik umgehen kann. Der würde explodieren!“
Wieder hatte ich lauter gesprochen, als es einer Unterhaltung zwischen Eheleuten angemessen wäre. Ich fühlte eine unerklärliche Wut in mir aufsteigen. Ich konnte nicht ausmachen, ob ich mich über meinen Chef oder über die Ahnungslosigkeit meiner Frau ärgerte.
„Na gut“, beschwichtigte Nelly. „Dann ist es wohl so. Manche Dinge lassen sich eben nicht einfach so ändern.“
„Ja, ich glaube auch.“
Die Ruhe, mit der Nelly auf mein persönliches Reizthema reagierte, beschämte mich. Jetzt war mir klar, dass ich mich vor allem anderen am meisten über mich selbst ärgerte. Ich war unfähig, mit meiner Frau, dem wichtigsten und liebsten Menschen in meinem Leben, eine angenehme, erbauliche Unterhaltung zu führen. Ich konnte meine Emotionen nicht einmal während der kurzen Zeit eines Abendessens unter Kontrolle halten. Unser Gespräch war beendet, weil es nicht möglich war, sich mit mir friedlich zu unterhalten. Nach dem Essen schaltete Nelly den Fernseher ein. Wir fanden einen Film, den wir beide ganz amüsant fanden. Dann gingen wir früh zu Bett.
Am nächsten Morgen stand ich leise auf, um Nelly nicht zu wecken. Sie musste erst später am Arbeitsplatz erscheinen, wenn ich bereits aus dem Haus war. Sie teilte sich eine Stelle als Zahnarzthelferin mit einer Kollegin und konnte ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten. Ich war froh, dass ich mich ihr nicht zeigen musste, denn ich hatte schlecht geschlafen. Ich war so aufgewühlt, dass unablässig Gedanken- und Gesprächsfetzen des gestrigen Tages vor meinem geistigen Auge vorbeizogen, ohne dass ich es verhindern konnte. Zwischen meinen Augenbrauen hatte sich eine tiefe Falte gebildet. Ich war nicht wirklich müde, vielmehr erschöpft vom pausenlosen Nachdenken. Wie jeden Morgen wärmte ich mir eine Schüssel Milch auf und füllte sie mit Haferflocken. ‚Wenigstens etwas in meinem Leben, das Bestand hat‘, dachte ich dabei. Mechanisch schaufelte ich mir den Brei Löffel für Löffel in den Mund, doch die Gedanken kreisten und kreisten. Auf dem Weg zur Arbeit war ein bestimmter Gedanke vorherrschend. Ich sagte mir immerzu, dass alles gut sei, solange ich nur mit Nelly meinen Frieden hatte. Ohne meine Frau wäre mein Leben trist und sinnlos. Beinahe hätte ich mich von finsteren Fantasien über einen Selbstmord aufsaugen lassen, doch dann entdeckte unter all den trüben Gedanken einen lichtvollen: Sie hatte mir vergeben! Sie hätte mir gestern Nachmittag ebenso gut eine Szene machen oder die kalte Schulter zeigen können, aber das hatte sie nicht getan; sie hatte sich zu mir gesetzt und gemeinsam mit mir gegessen. An diesen Gedanken klammerte ich mich, und das war meine Rettung.
Jetzt, da es in meinem Bewusstsein verankert war, dass sie mir vergeben hatte und mir immer noch treu zur Seite stand, fühlte ich mich stark wie nie zuvor. Das Vertrauen meiner Frau war mein persönlicher Schutzzauber. Solange ich dieses Vertrauen fühlte, war ich überzeugt davon, dass mir nichts und niemand etwas anhaben konnte, auch nicht mein Chef. Freilich war er unfreundlich, leicht reizbar, cholerisch und unbeliebt. Doch trotz seiner Fehler war er auch nur ein Mensch und kein bösartiges Ungeheuer. Obwohl wir ihn „Chef“ nannten, war er nur ein Abteilungsleiter und hatte noch zwei Vorgesetzte über sich. Es wäre falsch gewesen, ihm ihm alles anzulasten, was in der Firma danebenlief, er musste eben auch umsetzen, was von oben angeordnet wurde. Erich Müller-Stipinski hieß er offiziell, aber sein Familienname war zu lang und Erich wollte niemand zu ihm sagen. Also war er für die meisten einfach nur „der Chef“. Es hatte sich in der Firma herumgesprochen, dass seine Frau bei der Hochzeit darauf bestand, ihren Namen Stipinski zu behalten, sodass er einen Doppelnamen wählte, um seine Identität zu bewahren. ‚Ein armer Kerl‘, dachte ich für mich, ‚der von seiner Frau dominiert wurde und in der Firma den starken Mann spielen durfte.‘ Das zu glauben, stellte sich als ein Irrtum heraus.
Die sicher geglaubte Zuversicht, die mich beim Gedanken an die Unverwüstlichkeit meiner Ehe bestärkt hatte, war schneller verflogen, als ich ahnen konnte. Dazu reichte ein einziger bösartiger Blick meines Chefs aus, und ich fand mich in den tiefsten seelischen Abgründen wieder. Ich habe niemals zuvor oder danach einen Menschen kennengelernt, der ohne eine besondere Mimik, nur durch seine bloße Anwesenheit ein solches Übermaß an Verachtung für seine Mitmenschen verbreiten konnte. So wie an diesem Morgen reichten die zehn Sekunden aus, die er benötigte, um in das Besprechungszimmer zu treten, und jeder der anwesenden Sachgebietsleiter fühlte sich, als hätte man ihm einen Magenschwinger verpasst. Auch mein „Schutzzauber“ bewahrte mich nicht davor, dass sich mein Rücken krümmte und Schweiß aus den Achseln tropfte wie Wasser aus einem defekten Wasserhahn. Ohne irgendeinen von uns Sachgebietsleitern zur Kenntnis zu nehmen, setzte er sich auf seinen Stuhl und blätterte seine Notizen durch.
Während alle auf eine Begrüßung Müller-Stipinskis warteten, steckte seine Sekretärin den Kopf zur Tür herein und hauchte: „Entschuldigung… ich bräuchte ein paar Unterschriften.“
Müller-Stipinksi machte eine kaum wahrnehmbare Kopfbewegung, was heißen sollte: „Sie haben genau eine Minute!“ Er ließ sich eine Unterschriftenmappe und einen Kugelschreiber reichen, ohne die Sekretärin mit einem Blick zu würdigen. Nach der letzten Unterschrift nahm sie die Mappe und den Stift wieder an sich und verneigte sich, als wäre ihr eine große Gunst erwiesen worden. Lautlos schloss sie die Tür hinter sich.
Bei der folgenden Ansprache des Chefs duckten sich alle noch weiter in den Tisch hinein. Ich fühlte mich lebhaft an die Schulzeit erinnert, wenn die Lehrkraft das Notenheft zur Hand nahm und jeder wusste: jetzt wird der Stoff der letzten Stunde abgefragt! Auch damals rutschten die Schüler in ihren Stühlen möglichst weit nach vorn und senkten die Köpfe, um kleiner zu wirken, in der Hoffnung, sie mögen so übersehen werden. Müller-Stipinski verzichtete an diesem Morgen auf eine Abfrage, dafür bellte er seine Vorstellungen von einem zukunftsfähigen Arbeitsablauf wie ein Feldwebel in die Runde. Er verlangte mehr Einsatz, Verzicht auf Gehaltsforderungen und Urlaub, mehr Überstunden, weniger Krankheitstage etc. Im Grunde nichts Neues, aber heute Morgen traf mich dieser erbarmungslose Appell an einer Stelle, die bereits verwundet war. Wieder ein Mensch, der mir zu verstehen gab, dass das, was ich tat, ungenügend sei. Es reiche nicht aus, einfach nur das Notwendige zu tun und sich ansonsten einen schönen Tag zu machen.
Als die Besprechung zu Ende war, richtete ich mich vorsichtig wieder zu meiner vollen Größe auf; trotzdem fühlte ich mich einen Kopf kleiner. Ich ging zurück in mein Büro und setzte mich an meinen Schreibtisch. Anstatt meine Arbeit zu erledigen, musste ich nun überlegen, wie ich vorgehen musste, um mir eine weitere Daseinsberechtigung in der Firma zu erwerben. Punkt eins: Ich musste länger im Büro bleiben, egal, ob ich mehr zu arbeiten hatte oder nicht. Wenn mich der Chef dabei ertappte, bereits um fünf Uhr das Büro zu verlassen, riskierte ich meine Entlassung. Punkt zwei: Ich würde vermehrt auch am Samstag ins Büro gehen müssen. Punkt drei: Ich musste deutlich mehr Berichte an das Büro des Chefs schicken, denn andernfalls würde er denken, ich sei unproduktiv. War ich das?
Nein! Bestimmt nicht! Ich fand, dass ich sehr schnell und effektiv arbeitete. Gerade weil ich mich vor den vielen Besprechungen drückte, die ohnehin nur Monologe des Chefs zum Inhalt hatten, hatte ich viel mehr Zeit, meine Projekte durchzuziehen. Aber das zählte nicht. Diese drei oben genannten Punkte wären noch zu bewältigen gewesen. Doch es gab noch einen vierten Punkt, der wichtiger war als die drei vorhergehenden zusammen. Dieser Punkt stand schon vor der Besprechung auf meiner Todo-Liste: Ich musste meiner Frau ein Leben bieten, das ihr so viel Freude bereitete, dass sie gar nicht erst auf die Idee käme, mich zu verlassen. Das Fatale dabei war, dass mich die Erfüllung der ersten drei Punkte noch mehr als bisher daran hindern würde, den vierten Punkt in die Tat umzusetzen. Wie um alles in der Welt sollte ich das schaffen? Ohne Job und Geld konnte ich meiner Frau nichts bieten, aber mit Job und Geld fehlten mir Zeit und Energie.
Ich quälte mich mit Kopfschmerzen und Müdigkeit durch den Tag. Eine Lösung für mein Dilemma fand ich indes nicht. Erst am Abend, als ich nach Hause fuhr, verschaffte mir ein Geistesblitz ein wenig Hoffnung. Meine Frau liebte mich doch! Wenn ich ihr erklärte, in welchem Dilemma ich steckte, müsste sie mich doch verstehen. Dafür hatte man sich doch, um sich in schwierigen Zeiten zu trösten und zu unterstützen…
Als ich in die Seitenstraße, in der unser Haus lag, einbog, fiel mir ein Auto auf, das in der Garageneinfahrt parkte. Besuch? Meine Stimmung fiel erneut in den Keller. Ich wollte doch mit meiner Frau reden, in Ruhe, ausgiebig, Differenzen ausräumen, Perspektiven ausloten und so weiter! Missmutig schloss ich die Haustür auf und hörte lautes Lachen. Ich wusste, dass es in meinem Bekanntenkreis nur eine Person gab, die zu solchen Lachsalven fähig war: Meike Drechsler, eine von Marinas Freundinnen, die häufig an diesen Kaffeekränzchen teilnahmen und Nelly neuerdings immer häufiger aufsuchten. Nicht nur, dass sich diese Damen die Aufmerksamkeit meiner Frau stahlen und mich ihr entfremdeten, sie entweihten obendrein mein Heim mit ihren Ausdünstungen! Das gesamte Erdgeschoss roch bereits nach Meikes penetrantem Eau de Toilette. Es war mir unverständlich, warum sich meine Frau mit Leuten abgab, die sie doch eigentlich verachtete. Ich hatte doch mit eigenen Ohren aus ihrem Mund gehört, dass sie Meike als oberflächlich und nervtötend bezeichnete, dass sie sich abfällig über ihren abartigen Modestil beklagte und über ihren liederlichen Lebenswandel den Kopf schüttelte. Ausgerechnet diese Frau war nun in meinem Hause zu Gast? Ehe ich das Wohnzimmer betrat, lauschte ich der Unterhaltung. Es war nicht Meike allein, die sich vor Lachen bog. Auch Nelly ließ ihrer Heiterkeit freien Lauf. Meine Einschätzung, dass sich Nelly dazu genötigt fühlte, sich mit ihr zu unterhalten war also falsch. Sie hatte sogar ganz offensichtlich Spaß an ihrer Gesellschaft! Und wieder musste ich tief durchatmen, meinen eigenen Kummer zurückdrängen und den jovialen Gastgeber mimen. Ich fragte mich, wie lange mein gequältes Herz diese Selbstverleugnung noch mitmachen würde.
„Da ist ja auch der fleißige Ehegatte!“, rief mir Meike zu und breitete ihre Arme aus, um mich zu begrüßen. Ich ekelte mich davor, mein Gesicht an ihre dick geschminkte Wange zu drücken, und wäre ihr gerne entwischt, aber ich stand ungünstig. Die Tür war hinter mir ins Schloss gefallen und Meike hatte sich mir mit einer gekonnten Drehung direkt zugewandt, sodass jeder Fluchtweg versperrt war. Ich warf Nelly einen hilfesuchenden Blick zu, doch die machte keine Anstalten, mich aus meiner misslichen Lage zu befreien. Ich sah noch für einen kurzen Moment auf den lärmend-roten Lippenstift, der auch noch an ihren breiten Zähnen klebte, dann geriet ich ins Schwanken und hatte Mühe, mich auf den Beinen zu halten, weil ich eine Duftwolke aus ihren Haaren eingeatmet hatte.
„Der liebe, treue Heinrich!“, sagte Meike mit einer Begeisterung, die beinahe echt klang. „Gut siehst du aus! Ein fescher Mann, dein Heinrich; war er ja schon immer.“
„Nicht wahr?“, entgegnete Nelly weit weniger enthusiastisch als Meike.
„Du wolltest dich jetzt bestimmt auf der Couch entspannen, ein kleines Schläfchen gönnen, und nun ist diese doofe Tratschtante gekommen und liegt dir mit ihrer Lache in den Ohren“, sagte Meike und klimperte mit ihren geklebten Wimpern. „Aber keine Angst! Ich bleibe nicht den ganzen Abend. Versprochen!“
„Schon gut“, sagte ich. ‚Nur jetzt nicht wieder Nelly verärgern‘, dachte ich insgeheim. „Ich… ähm… wollte eh noch ein bisschen rausgehen, den Kopf frei kriegen. Unterhaltet euch nur weiter, ich werde euch nicht stören.“
„Jetzt willst du noch rausgehen?“, fragte Nelly. „Es ist stockdunkel.“
„Das macht doch nichts. Die Straßenlaternen sind an. Ich gehe einfach eine Runde durch den Ort.“
„Wie du willst.“
Unser Haus lag in einer ruhigen Wohnsiedlung. Hier gab es, abgesehen von den Vorgärten der kleinen Häuschen nichts zu sehen, in der Nacht schon gar nicht. Der einzige Grund für mich, hier im Dunkeln herumzugehen, bestand darin, mich abzulenken, indem ich ab und zu einen Blick in die beleuchteten Räume anderer Häuser warf. Nicht, dass ich jemanden „ausstalken“ wollte, es ging mir nur darum, die Geborgenheit hinter diesen Fenstern zu spüren, wahrscheinlich die Geborgenheit, die ich im Augenblick vermisste. Ich wollte daran glauben, dass sich die Menschen nach Einbruch der Dunkelheit in ihre warmen Zimmer zurückzogen, um dort gemeinsam zu Abend zu essen und sich zu unterhalten, und vor allem darüber freuten, ein Dach über dem Kopf und vier schützende Wände um sich zu haben, die das Böse und Bedrohliche aus ihrem Leben ausschlossen.
Ich ging dorthin, wo wenige Autos fuhren, in die kleinen, schmalen Gassen der Altstadt. Ich fühlte mich immer schon zu den zwergenhaften Behausungen hingezogen, die man erst fand, nachdem man um drei Ecken gelaufen, zwei Treppen hinunter und drei hochgegangen war, und eine kleine Brücke überqueren musste, um zum verborgenen Hauseingang zu gelangen. Wahrscheinlich steckt uns Menschen noch die Erinnerung an schützende Höhlen in den Genen. Wir fühlten uns immer schon wohl, wenn wir unseren Rückzugsort hatten, der von Bösewichten schwer zu entdecken und im Falle eines Angriffs leicht zu verteidigen war.
An einem steilen Weg, der mit groben, faustgroßen Steinen gepflastert war, lagen, an einen mit Sträuchern bewachsenen Hang geschmiegt, einige uralte Häuser, die nur von vorne zu betreten waren und über drei bis vier Etagen verfügten. Von der oberster aus gelangte man zumeist in einen winzigen Garten, der in den Hang hineingegraben worden und terrassenförmig angelegt war. Dahinter schloss sich der sogenannte Fürstenwald an, der den kompletten Hang bis hin zu einer Burgruine bedeckte, einst Sitz eines einflussreichen Adelsgeschlechts. In früheren Zeiten bot die Nähe der wehrhaften Burg Schutz, heute wirkten die massiven, kantigen Mauern und Zinnen eher bedrohlich.
Die Häuser der alten Siedlung waren zwar immer wieder renoviert worden, aber es war unübersehbar, dass jedes von ihnen ein Einzelstück war, das exakt der Geländeform angepasst worden war. In kaum einem Haus gab es rechte Winkel und senkrechte Wände. Trotzdem waren sie stabil, denn zur Zeit der Erbauung vor annähernd vierhundert Jahren war es üblich, sie mit meterdicken Fundamenten zu versehen, während die Mauern leicht nach innen geneigt waren und sich nach oben hin verjüngten, um das Gewicht zu reduzieren.
Ich sah in ein Fenster, das unterhalb einer gemauerten Treppe lag. Ein älterer Mann saß an einem Tisch und aß. Das Fensterglas war so klar, dass ich jedes Detail sehen konnte. Er hatte Kartoffelbrei und Bouletten auf seinem Teller, daneben stand eine Flasche Bier und ein Glas. Auf dem Tisch ausgebreitet lag eine Tageszeitung. An der Wand hinter ihm hing ein Holzgestell, in dem Schmuckteller aus Zinn aufgestellt waren. Obwohl ich mir meiner indiskreten Handlungsweise bewusst war, schaffte ich es nicht wegzusehen. Dann betrat eine Frau, wohl seine Ehefrau, den Raum. In der einen Hand trug sie ein Wollknäuel und Stricknadeln, in der anderen eine Teetasse. Sie setzte sich eine Brille auf und nahm neben ihrem Mann Platz. Der Mann zeigte keine Reaktion, auch nicht, als sie irgendetwas zu ihm sagte. Erst als sie zu stricken begann, sagte auch der Mann etwas, was sich vermutlich auf den Inhalt der Zeitung bezog, ohne jedoch seine Frau anzusehen. Dann schwiegen sie einige Minuten. Der Mann blätterte die Zeitung um, aß seine Bouletten und trank ab und zu einen Schluck Bier, während die Frau strickte. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, was mich trotz der nächtlichen Kälte dabei reizte, weiter durch das Fenster zu starren. Irgendwann stand die Frau auf und kam mit einer weiteren Flasche Bier zurück. Der Mann schenkte sich ein und nahm einen langen Zug. Dann sah er auf die Uhr, stand abrupt auf und kam auf mich zu. Schnell duckte ich mich. Als ich mich vorsichtig erhob, um erneut durch das Fenster zu spähen, waren die Vorhänge zugezogen. Ein schmaler offener Schlitz erlaubte mir, das Geschehen weiter zu beobachten. Der Mann hatte seinen Platz gewechselt; er saß nun in einem schweren Sessel. Auch die Frau hatte ihren Stuhl gedreht, war aber nach wie vor mit ihrer Strickarbeit beschäftigt. Das flimmernde Licht, das sich an der weißen Zimmerwand spiegelte, ließ darauf schließen, dass die beiden nun eine Fernsehsendung ansahen. Ich ging weiter. Hier würde an diesem Abend nichts Besonderes mehr passieren.
Während ich der Gasse entlang weiter bergan folgte, fragte ich mich, ob die Szene, die ich eben miterlebt hatte, die Gemütlichkeit repräsentierte, nach der ich mich sehnte. Doch dann ließ mich eine Stimme aufhorchen. Zuerst hielt ich sie für eine Stimme aus einer Fernsehsendung, doch dann sah ich, durch weiße Gardinen hindurch, einen Mann lautstark reden. Er fuchtelte mit den Armen und ging währenddessen auf und ab. Es dauerte nicht lange, dann hörte ich die Stimme einer weiteren Person, nicht weniger laut. Eine Frau mit sehr schriller Stimme erwiderte offenbar die Vorwürfe des Mannes äußerst vehement. Als hätte sie meine Gedanken gehört, ging sie zum Fenster, das einen Spalt geöffnet war, und schloss es. Der Streit war nun nur noch gedämpft zu hören, wurde jedoch deswegen nicht weniger heftig geführt.
Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich fror. Ich hatte mir nur eine dünne Jacke übergezogen, da ich nicht damit rechnete, dass die Temperaturen in dieser Nacht bis nahe an den Gefrierpunkt fallen würden. Ich kehrte um und ging auf demselben Weg nach Hause, auf dem ich gekommen war.
Das Auto von Meike Drechsler war weg. Ich schloss die Tür auf, sah Nelly in der Küche und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
„Was ist denn jetzt los?“, fragte sie scheinbar ungerührt, doch an ihren geröteten Wangen sah ich, dass ihr meine Begrüßung gefiel.
„Ich wollte dir nur zu verstehen geben, dass ich sehr genau weiß, was ich an dir habe.“
„Soso. Und dazu musstest du erst eine Stunde im Dunkeln spazieren gehen?“
„Tja, sieht wohl danach aus.“
Jetzt war sie es, die mir einen Kuss auf die Wange gab.
„Wenn das so ist, werde ich dich jetzt jeden Abend nach draußen schicken.“
Ich blieb am nächsten Abend zu Hause, auch am übernächsten. Doch dann hatte Nelly wieder Besuch, eine andere Freundin, sie hieß Erika, glaube ich, und es schien mir wiederum angebracht, das Weite zu suchen, um die Damen nicht zu stören. Nelly war damit einverstanden. Es war erst halb sechs, aber schon dunkel. Die Tage wurden zusehends kürzer in dieser Jahreszeit. Wir hatten Ende Oktober, die Herbstnebel fielen morgens und abends ein und bewirkten, dass sich die Sonne sogar tagsüber kaum noch zeigte. Es machte mir wenig aus, da ich die Tage ohnehin im Büro zubringen musste. Immer häufiger schaute ich aus meinem Bürofenster und stellte mir vor, dass es schön sein musste, draußen im Schutz des Nebels herumzugehen, beinahe so, als hätte ich einen Tarnumhang angelegt.
An den letzten beiden Tagen hatte ich mir viel Zeit zum Nachdenken genommen. Nelly war mir gegenüber freundlich, beinahe liebenswürdig, auch das Geburtstagsbesäufnis machte sie mir nicht mehr zum Vorwurf. Ich hatte keinen Grund, mich zu beklagen, und dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass eine Glut unter der Oberfläche schwelte, die ein sensibles Thema zum Kochen brachte und immer heißer wurde. Der Status quo war unwiederbringlich verloren. Etwas Neues war kurz davor, seinen Platz einzunehmen. Ich war in den letzten Wochen vorsichtig geworden und achtete auf solche Gefühle. Das war auch deshalb möglich geworden, weil ich seit Tagen keinen Alkohol mehr trank. Mein Verstand funktionierte seitdem wie eine geölte Maschine und es machte mir Spaß, in gedankliche Tiefen vorzustoßen, die ich bislang gemieden hatte.
Dieses Gefühl, dass etwas Neues heranzog und das Alte ablöste, war noch schwach. Doch mit jedem Versuch, es deutlicher auszuloten, stieg die Gewissheit in mir, dass es existierte und nicht aufzuhalten sein wird. Mein Geist war noch nicht bereit, es benennen zu können, zu nebulös war die Vorstellung davon. Es verhielt sich wie eine Idee, die erst heranwachsen musste, ehe sie eine materielle Form annehmen konnte. Ich spürte es in mir beinahe so, als wäre ich schwanger. Der Druck dieser neuen geistigen Idee würde sich so lange erhöhen, bis die dünne Schale, die das Innen vom Außen trennte, aufplatzte.
Ich hatte nicht etwa vor, dieser Entwicklung tatenlos zuzusehen, ganz im Gegenteil, ich wollte herausfinden, was da auf mich zukam, um mich darauf einstellen und im besten Falle sogar Einfluss darauf nehmen zu können. Dazu brauchte ich Zeit und ich musste vollkommen ungestört sein. Aus diesem Grund war mir an jenem Tag die Anwesenheit von Erika ganz recht, da ich Nelly schwer erklären konnte, warum ich so spät noch spazieren gehen wollte. Tatsächlich konnte ich es mir selbst nicht erklären. Ich glaubte, ich sei mir meiner Motive bewusst, doch die Wahrheit war, dass es mich in diese Nacht hinaustrieb, weil mich etwas rief. Ich deutete es als Botschaft aus meinem Unterbewusstsein, was nicht völlig falsch war. Allerdings hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich dabei einließ.
Der Nebel war an diesem Abend besonders dicht. Im Licht der Straßenlaternen glitzerten Millionen winziger Wassertröpfchen, die in der Luft schwebten und alles befeuchteten, was sie berührten. Ich stülpte den Kragen meiner Jacke nach oben und ging schneller, um mich aufzuwärmen. Im Gegensatz zu meiner letzten Wanderung sah ich auf meinem heutigen Weg fast keine Lichter, diese Gegend war weitgehend unbewohnt. Im Grunde war es mir heute egal, wohin und wie weit ich ging. Ich war mir sicher, der Funke der Erleuchtung würde mich überall treffen. Alles, was es dazu brauchte, war meine Konzentration. Ich hatte daher nicht auf meine Schritte geachtet, sondern war einfach immer geradeaus marschiert. Im dichten Nebel und bei fast völliger Dunkelheit fiel es mir leicht, mich dem Zufall hinzugeben. Dabei spürte ich, dass sich jene diffuse Stimmung, die mich schon den halben Nachmittag verfolgte, noch verstärkte. Plötzlich, ohne besonderen Anlass, geriet ich ins Zweifeln und blieb stehen. Die unterschiedlichsten Gedanken schwirrten in meinem Kopf herum. Für einen Moment hielt ich es gar für vernünftig, auf dem Absatz kehrtzumachen und nach Hause zu gehen. Doch im Nu meldete sich eine andere Stimme und packte mich bei der Ehre; aus Feigheit eine Chance verstreichen lassen, das wollte ich keinesfalls.
Ich hielt es für angebracht, mein Bewusstsein wieder auf den gegenwärtigen Augenblick zu richten. Am Ende könnte ich mich gar verlaufen haben und mein nächtlicher Ausflug hätte mir außer dem Spott meiner Mitmenschen nichts eingebracht. Alles, was ich mit Sicherheit sagen konnte, war, dass ich in eine Straße am Ortsrand geraten war. Nun jedoch tauchte aus dem Nebel unvermutet eine hohe Mauer vor mir auf. Ich brauchte einen Moment, um mich zu orientieren. Dann sah ich ein großes, schmiedeeisernes Tor und erkannte den Eingang zum Friedhof wieder. ‚Wie passend!‘, dachte ich. ‚Herbst, Nebel, Dämmerung – es könnte keine bessere Ergänzung dazu geben als einen Spaziergang über den Friedhof. Warum nicht?‘
Ich drückte einen der beiden geschmiedeten Torflügel auf, der sich unter leichtem Stöhnen in den Angeln drehte, als würde ihm die Störung der Totenruhe Schmerz bereiten. Ich fühlte mich lebhaft an bekannte Gruselfilme erinnert, was mich eher erheiterte als schockierte. Dennoch breitete sich ein kalter Schauer auf meinem Nacken aus und floss über meinen Rücken abwärts. Ein Windstoß schlug mir einen dürren Zweig ins Gesicht und ich spürte mein Herz schneller schlagen. Dennoch war ich nicht ängstlich, allenfalls wachsam. Hunderte rot glimmende Grablichter zeigten die Grabstellen an und gaben genügend Licht, um die Grabsteine und Inschriften zu erkennen. Ich hatte kein besonderes Ziel, wollte einfach nur ein Runde drehen, mich von der Stimmung inspirieren lassen und auf ein zufälliges Ereignis warten. Welcher Art dieses Ereignis sein sollte, wusste ich selbst nicht. Es war ungefähr so, als ginge ich in ein großes Einkaufszentrum, ohne zu wissen, was ich kaufen will. Ich dachte mir, wenn ich es sehe, dann weiß ich, dass ich es brauche.
Ich ging von Grabstein zu Grabstein und las die Namen und Lebensdaten. Teilweise waren die Inschriften aufwändig mit Gold auf schwarzem Granit geschrieben und gut zu lesen, andere waren in den Stein geschliffen und farblos, sodass es einige Mühe kostete, sie zu entziffern. Aber gerade die alten, verblassten Inschriften weckten mein Interesse. Automatisch formten sich in meinem Kopf Bilder dazu. Eine Helene Pollwieser, geboren 1927, gestorben 1949, und ein Ernst Pollwieser, geboren 1924, gestorben 1999, fielen mir auf; er hatte seine Frau um fünfzig Jahre überlebt. Was mag in ihm vorgegangen sein, als seine junge Frau 22jährig starb? Er hatte nicht mehr geheiratet, sonst wären die beiden nicht im selben Grab beigesetzt worden. Ob er sein Leben lang trauerte? War er verbittert oder konnte er sein Glück in der Erinnerung an sie finden? Und dann dieser Stein: Georg Soginow, geboren 1918, gestorben 1963, und Else Soginow, geboren 1921, gestorben 1968, darunter ein weiterer Name, Maria Soginow, geboren 1952, gestorben 1967. Vermutlich war anlässlich des Todes des Ehemannes auch der Name seiner Frau bereits eingearbeitet und das Datum nach ihrem Tod ergänzt worden, das war damals nicht unüblich. Unfassbar, dass diesem Mädchen, bestimmt ihre Tochter, nur 15 Lebensjahre vergönnt waren! Woran war sie wohl gestorben? Ein Unfall? Eine Krankheit? Hatte die Mutter den Tod ihrer Tochter nicht verkraftet und war ihr ins Jenseits gefolgt?
Ich sah aber auch Gräber von Menschen, die zusammen sehr alt geworden sind. Waren sie in ihren langen Ehen auch glücklich oder haben sie nur „durchgehalten“? Manche Gräber waren schön gestaltet, mit frisch gepflanzten Blumen, farblich perfekt arrangiert, andere waren sich selbst überlassen worden. Es gab Grabsteine, die glänzten, als würden sie täglich blank poliert, und andere, die völlig von Efeu überwuchert waren. Ich fragte mich, ob das etwas über die Beziehung zwischen den Verstorbenen und ihren Angehörigen aussagte, aber es fiel mir schwer, eine eindeutige Haltung dazu einzunehmen. Zwar gebe ich zu, dass mir gepflegte Gräber gefallen, aber wen ehrt man mit den Blumen? Die sterblichen Überreste eines Angehörigen? Sollte man nicht vielmehr den Geist des geliebten Menschen ehren, indem man die Erinnerung an ihn wachhält? Aber wie macht man das am besten? Es soll ja Leute geben, die in regelmäßigen Kontakt mit Verstorbenen treten, Séancen veranstalten und sich mit ihnen „unterhalten“. Zum wiederholten Male fragte ich mich, ob der Mensch, also alles, was er gesagt und getan, geplant, gedacht und gefühlt hat, mitsamt seinem Körper zu Staub zerfällt, oder ob es so etwas wie eine unsterbliche Seele gibt, eine unsichtbare Essenz, die unabhängig von einem Körper existieren kann. Wenn dem so wäre, würden sich diese Seelen dann über die fürsorgliche Grabpflege ihrer Angehörigen freuen und wären die anderen, vernachlässigten bitter enttäuscht darüber, dass ihre Grabstelle dem Verfall preisgegeben wurde? Vielleicht wäre es wichtig zu fragen, von welchen Motiven die Angehörigen geleitet werden, die Gräber auf die eine oder auf die andere Art zu behandeln. Ich konnte mir gut vorstellen, dass viele Menschen glauben, durch eine besonders liebevolle Grabpflege könnten sie wiedergutmachen, was sie zu Lebezeiten des Verstorbenen versäumt hatten.