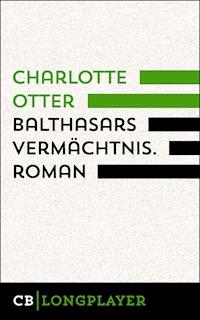
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein schneller, tougher Krimi aus Südafrika: Kriminalreporterin Magdalena Cloete hat vielleicht einen Fehler gemacht, als sie den Anrufer mit der leisen Stimme abwimmelte. Denn jetzt ist er tot. Jemand hat Balthasar vier Kugeln in die Brust gejagt. Es ist das Post-Apartheid-Südafrika der Jahrtausendwende. In Pietermaritzburg, Hauptstadt der Provinz KwaZulu-Natal, regiert jetzt der ANC. Doch in den Townships und Dörfern regieren auch Angst und Aberglaube … War es ein politischer Mord? Maggies Instinkte schlagen Alarm und auf der Suche nach der Wahrheit legt sie sich mit lokalen Politikern und Gangstern an – und hat auf einmal Schlägertypen an der Hacke. Doch Drohungen und selbst Anschläge verstärken nur Maggies Sturheit. Denn mittlerweile weiß sie genug über Balthasars Leben und sein Engagement in der Aidshilfe, um ihre professionelle Distanz in den Wind zu schießen und mit gefährlichen Stunts ihren Hals zu riskieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über das Buch
Kriminalreporterin Magdalena Cloete hat vielleicht einen Fehler gemacht, als sie den Anrufer mit der leisen Stimme abwimmelte. Denn jetzt ist er tot. Jemand hat Balthasar vier Kugeln in die Brust gejagt. Es ist das Post-Apartheid-Südafrika der Jahrtausendwende. In Pietermaritzburg, Hauptstadt der Provinz KwaZulu-Natal, regiert jetzt der ANC. Doch in den Townships und Dörfern regieren auch Angst und Aberglaube ...
War es ein politischer Mord? Maggies Instinkte schlagen Alarm, und auf der Suche nach der Wahrheit legt sie sich mit lokalen Politikern und Gangstern an – und hat auf einmal Schlägertypen an der Hacke. Doch Drohungen und selbst Anschläge verstärken nur Maggies Sturheit. Denn mittlerweile weiß sie genug über Balthasars Leben und sein Engagement in der Aidshilfe, um ihre professionelle Distanz in den Wind zu schießen und mit gefährlichen Stunts ihren Hals zu riskieren.
Ein schneller, tougher Krimi aus Südafrika.
Über die Autorin
Die Südafrikanerin Charlotte Otter schreibt in englischer Sprache, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Sie hat als Kriminalreporterin, als Zeitungsredakteurin sowie als freie Journalistin und Autorin gearbeitet, gegenwärtig jobbt sie in der IT-Branche. Charlotte Otter lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und Tonnen von Büchern in Heidelberg. »Balthasars Vermächtnis« ist ihr erster Roman.
Charlotte Otter
Balthasars Vermächtnis
Roman
Übersetzt von Else Laudan
Mit einem Vorwort von Else Laudan
CulturBooks Verlag
www.culturbooks.de
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2013
www.culturbooks.de
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Printausgabe: © Ariadne Verlag 2013
Übersetzung: Else Laudan, Lektorat: Iris Konopik
Originaltitel: Balthasar’s Gift © Charlotte Otter
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Umsetzung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 1.10.2013
ISBN 978-3-944818-16-0
Inhaltsverzeichnis
Ein schneller, tougher Krimi aus Südafrika
Ein Vorwort von Else Laudan
Aus Südafrika erreicht uns seit ein paar Jahren eindrucksvolle Kriminalliteratur, vermittelt eine Ahnung der multiethnischen, von einer Ära der Rassentrennung gezeichneten Gesellschaft und ihren Metropolen. Charlotte Otter ist eine neue Stimme in dieser Gattung. Ihr eindringlicher Genre-Roman um die couragierte Kriminalreporterin Magdalena Cloete lenkt den Blick auf die östliche Provinz KwaZulu-Natal, ihre jüngere Geschichte und Gegenwart, und nebenbei auf mehrere gern verdrängte Dramen des beginnenden 21. Jahrhunderts.
Christopher G. Moore schreibt im CULTurMAG: »Eine Mordermittlung in einer unruhigen Gesellschaft bringt die Spannungen in den Fokus, die dem Fall eine politische Dimension verleihen. Um Verhaltensweisen, Reaktionen und Gefühle zu verstehen, braucht es eine kulturelle Landkarte. Die besten Kriminalromane funktionieren wie ein GPS, das uns durch die gewundenen Schleichwege, lokalen Gassen und kaum erschlossenen Hügellandschaften führt.« Genau das schafft für mich Charlotte Otter mit diesem schnellen, toughen Krimi, der Südafrika nicht als schwarz-weißes Macho-Abenteuerland zeigt, sondern als sich mühsam demokratisierende Kultur, durch die sich bis heute Klüfte ziehen. Ich hoffe inständig auf weitere Romane mit Maggie und der Henne!
Elise Cooper und Tony Shembe
für ihre Leidenschaft
1
Dienstag, 7 Uhr früh
Sonnenlicht glitzerte auf der Klinge. Es hätte auch eine Armbanduhr sein können oder das Display eines Handys, die blinkende Schnalle eines Gürtels, aber es war ein Messer. Sie erkannte es an der verstohlenen Bewegung, mit der er das gezackte grinsende Ding aus seiner Jeanstasche zog und der Frau an die Rippen drückte. Sein Komplize plünderte ihre Einnahmen, schaufelte Münzen in eine Plastiktüte. Die Frau hielt den Kopf verschämt gesenkt, als sei das Schlimmste die Schande, in aller Öffentlichkeit ausgeraubt zu werden. Ihre Beine drohten zitternd nachzugeben. Nur die Grimasse des Messers hielt sie aufrecht.
Im frühmorgendlichen Berufsverkehr konnten die ihr das Messer in den Leib rammen, ohne dass es jemand mitbekam. Man würde ihren hingestreckten, blutenden Körper erst entdecken, wenn die Menschenmassen sich in ihre Büros, Fabriken, Läden und Schnellrestaurants verfügt und dort ihre Arbeitsgesichter, Uniformen und Namensschilder angelegt hatten. Maggie sah das Ganze von der Straße aus mit an, wo sie zwischen verkeilten Vorstadtlimousinen und Minibustaxis im Chaos des Stoßverkehrs festsaß. »Haltet sie auf!«, brüllte sie, doch die Polsterung ihres Helms verschluckte die Worte. Niemand hörte sie.
Der Messermann verpasste dem Stand der Straßenhändlerin einen Tritt, und ihre Waren – eine bunte Mischung aus Äpfeln, Orangen und Basecaps mit dem Logo der hiesigen Footballmannschaft – kullerten über den Boden. Sein Kumpan schubste die Frau, sie taumelte, fiel hin, und ihr Kopf traf das Pflaster mit einem scheußlichen Knack, das Maggie durch ihren Helm und über den Lärm der Motoren hinweg zu hören glaubte.
Ihr Schrei gellte in Maggies Ohren.
Die Ampel sprang auf Grün, und Maggie riss den Gaszug auf. Es roch scharf nach Benzin. Sie verfolgte die auf und nieder wippenden Köpfe der Diebe in der Menschenflut auf dem Bürgersteig. Sah, wie sich das rote und das gelbe T-Shirt durch die Menge schlängelten, Blicke gesenkt, nicht rennend, aber mit schnellem Schritt. Zielstrebig hielten die beiden auf den nahen Taxistand zu, wo sie der Innenstadt und der Gefahr des Entdecktwerdens entrinnen konnten. Maggie blieb auf gleicher Höhe mit ihnen, der Motor ihrer Yamaha knurrte tief.
Sie querten die Longmarket Street, Maggies Weg zur Arbeit. Eigentlich sollte sie hier rechts abbiegen, noch ein Stück fahren, ihr Bike parken und sich im Büro an ihr Tagwerk begeben, aber eine süße Mischung aus Benzindunst, Adrenalin und Grimm über den großspurigen Auftritt der Diebe trieb sie weiter hinter ihnen her. Sie gab wieder Gas, und der eine Kerl wandte sich um. Stumm blickte er ihr direkt in die Augen. Sie funkelte ihn drohend an. Er packte den anderen Mann am Arm und zog. Sie rannten los. Maggie peitschte ihre Maschine hoch.
Die Männer rempelten Fußgänger an, wichen aus, hasteten im Zickzack weiter. Sahen sich über die Schulter nach dem Motorrad um, schwenkten an der nächsten Ecke scharf nach rechts. Die Ampel stand auf Grün, und sie folgte ihnen. Hier waren weniger Leute unterwegs, die Männer rannten schneller. Sie würde sie verlieren. Gleich kamen die Querstraßen, die zu den Gassen der Innenstadt führten. In diesem Gewirr konnten sie abtauchen und endgültig verschwinden.
Sie schaltete runter, die Maschine brüllte auf, doch der Abstand zwischen ihr und den Männern vergrößerte sich weiter. Sie entkamen ihr.
Es gab nur eine Möglichkeit. Sie hielt auf den Bordstein zu und riss den Lenker hoch. Auf dem Gehweg kam sie schneller voran. Ein Mann im Anzug mit Handy am Ohr japste entgeistert und presste sich schleunigst an ein Schaufenster. Jetzt holte sie auf. Schon sah sie die Armmuskeln der beiden Kerle pumpen, hörte ihr Keuchen. Eine Frau, die gerade ihren Wagen geparkt hatte, schrie auf und warf hastig die Autotür zu. Im Rückspiegel sah Maggie kurz das dunkle O ihres Mundes.
Das Motorrad berührte beinahe schon die Fersen. Die T-Shirts waren dunkel von Schweiß.
»Halt!«, schrie sie. Keine Reaktion.
Vor ihr lag die Auffahrt zu einem Parkhaus. Die beiden drehten ab und sprinteten hinein. Maggie hinterher, doch da trennten sich die Männer. Einer rannte zurück auf die Straße. Der andere – gelbes Shirt, der Messermann – kletterte hastig die Holzstreben hoch, die auf die Überdachung des seitlich offenen Carports führten. Schon zog er sich aufs Dach.
Maggie drehte den Motor ab, zerrte die Maschine auf ihren Ständer und setzte ihm nach.
Die Hände schmierig vom Dachpappenteer, kämpfte sie um Halt, um sich aufs Dach zu wuchten, dann gelang es ihr, ein Knie über die Kante zu schieben. Sie hakte die Finger hinter ein paar Blechschindeln, die schon in der Morgensonne glühten, und zog sich vollends hoch. Das Dach bebte unter den Schritten des Mannes, als er über die Längsseite des Carports rannte. Maggie stürmte hinterher, in ihren Ohren donnerte das Blut.
Er erreichte das Ende des Dachs, schwang sich über die Begrenzungsmauer. Sie hörte ein Ächzen, als er unten aufkam. Dann stand sie an der Kante, sah die Betonfläche zwei Meter tiefer. Der Mann rappelte sich hoch und kam auf die Füße, aber er hinkte. Er hatte sich verletzt.
Sie kniete sich hin, drehte sich um, hielt sich mit beiden Händen fest und ließ sich bäuchlings an der rauen Mauer hinabgleiten. Spürte den Stoß in den Knöcheln, als sie unten landete, wirbelte herum und sah den Mann um die nächste Ecke humpeln. Schon fast in Reichweite.
Sie sprintete über den leeren Hof, schoss hinter ihm her um die Ecke.
Das Messer grinste sie an.
»Lass mich in Ruhe«, keuchte er, die Finger um den Griff geklammert. »Ich hab das Geld nicht.«
Maggie fühlte, wie ihr eine kalte Schweißperle zwischen den Schultern hinabrann. Sie streckte eine Hand aus. »Gib mir das Messer.«
Mit der anderen Hand griff sie in ihre Hosentasche. Sie hatte Mathonsi im Kurzwahlspeicher.
Schmerz peitschte über ihre offene Handfläche, eine Linie aus Blut durchkreuzte das Wort, das dort eintätowiert war. Die vier Buchstaben verschwammen, wurden unleserlich. Sie schaute hoch und sah seine Zähne aufblitzen, bevor er herumfuhr und wieder loslief. Roter Dunst schien sich um ihre Schläfen zu bilden, nackte Wut vernebelte ihr den Blick. So kam er ihr nicht davon.
Sie spurtete hinterher, packte seine Arme und sprang ihn an, ohne auf den stechenden Schmerz in ihrer Hand zu achten. Unter ihrem Gewicht gab sein angeknackster Knöchel nach, er ging zu Boden. Maggie spürte die steinharten Muskeln in seinen Armen, als sie verbissen rangen. Er strampelte wild mit den Beinen, sie zog den Fuß zurück und trat kräftig gegen seinen verletzten Knöchel. Er schrie auf. Als er reflexhaft seinen Fuß umklammerte, griff sie rasch zu, zog das Messer aus seiner Jeanstasche. Zielte mit seiner eigenen Klinge auf ihn, rappelte sich auf, zückte ihr Handy und wollte Mathonsis Nummer drücken.
Stattdessen klingelte das Handy. Ihr Boss war dran.
»Das passt gerade ganz schlecht«, sagte sie. Zu ihren Füßen manövrierte sich der Dieb in eine sitzende Haltung. Maggie setzte ihm das Messer unters Kinn, und er fuhr zusammen. In seinem Blick lag ein stumpfes Schillern der Verzweiflung. Er machte Anstalten, von ihr weg zu kriechen. Sie stellte einen Fuß auf seine ausgestreckte Hand – nein, er würde ihr nicht entwischen. Dafür sorgten ihre stahlkappenbewehrten Docs.
»So ist es immer«, versetzte Zacharius Patel ungerührt. »Es hat eine Schießerei gegeben. Vermutlich Mord. Mach, dass du zum HIV-Haus kommst. Ed ist schon auf dem Weg.«
»Geht klar«, sagte sie. Mord war brisanter als ein messerschwingender Dieb. »Muss hier nur noch schnell was abfertigen.«
»Mach keinen Quatsch, Cloete«, sagte Patel. »Gib Gas und versuch vor den Cops da zu sein. Wenn sie erst den Tatort abgesperrt haben, ist die Story im Koma.«
Sie verzog das Gesicht und drückte den Anruf weg. Ihr brauchte kein Zacharius Patel zu erzählen, wie sie ihren Job zu machen hatte.
Ohne den Schmerz zu beachten, packte sie mit der Rechten das knochige Handgelenk des Mannes und zog mit der Linken schnell den Schnürsenkel aus einem ihrer Docs. Zerrte den Kerl auf die Füße, schubste ihn zu einem Laternenpfahl und band ihm die Hände hinter dem Pfahl zusammen. Dann rief sie Mathonsi an.
»Ich hab hier ein Geschenk für euch«, erklärte sie der Polizistin. »Carbineer Street, gleich hinterm Parkhaus Prince Alfred.«
Zurück beim Bike, ruckte sie es vom Ständer und setzte den Helm auf. Keine Zeit, die blutende Hand zu säubern oder zu versorgen. Sie musste zum HIV-Haus, und zwar schnell.
Eine Fahrt von acht Blocks im dicksten Berufsverkehr. Als sie den Blinker setzte, um auf die Hauptstraße einzubiegen, klemmte sich wild hupend ein Minibustaxi vor ihre Nase, aus den offenen Fenstern dröhnte Kwaito, drinnen drängten sich fünf Fahrgäste pro Sitz. Sie stieß einen lautlosen Fluch aus, der Fahrer warf ihr ein lässiges Peacezeichen zu. Die Taxis beherrschten die Straßen, und wer anders darüber dachte, riskierte einen Stoß in die Seite. Das konnte sie sich gerade nicht leisten. Die Arbeit rief.
Dann sprang die Ampel um, und Horden von Fußgängern schwärmten über die Straße. Sie fluchte erneut. Sobald der Weg frei von menschlichen Hindernissen war, trieb sie die Maschine hoch, bis die Häuser und Läden links und rechts zu Streifen verschwammen.
Als sie rechts einbog, sah sie die dicht gedrängte Menschenmenge vor dem Sitz der hiesigen Aidshilfe-Mission, den Einheimischen als HIV-Haus bekannt. Ein finster dreinblickender Polizist bewachte das Tor in dem stacheldrahtbewehrten Zaun.
Sie kam zu spät. Patel würde fuchsteufelswild sein. Jagd auf Straßenräuber stand eindeutig nicht in ihrer Stellenbeschreibung.
Sie eilte auf die schweigende Menge zu, suchte Ed. Schnell machte ihr geübter Blick seine blonden Haare und breiten Schultern ausfindig.
»Hi«, sagte sie. »Bin gekommen, so schnell ich konnte.«
»Nicht schnell genug«, erwiderte der Fotograf, die Kamera ans Gesicht gepresst. Ed hatte ein Händchen für Bilder, nicht für Worte.
Aus dem Inneren des Gebäudes ertönte Wehklagen. Jemand lag auf der Stoep, blutüberströmt. Ein Notarztteam versuchte offenbar gerade, die Person zu reanimieren, aber es sah nicht aus, als ob sie Erfolg hätten.
Mit gezücktem Notizbuch wandte sich Maggie an einen Mann mittleren Alters, der neben ihr stand. Er war klein und rundlich und hielt sich beide Hände vor den Mund, die Augen weit aufgerissen.
»Ich bin von der Gazette. Haben Sie gesehen, was passiert ist?«
»Hau, Miss«, sagte er. »Ich hab in meinem Laden die Schüsse gehört. Bin hergerannt und sah ihn da liegen.«
»Allein?«
»Nein, die Chefin vom HIV-Haus ...«
»Lindiwe Dlamini.« Das Oberhaupt der Aidshilfe-Mission war wohlbekannt für ihre Ansichten zur Politik um HIV und AIDS. Sie erzählte jedem, der zuhörte, dass die Regierung bei weitem nicht genug tat, um die Epidemie in den Griff zu bekommen.
»Ja, genau, sie saß da, hat ihn im Arm gehalten und geweint. Das Blut lief aus seiner Brust überallhin, auch auf ihre Sachen. Dann kamen die Cops und brachten sie nach drinnen.«
»Wissen Sie, wer der Mann ist?«
»Er kommt oft in meinen Laden, holt sich Cooldrinks. Sein Name ist Balthasar Meiring.«
Maggie erinnerte sich sofort an die heisere leise Stimme. Es war kurz vor Redaktionsschluss gewesen, und sie stand unter Zeitdruck, als sie den Anruf entgegennahm, die Finger auf der Tastatur, den Hörer zwischen Kopf und Schulter geklemmt.
»Ms. Cloete?« Er hatte einen Akzent gehabt, Afrikaans mit einer Schicht gehobenem Englisch darüber, als hätte er eine englische Schule oder Universität besucht. Der Dialekt klang ähnlich wie ihr eigener, nur dass sie nicht das Privileg einer akademischen Bildung genossen hatte. Stattdessen hatte ihr die Gazette eine Art dritten Bildungsweg eröffnet, mit einem Bachelor in Mord, Vergewaltigung und Raub, Tag für gnadenlosen Tag.
»Cloete.«
»Balthasar Meiring hier, von der Aidshilfe-Mission. Wir haben nächste Woche einen Fall vor dem Landgericht, bei dem Sie unbedingt dabei sein müssen.«
»M-hm.« Sie unterbrach das Tippen, um in ihren Notizen zu wühlen. Da war der O-Ton, den sie suchte. Mit einer Breitseite fliegender Finger feuerte sie das Zitat in ihre Story.
»Mehrere hiesige Familien, die durch AIDS Angehörige verloren haben, führen eine Sammelklage gegen den Arzt, der ihnen gefälschte Medizin verkauft hat. Es geht um gewaltige Schadenersatzansprüche.«
Sie hörte auf zu tippen und sah aus dem Fenster auf die Kronen der Eichen in den Old Supreme Court Gardens. »Klingt nach einer Story, die wir bringen würden. Hören Sie, ich geb das weiter an Aslan Chetty, meinen Kollegen vom Ressort Gesundheit und Soziales. Wie, sagten Sie noch, war Ihr Name?«
»Meiring«, antwortete er, »Balthasar Meiring.« Kurze Pause, dann fuhr er hartnäckig fort: »Aber, Ms. Cloete, Sie sind doch zuständig für Verbrechen. Ich kenne Ihre Artikel. Ich will, dass Sie der Sache nachgehen.«
»Danke für das Kompliment, aber ich kann nicht einfach im Revier meiner Kollegen wildern.«
»Ms. Cloete«, die Stimme wurde eindringlicher. »Hier geht es um Leute, die das Leben schon übelst drangsaliert hat. Sie brauchen jemanden, der an ihrer Story dranbleibt und sich ernsthaft für ihr Schicksal interessiert. Jemand mit Sinn fürs Menschliche. Nicht bloß irgendwelche Paparazzi, die nur ihre Schlagzeilen im Kopf haben. Ich war lange fort, aber 1989 war ich noch hier. Ich hab mitgekriegt, wofür Sie einstehen und was Sie auf sich genommen haben.«
»Ich will mal sehen, was ich tun kann.« Sie war es gewöhnt, von Spinnern angerufen zu werden, die glaubten, ihre Story sei ein Aufmacher. Sie hatte Übung darin, solche Kandidaten elegant am Telefon abzuwimmeln. Im Übrigen wollte sie nicht an 1989 denken. Eine Kostprobe Knast hatte ihr gereicht. »Ich verspreche Ihnen, wir bleiben dran.«
»Sie sind die Richtige, Ms. Cloete«, raunte der Mann.
Sie hatte das Gespräch beendet und ihre Story vor Ablauf der Deadline eingereicht. Auf dem Weg nach draußen steuerte sie Aslans Schreibtisch an und erzählte ihm von dem Anrufer. Er wiegte den Kopf. »Ich tu mein Möglichstes, Maggie, aber du weißt ja, wie es ist.« Sie wusste es. Dank der AIDS-Epidemie und dem spürbaren Mangel an Engagement seitens der Regierung war das Ressort Gesundheit und Soziales mehr als ausgelastet und das zweitgrößte der Zeitung. Nach Verbrechen, versteht sich.
Balthasar Meiring hatte ihr also eine Story ans Herz legen wollen, und nun war er tot. Am helllichten Tag erschossen, und zwar auf der Stoep der Aidshilfe-Mission. Verdammt. Sie hätte doch auf ihn hören sollen, als er anrief. Hätte zu dieser Verhandlung gehen sollen. Wäre er dann noch am Leben? Musste man jetzt schon sterben, um sich ihre Aufmerksamkeit zu sichern?
Sie bahnte sich einen Weg zu dem Polizisten und zeigte ihm ihren Presseausweis. »Wissen Sie, was hier vorgefallen ist?«
Es kam selten vor, dass Cops am Tatort Informationen preisgaben, aber ab und zu erwischte sie jemanden, der redete. Sie fragte immer, nur für den Fall, doch der Uniformierte sah sie kaum an. »Da ist wohl ein Raubüberfall aus dem Ruder gelaufen«, knurrte er unbeteiligt. »Für druckbare Informationen wenden Sie sich an die Pressestelle der Polizei.«
Das war die Antwort, mit der sie gerechnet hatte. Thandi Mathonsi, die Polizeisprecherin, informierte Maggie tagtäglich über große und kleine Verbrechen und beantwortete geduldig ihre Millionen von Fragen. Groß und schlagfertig, mit einem Verstand so scharf wie ihre Designerbrille, wusste sie immer, wie sie den journalistischen Hunger nach Details befriedigen konnte, ohne ihre politischen Grenzen zu überschreiten.
»Keine Fotos mehr jetzt!« Der griesgrämige Cop reagierte wohl auf ein Signal von drinnen und hielt resolut eine Hand vor Eds Linse.
Maggie warf Ed einen Blick zu und hoffte, er hatte etwas im Kasten. Er zog eine Grimasse und ließ sich die Kamera auf die Brust fallen.
Die Sanitäter gaben auf. Der Tod hatte gesiegt. Sie breiteten eine schwarze Decke über die Leiche und zogen ab. Der Rest war Sache der Polizei. »Gehen Sie weiter«, forderte der Charmeur am Tor die Schaulustigen auf. »Die Party ist vorbei.«
Die Leute zerstreuten sich kopfschüttelnd. Niemand sieht gern Menschen sterben. Maggie griff sich den rundlichen Typ, bevor er verschwinden konnte, und sie verzogen sich in den Schatten eines Jacarandabaums auf der anderen Straßenseite. »Ich schreibe einen Bericht für die morgige Ausgabe der Gazette. Darf ich Sie zitieren?«
»Das geht in Ordnung.« Er buchstabierte seinen Namen, und sie wiederholte ihn, um sicherzugehen.
»Gibt es etwas, was Sie über Meiring sagen möchten?«
»Freundlicher Typ, nahm sich immer Zeit zum Reden. Sprach auffallend gut Zulu.« Er zog eine Ausgabe der Gazette aus der Gesäßtasche und fächelte sich Luft zu.
»Ist so was hier früher schon vorgekommen?«
»Keine Schießereien«, er sog Luft durch die Zähne. »Nicht seit der Geiselnahme im Dezember. Ein paar kleinere Überfälle, aber das ist der erste richtig schlimme Vorfall seit langer Zeit.«
»Hat irgendwer, den Sie kennen, irgendwas gesehen? Vielleicht den Täter?«
»Nix.«
Ein zweiter Krankenwagen rollte heran. Eine Frau in blauer Jacke mit reflektierenden Streifen auf den Ärmeln stieg aus und ging ins Haus. Sie trat über die Blutlache hinweg, die auf der Treppe der Stoep langsam gerann.
Maggie und Ed warteten im Schatten, während die Polizei die Leiche abtransportierte. Es hieß immer, der unter Journalisten so verbreitete Alkoholismus läge am Stresspegel, aber sie war überzeugt, dass der ständige Leerlauf viel mehr dazu beitrug. Sie verbrachten ihr Leben mit Warten: Warten, bis Leute zu weinen aufhörten. Warten, dass sie aus dem Haus kamen, damit man ihnen ein Statement abluchsen konnte. Warten auf diesen und jenen Rückruf. Warten, ob eine Gerichtsverhandlung nicht zum x-ten Mal vertagt wurde. Warten, bis die Polizei eine Erklärung abgab, so dass man eine Story raushauen konnte. Warten, ob der Chefredakteur die Story absegnete, damit man sie in Satz geben und verflixt noch mal endlich nach Hause gehen konnte. Kein Wunder, dass sie alle soffen.
Ihre Hand tat allmählich ernstlich weh. Das getrocknete Blut zog eine schartige Linie über ihre Handfläche.
Jetzt kam die Sanitäterin wieder aus dem Haus, den Arm stützend um eine Frau gelegt. Lindiwe Dlamini ging gebeugt und lehnte sich schlaff an den Körper der jungen Helferin. Ihr weißes Hemd war stellenweise mit Rot vollgesogen, der marineblaue Rock übersät von dunkleren Flecken. Maggie überquerte die Straße.
»Mrs. Dlamini?«
Sie blickte auf, die Augen geschwollen, die Wangen tränengestreift.
»Ich bin Maggie Cloete von der Gazette. Können Sie mir sagen, was passiert ist?«
Die Sanitäterin machte ein finsteres Gesicht, aber Lindiwe Dlamini blieb stehen. Maggie hielt den Atem an. Irgendeine Information, ein Ansatzpunkt für ihre Story?
»Wir werden zu gegebener Zeit eine Erklärung veröffentlichen«, sagte Dlamini, ihre riesige schwarze Handtasche fest an sich gepresst, und ging weiter.
»Ist das Opfer Balthasar Meiring?«
Die Frau stand schon vor dem Krankenwagen, um ihre Schultern lag beschirmend der blaue Arm der Helferin. Maggie erhaschte ein kurzes Nicken der Bestätigung, ehe Lindiwe Dlamini einstieg. Dann rollte das Fahrzeug davon. Zurück blieben zwei Polizisten, die auf der Stoep standen und sich berieten, sowie eine Pfütze gerinnenden Blutes und die kreischenden Hirtenmainas in den Jacarandabäumen.
Bis auf den Namen des Opfers hatte sie nichts – keinen Zeugen, keinen Kommentar von Lindiwe Dlamini, und dank dem muffeligen Cop wahrscheinlich nicht mal brauchbare Bilder. Alles, was sie hatte, war eine schmerzende Hand und in ihren Eingeweiden das nagende Gefühl, dass sie Balthasar Meiring nicht so hätte abwimmeln dürfen.
2
Dienstag, 9 Uhr
In der Redaktion hielt sie ihre Hand unter kaltes Wasser. Frisches und getrocknetes Blut und Dreck rannen in den Abfluss. Sie tupfte die Hand trocken und wickelte etwas Klopapier um die Wunde. Die Tätowierung war mal wieder verblasst. Lynn. Sie würde den Schriftzug bald nachstechen lassen müssen. Alle paar Jahre wieder. Damit sie es nie vergaß.
Sie holte sich einen Kaffee – schwarz, kein Zucker – und begab sich in den Besprechungsraum, wo ihre Kollegen rund um den ovalen Tisch saßen, auf dem sich die Zeitungen des Tages türmten. Es roch nach Kaffee und Tinte, unterlegt vom Adrenalin eines neuen Tages an der Front. Auch nach elf Jahren als Kriminalreporterin hatte sie die Nase noch nicht voll von diesem Geruch.
Aslan zwinkerte ihr zu, als sie sich neben ihm auf einen Stuhl gleiten ließ, aber Patel bedachte sie mit einem finsteren Blick. Der Nachrichtenredakteur war klein und durchtrainiert mit einem dazu passenden blitzschnellen Verstand. Er hatte eine ganze Reihe von Marotten. Eine davon betraf Pünktlichkeit.
»Du warst heute spät dran, Cloete.«
Sie zuckte die Achseln. »Musste einen Dieb fangen.« Sie lehnte sich nach vorn und zog eine druckfrische Zeitung zu sich heran. Ihr Artikel von gestern – Massenkarambolage auf dem Highway – war auf der Titelseite. Ihren Namen unter dem Aufmacher der Zeitung zu sehen gab ihr ein warmes Gefühl der Befriedigung.
»Und dir dabei Blessuren einhandeln.« Er deutete auf ihren behelfsmäßigen Verband.
»Bloß ein Kratzer.«
»Schön, wir fühlen uns also geehrt, dass du pünktlich zur Sitzung erscheinst. Und warten mit angehaltenem Atem auf deinen Bericht.«
Sally-Anne Sheperd, die Kunstjournalistin, kicherte beflissen. Männer auf der Suche nach Bestätigung für ihr Ego konnten sich auf die Dienste von Sally-Anne Sheperd stets verlassen.
»Sieht nach Mord aus. Das Opfer ist ein Mann namens Balthasar Meiring.«
»Motiv?«
»Keine Ahnung. Die Cops vor Ort spekulierten, dass es ein vermasselter Raubüberfall war.«
»Wissen wir was über diesen Meiring?« Patel kratzte sich mit einem Bleistift am Kopf. Ein Leben als Chefredakteur und Sklave von sechs Deadlines pro Woche, dazu ein Team von dickköpfigen Reportern und ein Herausgeber, dem vor allem daran lag, seinen Status in Cocktailkreisen zu erhalten – das alles hatte seine Schläfen grau gefärbt.
»Wenig. Er hat mich letzte Woche angerufen, es ging um den Prozess wegen AIDS-Medikamentenschwindel vor dem Landgericht.«
Patel runzelte die Stirn. »Er hat dich angerufen, und jetzt ist er tot?«
Sie wand sich unbehaglich. »Ja. Ich hab den Fall an Aslan weitergereicht, aber jetzt fällt er wohl wieder in mein Ressort.«
»Ich schau mal, ob ich es dazwischenkriege.« Aslan fuhr sich mit der Hand über die sorgfältig nach hinten gegelten Haare.
»Du meintest doch, du hast zu viel zu tun.«
»Das war, bevor ein aufsehenerregender Mordfall daraus wurde.« Aslan lehnte sich im Stuhl zurück und verpasste Maggie die volle Breitseite seines einnehmenden, strahlend weißen Lächelns.
»Womit es naturgemäß in mein Ressort fällt.« Sie verschränkte die Arme. Solche Spielchen waren ihr nicht neu. Sie hatte ihm alles beigebracht, was er über Journalismus wusste. Übergriffe auf ihr Ressort ließ sie nicht durchgehen.
»Na, dann sollen andere Federn bei Schuld und Elend verweilen.« Aslan mit seinem Abschluss in englischer Literatur zitierte bei jeder Gelegenheit Jane Austen. Sie schnitt ihm eine Fratze. Sie hatte nie eine Zeile von Jane Austen gelesen und auch nicht die Absicht.
»Kinder, keine Streitereien.« Patels Mahnung brachte beide zum Schweigen. Er wandte sich an Ed. »Fotos?«
»Ein paar«, sagte der Fotograf. Sally-Anne beugte sich vor und flüsterte ihm etwas zu. Die Nähe ihrer Lippen an seinem Ohr und das leichte Kräuseln der gebräunten Haut um seine Augen beim Zuhören verrieten deutlich, dass ihre Beziehung über das Professionelle hinausging. Maggie bohrte sich die unversehrte Faust in ihre verletzte Handfläche. Was sah er bloß in dieser oberflächlichen, affektierten Nulpe?
»Warum nur ein paar?« Patel fixierte ihn wie ein Mungo eine Schlange.
»Die Cops haben nicht mitgespielt.«
»Dann müsst ihr wohl die trauernde Familie besuchen. Rettet die Story und bringt mir Fotos von tief erschütterten Angehörigen.«
Maggie zupfte an ihrem Klopapierverband herum. Er begann sich bereits aufzulösen. »Die Polizei hat die Verwandten wahrscheinlich noch gar nicht benachrichtigt. Es ist erst vor einer Stunde passiert.«
Patel rieb sich das Kinn. »Meiring«, sagte er. »Kann es sein, dass er irgendwie mit Lourens Meiring verbandelt ist?«
Lourens Meiring war ein ortsansässiger Farmer. Er hatte vor über einem Jahrzehnt ein grotesk mildes Urteil erhalten, nachdem er einen seiner Arbeiter umgebracht hatte. Er plädierte auf Notwehr, und das Justizsystem des Apartheidsregimes hielt es für angemessen, ihm nicht mal ein Jahr auf Bewährung zu verpassen.
»Das weiß ich nicht«, sagte Maggie. »Wobei – einer hat erzählt, dass Meiring gut Zulu sprach. Das würde zu einem Farmersohn passen.«
»Überprüf das noch, bevor ihr hinfahrt. Cloete und Blomfeld wegtreten.«
Sie erhoben sich, bereit zum Aufbruch.
»Ach, Cloete?« Patel starrte in seine Aufzeichnungen, sah sie nicht an.
»Ja?«
»Nzimande macht mir Druck, er will eine starke Headline, also reiß dich bitte zusammen. Keine Umwege, um Jagd auf Bankräuber zu machen oder Taschendiebe zu verprügeln. Ich will eine anständige Titelstory und gute Bilder.« Er gönnte ihr ein schiefes Lächeln.
»Jawohl.« Sie schlug die Hacken zusammen und stapfte aus dem Raum, dicht gefolgt von Ed. Zacharius Patel bekam vielleicht Druck vom Herausgeber, aber seine Direktiven konnte er sich sparen. Sie wusste besser als jeder andere in seinem Stab, wie man noch unter schwierigsten Umständen eine Story an Land zog.
»Ich geh noch ins Archiv und hol mir Hintergrundinfos zu Meiring«, sagte sie zu Ed. »Schnapp dir deine Ausrüstung und warte beim Fuhrpark auf mich.«
Ed trollte sich, um seine Kameras zu holen. Maggie ging Informationen jagen. Auf dem Weg rief sie bei Officer Mathonsi an, die nach dem zweiten Klingeln dran war. »Hallo, Maggie.«
»Thandi? Der Typ, der heute Morgen vor dem HIV-Haus erschossen wurde, habt ihr da schon irgendwas?«
»Jaa«, sie dehnte das Wort, als ob sie ihren Arm nach einer Akte ausstreckte. »Meiring. Familie aus Greytown. Farmer. Sie sind schon unterrichtet. Der Vater ist auf dem Weg hierher, um die Leiche zu identifizieren.«
»Wie heißen die Eltern mit Vornamen?« Maggie hielt den Atem an.
»Sanet und Lourens.«
Sie atmete aus. Balthasar Meiring war also der Sohn eines schießwütigen Rechten, der nicht erfreut sein würde, wenn die lokale Presse ihm mit Fragen über die Verbindung seines Sohns zum HIV-Haus die Tür einrannte.
Verdammter Patel. Er hatte auf Anhieb richtig gelegen. Wieder mal.
Thandi gab ihr die Adresse – eine Farm namens Oorwinning an der Straße nach Greytown.
»Und mein Geschenk?«, fragte Maggie. »Habt ihr ihn gefunden?«
»Als wir hinkamen, war er weg. Hat uns nichts hinterlassen bis auf einen blutbefleckten Schnürsenkel. Ich schätze, der gehört dann wohl Ihnen?«
Maggie überging den leisen Spott. Thandi Mathonsi mochte sich amüsieren, aber die Cops taten einfach nicht genug, um gewöhnliche Leute zu schützen. Sie verabschiedete sich, zog ihren senkellosen, schlappenden Stiefel aus und eilte die zwei Stockwerke zum Archiv hinauf.
»Morgen, Alicia«, rief sie laut. Es rumorte kurz hinter den Regalen, dann tauchte Alicia auf. Ihre Kleidung war heute in verschiedenen Schattierungen von Mauve gehalten, was zu ihrer bläulichen Haartönung passte, und sie roch nach dem Lavendelduft alter Damen. Die dienstälteste Angestellte der Gazette sah sich als Torhüterin des Zugangs zu Informationen. Sie verlangte besondere Behandlung. Außerdem unterhielt sie einen Medikamentenfundus, der jeder Apotheke Konkurrenz machen konnte.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Maggie und wappnete ihre Nase gegen die bevorstehende Reizüberflutung, als die Archivarin sich über den Tresen lehnte und sie sorgenumflort anblickte. Alicia, die zwei Etagen entfernt vom Trubel der Redaktion im Archiv festsaß, fand, dass höfliche Erkundigungen über ihren Gesundheitszustand das Mindeste waren, was ihr zustand. Ohne diesen Tribut würde sie keine Informationen preisgeben, und Maggie brauchte Informationen.
»Ich habe sehr schlecht geschlafen.« Alicia hatte eine Vorliebe für schlimme Nächte. »Die verflixten Affen haben schon wieder auf dem Dach herumgetobt.«
»Das tut mir leid.«
Alicia blinzelte sie an. »Haben Sie Probleme mit Ihrem Schuhwerk, Liebes?«
»Ja«, sie stellte ihren Stiefel auf den Tresen. »Sie haben nicht zufällig einen Schnürsenkel übrig?«
»Doch. Und einen Verband für die Hand da brauchen Sie auch.« Alicia öffnete ihre Schublade, holte ein antiseptisches Spray heraus und duschte die Wunde damit. Es stach höllisch, aber sie war dankbar. Eine entzündete Hand konnte sie nicht brauchen. Alicia nahm eine Mullbinde aus ihrem Erste-Hilfe-Fundus, wickelte sie um Maggies Hand und förderte dann einen Schnürsenkel zutage. Neongrün. »Jetzt, wo der Selbstfürsorge Genüge getan ist: Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Sie trug ihr Anliegen vor und fädelte den Senkel ein, während Alicia sich in einer Lavendelwolke zur Abteilung Achtziger aufmachte, um die Unterlagen über Lourens Meiring zu suchen. Mit einem gelben Pappordner kehrte sie zurück. Darauf stand Meiring, Lourens und darunter: Totschlag ohne Vorsatz. Afrikaaner-Sezession, Afrikaner Weerstandsbeweging AWB.
Maggie setzte sich an einen Tisch, schlug ihr Notizbuch auf und trug ein paar Infos zu Meiring senior ein. 1986 hatte er nur neun Monate auf Bewährung bekommen, der Urteilsspruch lautete auf Körperverletzung mit Todesfolge, im Affekt. Das Opfer war einer seiner Farmarbeiter, ein Mann namens Pontius Ncube. Sie fand ein körniges Foto von Meiring zur Zeit des Prozesses. Bärtig, sonnengebräunt, in Khakishorts, der Inbegriff des weißen Farmers aus KwaZulu-Natal. Nur eben mit einer Mordanklage am Hals.
»Danke, Alicia«, sagte sie und klatschte die Akte wieder auf den Tresen. »Dann wollen wir mal Mister AWB aufsuchen.«
3
Dienstag, 10 Uhr
Trotz ihrer pochenden Hand fuhr Maggie sie raus nach Greytown. Als Künstler musste Ed ständig aus dem Fenster starren und die Landschaft bewundern, und es war ihr lieber, wenn er dabei nicht die Hände am Lenkrad hatte. Da die Dienstwagen der Gazette grundsätzlich keine Klimaanlage besaßen, hatten sie die Fenster ganz heruntergekurbelt. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn, ihr T-Shirt klebte feucht an der Rücklehne des Fahrersitzes.
Sie sausten über die sanften Hügel ostwärts aus der Stadt heraus. Am Himmel kreiste ein Falke über seiner Beute. Ed zielte mit seiner Linse und schoss ein Foto. Ein Staudamm schimmerte zu ihrer Linken, und sie stellte sich das kühle Nass vor, den Genuss, aus der Hitze in eisige Kälte einzutauchen und einen Blick auf Eds muskulöse Schenkel zu werfen. Sie pfiff sich zurück. Das war gefährlich tiefes Wasser, zu tief für sie.
Es hatte eine Zeit gegeben, da sie mit Ed Bromfields muskulösen Schenkeln aufs Intimste vertraut war. Damals war sie noch ein Frischling unter den Reportern, von der Berichterstattung über Vorstadtgaunereien direkt in einen Bürgerkrieg katapultiert. In den Townships von KwaZulu-Natal tobten täglich neue Schlachten zwischen Mandelas ANC-Kadern und der alten Garde der Inkatha-Führer. Sie sah die Teenager daliegen, deren Blut in den ausgedörrten Boden sickerte, die Frauen, beim Wäscheaufhängen mit Pangas niedergemetzelt. Sie hatte sich damals für ein paar Monate in Eds Arme geflüchtet, um diese Bilder loszuwerden.
Mit den Jahren waren sie dann verblichen, doch Balthasar Meirings Anruf letzte Woche hatte sie ihr wieder frisch ins Gedächtnis gerufen.
»Hier abbiegen.« Eds Stimme holte sie in die Gegenwart zurück. Ein knarrendes blaues Schild wies zur Oorwinning Farm.
Sie bog vom asphaltierten Highway auf einen Feldweg ein, zerfurcht und holprig. Die Akazien der Meiring-Plantage kamen in Sicht, wie gut gedrillte Soldaten schienen sie im Gleichschritt über die Hügel zu marschieren. Diese Akazien waren invasive Fremdlinge, für die hiesige Lederindustrie kultiviert. Entsprechend bedeutete die schier endlose Ausdehnung dieses Baumbestands, dass Meiring ein vermögender Mann war.
Sie roch die Staubwolke, noch bevor sie sie im Rückspiegel entdeckte – ein Bakkie donnerte hinter ihnen heran und trompetete wie ein wütender Elefantenbulle. Maggie wich zur Seite aus und hielt an, das Fahrzeug raste dicht an ihnen vorbei und füllte den Toyota mit Staub.
Ed fächelte mit der Hand vor seinem Gesicht. »Wahnsinniger.«
Sie hustete würgend und versuchte einen Blick auf den Fahrer zu werfen, aber der blieb im Staub verborgen.
Energisch kurbelte sie das Fenster hoch und lenkte den Wagen wieder auf den Weg. Es folgten weitere sechs Kilometer Akazienwald, bevor das Farmhaus in Sicht kam. Hier hieß nichts willkommen. Der zwei Meter hohe Zaun, von Stacheldraht gekrönt, ermutigte nicht zu Besuchen. Rechts vom Tor stand ein Pfosten mit einer Klingel, also klingelte sie.
»Ja?«, ertönte eine weibliche Stimme.
»Goeie Môre«, sie wechselte ins Afrikaans.
»Môre.«
»Ist da Mrs. Meiring?«
»Ja.«
»Mein Name ist Magdalena Cloete, ich komme von der Gazette in Maritzburg. Es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist.«
Schweigen.
»Mrs. Meiring, wir möchten dem Andenken Ihres Sohnes Ehre erweisen – ich will einen Artikel schreiben, damit die Menschen erfahren, was für eine schreckliche Tragödie das Ganze ist. Kann ich reinkommen und mit Ihnen sprechen?«
Sie sah Ed an und drückte die Daumen. Die Wendung »Ehre erweisen« wirkte meist Wunder.
Sie hörte gedämpftes Gemurmel, als ob Mrs. Meiring mit jemandem verhandelte. Ihrem Mann? Bewaffnet mit einer seiner Schrotflinten?
»Gehen Sie weg.« Jetzt war eine andere Stimme in der Leitung. Eine Männerstimme, barsch und aufgewühlt. »Wir haben gerade erfahren, dass unser Sohn tot ist. Lassen Sie uns in Ruhe.«
»Sind Sie Mr. Meiring?«
»Ja.«
»Mr. Meiring, der Tod Ihres Sohnes tut uns wirklich aufrichtig leid. Aber je mehr wir über ihn wissen, desto besser können wir die Polizei bei der Ermittlung unterstützen. Seinen Mörder fangen helfen.«
Ed zeigte ihr den hochgereckten Daumen: Seiner Meinung nach würde ihre Formel funktionieren.
Sie hörte ein Quietschen und sah zu, wie das Tor vor ihnen aufschwang.
Das Haus lag zur Linken. Ein großes weißes, einstöckiges Gebäude mit einer breiten Rundum-Veranda, flankiert von einer gewaltigen Eiche. Bellende Hunde begleiteten sie um das Haus herum zu einem kiesbestreuten Parkplatz. Sie wollte schon aussteigen, fuhr aber zurück, als ein Schäferhund sie wild anknurrte. Das Biest stemmte die Vorderpfoten auf die Wagentür und versuchte durch das Fenster nach ihr zu schnappen. Das sah nicht gut aus. Unwillkürlich sah sie sich nach einem Farmer mit Schrotflinte um.
Eine Frau tauchte auf, hochgewachsen, mit kurzgeschnittenem fahlblondem Haar. Sie packte das Tier im Nacken. »Ich lege sie schnell an die Kette.«
Als der Hund sicher angeleint war, stieg Maggie aus dem Auto. Die Frau war im Windschatten ihres Hauses stehen geblieben, eine Hand kniff an ihren überlangen Shorts herum. Die waren mit irgendwas befleckt.
»Mrs. Meiring. Es tut mir so leid, was passiert ist.«
Ihre Hand flatterte an die Kehle. »Mein Mann ist gerade aus der Stadt zurückgekommen. Er hat ...« Sie brach ab.
Der Verrückte auf dem Weg vorhin war also Meiring gewesen. Auf dem Heimweg von der Identifikation der Leiche. Mrs. Meiring zückte ein bereits stark strapaziertes Papiertaschentuch und rieb sich die Augen. Maggie nutzte die Pause. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne mit Ihnen über Ihren Sohn sprechen, ein paar Einzelheiten erfahren, so dass wir ihn angemessen würdigen können.«
»Ja, in Ordnung.« Die Frau schlang die Arme um sich. Sie begann zu zittern. Schock.
»Könnten wir reinkommen? Es ist heiß hier draußen, und ein Getränk würde uns guttun.« Mrs. Meiring brauchte dringend etwas zu trinken, dachte sie bei sich. Etwas Starkes.
»Folgen Sie mir.«
Sie betraten das Haus und standen in einer Küche, makellos sauber und auf Hochglanz poliert. Nichts deutete darauf hin, dass der Tod das alltägliche Morgenritual unterbrochen hatte.
»Zur Veranda geht es da entlang. Lourens wartet dort. Ich will nur schnell Cora holen, sie soll uns was zu trinken bringen.« Mrs. Meiring wies einen langen Flur entlang.
Maggie ging voraus, Ed hinter sich, in ein Speisezimmer mit großen Fenstertüren zur Veranda. Sie hatte Zeit, ein dicht gedrängtes Bataillon von Vorfahren zu betrachten, das auf düsteren, sepiafarbenen Fotografien die Wände des Speisezimmers zierte. Von der Veranda aus überblickte man einen schönen, gut gepflegten Park mit Rosen in Hülle und Fülle sowie einem Gemüsegarten, in der Ferne ragten die Drakensberge in den Himmel. Das war das Gebirge, über das sich die Vorfahren der Meirings wie auch Maggies Ahnen mit Ochsenkarren gekämpft hatten, um ein neues Land zu besiedeln. Fremde Eindringlinge, genau wie die Akazien. Und diese Berge betrachtete Lourens Meiring, den Rücken zu ihnen, die Schulter gegen einen Pfeiler gelehnt.
»So, die Geier sind also gelandet«, sagte er, drehte sich um und blies eine Qualmwolke in die Luft. Er rauchte Filterlose, schwer und betäubend. Er sah aus wie auf dem Foto, das sie sich vorhin angesehen hatte, nur dass ihm in den seitdem vergangenen Jahren ein weißer Weihnachtsmannbart gewachsen war, der um den Mund herum vergilbte.
»Mr. Meiring, Ihr tragischer Verlust tut uns sehr leid.« Sie trat auf ihn zu, die bandagierte Hand zum Schütteln ausgestreckt.
Er zog wieder an seiner Zigarette und ignorierte ihre Hand. »Ach ja?« Seine Augen waren von einem unangenehmen blassblauen Farbton, wie der Himmel an einem Tag, an dem es einfach zu heiß werden würde.
Mrs. Meiring erschien mit einer jungen Frau im Schlepptau. Aus ihrer Größe schloss Maggie, dass sie eine Meiringtochter war, doch im Gegensatz zu ihrer Mutter hatte sie dunkles Haar und Mr. Meirings rötliche Gesichtsfarbe. Beide Frauen richteten den Blick auf Meiring, erwarteten, dass er das Kommando übernahm. Stattdessen zog er an seiner Zigarette und drehte sich weg.
Mrs. Meiring überbrückte schließlich das Schweigen. »Das ist meine Tochter Christabel. Sie lebt mit ihrem Mann Jannie und ihren Kindern in der Nähe.«
Maggie sah Christabel an. »Die Tragödie um den Tod Ihres Bruders tut mir sehr leid.«
Die Jüngere nickte. Ihre Augen und die Nase waren vom Weinen gerötet.
»Ich hoffe einfach, ein paar Einzelheiten über ihn zu erfahren, um ein Bild zusammenzufügen, das zeigt, wer er war. Wollen wir uns nicht setzen?« Sie deutete auf die Verandamöbel.
Christabel ließ sich dicht neben ihrer Mutter auf dem Rattansofa nieder. Meiring blieb stehen. Maggie sah den Frauen ernst in die Augen. Als Aslan sie noch begleitete, um das Handwerk des Kriminalreporters zu erlernen, nannte er das ihre Beileidsmiene. Er selbst war ein Naturtalent im Erwärmen der Herzen, eroberte sie im Flug mit seinem Zahnpastalächeln, das Gesicht zerknautscht vor Mitgefühl.
»Mrs. Meiring, erzählen Sie mir von Ihrem Sohn. Was war er für ein Mensch?«
Sanet Meiring lächelte schief. »Sehr künstlerisch veranlagt. Er liebte Malerei, Bücher, Musik. Als er klein war, wollte er mir immer im Garten helfen. Er hatte viele Freunde. Wenn er aus der Schule oder später von der Universität kam, verschwand er immer gleich wieder, um sie zu besuchen. Wir haben wenig von ihm gesehen.«
»Hat er noch hier gewohnt?«
»Nein, schon eine ganze Weile nicht mehr. Er ist 1990 nach London gezogen, nach seinem Studium.«
»Wo hat er studiert?«
»Stellenbosch University. Er hat einen sehr guten Abschluss gemacht.«
»Was hat er in London getan?«
Sanet seufzte und konzentrierte ihren Blick auf die Rosen. Ihr Gesicht wirkte leicht verschlafen, als sei sie noch im Begriff, aufzuwachen und ihren Traum abzuschütteln.
Christabel warf einen Blick auf ihre Mutter, und ein leichtes Stirnrunzeln deutete sich zwischen ihren Brauen an, als sie an ihrer Stelle antwortete: »Er war dort Hilfspfleger in einem Krankenhaus.«
Vielleicht war das die Verbindung zu seiner AIDS-Tätigkeit. Er hatte immerhin Erfahrung in einem Heilberuf.
Sie versuchte Sanet Meiring aus ihren Träumen zu reißen und an den Tisch zurückzuholen. »Mrs. Meiring, wann ist denn Ihr Sohn wieder hergezogen?«
»1998.« Christabel agierte weiterhin als Sprachrohr ihrer Mutter.
»Aus welchem Grund ist er zurückgekehrt? Wissen Sie das?« Maggie kannte die Statistiken. Auswanderer, die acht Jahre in London überstanden hatten, kamen in der Regel nicht wieder. Sie hatten sich an den Regen gewöhnt und gelernt, wie man U-Bahn fuhr und wo man das beste Biltong kaufen konnte. Warum sollten sie zurückwollen in das Land des Sonnenbrands und der Gewalt?
»Er hatte einfach Heimweh. Das ist doch wohl Grund genug, oder etwa nicht?«, warf Lourens Meiring über die Schulter.
»Doch, natürlich.« Einfühlsame Beschwichtigung war meist eine brauchbare Taktik im Umgang mit frischgebackenen Hinterbliebenen.
In diesem Augenblick erschien eine Frau mittleren Alters in Hausmädchenuniform und brachte ein Tablett mit Eiswasser. Auch ihr dunkles Gesicht wirkte eisig. Sie schenkte Wasser ein und reichte jedem der Anwesenden ein Glas. Aus dem Augenwinkel nahm Maggie wahr, wie sie zögernd verharrte.
»Danke, Cora«, sagte Christabel betont. Cora verschwand.
Maggie nippte an ihrem Wasser und nahm den entscheidenden Punkt in Angriff. »Balthasar wurde vor der Aidshilfe-Mission erschossen. Wissen Sie vielleicht, warum er dort war?«
Sanets starrer Blick ließ sich nicht von ihrem Garten lösen. Maggie beobachtete, wie die Augen der Frau einer Hadeda folgten, die sich in ihrem hausfrauenbraunen Federkleid pickend einen Weg über den Rasen suchte.
»Soweit wir wissen, hat er da gearbeitet«, antwortete Christabel für ihre Eltern.
Sie vermerkte die Formulierung ›soweit wir wissen‹. Wozu diese Relativierung? Ein Hintertürchen? »Wie lange war er schon bei der Aidshilfe-Mission?«
»Er fing da an, als er zurückkam. Juli 1998.«
Sie spürte ein vertrautes Prickeln in ihrem Nacken, das hatte sie immer, wenn sich eine Story herauszukristallisieren begann. Erneut versuchte sie Sanet Meirings ziellosen Blick zu erhaschen. »Mrs. Meiring, wie kommentieren Sie die Tragödie, dass Ihr Sohn wenige Jahre nach seiner Rückkehr aus Übersee ein weiteres Opfer der eskalierenden Kriminalität in Südafrika geworden ist?«
»Die wissen nicht, was sie tun«, sagte Sanet. Ihr Blick hob sich ein wenig, suchte den Schutzwall der Berge, die in einiger Entfernung einen Halbkreis bildeten. »Ob die Gerichte und die Polizei nun für Recht sorgen oder nicht, wir jedenfalls finden Zuflucht darin, dass Gottes Gerechtigkeit stets vollstreckt wird. Sie werden sich vor einem himmlischen Gericht verantworten müssen und für schuldig befunden werden.«
Maggie dachte an den Anruf, an das bedächtige Raunen. »Mrs. Meiring, hatte Balthasar irgendwelche Feinde? Kann es vielleicht sein, dass sein Tod kein dummer Zufall war?«
»Nein!«, antwortete Christabel für ihre Mutter. »Er war ausgesprochen beliebt, und zwar bei allen. Wie können Sie so etwas überhaupt sagen?«
Vielleicht doch nicht so beliebt, dachte Maggie. Der Mann hatte eine Klage vor dem Landgericht losgetreten. Er hatte etwas gegen jemanden gehabt, und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass dieser Jemand seine Gefühle erwiderte.
»Haben Sie ein Bild von ihm, das wir in der Zeitung bringen könnten? Wir geben es Ihnen selbstverständlich zurück.«
Gewaltsam zerrte Sanet ihren Blick zurück zu den Anwesenden, die auf der Veranda saßen. »Ja«, sagte sie. »Ich suche Ihnen eins heraus.« Sie stand auf und ging nach drinnen.
Christabel wandte sich an Ed, zeigte auf seine Kamera. »Was haben Sie damit vor? Fotos machen?«
»Nur mit Ihrer Erlaubnis«, erwiderte er.
»Vielleicht möchten Sie ein Bild von Ma und mir im Garten?«, sagte sie. »Am besten vor den Rosen, die sie und er so geliebt haben.«
»Gern«, sagte Ed gefügig. »Gute Idee.«
»Wo hat Balthasar gewohnt?«, fragte Maggie.
»Irgendwo in der Stadt«, sagte Christabel, die Augen weiterhin auf Ed gerichtet. »Wir waren nie eingeladen.«
»Lebte er allein?«
»Wissen Sie, Miss, mein Bruder war ein sehr eigenbrötlerischer Mensch. Man weiß nicht viel über jemanden, der nichts von sich preisgeben will. Man kann sich schließlich nicht einfach in anderer Leute Privatleben drängen.« Ihre Lippen bildeten eine harte Linie.
Aus dem Inneren des Hauses erklang das Heulen eines Staubsaugers. Selbst wenn der Tod Einzug hielt, mussten Häuser geputzt werden, wollte man den täglichen Kampf gegen den Staub nicht verlieren. Warum hatte Balthasar Meiring seine Familie nie zu sich eingeladen? Wo lag der Grund für das böse Blut zwischen ihnen? »Haben Sie vielleicht eine Adresse für mich, eine Telefonnummer?« Sie würde dort anrufen in der Hoffnung, jemanden zu finden, der ihr ein besseres Bild von Balthasar vermitteln konnte. Das Gespräch mit seiner Familie fühlte sich an, als hörte sie Leuten zu, die über einen schon vor langer Zeit Gestorbenen redeten.
Sanet kam mit zwei Fotos zurück. Eins von einem Schuljungen, bänglich dreinschauend und voller Pickel. Das andere war eine typische Familienaufnahme und nach der Kleidung, die sie trugen, etwa zehn Jahre alt. Balthasar, lang und dünn mit einem fahlen blonden Haarschopf, stand neben seiner Mutter. Maggie versuchte ihn mit dem leise sprechenden Mann in Einklang zu bringen, der sie angerufen, dann mit der Leiche, die sie heute Morgen gesehen hatte. Wie meistens war der mentale Sprung, den es brauchte, um eine lebende Person in ihrer Leiche wiederzuerkennen, schon an sich überfordernd. Sie gab es auf.
»Wer ist das?«, fragte sie stattdessen und zeigte auf eine Frau neben Sanet und Christabel. Sie war ebenso groß wie die anderen beiden Frauen und glich in Zügen, Teint und Haarfarbe der Tochter.
»Meine Zwillingsschwester Claudine. Sie lebt in Durban«, sagte die junge Frau. »O Gott, Ma – Claudie. Wir müssen es ihr sagen.« Ihr Gesichtsausdruck entgleiste. Die Gesprächszeit war zu Ende. Die Gewitterwolken der Trauer standen kurz vor einer gewaltsamen Entladung.
»Ich brauch nur noch schnell ein Foto.« Ed erhob sich. »Mr. Meiring ...?«
Der Vater des Toten drückte seine Zigarette auf dem Boden aus und schüttelte den Kopf. Ed dirigierte die beiden Frauen in den Rosengarten, wo Sanet mit glasigen Augen in die Kamera blickte, als stünde sie bereits vor ihrem himmlischen Gericht. Maggie beobachtete, wie Christabel für das Foto ihr Haar zurechtzupfte. Neben ihr auf der Veranda, die Arme verschränkt, das Gesicht undurchdringlich, beobachtete es auch Lourens Meiring.
In der Küche entwand sie Sanet die beiden alten Fotos und versprach, sie am nächsten Tag per Kurier zurückzusenden. Sie fragte erneut nach Balthasars Telefonnummer, die Christabel ihr auf einen Zettel kritzelte.
»Kann ich später am Tag noch mal anrufen und mit Mr. Meiring sprechen?«, fragte sie, als Christabel sie zum Auto trieb. »Vielleicht hat er ja noch etwas hinzuzufügen.«
»Nein!« Sanet, die in der Tür stand, erwachte unvermittelt aus ihrer Trance. Sie funkelte Maggie an, der trotz der Hitze ganz kalt wurde. Nachdem Meirings Mutter gerade zwanzig Minuten lang konsequent gemauert hatte, wirkte dieser Gefühlsausbruch geradezu erschreckend. »Das wird zu viel, zu viel für ihn und für uns! Es ist jetzt schon zu viel. Gehen Sie, schreiben Sie Ihren Artikel. Schreiben Sie, er war ein guter Sohn und wir liebten ihn. Schreiben Sie, wir finden Trost in Gott, und wir hoffen, wir hoffen inständig ...«, ihre Stimme kippte, »... dass Er unseren Sohn im Himmel zu sich nehmen und ihn nicht verdammen möge. Er war so ein lieber, guter Junge. Ich werde nie verstehen, warum es so falsch lief.« Sie vergrub ihr Gesicht an der Schulter ihrer Tochter.
Christabel tätschelte ihr den Rücken und bedeutete ihnen mit einer Geste, als wollte sie Fliegen verscheuchen, endlich zu verschwinden. Unter dem Knurren der Schäferhunde stiegen sie ins Auto. Maggie wendete auf dem Parkplatz. Cora kam mit einem Korb aus der Küche, ihr Gesicht ausdruckslos unter dem geknoteten Doek, und sah ihnen nach, als sie die Auffahrt entlangrollten. Durchs offene Autofenster hörte Maggie das Zetern der Hadeda, die jetzt in der alten Eiche saß.
Sie fuhren den langen Feldweg entlang, holperten durch die Schlaglöcher. Der Staub drang durch die offenen Fenster herein und füllte Maggies Mund. Im Rückspiegel sah sie, wie die Berge kleiner wurden, und musste das Verlangen unterdrücken, den Wagen zu wenden und ihnen entgegenzufahren. Dort war die Luft kühl und erfrischend, nicht flirrend vor stechender Hitze und Tod wie hier unten in den Tälern.
»Das war hart«, sagte sie, als sie auf dem Weg zurück zur Hauptstraße an all den Akazien vorbeizuckelten. »Hattest du auch das Gefühl, dass sie ihn im Grunde kaum kannten?«
Ed holte ein Tuch aus seiner Tasche und begann die Linse seiner Kamera zu reinigen. »Ich weiß nicht. Sie stehen unter Schock. Wahrscheinlich sind sie gar nicht ganz bei sich.«
Das stimmte. Sie hatten über die Jahre unzählige trauernde Familien interviewt. Man konnte nie vorhersagen, wie die Leute sich verhielten, wenn es um Mord ging. »Kam mir aber vor, als hätten sie sich ziemlich entfremdet.«
Ed stopfte sein Tuch zurück in die Tasche, hängte den Arm aus dem offenen Wagenfenster und starrte in die vorbeirauschenden Akazien. »Ein bisschen wie du und deine Leute.«
Sie verkniff sich eine Antwort. Auf seine unbedarfte, nervtötende Art hatte Ed mal wieder ins Schwarze getroffen. Sie war unter Menschen wie den Meirings aufgewachsen. Aber wenn Kinder erwachsen wurden, sahen sie ihre Eltern oft in ganz neuem Licht. Vielleicht hatte Balthasar Meiring die Bigotterie seiner Familie nicht mehr ertragen können und war auf Abstand gegangen. Das Gefühl kannte sie nur zu gut.
Sie musste Ed bestrafen, weil er recht hatte. »Wie läuft es denn so mit dir und Sally-Sue?«
Ed wirkte erschrocken. Wahrscheinlich hatte er sich eingebildet, dass es immer noch ein Geheimnis war. »Ihr Name ist Sally-Anne. Wie du sehr wohl weißt.«
»Sie ist eine Nulpe, wie du sehr wohl weißt.«
»Ist sie nicht«, sagte Ed. »Sie ist ein prima Mädchen.«
Wenn man nichts lieber tat, als zum Frisör, zum Lunch und ins Ballett zu gehen, dann war Sally-Anne vielleicht ein prima Mädchen. Als Kriminalreporterin hatte sie keine zwei Tage durchgehalten. Sie war gleich am ersten Tatort eingeknickt, hatte einen Nervenzusammenbruch inszeniert und Patel angebettelt, sie ins Ressort Schöne Künste zu versetzen. Sie hatte einfach nicht den nötigen Mumm für den Job, die hohle Nuss.
Ed starrte aus dem Fenster, während Maggie bemüht war, sich imaginäre Bilder von ihm und Sally-Anne aus dem Kopf zu schlagen. Sie dachte an Meirings versteinerte Einsilbigkeit, an die undurchschaubare Tochter und Sanets Übertritte ins Traumland. Betrauerten sie wirklich seinen Tod, oder galt ihr Schmerz mehr dem Umstand, dass Balthasar Meiring sie von sich gestoßen hatte, als er noch am Leben war?
4
Dienstag, 17 Uhr
Sie tippte die letzten Worte der Meiring-Story ein und drückte »Senden«.
Patel würde nicht sonderlich beeindruckt sein. Nachdem sie Ed abgesetzt hatte, war sie noch zu der Adresse gefahren, die Mathonsi ihr als Meirings Wohnsitz genannt hatte. Ein lauschiges Plätzchen in den grünen Vororten, wo sie klingelte und rief, wo sich jedoch kein Vorhang bewegte, kein Kopf im Fenster auftauchte und niemand sie einließ. Der Ort war das reinste Grab.
Später versuchte sie es unter Balthasars Privatnummer, aber es klingelte bloß vergeblich. Sie rief in der Mission an, doch dort lief nur der Anrufbeantworter. Im Telefonverzeichnis von Durban gab es vierzehn Einträge unter C. Meiring, und es gelang ihr nicht, Balthasars andere Schwester aufzuspüren. Als die Deadline gefährlich näher rückte, schrieb sie die Story runter, gönnte sich bei den Zitaten etwas künstlerische Freiheit und baute auch noch das vierzehn Jahre zurückliegende Verbrechen des alten Meiring ein. Der Richter hatte ihn zwar vom Haken gelassen, sie aber würde das nicht tun. Sie mochte keine Mörder. Auch nicht, wenn ihr Verbrechen vor mehr als einem Jahrzehnt und in einer anderen politischen Ära stattgefunden hatte.





























