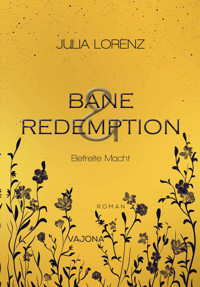5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Felicity glaubt nicht an Magie. Bis sie sich durch einen Ring aus dem Nachlass ihrer Großmutter unvermittelt in einer völlig fremden Welt wiederfindet. Um das Chaos perfekt zu machen, verliert sie nicht nur ihren einzigen Weg nach Hause, sondern gerät auch noch in die Hände von Nikolas Beaumont. Seines Zeichens Kronprinz und arrogantes Arschloch. Der Deal: Felicity hilft ihm, einen magischen Gegenstand zu stehlen, bevor es der Fae-Königin Myra gelingt, ihre vor langer Zeit geraubten Kräfte zurückzuerlangen. Sind sie erfolgreich, hilft Nikolas Felicity, in ihre Welt zurückzukehren. Während ihrer unfreiwilligen Zusammenarbeit muss sich Felicity nicht nur der Vergangenheit ihrer eigenen Familie stellen, sondern auch den immer stärker werdenden Gefühlen gegenüber Nikolas, den sie doch eigentlich verabscheut und der so viel mehr über sie zu wissen scheint, als er sollte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Julia Lorenz
Bane and Redemption
Beraubte Magie
(Band 1)
Bane & Redemption – Beraubte Magie
© 2024 VAJONA Verlag
Originalausgabe bei VAJONA Verlag
Lektorat: Aileen Dawe-Hennings
Korrektorat: Désirée Kläschen
Umschlaggestaltung: VAJONA Verlag GmbH unter
Verwendung von Motiven von rawpixel
Satz: VAJONA Verlag, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Für meine Oma, von der ich die Liebe zu Geschichten habe. Eines Tages werden wir uns wiedersehen und ich werde dir diese hier erzählen.
Prolog
Nikolas
Die Menschen sagen, der Tod käme leise. Schleiche sich unbemerkt in der Nacht heran und reiße seine Opfer hinab in sein Reich. In Wahrheit war es eher die Welt, die verstummte. Sei es aus Angst oder Ehrfurcht. Kam der Tod, hielt das Universum für einen Moment den Atem an.
Der zu große Mantel ließ die Frau in seinen Armen zerbrechlicher wirken, als sie war. Sie alle hätten keine Chance gegen sie und doch rann nun ihr Blut über seine Finger. Ihre Atemzüge drangen abgehackt durch die Stille, während seine Hände auf ihren Bauch drückten und versuchten, den stetigen Blutstrom zu stoppen.
»Ach, Nikolas«, säuselte eine Stimme in sein Ohr. »Du kannst sie nicht retten. Niemand kann das mehr.«
Er blinzelte, kniff die Augen zusammen. Tat alles, um sich nicht umzudrehen. Und dann tat er es doch. Sein Blick traf auf grüne Iriden. Dichte schwarze Wimpern. Zarte, makellose Haut und sanfte rote Locken, die das schönste Gesicht einrahmten, das er je gesehen hatte. Das er noch einmal berühren wollte. So sehr. Er ließ zu, dass sie mit einem Finger über seine Wange strich, und plötzlich war es sein Atem, der abgehackt über seine Lippen kam. Sein Herz hämmerte gegen seine Brust und er hatte sich bereits halb erhoben, als endlich auch sein Verstand einsetzte.
»Du bist nicht hier.« Denn wenn sie es wäre, würde kein Fleckchen Erde mehr um sie herum existieren. Statt auf lehmigem Waldboden würde er in einem Meer aus Flammen knien. Statt das Blut einer Fremden an seinen Händen wäre es das seiner eigenen Freunde.
»Noch nicht. Aber wir werden uns bald wiedersehen.«
Die Illusion zersprang in einem Wirbel aus Farben. Ihr Körper war fort, aber ihre Magie blieb. Senkte sich als dichte Decke über die Lichtung.
Ein leises Keuchen zog seine Aufmerksamkeit zurück zu der Frau in seinen Armen. Riya. Sie hatte gesagt, ihr Name sei Riya. Blutbefleckte Lippen teilten sich, als sie zum Sprechen ansetzte.
»Nicht«, murmelte er, als würde das jetzt noch etwas bringen. Sie würde sterben. Es konnte ihr niemand mehr helfen. Eine neuerliche Welle an Blut rann über seine Finger. Sie durchtränkte den Stoff des Mantels und färbte den einst goldenen Drachen darauf in ein tiefes Rot. Sein Mantel. Sein Drache. Seine Schuld.
»Wenn du sie aufhalten willst … Wenn du bereit bist, dich gegen sie zu stellen …« Mühsam arbeiteten sich die Worte über Riyas Lippen. Ihr Körper krampfte zusammen und er war sich schon sicher, dass es ihr letzter Satz gewesen war, als sie sich aufrichtete und seinen Arm packte. »Wenn du bereit bist, für dein Land zu kämpfen. Dann finde Felicity. Sie ist der Schlüssel.«
»Was –«, begann er, aber Riya redete weiter. Sie wusste, dass ihr die Herzschläge ausgingen.
»Finde Felicity. Die Elfen wissen, was damals passiert ist. Er weiß es.« Schmerzhaft bohrten sich ihre Finger in seine Haut. »Schütze sie. Versprich es.«
Nikolas zögerte nur einen Sekundenbruchteil. Den Wunsch eines Todgeweihten schlug man nicht ab. Ganz gleich ob menschlich oder nicht. Die letzte Bitte hatte man zu erfüllen. Also nickte er. »Ich verspreche es.«
Riyas Mundwinkel hoben sich kaum merklich. Ihr Kopf fiel nach hinten. Ein Beben ging durch den Waldboden und dann brach die Magie aus ihrem Körper. Weißer Nebel hüllte sie ein, drang ihm in Augen, Mund und Nase, bis nichts weiter existierte. Geräusche, Bilder, Gerüche. All seine Sinneseindrücke stammten aus den Erinnerungen einer Fremden. Riyas Geist mochte bereits auf dem Weg zur anderen Seite sein, aber ihre Magie zeigte ihm, was er wissen musste. Und was zu tun war.
Er musste Felicity finden.
Kapitel 1
Felicity
Das Haus lag totenstill da. Die Vorhänge waren zugezogen und lediglich ein schmaler Lichtstrahl schaffte es, sich durch den dicken Stoff zu kämpfen. Staub tanzte durch die Luft, wirbelte unter meinen Schuhen auf und versank dann in dem dicken Teppich. Meine Schritte verursachten kaum ein Geräusch, während ich langsam an abgedeckten Möbeln vorbeiging. Weiße Tücher lagen über den Einrichtungsgegenständen, die Konturen darunter waren nur noch zu erahnen. Ein bogenförmiger Durchgang gab die Sicht in das angrenzende Wohnzimmer frei, das nicht viel anders aussah als der Flur. Eine ferne Erinnerung schoss mir durch den Kopf. Die Möbel in diesem Raum waren einst von einem satten Grün gewesen. Abgesessene Polster und ein Sofa, auf dem am rechten Rand ein roter Fleck prangte. Von einem Filzstift, den ich dort als kleines Kind ohne Kappe liegen gelassen hatte. Ich hatte Angst, dass meine Grandma sauer sein würde, aber sie hatte bloß gelacht und gemeint, der Fleck sehe aus wie eine Erdbeere. Dann hatten wir jede Menge Erdbeeren gegessen. Genau auf diesem Sofa und meine winzigen Finger hatten noch mehr Spuren hinterlassen. Das alles war so lange her, dass ich nicht sicher war, welcher Teil wirklich passiert war und welchen ich mir nur einbildete. Trotzdem widerstand ich dem Drang, das Tuch zu heben und nach den roten Sprenkeln zu suchen. Ich mochte die Erinnerung, wie sie war. Ein Geräusch von draußen ließ mich aufblicken. Wahrscheinlich die Waschbärenfamilie, die sich im Keller eingenistet hatte. Meine Mum schimpfte seit Wochen darüber. Noch ein Grund, warum sich das Haus so schwer verkaufen lasse. Aber sie hatte schlussendlich doch einen Käufer gefunden. Nicht, dass mir das jemand gesagt hätte. Mum hatte nicht gewusst, dass ich mich im Haus aufhielt, als sie das Telefonat geführt hatte. Mein Kühlschrank war leer gewesen, mein Konto ebenso und ich hatte meine Eltern viel zu lange nicht mehr besucht.
Schon wieder dieses Geräusch. Stirnrunzelnd sah ich zum Flur zurück, indem sich auch die Treppe zum Keller befand. Die Waschbären würden doch nicht hier hochkommen, oder? Ich räusperte mich laut, um den Tieren zu zeigen, dass sie nicht allein waren und es für alle Parteien besser wäre, wenn jeder in seinem Bereich bliebe. Gegen einen Waschbären würde ich definitiv den Kürzeren ziehen. Vielleicht war es auch eine blöde Idee gewesen, herzukommen, aber morgen würde die Firma aufschlagen, um das Haus auszuräumen. Ich wollte es wenigstens noch ein letztes Mal sehen.
Eine Welle des schlechten Gewissens überkam mich, als ich in die Küche ging und mit den Fingern über das Holz der Arbeitsflächen strich. Der Tag, an dem wir Erdbeeren gegessen hatten – ich musste ungefähr fünf gewesen sein – war der letzte, an dem ich Grandma gesehen hatte. Meine Mum hatte mich abgeholt, die beiden hatten sich furchtbar gestritten, und das war es gewesen. Sie hatte mir nie gesagt, worum es gegangen war. Nachdenklich zog ich eine der Schubladen auf und besah mir den Inhalt. Das Chaos darin brachte mich zum Grinsen. So sah es bei mir auch aus. Zwischen Gummibändern, Deckeln für Marmeladengläser und aus Zeitungen gerissenen Rezeptseiten lagen zerknitterte Geldscheine und einige Münzen. Meine Mutter hatte nicht mal das Geld herausgenommen, bevor sie der Firma auftrug, alles, was sich im Haus befand, wegzuschmeißen. So wenig wollte sie damit zu tun haben. Ich ließ es ebenfalls liegen, dafür war ich nicht hergekommen, betrachtete aber eine Goldmünze, die ich keinem mir bekannten Land zuordnen konnte. Verschlungene und kaum erkennbare Symbole waren auf beide Seiten geprägt. Die Münze fühlte sich ungewohnt schwer an. Trotzdem wanderte auch sie zurück in die Schublade.
Ein drittes Rumpeln, dieses Mal kam es definitiv nicht aus dem Keller. Wie in Zeitlupe drehte ich mich um, bereit, bei erster Gelegenheit auf die Kücheninsel zu springen und von dort Verteidigungsposition zu beziehen. Aber es war keine Waschbärenfamilie, die im Türrahmen auftauchte, sondern ein etwa einen Meter und achtzig großer Kerl. Mit den gleichen roten Haaren wie ich und Sommersprossen auf der Nase.
»Ren!« Ich knallte die Schublade zu und starrte meinen besten Freund an. »Du hast mich zu Tode erschreckt! Was machst du hier?«
»Du warst nicht in deiner Wohnung, ich habe dich gesucht.« Neugierig sah er sich um. »Bist du hier eingebrochen?«
»Nein?« Ich hatte immerhin einen Schlüssel. Okay, meine Mum hatte einen Schlüssel und ich hatte ihn mir ausgeliehen. Aber all das hier sollte ohnehin morgen weggeworfen werden, wen kümmerte es also. Moment mal. Ich hatte einen Schlüssel, aber Ren … »Wie bist du hier reingekommen?«
»Durch den Keller.« Er kratzte sich verlegen am Hinterkopf. »Ich glaube, da unten lebt etwas.«
Ach, was er nicht sagte. »Wieso hast du mich gesucht? Und wie zum Teufel hast du mich gefunden?!«
»Du warst noch zu Hause in meinem Laptop eingeloggt. Ich konnte dich orten. Und zu dem Warum …« Ren zog eine mir bisher verborgene Tüte hinter dem Rücken hervor. Sie war weiß und mit einer absurd großen rosafarbenen Schleife zugebunden. Mir schwante Böses. »Glaub ja nicht, dass du an deinem Geburtstag vor mir fliehen kannst.«
Na klasse. Ich hasste meinen Geburtstag. Ren gehörte zu der Sorte Mensch, die bereits die ganze Woche um den Tag herum verplant hatte. Sein Motto war: Wir wurden alle älter, da konnten wir es auch gleich feiern. Meins war eher: Lasst mich bloß alle in Ruhe.
Er stellte die Tüte auf die Kücheninsel und ich warf dem Geschenk einen missbilligenden Blick zu.
»Ich war in deiner Wohnung, bevor ich hergekommen bin«, fuhr Ren betont beiläufig fort. »Du weißt, ich würde nie einfach deine Post öffnen, aber der Brief war schon offen.«
»Und da musstest du ihn natürlich lesen.« Es war schon okay, ich hätte das gleiche getan. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander.
»Warum hast du es mir nicht gesagt?«
Dieser verfluchte Brief, der mich seit drei Tagen nicht mehr richtig schlafen ließ. Das Logo der Uni hätte mich schon stutzig machen sollen, bevor ich ihn geöffnet hatte. Die meldeten sich nur per Post, wenn es wirklich wichtig war. Und dieses Mal hatte ich es richtig verkackt. Ich hatte es schon eine Weile kommen sehen und eigentlich war es unvermeidbar gewesen. Aber trotzdem. »Ist doch auch egal.«
»Fel, du bist von der verdammten Uni geflogen!«
»Ich hatte sowieso nicht vor, das Studium zu beenden.« Ich zuckte gelassen mit den Schultern, obwohl es in mir ganz anders aussah. »Ich suche mir was anderes.«
»Und wann?«
»Hör auf, wie meine Mutter zu klingen.«
Ren hob abwehrend die Hände. »Okay, okay. Themenwechsel. Aber nur, weil du Geburtstag hast.«
Ich reagierte auf diesen letzten Kommentar mit einem Laut, den man wohl als unwilliges Knurren bezeichnen konnte und der Ren zum Grinsen brachte.
»Was ist das hier überhaupt für ein Haus?«, fragte er dann.
»Meine Grandma hat hier gelebt.« Ich ging wieder ins Wohnzimmer und er folgte mir. »Ich wollte es mir noch einmal ansehen, bevor es morgen ausgeräumt wird.«
»Die Grandma, auf deren Beerdigung wir vor ein paar Wochen waren?«
»Ja.« Die Beerdigung war eine Sache für sich gewesen. Auch hiervon hatte ich eher zufällig erfahren und Ren angefleht, mich zu begleiten, weil ich mich allein nicht getraut hatte. Eigentlich wollte ich im Hintergrund bleiben. Meine Grandma war praktisch eine Fremde für mich gewesen, aber irgendwas hatte mich gedrängt, ihrer Beisetzung beizuwohnen. Der Plan war in dem Moment in Flammen aufgegangen, als ich die kleine Kapelle betreten hatte. Meine Mum hatte keine Fotos gehabt und ich kannte Grandma nur als beinahe achtzigjährige Frau, aber als sie jünger gewesen war – viel jünger – hatten wir uns wohl recht ähnlich gesehen. So ähnlich, dass jede ihrer Freundinnen ungefragt eine Hand an mein Gesicht legte und mir diesen Umstand lautstark mitteilte. Das wiederum hatte mehr Bekannte angelockt, die meinten, mich anfassen zu müssen. Die Situation war von unangenehm zu gruselig gekippt, als ich das Bild gesehen hatte, das neben dem Sarg aufgestellt worden war. Für einen Moment dachte ich wirklich, auf meiner eigenen Beerdigung gelandet zu sein. Ich war die perfekte Kopie meiner Grandma. Und ich trug ihren Namen. Letzteres war keine Überraschung, aber hätte mich meine Mutter auch so genannt, wenn sie gewusst hätte, wie ähnlich wir uns einst sein würden? Zu sagen, dass ich von der Beerdigung geflohen war, wäre noch untertrieben.
Etwas riss mich aus meinen Gedanken und ich musste kurz überlegen, was es gewesen war. Dann durchquerte ich das Wohnzimmer und ging auf das Bild zu, das an der gegenüberliegenden Wand hing. Zwischen abgedeckten Möbeln und den leeren Wänden stellte es einen unübersehbaren Farbklecks dar und ich fragte mich, warum es mir nicht vorhin schon aufgefallen war. Der Rahmen war schmucklos, doch das Bild darin ungleich detailliert. Der Himmel war wolkenlos, aber der darunterliegende Wald, der sich von einer Seite des Gemäldes zur anderen erstreckte, war trotzdem nebelverhangen. Tief schlängelten sich die weißen Schwaden durch dunkle, beinahe schwarze Bäume. Obwohl das vertrocknete Gras im vorderen Bereich den Eindruck eines heißen Sommers erweckte, lief ein kalter Schauer über meinen Rücken, der sich verstärkte, je länger ich das Bild betrachtete. Ich beugte mich hinunter und könnte schwören, zwischen zwei der Bäume ein winziges Augenpaar ausmachen zu können. Direkt daneben einen kleinen erdbeerroten Fingerabdruck. Ich hob die Hand und legte einen Finger auf die Stelle, die mein viel jüngeres Ich ebenfalls berührt haben musste.
Mit einem lauten Krachen fiel das Bild von der Wand. Ich sprang zurück und griff reflexartig nach Rens Hand, der neben mir aufgetaucht war. Noch während mein donnernder Herzschlag versuchte, sich zu beruhigen, trat er wieder vor und pfiff leise.
»Deine Grandma hatte Geheimnisse.«
Ich würde gern protestieren, aber normale Leute hatten kein Loch in die Wand hinter einem Bild geschlagen, oder? Es war nicht einmal ein in die Wand eingelassener Safe, sondern einfach nur ein Loch. Also nicht einmal besonders sicher.
Ren griff hinein und zog einen Lederrucksack hervor, der seinem Aussehen und Zustand nach aus einer Zeit lange vor mir stammen musste.
Auffordernd hielt er ihn mir hin. »Willst du ihn aufmachen?«
Verdammt, natürlich wollte ich. Und da Grandmas Geist noch nicht aus dem Jenseits aufgetaucht und uns mit Blitzen beworfen hatte, war es für sie wohl auch okay. Besser du als jemand vom Entsorgungsunternehmen, sagte ich mir, setzte mich Ren gegenüber auf den Boden und begann den Knoten aufzufriemeln, der die Bänder des Rucksacks fest geschlossen hielt.
Mit angehaltenem Atem griff ich hinein und holte etwas Weiches, nahezu Samtenes hervor. Ein Kleid? Was zur Hölle? Der satte dunkelblaue Stoff zerrann wie Wasser zwischen meinen Fingern. Feine Muster aus Sternen, Blumen und verschlungenen Figuren verzierten die ausladenden Lagen. Neben mir entfaltete Ren einen schweren grünen Mantel, der an mir etwa bis zum Boden reichen würde. Saum und Ärmelaufschläge waren mit winzigen Stickereien verziert, die sich bei genauerem Hinsehen als ineinander verschlungene Pflanzen, Baumkronen und langbeinige Tiere mit geschwungenen Geweihen entpuppten. Beide Kleidungsstücke waren unbestreitbar wunderschön, aber warum hatte Grandma sie hinter einem Bild versteckt?
»Vielleicht ist es ja gestohlen«, spann Ren meinen unausgesprochenen Gedanken weiter. »Vielleicht war deine Grandma ja eine Verbrecherkönigin und wir decken hier gerade deine dunklen Familiengeheimnisse auf.«
»Ja, vielleicht. Oder vielleicht spinnst du auch.« Lachend drehte ich den Rucksack und schüttelte ihn. Einige Gegenstände fielen klirrend auf den Boden. Ein paar Münzen. Genau die Art, wie ich sie in der Küchenschublade gefunden hatte. Eine silberne Brosche mit blauen Steinen, einige Ketten aus mir unbekanntem Material und ein tiefschwarzes Stoffsäckchen. Ich öffnete es und betrachtete den Ring, der darin verborgen gewesen war. Fein gearbeitete goldene Blätter wanden sich elegant zu einem Band, das in der Mitte von einem grünen Stein unterbrochen wurde. Ich konnte nicht beschreiben, wie, aber es machte den Eindruck, der Ring würde das wenige Licht im Raum einsaugen. Eine interessante optische Illusion war es allemal.
»Den solltest du behalten.« Ren hatte sich nach vorn gelehnt und betrachtete interessiert das Schmuckstück auf meiner Handfläche. »Ist hübsch.«
»Ich bin nicht hergekommen, um irgendwas zu behalten.« Mit einem tiefen Seufzen steckte ich sämtlichen Schmuck sowie Kleid und Mantel zurück in den Rucksack. Nie hatte ich einen Versuch unternommen, die Beziehung zu meiner Großmutter zu kitten. Ich hatte ja nicht einmal gewusst, dass sie noch immer in diesem Haus gelebt hatte. Ich hatte schlichtweg verdrängt, dass es sie gab – und jetzt gab es keine Möglichkeit mehr, dies ungeschehen zu machen. Hätte sie gewollt, dass ich irgendwas aus dem Haus behielt, hätte es ein Testament gegeben. Obwohl ich meiner Mum durchaus zutrauen würde, dies ebenfalls vor mir verborgen zu halten. Ich hatte aufgehört zu fragen, aber ich war verdammt neugierig, worum es damals in diesem Streit gegangen war. Jetzt noch viel mehr als zuvor.
Den Rucksack legte ich zurück in sein Versteck. Ren half mir, das Bild wieder davorzuhängen. Ich wackelte probehalber am Rahmen und runzelte die Stirn. War es gerade noch so einfach von der Wand gefallen, bewegte es sich jetzt keinen Millimeter mehr. Seltsam …
Wir kehrten zurück in die Küche und ich musste mich endlich der Tüte widmen, die noch immer unschuldig an ihrem Platz stand.
»Okay«, seufzte ich übertrieben dramatisch. »Sag schon, was ist das?«
»Kein Geburtstagsgeschenk. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, für dich eine Party zu schmeißen. Deshalb ziehst du das hier an und kommst mit auf meine Cluberöffnung heute Abend. Es geht nicht um dich, niemand weiß, wer du bist, aber du kommst trotzdem mal raus.«
»Das klingt, als hättest du das sehr genau durchdacht?«
»Mein idiotensicherer Plan, deinen Geburtstag mit dir zu verbringen. Dieses Event heute Abend ist wichtig für mich und ich bin dein bester Freund. Mich nicht zu begleiten, würde dich also zu einem sehr schlechten Menschen machen.«
»Vielleicht habe ich ja kein Problem damit, ein schlechter Mensch zu sein«, sagte ich nur halb scherzhaft, aber nahm trotzdem die Tasche und spähte hinein. Das schwarze Minikleid darin ließ mich die Augen verdrehen und beschwor gleichzeitig freudige Erwartung in mir hervor. Vielleicht brauchte ich ja wirklich genau das, um den Tag heute verdrängen zu können.
Kapitel 2
Grelles Neonlicht brachte mich dazu, die Augen zusammenzukneifen. Musik kam aus allen Richtungen und Menschen drängten sich um mich herum. Ein Pochen machte sich hinter meinen Schläfen breit, das durch den dröhnenden Bass nicht besser wurde. Ren stand auf einer Anhöhe, die den ganzen Club umrahmte. Er hatte tatsächlich einen Anzug an, was mich irritierte und gleichermaßen faszinierte.
Als er mir vor vier Jahren das erste Mal von seinen Plänen erzählte, hatte ich es für Träumereien abgetan, doch das war bereits sein zweiter Club. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er allzu bald aufhören wollte, sich in der Partyszene ganz nach oben zu arbeiten. Und für mich hatte das auch seine Vorteile. Zufrieden zupfte ich das goldene Papierbändchen an meinem Handgelenk zurecht, das mir in dieser Nacht so viele Gratisdrinks brachte, wie ich wollte, und bahnte mir meinen Weg durch die Menge. Plötzlich ging unvermittelt ein Ruck durch den Boden. Instinktiv hielt ich mich an einem Geländer fest, doch das Beben war genauso rasch vorbei, wie es gekommen war. Oder hatte ich bereits zu viel getrunken? Vielleicht sollte ich es langsamer angehen lassen. Immerhin schien niemand sonst etwas bemerkt zu haben.
Ach, was soll’s. Ich straffte die Schultern und versuchte, möglichst nüchtern zu wirken, als ich dem Barkeeper ein Zeichen gab und dieser mir kurz darauf einen rot glitzernden Cocktail reichte. Zeit genug, das hier zu bereuen, war auch morgen noch. Die Flüssigkeit schmeckte süß und klebte an meinen Lippen. Suchend sah ich mich um, doch Ren war nirgendwo zu sehen. Andererseits erschwerten mir die blinkenden Lichter und die Nebelschwaden die Sicht. Ich schob mich durch die Gästeschar und verlor dabei den Halt.
Bildete ich es mir nur ein oder hatte der Boden erneut gezittert?
Hastig sah ich mich um. Hatte niemand etwas bemerkt?
Einige Menschen machten Platz und ich drängte mich rasch durch die Lücke. Keiner von ihnen sagte etwas, als der Boden wackelte. Was zur Hölle war das?
Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich auf den Drink in meiner Hand. Ich war mir sicher, nicht so betrunken zu sein … Genauso ausgeschlossen war es, irgendetwas im Getränk zu haben. Überall war Security und auch ich achtete peinlich genau darauf. Trotzdem stellte ich das Glas auf dem nächstgelegenen Tisch ab. Für den Rest des Abends würde es doch besser Wasser tun.
»Hey.«
Erschrocken taumelte ich zurück, aber Ren packte mich an den Schultern und hielt mich aufrecht.
»Alles in Ordnung?«, fragte er mit gerunzelter Stirn.
»Sicher.« Ich lächelte breit und hoffentlich überzeugend. »Beeindruckend, was du hier auf die Beine gestellt hast.«
»Danke.« Er richtete den Kragen seines Anzugs. »Du weißt, dass ich noch immer eine Barkeeperin brauche?«
Ich wollte schon ablehnen, hielt dann aber inne. Warum eigentlich nicht? Mein aktueller Nebenjob war furchtbar und es wäre leicht verdientes Geld. Außerdem würde es mir etwas zu tun geben, bis ich die Sache mit dem Studium geklärt hatte. Beim Gedanken an Letzteres überkam mich wieder ein ungewohntes Angstgefühl. So konnte es nicht immer weitergehen. Ich musste damit beginnen, mein Leben zu ordnen, hatte aber keine Ahnung, wo ich anfangen sollte.
»Ich denke darüber nach, okay?« Bevor er noch beginnen konnte, konkrete Pläne zu formen, zog ich mein Handy aus der kleinen Handtasche, die ich mitschleppen musste, weil wer auch immer dieses Kleid designt hatte, Taschen für überflüssig hielt. »Entschuldige mich kurz, meine Mum hat schon dreimal angerufen und ich will sichergehen, dass nicht noch jemand gestorben ist.«
Ren nickte, doch ich spürte, dass sein Blick mir folgte, als ich mir abermals einen Weg durch die Menge bahnte. Kaum war ich aus der Tür nach draußen getreten, verblasste die Musik zu einem dumpfen Hintergrundgeräusch. Augenblicklich fiel mir das Atmen leichter. Ich blinzelte, doch die Umgebung war noch immer in einen leichten Nebel getaucht. Normalerweise hätte ich das sicherlich seltsam gefunden, aber heute war sowieso ein schräger Tag. Es lag bestimmt am Alkohol und an der Jahreszeit. Es war immerhin Herbst.
Ohne ein richtiges Ziel vor Augen ging ich die Straße entlang. Ich brauchte ein wenig frische Luft.
Ren hatte sich eine Location ausgesucht, die an einen Park grenzte, sodass ich schon bald die hoch aufragenden Häuser beiseitelassen und gegen Grasflächen mit Bäumen tauschen konnte. Natürlich freute ich mich für meinen besten Freund, doch während Ren einen Erfolg nach dem anderen erzielte, fühlte ich mich, als müsste ich mit meinem Leben bereits viel weiter sein, um auch nur ansatzweise mit ihm mithalten zu können. Mit einem tiefen Seufzen setzte ich mich auf die Kante einer Bank, legte den Kopf in den Nacken und sah in den sternenübersäten Himmel. Diese Aussicht war schon immer beruhigend gewesen – dieses Gefühl, ein winziger Teil von etwas so viel Größerem zu sein.
Irgendwo in der Ferne stritten zwei Katzen, ein paar Leute unterhielten sich lautstark und offensichtlich betrunken und zwischen all das mischte sich das unverkennbare Geräusch von Pferdehufen. Verwirrt sah ich auf, doch der Weg lag zu beiden Seiten noch immer völlig verlassen da. Ein kalter Windhauch streifte durch die Nacht und sorgte dafür, dass sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten. Vielleicht war es doch besser, reinzugehen.
Das Handydisplay leuchtete schwach auf, als ich das Telefon zurück in die Tasche steckte. Meine Mum hatte nicht angerufen, aber das wusste Ren. Ich war eine furchtbare Lügnerin. Zählte wohl für mich. Gerade wollte ich den Reißverschluss der Tasche schließen, als mir etwas anderes in der hintersten Ecke des Stoffes auffiel. Stirnrunzelnd holte ich es hervor. Es war der Goldring von vorhin. Hatte Ren mir den in die Tasche gesteckt oder hatte ich ihn unterbewusst noch in der Hand gehalten, nachdem wir das Zimmer verlassen hatten? Eine Welle schlechten Gewissens flutete mich, ebbte aber gleich darauf wieder ab. Vielleicht war es ja Schicksal. Mum wollte nichts mit dem Haus und den Sachen zu tun haben, hatte mir aber nie explizit gesagt, die Finger davon zu lassen. Ich würde den Ring einfach als Geburtstagsgeschenk betrachten. Irgendwas Gutes musste dieser Tag ja haben. Ihn zum Haus zurückzubringen, würde ohnehin nicht funktionieren.
Lächelnd steckte ich ihn an meine rechte Hand, und als sei er für mich gemacht, rutschte der Ring perfekt passend auf meinen Finger.
Gerade als ich aufstand, wallte eine Welle aus Übelkeit durch meinen Körper. Die Welt kippte zur Seite, meine Knie schlugen schmerzhaft auf dem Kiesweg auf. Die Erde bebte ein weiteres Mal. Was war hier bitte los? Was war mit mir los?
Kälte drang in jede Zelle meines Körpers. Weiße Nebelschwaden wanden sich über den Boden. Binnen Sekunden wurde die Schwärze der Nacht, soeben noch von unzähligen Lichtern erhellt, zu einem undurchdringlichen und allumfassenden Weiß.
Kapitel 3
So abrupt, wie er gekommen war, verschwand der dichte Nebel. Die Welt stand wieder still und der dunkle Himmel war auf ein Neues von unzähligen Sternen übersät. Vorsichtig, der plötzlichen Ruhe noch nicht ganz vertrauend, richtete ich mich auf – und erstarrte.
Wo sich soeben noch Londons Skyline gegen den Himmel abgezeichnet hatte, war nun nichts weiter als eine weite Landschaft aus Feldern und Hügeln, gut zu erkennen im fahlen Licht des Vollmondes.
Nein … Ich stolperte einen Schritt zurück und wäre beinahe wieder auf die Knie gesunken. Mein Körper zitterte. Das war einer von Rens Scherzen. Einer, bei dem ich keine Ahnung hatte, wie er ihn durchgezogen hatte, aber es musste so sein. Oder ich war endgültig verrückt geworden.
Langsam, ohne zu wissen, was mich erwartete, drehte ich mich um. Eine Mischung aus Erleichterung, Überraschung und Fassungslosigkeit ergriff von mir Besitz. Hinter mir lag eine Stadt. Nicht London, so viel war sicher, aber doch eine Ansammlung aus hell erleuchteten Häusern mit steinernen Türmen und Giebeldächern. Die fehlende Skyline wurde durch ein gewaltiges Schloss ersetzt, das sich dunkel hinter der Stadt abzeichnete.
Was. Zur. Hölle.
Ich wusste nicht, wie lange ich die Stadt angestarrt hatte, bis ich das Geräusch galoppierender Pferde hörte. Dieses Mal war es keine Einbildung gewesen. Eine Gruppe von fünf Reitern preschte auf die Stadt zu. Auf ihrer Brust prangte ein goldenes Symbol, das ich so schnell nicht erkennen konnte. Dunkelblaue Umhänge verdeckten die Schwerter an ihren Seiten nur zur Hälfte. So schnell wie sie gekommen waren, so schnell waren sie vorbei und innerhalb von Sekunden hinter der hohen Mauer verschwunden, die die Stadt einrahmte.
Sprachlos sah ich ihnen nach, bis die unverkennbare Kälte des Herbstes mir bewusst machte, dass ich allein in der Nacht in einem kurzen Kleid mitten auf einem Feldweg stand. Was immer hier vor sich ging, wenn ich mich nicht in Bewegung setzte, würde ich es wohl niemals herausfinden.
Ich drehte mich einmal um mich selbst. Hinter mir erstreckte sich bloß die Hügellandschaft, die im Mondlicht geheimnisvoll leuchtete. Nichts, was man mitten in der Nacht allein erkunden wollte.
»Also gut, dann eben die Stadt«, sagte ich laut zu mir selbst. Ein hoffnungsloser Versuch, die Stille zu vertreiben. Meine Gedanken rasten, versuchten erfolglos, einen Plan zu ersinnen, was jetzt zu tun war. Doch bevor ich zu einem Ergebnis kommen konnte, stand ich bereits vor der Stadtmauer, die aus der Nähe gesehen bedrohlich hoch über mir aufragte.
Ich zuckte zusammen, als ich die beiden mit Schwertern bewaffneten Männer bemerkte, die davor Wache hielten. In ihren dunklen Uniformen verschmolzen sie beinahe mit der Mauer in ihrem Rücken. Ein goldener Drache, den Schwanz um den eigenen Körper geschlungen, prangte auf ihren Brustpanzern.
Ich räusperte mich und der Dunkelhaarige der Soldaten senkte den Blick, um mich anzusehen.
»Papiere«, forderte er barsch und ich wäre vor Erleichterung beinahe eingeknickt. Wir sprachen dieselbe Sprache. Was auch immer dies bedeuten mochte.
»I-ich habe leider keine.« Gott, ich wünschte wirklich, meine Stimme wäre fester.
Der Soldat blickte finster auf mich herab. »Dann musst du bezahlen.«
»Aber ich habe auch kein Geld bei mir.« Selbst die Tasche mit meinem Handy musste mir bei dem, was passiert war, abhandengekommen sein. »Bitte. Ich kann doch nicht hier draußen bleiben.«
»Nicht unser Problem.« Jetzt hatte der blonde Mann gesprochen.
Ich spürte, wie Tränen in meinen Augen brannten. Hastig wischte ich sie fort. Als ich die Hand wieder sinken ließ, glänzte der Goldring, den ich vorhin so achtlos auf den Finger geschoben hatte. Ich zögerte nicht, sondern nahm ihn ab und reichte ihn dem dunkelhaarigen Soldaten. »Ist das genug?«
Die Wache inspizierte das Schmuckstück und reichte es an den Blonden weiter, der mit den Schultern zuckte. »Na gut. Wir wollen ja nicht, dass du von den Wölfen gefressen wirst.«
Die Männer lachten, doch sie traten zur Seite und zogen die Flügel der großen Tür einen Spalt weit auf, sodass ich hindurchtreten konnte. Krachend fielen sie hinter mir ins Schloss. Auf einmal kam ich mir vor wie eine Maus, die in die Falle gegangen war. Doch für einen Rückzug war es zu spät. Die Unsicherheit herunterschluckend, straffte ich die Schultern, hob das Kinn und trat einen Schritt nach vorn.
Vor mir erstreckte sich ein Gewirr aus Wegen, die von eng beieinanderstehenden Häusern gesäumt wurden. Trotz der späten Stunde waren Menschen unterwegs, einige warfen mir neugierige Blicke zu.
Ich verschränkte automatisch die Arme vor der Brust und folgte einer der breiteren Straßen, die augenscheinlich zur Stadtmitte führten. Mit hoffentlich sicheren Schritten ging ich den Weg entlang, darauf bedacht, die Menschen um mich herum nicht zu sehr anzustarren. Wenn nicht schon die Kleidung der Leute auffällig genug gewesen wäre, dann wäre es spätestens die völlige Abwesenheit jeglichen elektrischen Lichts. Stattdessen brannten alle paar Schritte Fackeln, tauchten die Umgebung in einen rötlichen Schimmer und sandten verzerrte Schatten über den Boden. Es wirkte fast so, als wäre die Stadt aus der Zeit gefallen. Ich erstarrte. Vielleicht war es nicht die Stadt, sondern ich selbst, die –
Nein! Energisch schüttelte ich den Kopf. Das war verrückt. Völlig verrückt. Wahrscheinlich befand ich mich in einer dieser Mittelalterstädte, die für Renaissancefeste erbaut worden waren. Was aber nicht erklärte, wie genau ich hergekommen war.
Aus einem Gebäude mit grünen Fensterläden und kleinen Tischen vor der Fassade – eine Art Gasthaus? – drangen Stimmen und Gelächter. Warmes Licht fiel durch die offene Tür auf die Straße und ich überlegte gerade, ob ich nicht hineingehen sollte, als hinter mir ein Pfiff ertönte. Ich drehte mich um. Ein Mann grinste mich an, seine schiefen Zähne glänzten in der Dunkelheit. »Na, Kleines? Interesse an Gesellschaft?«, fragte er mit von Alkohol verzerrter Stimme.
»Nein.« So schnell es ging, setzte ich meinen Weg fort. Schritte ertönten hinter mir und mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich warf einen Blick über die Schulter. Der Mann folgte mir. Zwar mit einigen Metern Abstand, aber ich machte mir keine Illusionen, dass er nicht mit einem Satz bei mir sein könnte.
»Jetzt warte doch mal.«
Hastig blickte ich mich um, doch die breite Straße hatte sich in eine schmalere verwandelt, und es waren weit und breit keine Menschen mehr zu sehen. Wie hatte ich nicht bemerken können, dass ich von der Hauptstraße abgekommen war?
»Hey, Kleine!«
Ich wirbelte herum. »Nenn mich noch einmal Kleine und es wird dir leidtun!«
»Oh.« Der widerliche Kerl bleckte die gelben Zähne. »Du bist ja ein wildes Ding.« Er trat einige Schritte auf mich zu. Ohne nachzudenken, holte ich aus und rammte ihm die Faust ins Gesicht. Verdammt! Niemand hatte mir gesagt, wie weh es tat, jemanden zu schlagen. Meine Knöchel brannten, doch ich hatte keine Zeit, mich um den Schaden zu kümmern. Der Mann brüllte auf. Bevor ich mich versah, packte er mich an den Haaren und schleuderte mich gegen eine Mauer. Blut tropfte von seiner Lippe und ich roch seinen stinkenden Atem, der auf meine Haut prallte, als er sein Gesicht nah an das meine brachte.
Ich presste mich gegen den Stein in meinem Rücken, um Abstand zwischen mir und meinen Angreifer zu schaffen. Dann riss ich mein Knie hoch und rammte es ihm mit so viel Kraft, wie ich aufbringen konnte, zwischen die Beine.
Er heulte vor Schmerz und taumelte einen Schritt zurück. Jetzt oder nie.
Ich ergriff meine Chance und duckte mich weg, doch nach drei Schritten schlang sich ein Arm um meine Taille und riss mich schmerzhaft zurück. Mein Kopf stieß gegen die Wand.
Wag es ja nicht, jetzt ohnmächtig zu werden, sagte ich mir immer wieder, während ich blinzelte, um die schwarzen Punkte vor meinen Augen zu vertreiben.
Wäre ich eine bessere Kämpferin gewesen, hätte ich die Situation analysieren können. Hätte gewusst, wie ich mich dem eisernen Griff meines Angreifers entwinden konnte. Aber meine Kampferfahrung erschöpfte sich in drei Selbstverteidigungsstunden, die zu viele Jahre zurücklagen, als dass ich mich daran erinnerte.
Und so konnte ich nur hilflos stöhnen, als er mein Kinn packte und meinen Kopf nach oben bog, sodass ich gezwungen war, ihn anzusehen. Ein Schatten tauchte am Rand meines Sichtfeldes auf, doch die Welt drehte sich zu schnell, um ihn genauer auszumachen.
Ich schloss die Augen. Heiße Tränen liefen über meine Wangen. Und dann war die Hand auf meiner Haut verschwunden. Ein dumpfes Stöhnen drang an meine Ohren.
Ich stieß zitternd den Atem aus und öffnete langsam meine Augen. Mein Angreifer lag auf dem Boden der Gasse, die Knie an die Brust gezogen. Über ihm ragte eine dunkle Silhouette empor.
Der Mann wimmerte, als die Gestalt ausholte und zwei gut platzierte Schläge gegen seinen Kopf schmetterte. Dann blieb der Widerling regungslos liegen.
Ich wagte es nicht, mich zu bewegen, geschweige denn einen Laut von mir zu geben, als sich die dunkle Gestalt langsam zu mir umdrehte.
»Zu euren Diensten, Mylady.« Er ließ die Kapuze seines schwarzen Mantels zurückfallen und enthüllte einen Schopf unordentlicher Haare. Ein Grinsen lag auf seinen Lippen, als er eine Verbeugung andeutete, die durch das amüsierte Funkeln in seinen Augen eher spöttisch als höflich wirkte. »Oskar Reyes. Und das Wort, nach dem du suchst, ist Danke.« Er zwinkerte mir zu.
Ich starrte den Mann an. Er war jung, vielleicht Anfang zwanzig, doch seine hohen Wangenknochen und der stechende Ausdruck in seine Augen ließen ihn auf den ersten Blick älter wirken.
»Ist –« Ich räusperte mich, meiner Stimme noch nicht vertrauend. »Ist er tot?« Die Antwort auf diese Frage sollte mir völlig egal sein.
Oskar sah auf die reglose Gestalt am Boden. »Nein.« Mit zwei Fingern im Mund stieß er einen hohen Pfiff aus, der von irgendwo weit weg dumpf erwidert wurde. »Aber er wird sich wünschen, er wäre es.«
Keine Ahnung, was das heißen sollte, aber die leise Stimme in meinem Kopf warnte mich, genauere Fragen zu stellen.
»Danke.« Der Boden schwankte noch immer und ich legte eine Hand an die Mauer, um mich zu stabilisieren.
»Alles in Ordnung?« Oskar trat einen Schritt näher. Vermutlich, um mich zu stützen, aber ich wich hastig zurück.
»Alles gut.«
Er nickte und brachte Abstand zwischen uns. Der Mann am Boden stöhnte. »Halt das mal kurz.« Noch bevor ich reagieren konnte, drückte Oskar mir eine Papierrolle in die Hand, die er soeben noch unter dem Arm getragen hatte. »Nicht knicken. Das ist unbezahlbar.«
»Und warum«, begann ich zögernd und lugte unter eine der papiernen Ecken, während er sich zu dem Mann hinunterbeugte, »trägst du ein unbezahlbares Gemälde mitten in der Nacht durch die Stadt?«
»Hab’s geklaut«, sagte Oskar, ohne aufzusehen, und begann, systematisch die Taschen des Kerls zu durchsuchen.
Ich verdrehte die Augen. »Sehr witzig.«
»Das war kein Witz.« Abschätzend besah er ein paar Münzen, schnippte einen Fussel fort und steckte seine Beute in die eigene Tasche. Dann richtete er sich auf und nahm mir die Rolle aus der Hand. »Weißt du, Lebensretter bin ich nur nebenbei. Hauptberuflich – nun, sagen wir einfach, ich beschäftige mich mit Kunst.«
»Erzählst du oft Fremden auf der Straße, dass du gerade von einem Kunstraub kommst?«
»Ab und zu.« Oskar legte den Kopf schief, das Grinsen noch immer auf den Lippen.
»Okay …« Ich strich mir fahrig das Haar aus dem Gesicht. »Also, eh … Du kannst mir nicht zufällig sagen, wo wir hier sind?«
»Terralore.«
»Und das Land?«
Er sah mich forschend an. »Wie heftig bist du noch mal gegen die Mauer geprallt?«
»Kannst du es mir einfach sagen?«
»Gleicher Name«, antwortete er schließlich mit einem Schulterzucken.
»Ist das nicht verwirrend?« Ich sah mich um und nahm meine Umgebung zum ersten Mal genauer unter die Lupe. Wir befanden uns in einer Seitengasse, die mit einer Mauer endete, die mindestens drei Meter maß. Außer einem Haufen vergessener Ziegelsteine befand sich hier nichts weiter. Wo war der Typ so plötzlich hergekommen?
»Ich weiß nicht. Bis jetzt nicht. Bist du verwirrt?«
»Was?« Ich wandte mich ihm wieder zu, meine Frage hatte ich bereits völlig vergessen.
»Ob du verwirrt bist?« Er runzelte die Stirn.
»Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich, wo doch dieser ganze Abend so herrlich viel Sinn ergibt?« Ich wurde zum Ende hin immer lauter und warf frustriert die Arme in die Luft.
»Also gut, jetzt bin ich verwirrt. Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
»Vergiss es.« Seufzend rieb ich mir über die Augen. »Danke noch mal für«, ich gestikulierte zu der Gestalt am Boden, »das da.« Was ich jetzt dringend wollte, war, aus dieser Gasse zu verschwinden, die Sicherheit von Menschen um mich herum zu spüren und herauszufinden, wo, zum Teufel, ich eigentlich war. Oder wann. Auch wenn das immer noch völlig verrückt klang.
Ich trat einige langsame Schritte nach vorn, aber Oskar machte keine Anstalten, mich aufzuhalten.
»Wo kommst du eigentlich her?«, rief er mir nach, als ich fast das Ende der Gasse erreicht hatte.
»London.«
»Noch nie von gehört.«
Ich schnaubte leise. »Ja, das kann ich mir denken.«
Kapitel 4
Glücklicherweise mündete der Weg schon bald wieder in eine breitere Straße. Priorität eins war jetzt, einen Platz zum Schlafen zu finden. Ich sah mich um, doch außer einem bereits geschlossenen Blumenladen und einem Schneider, in dessen Schaufenster ausladende Ballkleider in grellem Gelb ausgestellt waren, gab es nichts weiter zu entdecken.
»Und was macht ein Mädchen aus London hier mitten in der Nacht allein auf der Straße, gekleidet wie eine Dirne?«
Ich stolperte zurück, als Oskar scheinbar aus dem Nichts elegant vor mir auf der Straße landete. Einige Passanten warfen uns neugierige Blicke zu. Ich verengte die Augen, als seine Worte durch den Schock zu mir durchdrangen. »Gekleidet wie was?«
»Dirne«, wiederholte er hilfsbereit. »Oder auch Hure, Kurtisane … Liebesdienerin?« Er wackelte mit den Brauen.
»Du …« Ich schüttelte den Kopf und drängte mich an ihm vorbei.
Er lief einfach rückwärts vor mir her. »Das sollte keine Beleidigung sein. Lediglich eine Frage. Keine Wertung meinerseits. Nicht, dass du glaubst, ich würde denken, deine Kleidung hätte irgendwas mit gerade eben zu tun. Da hättest du auch einen Kartoffelsack tragen können. Die Stadt ist eigentlich recht sicher, aber ein paar Exemplare seiner Art verirren sich leider ab und zu hier her. Er wird es nicht noch mal tun.«
»Will ich es wissen?«
»Was jetzt mit ihm passieren wird?« Jegliche Spur von Amüsement verschwand aus Oskars Zügen. »Vermutlich eher nicht.«
»Na gut.« Ich zupfte das inzwischen etwas lädierte schwarze Kleid zurecht. Zeit für einen Themenwechsel, denn ihn zu ignorieren, brachte mich offenbar nicht weiter. »Vielleicht bin ich ja genau aus diesem Grund hier. Für Dirnen-Dinge.«
Das brachte mir nur ein Schnauben ein. »Bist du nicht.« Oskar ging jetzt neben mir her und musterte mich neugierig.
»Woher willst du das wissen?«
»Ich weiß es eben.«
»Dann hast du also Erfahrungen mit Liebesdienerinnen, ja?«
»Ich kenne jeden in der Stadt, der seine Dienste dem horizontalen Gewerbe verschrieben hat.« Als er meinen Blick bemerkte, fügte er hastig hinzu: »Nicht auf die Weise. Wir arbeiten manchmal zusammen.«
Ich hob abwehrend die Hände. »Noch eine Sache, die ich gar nicht wissen will.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
Ich zögerte. Unsicher, wie viel ich einem völlig Fremden anvertrauen konnte. Einem völlig Fremden, der gerade, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Mann zusammengeschlagen hatte, der nicht nur zwei Köpfe größer, sondern auch doppelt so breit war wie er selbst. Aber er hatte mir dabei wahrscheinlich auch das Leben gerettet.
»Ich bin aus Versehen hier.«
Oskar lachte. »Wie kommt man denn aus Versehen in eine Stadt?«
»Keine Ahnung. Schlechter Orientierungssinn?«
»Schön, du musst es mir nicht sagen. Kommst du mit?«
Verwirrt blinzelte ich ihn an. »Wohin?«
»Ich dachte bloß, dass du die Nacht nicht auf der Straße verbringen willst.« Mit einem Schulterzucken vergrub er die Hände in den Taschen seines Mantels, das Bild locker unter den Arm geklemmt. »Wir haben Platz, was zu essen und«, er deutete auf mein mitgenommenes Outfit, »meine Frau leiht dir sicher etwas Sauberes zum Anziehen. Wenn du Nein sagst, lasse ich dich in Ruhe. Versprochen.«
Ich verlangsamte meine Schritte und nahm mir zum ersten Mal Zeit, ihn genauer zu betrachten. Unordentliche, aschblonde Haare, graue Augen, die mich mit einer Mischung aus Neugierde und Belustigung musterten, und der Ansatz eines verschlungenen Tattoos, das sich gerade noch unter dem Ausschnitt seines schwarzen Hemdes zeigte.
»Du hast eine Frau?«
»Na ja, so etwas in der Art. Sag ihr lieber nicht, dass ich das gesagt habe.«
»Sie ist doch freiwillig bei dir, oder?« Die Frage war mir herausgerutscht, bevor ich sie aufhalten konnte, doch Oskar lachte nur.
»Aber natürlich. Ich klaue Bilder, keine Menschen. Pass auf.« Er trat ein paar Schritte zurück. »Ich werde jetzt gehen. Langsam. Und wenn du beschließt, heute Nacht nicht draußen sein zu wollen, kommst du einfach hinterher, ja?« Er ließ mir keine Zeit zu antworten, sondern drehte sich um und schlenderte entspannt die Straße entlang. Unsicher auf meiner Unterlippe kauend, sah ich ihm hinterher. Irgendwo in der Dunkelheit ertönte ein Rascheln und ich zuckte zusammen. Mein Blick flackerte wieder zu Oskars sich langsam entfernender Gestalt, dann zurück zu der ansonsten verlassenen Gegend. Ach, scheiß drauf. Nicht sicher, ob ich gerade mein Todesurteil unterschrieb, eilte ich ihm nach.
»Gute Entscheidung.«
»Ich kann Karate.« Konnte ich nicht.
Er hob amüsiert eine Augenbraue. »Keine Ahnung, was das sein soll, aber wie schön für dich.«
Ich betrachtete Oskar nachdenklich, während ich ihm durch die Straßen dieser seltsamen Stadt folgte. Er musste nie zweimal über den Weg nachdenken, zögerte auch nicht eine Sekunde, bevor er uns durch enge Gassen und halb verborgenen Durchgänge führte. In seiner dunklen Kleidung verschmolz er perfekt mit der Nacht um uns herum.
»Ist das deine normale Abendbeschäftigung?«, fragte ich.
»Meistens. Manchmal überfalle ich auch Banken.« Er lachte, als ich ihn erschrocken ansah. »Das war ein Scherz.«
Ich nickte wenig beruhigt. Wenn überhaupt warfen seine Antworten mehr Fragen auf, als sie lösten.
Schnell hatten wir die geschäftigen Straßen der Stadt hinter uns gelassen. Die meisten Häuser maßen hier nicht mehr als zwei Stockwerke und hatten kleine Gärten, in denen vereinzelt Hühner gackerten. Ich fragte mich gerade, wie lange wir noch gehen mussten und ob er mich womöglich aus der Stadt herausführen würde, als Oskar vor einem heruntergekommenen Gebäude stoppte, dessen brettervernagelten Fenster wenig einladend wirkten. Ein schief hängendes Schild zeigte einen verwaschenen Namen, den ich nicht mehr entziffern konnte. Es musste sich wohl einst um einen Gasthof gehandelt haben, war jetzt aber nur noch eine Ruine.
»Du willst, dass ich mit dir da reingehe?«
»Nicht hinein.« Oskar ging um das Gebäude herum, bis wir eine verwitterte Holztür erreichten. »Hinunter. Oben wohnt ein verwirrter alter Hexer. Er ist ein bisschen schräg, aber er lässt uns günstig hier leben und hält den Mund.« Oskar hielt inne, als er merkte, dass ich ihm nicht mehr folgte. »Kommst du?«
»Hexer?«, wiederholte ich perplex.
»Keine Sorge. Der praktiziert kaum noch, und wenn, nur kleine Sachen. Du wirst es gar nicht merken.«
»Hast du gerade wirklich Hexer gesagt?« Meine Stimme klang einige Oktaven höher als normal. »Jemand, der wirklich mit Magie zu tun hat?« Oskar runzelte die Stirn. »Ja. Aber wie gesagt: Er lässt vielleicht seine Kürbisse schneller wachsen oder zündet mal ein kleines Feuer an. Nichts, das Auswirkungen auf dich hätte.«
Die Welt drehte sich schon wieder viel zu schnell. Das tat sie im Moment gern. Aber das machte die Zeitreisetheorie dann wohl zunichte.
»Hast du vor, die ganze Nacht hier zu stehen?«, zog Oskars Stimme mich aus dem Strudel meiner Gedanken.
»Nur mal so nebenbei …« Unsicher zupfte ich an einer Haarsträhne, die selbst in der nur dämmrig beleuchteten Straße rot schimmerte. »Ich werde doch nicht auf einem Scheiterhaufen enden oder so?«
Zum ersten Mal in dieser Nacht war Oskar es, der mich verwirrt ansah. »Wieso sollte das passieren?«
»Keine Ahnung? Könnte ja sein.«
»Ist das«, begann er und sah dabei aus, als sei er nicht sicher, wie genau er die Frage formulieren sollte, »etwas, das in deinem Land häufiger geschieht?«
»Nicht mehr?«
»Allmählich frage ich mich, ob nicht eher ich Angst vor dir haben sollte.« Kopfschüttelnd öffnete er die Tür und deutete mir an, zuerst hindurchzutreten. Eine steile Holztreppe führte circa zwanzig Stufen nach unten, wo sich eine weitere Tür befand. Ich zwang mich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, und betrat vorsichtig die erste der knarrenden Stufen, eine Hand an der Wand, um nicht abzurutschen. Ohne Vorwarnung entzündeten sich kleine Fackeln an den Wänden. Ich zuckte erschrocken zusammen. Nichts weiter passierte, weshalb ich noch einen Schritt wagte. Als ich mich der zweiten Tür nährte, drangen Stimmen zu uns hinauf, die sich mit dem Lachen einer Frau mischten.
Ich drückte die Tür auf und sofort schlugen uns Wärme und der Geruch nach Essen entgegen. Der Raum war nicht besonders groß, aber er bot Platz für einen Tisch aus dunklem Holz, mehrere nicht zusammenpassende Stühle und einen steinernen Kamin an der gegenüberliegenden Wand. Zwei Männer saßen an dem Tisch, auf dem Boden neben dem Kamin eine junge Frau, die eine Sammlung verschiedenster Pflanzen vor sich ausgebreitet hatte und sie zu Sträußen band. Sie hatte sich schon halb erhoben, als ich hörte, wie Oskar hinter mir durch die Tür trat.
»Oh, du bist es.« Ihre Haltung entspannte sich sichtlich, dennoch ließ sie mich nicht aus den Augen. Es bedurfte eines beherzten Stupsers in den Rücken, damit ich weiter nach vorn ging und Oskar die Tür hinter uns schließen konnte.
»Hey, Reyes!«, rief einer der Männer, den ich ebenfalls auf etwa mein Alter schätzen würde. Die Beine hatte er auf der Holzoberfläche des Tisches abgelegt, seine blonden Locken fielen ihm wirr ins Gesicht. »Hatten wir uns nicht geeinigt, keine Streuner mehr mit nach Hause zu bringen?«
»Halt die Klappe, Will.« Oskar wandte sich an mich. »Ignorier ihn einfach. Das machen wir auch.«
»Wohnt ihr alle hier?«, fragte ich und sah mich genauer um. Trotz der mehr als merkwürdigen Situation konnte ich nicht das Gefühl der Behaglichkeit abschütteln, das dieser Ort verströmte. Mehrere Schuhe standen unordentlich neben der Tür. Über den Lehnen der Stühle hingen achtlos Mäntel und auf einem gefährlich schief stehenden Herd blubberte ein Topf vor sich hin, auf den keiner wirklich zu achten schien. Neben Will saß ein weiterer Mann, die Hand in den dunklen Haaren vergraben und die gesamte Aufmerksamkeit auf ein Buch gerichtet, so, als interessiere es ihn kein bisschen, was um ihn herum passierte.
»Wohnen und arbeiten.« Oskar grinste stolz. »Willkommen im Unterschlupf der Untergrundbewegung.«
Die Frau am Kamin schnaubte, woraufhin Oskar ihr einen bösen Blick zuwarf.
»Ihr seid zu dritt. Drei Leute sind keine Bewegung«, sagte sie ungerührt.
»Na, mit dir sind wir immerhin vier.« »Vergiss es. Ich wurde gegen meinen Willen mit da reingezogen. Ich passe nur auf, dass du und die zwei Chaoten da hinten sich nicht aus Versehen umbringen.«
»Du weißt schon, dass wir dich hören können?« Der namenlose Mann runzelte mürrisch die Stirn, doch die Frau schenkte ihm nur ein unschuldiges Lächeln.
»Ich hab dich auch lieb.«
»Schön. Dann willkommen im Unterschlupf der beginnenden Untergrundbewegung.« Oskar fuchtelte ungeduldig mit der Hand und schubste mich weiter in den Raum hinein. »Freya, könntest du ihr was zum Anziehen leihen?«
»Sicher.« Freya stand auf und bedeutete mir mit einem Nicken, ihr zu folgen, während sie sich im Gehen getrocknete Pflanzenreste von den Kleidern klopfte.
Oskar hatte sich zu den beiden Männern an den Tisch gesetzt und beachtete mich nicht mehr. Fantastisch … Wo war ich da nur hineingeraten?
Stumm folgte ich Freya eine weitere Treppe hinunter und durch einen Flur in ein kleines Zimmer. »Du kannst hier schlafen. Ich komme gleich wieder«, sagte sie und war verschwunden, bevor ich antworten konnte.
Ich seufzte und setzte mich auf die Bettkante. Langsam machten sich die Strapazen der letzten Stunden bemerkbar. Meine Schultern schmerzten, meine Hand brannte und in mir hatte sich eine hartnäckige Übelkeit festgesetzt. Ich rieb mir übers Gesicht und zwang mich, wach zu bleiben, indem ich meine Umgebung in Augenschein nahm. Das Zimmer hatte steinerne Wände und befand sich so weit unter der Erde, dass es keine Fenster gab. Die Einrichtung war schnell erfasst: das Bett, auf dem ich saß, ein Nachttisch mit einer Kerze, deren Licht gespenstische Schatten an die Decke warf, und eine hölzerne Kommode auf der gegenüberliegenden Seite. Ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber glaubte, dass auch diese Flamme erst in dem Moment zu brennen begonnen hatte, als wir durch die Tür getreten waren. »Die kannst du haben«, riss Freyas Stimme mich aus meinen Gedanken. »Du bist etwas größer als ich, aber das wird schon gehen.«
Ich murmelte ein »Danke« und betrachtete die Sachen. Sie waren schlicht. Hemd und Hose aus Leinen, doch sie sahen tatsächlich aus, als sollten sie mir passen.
»Was ist da passiert?«, fragte Freya und deutete auf meine Hand.
»Was?« Ich blickte nach unten. »Oh.« Meine Knöchel waren aufgeplatzt und Reste von vertrocknetem Blut klebten daran. »Sagen wir einfach, meine erste Begegnung in der Stadt lief nicht so gut ab.«
»Ich hoffe, du hast ihn wenigstens gut erwischt?«
»Na ja, dein Mann hat das meiste gemacht.«
Freya erstarrte. Dann presste sie die Lippen zusammen und hob ganz langsam eine Braue. »Mein was?«
»Oh, tut mir leid«, erwiderte ich hastig. »Er sagte nur, seine Frau könne mir Sachen leihen und da dachte ich, du … Na ja.« Ich zuckte unsicher mit den Schultern, während meine Stimme langsam erstarb.
»Ich werde ihn umbringen.« Freya schoss einen giftigen Blick in die Richtung, aus der die leisen Stimmen der Männer zu uns hinunter drangen.
»Dann seid ihr nicht …?«
»Verheiratet? Bei den Göttern, nein! Wir schlafen manchmal miteinander, ja, aber ich bin nicht so dumm, diesen Kerl zu heiraten. Nicht, dass er das überhaupt wollen würde, natürlich.«
»Ich … ähm, das ist … schön für euch?«, stotterte ich. Was sollte man auf eine solche Aussage auch sonst erwidern?
Freya lachte und ersparte mir weitere Worte, indem sie in dem angrenzenden Badezimmer verschwand. Wasser rauschte, dann kehrte sie mit einem feuchten Tuch zurück und begann, das Blut von meiner Hand zu wischen.
»Fließendes Wasser«, murmelte ich nachdenklich und erntete dafür nicht den ersten schrägen Blick an diesem Abend.
»Also.« Freya verteilte eine schwach nach süßen Blumen duftende Paste auf meinen Fingern. Sie fühlte sich angenehm kühl an. »Scheint weder gebrochen noch verstaucht zu sein. In ein paar Tagen merkst du davon nichts mehr.«
»Du scheinst dich damit auszukennen?«
»Mein Vater ist Heiler. Er bringt mir sein Handwerk bei. Und bei denen da oben«, sie nickte in Richtung Treppe, »bekomme ich mehr als genug Übung.«
»Danke«, murmelte ich zum gefühlt hundertsten Mal binnen weniger Stunden. Ich hatte so viele Fragen, aber die Müdigkeit, die mich erfasste, seit ich mich aufs Bett gesetzt hatte, machte es mir schwer, meine Gedanken zu ordnen. Die Welt wirkte zunehmend wie in Watte gepackt.
Freya runzelte die Stirn und hielt meine Hand in das Licht der Kerze, die neben dem Bett stand. »Das scheint aber nicht von einem Schlag zu kommen.«
»Nein.« Ich verengte die Augen und betrachtete das feine rote Band, das sich um meinen Finger wand.
»Hast du dich verbrannt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Aber ich hatte vorhin einen Ring um. Vielleicht ist das eine allergische Reaktion auf das Metall.«
»Ja, vielleicht«, murmelte Freya und klang dabei wenig überzeugt. »Woher kommst du noch mal?«, fragte sie dann beiläufig, während sie den Lappen zurück ins Badezimmer brachte.
»Von weit her, wie es aussieht«, antwortete ich leise und sank seufzend in die weichen Kissen. Ich wollte noch etwas sagen, doch es war mir entfallen, bevor ich eine Chance hatte, den Gedanken zu greifen. Falls Freya zurückkam, bemerkte ich es nicht. Mein Körper war zu erschöpft, um den Schlaf noch länger fernzuhalten.
Kapitel 5
Als ich am nächsten Morgen in die Küche kam, waren weder Oskar noch Freya zu sehen. Nur die beiden Männer vom Vorabend saßen an dem großen Tisch. Will hatte sich in seinen Stuhl gelümmelt und ließ die Beine über die Lehne baumeln. Der Dunkelhaarige, dessen Namen ich noch nicht kannte, saß vor einer Leinwand und zeichnete mit konzentrierter Miene feine Striche.
»Morgen.« Der Türrahmen stellte eine sehr verlockende Stelle dar, um stehenzubleiben.
»Oh, unser Streuner.« Will richtete sich auf, aber er zwinkerte mir zu und nickte zum Tisch. »Frühstück?«
»Danke.« Ich nahm ein rundes Gebäckstück und betrachtete es ratlos. Schließlich zuckte ich mit den Schultern und zupfte einen Happen ab. Was immer es war, schmeckte süß, war innen warm und weckte meinen Hunger. »Wo ist Oskar?«
»Keine Ahnung«, antwortet Will leichthin.
»Okay.« Ich wollte gerade ein weiteres Stückchen Teig abzupfen, als ich die Aufmerksamkeit des Dunkelhaarigen auf mir spürte. »Was?«
Er verengte die Augen. »Du bist seltsam.«
»Ähm, danke?«
Er grunzte und wandte sich dann wieder seinem Bild zu.
Will lachte. »Matt braucht etwas, um aufzutauen.« »Okay«, sagte ich erneut und setzte mich dann auf die Kante des nächsten Stuhls. Neugierig lehnte ich mich vor, um mir Matts Arbeit anzusehen. Das Bild stand erst zur Hälfte, aber es schien sich um eine weite Landschaft zu handeln, die von einem blau glitzernden Fluss durchbrochen wurde. Rote und gelbe Wildblumen wuchsen an seinem Ufer, im Hintergrund war die Silhouette der Berge zu erkennen. »Das ist beeindruckend.«
»Es ist eine Fälschung. Matt malt es, Oskar tauscht es aus und ich verkaufe dann das Original. Arbeitsteilung.« Will schob mir das Buch zu, in das Matt gestern Abend so vertieft gewesen war. Und tatsächlich befand sich eine Abbildung des Gemäldes auf der aufgeschlagenen Seite, begleitet von einem kurzen Text, der einen Künstler und eine Stadt benannte. Von beidem hatte ich noch nie etwas gehört. Bevor ich die wenigen Zeilen vollständig lesen konnte, wurde das Buch weggezogen und mit einem Knall zugeschlagen, der von den steinernen Wänden widerhallte. Ich sah gerade rechtzeitig auf, um mitzubekommen, wie Matt Will einen finsteren Blick zuwarf.
»Was denn?« Der Blonde lehnte sich lässig in seinem Stuhl zurück. »Sie wusste doch eh schon die Hälfte.«
»Heißt ja nicht, dass du ihr die andere auch noch erzählen musst. Du und Oskar, ihr werdet beide dafür sorgen, dass wir in einem Verlies landen.«
Will winkte ab und stand auf. Ich beobachtete, wie Matt kopfschüttelnd den Pinsel in ein kleines Gefäß mit gelber Farbe tauchte. Eine weitere Wildblume fand ihren Platz neben dem Fluss, wobei seine groben Pinselstriche so gar nicht zu den feinen Details passen wollten.
»Wenn es dich beruhigt«, begann ich zögernd, »ich habe nicht vor, irgendjemanden zu verraten.«
»O ja. Sehr beruhigend, Mädchen, das ich seit fünf Minuten kenne.«
Ich wollte etwas erwidern, doch das Öffnen der Tür ersparte mir weitere Worte. Erleichtert atmete ich auf, als Oskars unordentlicher Haarschopf zum Vorschein kam.
»Du bist noch da.« Er warf seinen Mantel über einen Stuhl.
»Wo hätte ich schon hingehen sollen?«
Oskar schnappte sich zwei der süßen Brötchen und steckte eines komplett in den Mund. »Tja. Matt hier lässt viele die Flucht ergreifen.« Er klopfte seinem Kumpel auf die Schulter.
Matt zeigte ihm den Mittelfinger, ohne von seiner Leinwand aufzublicken.
»Also ich glaube, wenn ich jetzt noch nicht weggerannt bin, werde ich es so schnell auch nicht tun.« Nicht dass es einen Ort gäbe, den ich aufsuchen konnte. Die bittere Erkenntnis nahm mir jeglichen Appetit und ich legte mein Frühstück beiseite.
»Also.« Oskar ließ sich mir gegenüber auf einen Stuhl fallen. »Felicity …«
»Fel«, korrigierte ich automatisch. Ich mochte die volle Version meines Namens nicht besonders. Die Schuld daran trug nicht unerheblich meine Mum und ihre Abneigung gegen Grandma. Außerdem hatte Ren als kleines Kind immer Probleme mit der Aussprache gehabt, also war aus meinem vollen Namen Fel geworden. Mit einem kurzen E. Damals hatten wir es lustig gefunden, heute war es, als sei es immer mein Name gewesen. Aber – Ich starrte zu Oskar, der mich mit einer ruhigen Neugierde beobachtete. »Woher kennst du meinen Namen?«
»War geraten.« Er grinste, riss ein Stück Brötchen ab und warf es sich gekonnt in den Mund. »Aber du hast gerade eine Vermutung bestätigt.«
»Und die wäre?«
»Weißt du, in dieser Stadt wimmelt es von Leuten, die ganz begierig darauf sind, ihre Informationen zu teilen, wenn man ihnen nur die richtige Motivation liefert.« Er lehnte sich vor und senkte verschwörerisch die Stimme. »Vor ein paar Tagen kam mir zu Ohren, der Kronprinz lasse im ganzen Land nach einer Felicity suchen. Alles streng geheim natürlich. Da tauchst du gestern wie aus dem Nichts auf und – nimm es nicht persönlich –, du benimmst dich echt seltsam.«
Ich setzte mich gerader hin. »Was?«
Oskar legte den Kopf schief. »Ihr kennt euch nicht zufällig?«
»Natürlich nicht! Ich kenne niemanden in dieser Stadt. Oder in diesem Land. Außerdem gibt es ja wohl mehr als eine Felicity hier.« Sollte das ihn überzeugen oder eher mich selbst? Und wäre es nicht gut, jemanden zu haben, der offenbar mehr über das wusste, was vorgefallen war?
»Ich hielt es auch für einen kuriosen Zufall«, fuhr Oskar fort. »Bis Freya mir davon erzählt hat.« Er tippte auf das rote Band, das sich hartnäckig an meinem Ringfinger hielt.
Ich inspizierte meine Hand. »Was ist damit?« Was immer Freya gestern auf die Verletzung getan hatte, es hatte sämtliche Rötungen, Kratzer und Abschürfungen geheilt. Nur das nicht.
»Das ist ein magisches Mal. Eine Art Brandwunde, die entsteht, wenn ein magischer Gegenstand sich mit einem Körper verbindet.« Oskar sah mich forschend an. »Solche Gegenstände sind selten. So richtig selten. So sehr, dass ein Prinz durchaus Interesse daran haben könnte.«
»Nicht nur er«, mischte sich Will in das Gespräch ein. »Viele in der Stadt könnten Interesse an dir entwickeln.«
»Der Ring meiner Großmutter«, murmelte ich abwesend. Es war unmöglich … und doch die einzige Möglichkeit.
»Wo ist er überhaupt?«
»Wer?«
Will hob eine Braue. »Der Ring?«
»Den …« Mit einem Stöhnen kniff ich die Augen zusammen. »Den hab ich nicht mehr.«
»Das ist nicht dein Ernst?«
»Ich habe ihn den Wachen am Tor gegeben, damit sie mich in die Stadt lassen.« Mit einem Mal überkam mich der übermächtige Drang, den Kopf in den Armen zu vergraben und zu weinen.
Matt tat mir – vermutlich unabsichtlich – den Gefallen, mich vor diesem Gefühlsausbruch zu bewahren, indem er endlich den Pinsel beiseitelegte und fragte: »Wie lange bist du schon hier?«
»Seit gestern Abend. Im einen Moment war ich in einem Park in der Nähe meiner Wohnung und im nächsten draußen vor der Stadt. Ich weiß, wie das klingt, aber –«
»Wie kann der Prinz dich dann schon seit Tagen suchen?«, unterbrach er mich ungerührt.
»Ich weiß es doch nicht!« Frust regte sich in mir, auch wenn die Frage durchaus ihre Berechtigung hatte. Wie konnte dieser Prinz, Tage bevor es – wobei auch immer es sich hier handelte – passiert war, davon gewusst haben?
»Vielleicht sollte sie mit Liam sprechen.«
Dankbar für die Ablenkung drehte ich mich zu Freya um, die in diesem Moment die Küche betreten hatte. »Wer ist Liam?«
»Mein Cousin. Und eine Art Experte für alles Magische. Vielleicht ist das hier wirklich ein riesiger Irrtum.« Sie stellte einen Korb mit frischen Kräutern auf dem Tisch ab und setzte sich neben Oskar, der zur Seite rückte, um ihr Platz zu machen.
»Ich sage es zwar nicht gern«, gab er mit einem Seufzen zu, »aber das wäre vermutlich tatsächlich eine gute Idee.«
»Sehr gut, ich habe ihm nämlich gestern noch geschrieben, dass du vorbeikommst.«
Abrupt sah er auf. »Wieso denn ich?«
»Weil ich heute viel zu tun habe.«
»Und das ist mein Problem, weil …?«
Freya lächelte süß. »Hast du mich gestern als deine Frau vorgestellt?«