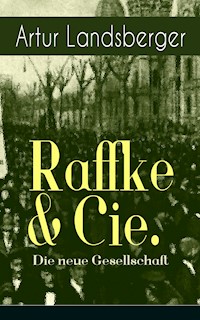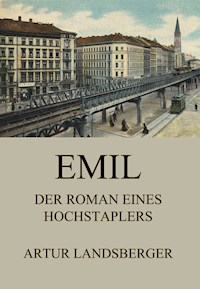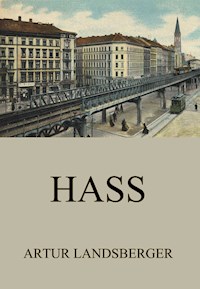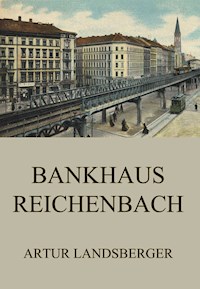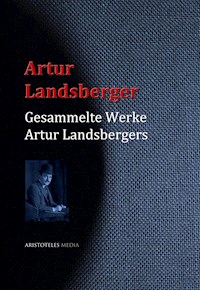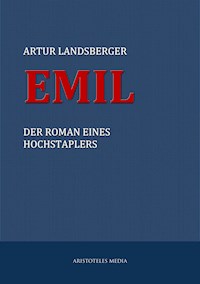Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Buch "Bankhaus Reichenbach" von Artur Landsberger ist ein faszinierender historischer Roman, der die Geschichte einer der einflussreichsten Banken im Deutschland des 19. Jahrhunderts erzählt. Landsberger kombiniert geschickt historische Fakten mit fiktiven Elementen, um ein lebendiges Bild dieser turbulenten Zeit zu zeichnen. Sein Schreibstil ist präzise und detailreich, was es dem Leser ermöglicht, tief in die Welt des Bankwesens einzutauchen. Der Autor zeigt ein tiefes Verständnis für die Finanzwelt und präsentiert komplexe Themen auf eine klare und zugängliche Weise. Mit "Bankhaus Reichenbach" liefert Landsberger nicht nur eine fesselnde Erzählung, sondern bietet auch Einblicke in die sozialen und politischen Veränderungen dieser Ära. Artur Landsberger, ein renommierter Historiker und Finanzexperte, greift in diesem Buch auf sein umfangreiches Wissen über das Bankwesen im 19. Jahrhundert zurück. Seine akademische Expertise und Leidenschaft für Geschichte spiegeln sich deutlich in seiner detaillierten Recherche und präzisen Darstellung wider. Als angesehener Experte auf dem Gebiet der Finanzgeschichte bringt Landsberger seine Leser dazu, die komplexe Welt des Bankwesens aus einer neuen Perspektive zu betrachten. "Bankhaus Reichenbach" ist ein Muss für jeden, der an Finanzgeschichte, historischen Romanen oder einfach nur gutem Storytelling interessiert ist. Landsbergers meisterhafte Erzählung wird Sie von der ersten bis zur letzten Seite fesseln und Ihnen einen frischen Blick auf die Vergangenheit ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bankhaus Reichenbach
Inhaltsverzeichnis
Es handelt sich um: Frau Kommerzienrat Reichenbach. Hanni Reichenbach, deren Tochter. Heinz Reichenbach, Frau Reichenbachs Neffe. Heinrich Morener, Großspekulant. Karl Morener, dessen Neffe. Hedda v. Nedlitz.
In die Handlung greifen ein: Kommerzienrat Reichenbach. Urbach, Meßter, Direktoren bei Reichenbach. L. E. Schnitter, Finanzierungen. Gräfin Amalie Wahl-Reuth, Heddas Tante.
Erster Teil
1.
Das Bankhaus der Gebrüder Reichenbach & Co. am Berliner Gendarmenmarkt war eins der angesehensten Privatinstitute der Reichshauptstadt. Im Jahre 1778 von Ferdinand Reichenbach gegründet, den König Friedrich II. mit dem Titel Hofbankier auszeichnete, sah es bald der Feier seines hundertfünzigjährigen Bestehens entgegen. Auch gesellschaftlich spielte die Familie Reichenbach bis zum Weltkriege eine Rolle. Nicht durch geräuschvolle Feste und Hervortreten bei öffentlichen Veranstaltungen. Man sah sie weder bei den Premieren im Opernhaus, noch auf den Subskriptions- und Pressebällen, weder zu den Paraden auf dem Tempelhofer Feld, noch bei den Rennen in Hoppegarten und Karlshorst. Aber es galt für einen Vorzug, bei Reichenbachs zu verkehren, selbst für die Offiziere der Gardekavallerie, die sich bekanntlich nicht gerade in die bürgerlichen Salons drängten. Die Botschafter und Gesandten der fremden Staaten gaben bei ihnen die Karten ab, und zwar zuerst, was den Neid gesellschaftlich ehrgeiziger Familien, die sich mehr dünkten, erregte. Zu alledem taten Reichenbachs nichts. Darin gerade lag ihre Stärke. Sie suchten nicht, sie ließen sich suchen. Das taten viele. Aber von den vielen unterschieden sie sich dadurch: sie taten nichts dazu, daß man sie fand.
Die Umstellung nach dem Kriege und der Revolution bot Menschen ohne Tradition, selbst wenn sie Gewissen hatten, keine Schwierigkeit. Am allerwenigsten den Angehörigen des Bankgewerbes. Gerade ihnen hatte man Generationen hindurch den Staat als das Muster eines redlichen Kaufmanns vor Augen gehalten. Warum sollten sie sich da nicht auch jetzt auf ihn als Vorbild berufen, wenn sie Dinge taten, die, über das ungeschriebene Gesetz der guten Sitten hinaus, gegen Treu und Glauben verstießen. Wer sich wie Leonard Reichenbach aber die Frage vorlegte: wie hätte dein Vater, Groß- und Urgroßvater in einem solchen Falle gehandelt, der rettete zwar seinen guten Ruf, der um das Jahr 1928 herum nicht hoch im Preise stand, verlor aber sein Vermögen.
Als Leonard Reichenbach damals, um durch den Krieg unterbrochene Geschäftsverbindungen wieder anzuknüpfen, mit den Direktoren anderer Banken nach Neuyork fuhr, erwiesen sich Tradition und Charakter für ihn als schwere Belastung. Denn während jene Direktoren, die im Interesse der von ihnen geleiteten Banken reisten, in erster Linie an die Rettung ihres eigenen Vermögens dachten, sah Reichenbach seine Hauptaufgabe darin, die ihm anvertrauten Kapitalien seiner Kunden zu retten.
So kam es, daß Reichenbach nach seiner Rückkehr sich stolz sagen konnte, alle, die sich ihm anvertraut hatten, wenn auch nicht vor Verlusten, so doch vor dem Zusammenbruch bewahrt zu haben. Er selbst aber hatte den größten Teil seines Vermögens verloren. Und als der Staat bald darauf seine Bürger durch die völlige Entwertung einer neuen Anleihe erneut um die ihm anvertrauten Sparanlagen betrog, räumte Reichenbach allen Kunden, denen er im Vertrauen auf den Staat zur Zeichnung geraten hatte und die nun in Bedrängnis waren, Kredite ein.
Das führte zu Verbindlichkeiten, denen das bereits geschwächte Bankhaus nicht gewachsen war. Eines Tages sah sich Reichenbach vor die Notwendigkeit gestellt, seine Firma und sein bei Brandenburg gelegenes Gut mit Schloß Reichenbach dem bekannten Grundstücksspekulanten Heinrich Morener gegen Übernahme sämtlicher Verbindlichkeiten auszuliefern. Und er mußte mit dieser Lösung, die ihm mit Frau und Tochter gerade noch die Möglichkeit einer bescheidenen Existenz ließ, noch zufrieden sein. Denn die Übernahme erfolgte nicht etwa auf Grund einer Bilanz, die unzweideutig den Zusammenbruch und die Passiva in Höhe von vielen Millionen Mark ergab, sondern sie war dem Zufall zu danken, daß der Großspekulant Heinrich Morener von dem Ehrgeiz besessen war, ein von der guten Gesellschaft anerkannter, sogenannter feiner Mann zu werden. Und man mußte schon eine Urkunde gefälscht oder silberne Löffel gestohlen haben, um als Chef des Hauses Gebrüder Reichenbach & Co. nicht als feiner Mann zu gelten.
Morener hatte denn auch aus seinen Motiven kein Geheimnis gemacht und gesagt:
»Wenn ich kein Geschäft mehr anrühre und als Wohltäter der Menschheit mein Vermögen opfere, so bleibe ich in den Augen der Welt doch immer der Grundstücksspekulant Heinrich Morener. Als Inhaber des Bankhauses Gebrüder Reichenbach auf Schloß Reichenbach aber wird aus Heinrich Morener ein anderer Mensch. Und das lasse ich mich etwas kosten.«
Leonard Reichenbach empfand bei diesen Verhandlungen so starkes seelisches und körperliches Unbehagen, daß er oft nachgab, nur um zu einem Ende zu kommen. Im übrigen befand er sich in einer Lage, in der Morener diktieren konnte. Auch jetzt, als er die Herausgabe der in seinem Privatbureau und im Konferenzsaal hängenden Familienbilder als etwas Selbstverständliches forderte, erwiderte Morener:
»Sie gehören zur Firma, um die Kontinuität zu wahren. Ihr Aus- und mein Eintritt muß als ununterbrochene Fortdauer eines Ganzen erfolgen. Wenn der Zusammenhang unterbrochen wird, so entsteht etwas Neues, und ich kann statt Reichenbach ebensogut Morener firmieren. Mir aber liegt gerade daran, das Alte fortzusetzen.«
Reichenbach verstand das nur zu gut. Die Einwände Moreners waren ja gerade die Gründe, aus denen er alles, was an seine Vorfahren erinnerte, aus dem Kauf hatte ausschließen wollen.
Als Morener sah – staunend sah, wie schwer es Reichenbach wurde, sich von diesen Bildern zu trennen, die ihm seiner Ansicht nach doch nichts mehr nützen konnten, schlug er ihm vor, in der Firma zu bleiben – als Chef, wenn er wolle – neben ihm.
»Reichtum und Wohlbefinden sind relative Begriffe,« erwiderte Leonard Reichenbach. »War es bis heute für mich ein Erlebnis, wenn eine meiner hochgezogenen Stuten fohlte, so wird es mir von morgen ab genau dieselbe Freude bereiten, wenn meine Jagdhündin Junge wirft.«
»Und schließlich werden Sie sich damit begnügen, daß eines Ihrer Hühner Eier legt. – Mein lieber Kommerzienrat, Sie verzeihen – aber bei der Weltanschauung wundert es mich nicht, daß Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute stehen.«
»Und wenn ich Ihnen erkläre, Herr Morener, daß ich auch da, wo ich heute stehe, noch nicht mit Ihnen tausche.«
»Was heißt das? Sie haben mit mir getauscht – und zwar so gründlich, daß ich auch als Mensch an Ihre Stelle treten werde.«
»Das möchte ich nicht erleben.«
»Es ist der einzige Grund, aus dem ich derartige Opfer bringe. Für nichts anderes zahle ich meine Millionen als für den hundertfünfzigjährigen Glanz Ihres Namens, von dem ich in diesem Augenblick, in dem ich meinen Namen unter diese Urkunde setze, Besitz ergreife – um ihn nie wieder freizugeben.«
»Sie begnügen sich nicht mit dem Bankhaus, der Firma, dem Schloß, dem Gut, dem Gestüt – Sie wollen mich mit Haut und Haaren fressen.«
Und wenn man den hochgewachsenen, breitschultrigen, schweren Heinrich Morener jetzt vor dem schmächtigen, zarten Leonard Reichenbach, der ihm kaum bis zur Schulter reichte, stehen sah, konnte man es beinahe für möglich halten.
»Mein Ziel ist es,« erwiderte Morener, »daß, wenn in ein, zwei Jahren irgendwo der Name Morener fällt – Jeder fragt: »Sie meinen Morener–Reichenbach?« – Das mag eine fixe Idee von mir sein – möglich! Aber ich habe sie und führe sie – wie alles, was ich anpacke – durch.«
»Wenn mit mir auch der Geist Reichenbach verschwände – dann vielleicht. Aber Sie irren, wenn Sie glauben, daß Sie an die Stelle eines Toten treten. Sie werden auf einen unsichtbaren Widerstand stoßen – überall, wo Sie versuchen werden, sich über diesen Geist hinwegzusetzen.«
»Das klingt vorzüglich, Herr Kommerzienrat. Aber über alle diese Dinge ist die Zeit hinweggeschritten – erbarmungslos hinweggeschritten.«
»Diese Dinge leben, sage ich Ihnen – und sie kehren wieder.«
»Dann wird man sich ihnen anpassen.«
»Man kann sich nur Dingen anpassen, die man erlernen kann.«
»Wie meinen Sie das?«
»Daß Tradition unerlernbar ist.«
»Sie sehen überall Reibungsflächen und konstruieren Gegensätze, die gar nicht vorhanden sind.«
»Gibt es größere Gegensätze als unsere Weltanschauungen?«
»Weltanschauungen? – Ich habe keine Zeit, mir eine zu bilden. Ich denke und handle. Meine Weltanschauung ist der Erfolg – und danach allein werden Sie heute beurteilt.«
»Haben Sie Ihren Neffen Karl Morener, der doch voraussichtlich mal an Ihre Stelle treten wird, auch in diesem Geiste erzogen?«
»Allerdings! Und ich gebe Ihnen den Rat, auch auf Ihren Neffen Heinz, den ich nach unserem Vertrage ja mit übernehmen soll, in diesem Sinne zu wirken.«
»Das geht über meine Verpflichtung hinaus.«
»Es wird sein Fortkommen erleichtern.«
»Ich lehne es trotzdem ab. Sie, Herr Morener, werden sich nicht ändern! Aber ich hoffe, daß in dem unabwendbaren Kampf zwischen unseren Neffen die Reichenbachsche Weltanschauung siegen wird.«
»Ich sehe nur voraus, daß Sie eine neue Enttäuschung erleben werden.«
»Warten wir ab,« erwiderte Reichenbach, nahm die Feder und unterschrieb. Nach ihm Morener. Und als sie sich nach vollzogener Unterschrift die Hände reichten, fühlten sie, daß dieser Vertrag trotz langwieriger Verhandlungen, die vorausgegangen waren, kein Abschluß, sondern ein Anfang war.
Das Geschäft freilich, ganz geführt in Moreners Geiste, der ja der Geist der Zeit war, entwickelte sich derart, daß Gebrüder Reichenbach & Co. schon nach zwei Jahren wieder die erste Privatbank Berlins war. In diesem Jahre starb Leonard Reichenbach. Nach Jahren zum ersten Male erinnerte man sich wieder der Verdienste dieses seltenen Mannes, um den sich nach seinem Zusammenbruch kein Mensch mehr gekümmert hatte. Sein Begräbnis war ein weithin sichtbares Zeichen seiner einstigen geschäftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung.
Viele der früheren Freunde drückten wohl etwas beschämt die Hände der Frau Kommerzienrat Reichenbach und ihrer eben erwachsenen Tochter. Und wenn mancher dabei versprach – und es in dieser Stunde wohl auch so meinte – daß er sich nun der Witwe und der Tochter annehmen werde, so wußten Mutter und Kind doch, daß dieser Händedruck der letzte war.
Heinrich Morener aber, der neben der Witwe stand, war so stark von dieser letzten Kundgebung zu Ehren Reichenbachs beeindruckt, daß er sich in seinem gesellschaftlichen Ehrgeiz bei jedem, der Frau Reichenbach die Hand reichte, fragte: »Wird der wohl auch an meinem Begräbnis teilnehmen?« – Wohl nicht ganz frei von diesem Gedanken, bot er der Witwe am nächsten Tage außer seinem Trost eine in dem Vertrage nicht vorgesehene Rente aus dem Reingewinn der Bank. Frau Reichenbach lehnte in höflichster Form eine Unterstützung ab, die nicht im Sinne ihres in Gott ruhenden Mannes sei. Sie gab aber ihrer großen Freude über das Anerbieten Ausdruck, weil sie daraus ersehe, daß der Geist Reichenbach auch unter Heinrich Moreners Leitung fortlebe. Weniger die Ablehnung als die Begründung stimmte Morener nachdenklich –.
2.
Wieder waren zwei Jahre vergangen. Eine Reihe namhafter Privatfirmen waren in dem Bankhaus Gebrüder Reichenbach aufgegangen, ohne daß Morener einen Teilnehmer aufgenommen hätte. An der Börse hatte man vor seiner Tüchtigkeit und seinem Glück gleich großen Respekt. Je erfolgreicher Morener in seinem Bemühen war, der Bank gerade die Kundschaft wieder zuzuführen, die mit dem Austritt Leonard Reichenbachs verschwunden war, um so eifriger ahmte er die Methoden seines Vorgängers nach und hielt sich von Spekulationen und Geschäften fern – auch wenn sie großen Gewinn versprachen –, denen er seinen Aufstieg verdankte. Aber das geschah weniger aus Überzeugung als aus dem Wunsche heraus, mit der Zurückgewinnung der Kunden sich auch deren Salons zu erschließen. Hierzu war der Weg über Frau Reichenbach, die nur ihrer sportliebenden Tochter wegen noch gelegentlich Verkehr pflegte, der gegebene. Aber es hatte bisher an einem Anlaß gefehlt, die nach dem Tode Reichenbachs völlig abgeschnittene Verbindung wiederherzustellen.
Morener ärgerte sich über sich selbst, wenn er sich wie jetzt bei derartigen Gedanken ertappte. Ein Mann von meinem Format pfeift auf derart äußerliche Dinge, redete er sich zu, fühlte aber im selben Augenblick, daß er sich belog und gestand sich, daß diese krankhaft gesteigerte Sehnsucht, auch Leonard Reichenbachs gesellschaftliche Stellung zu erobern, ihm mehr wert war als alle geschäftlichen Erfolge. –
Der Privatsekretär meldete Herrn Karl Morener. Sofort reagierte sein Gehirn mit dem Gedanken: vielleicht durch ihn! – Er saß in seinem Bureau, einem großen hellen Raum, in dem außer einem großen Perserteppich nur ein paar Sessel und ein Riesenschreibtisch standen. An den Wänden hingen die Bilder der Reichenbachschen Chefs, die für ihn mehr als nur dekorativen Wert hatten, und an denen die Übernahme von Bank und Schloß beinahe gescheitert wäre.
Als sein Neffe Karl, der zusammen mit Heinz Reichenbach seit zwei Jahren Prokura hatte, das Bureau betrat, sah Morener zur Uhr und sagte:
»Guten Morgen, mein Junge! So früh habe ich dich hier noch nie gesehen.«
Karl, eine durchtrainierte Sportfigur, der bei aller äußeren Pflege – ja, je mehr er sich pflegte, um so deutlicher – etwas vom Professional anhaftete, erwiderte kühl:
»Es ist dein Wunsch, daß ich Sport treibe und Gesellschaften besuche. Wenn ich morgens reite, vormittags Tennis spiele, nachmittags Golf und abends Bridge – ich bitte dich, wo soll ich da die Zeit hernehmen, mich um das Geschäft zu kümmern?«
Karl ließ sich, ohne die Anforderung seines Onkels abzuwarten, in einen Sessel fallen, der gegenüber dem Schreibtisch stand, und sagte in einem Ton, der nicht erkennen ließ, ob es ganz ernst gemeint war.
»Ich freue mich, Onkel, daß du meine Verdienste anerkennst. Das gibt mir den Mut . . .«
Heinrich Morener stützte die Arme auf die Stuhllehne, rückte den schweren, breiten Körper näher an den Tisch heran, streckte den mächtigen Kopf mit der breiten Nase und den stechenden Augen vor und fragte:
»Wieviel?«
»Heute komme ich nicht, um etwas zu holen.«
»Nanu? – Bringst du mir am Ende gar etwas?«
»Ja! Eine Frau! Schön, jung, aus einem alten Stall, Rasse, Uradel.«
»So eine Frau könnte mich reizen.«
»Dich?« – Karl sah erschrocken den Onkel an.
»Ja! – Oder bringst du mir etwa eine Nichte? In dem Fall interessiert mich in erster Linie, zu wissen, ob sie vermögend ist.«
Karl erhob sich und sagte kalt:
»Ich danke dir für deine Aufklärung.«
»Bleib!« befahl Morener. Karl nahm wieder Platz –
»So! und nun klär' mich auf!«
»Ich wußte nicht, daß du mit deinen fünfzig Jahren . . .«
»Vierundfünfzig,« berichtigte Morener.
». . . noch an eine Ehe denkst. Infolgedessen hoffte ich als einziger Verwandter . . .«
»Du weißt nun also, daß das ein Irrtum war.«
»Ja!« – Karl war schon wieder im Begriff sich zu erheben. »Bleib!« wiederholte Morener. Diesmal mit größerer Bestimmtheit. »Wer ist die schöne, junge, rassige Frau aus altem Stall?«
»Du denkst doch nicht etwa im Ernst daran?«
»Ich denke daran – und du wirst mir dazu verhelfen.«
»Auch dann, wenn ich dir sage, daß ich sie liebe?«
»Das habe ich in den letzten Jahren schon zu oft von dir gehört. Arbeite mehr und du wirst weniger Zeit finden, dich zu verlieben.«
»Es ist ernster als sonst.«
»Das sagst du jedesmal. Ich brauche es also nicht ernst zu nehmen. Du wirst am Leben bleiben – auch wenn aus dieser Ehe nichts wird.«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Ich weiß es – das genügt. Aber was wichtiger ist und worüber ich schon lange mit dir sprechen wollte, da es auch dich angeht, ist folgendes: Je deutlicher das Selfmadetum unserer Zeit den Stempel aufdrückt, um so stärker leide ich darunter, ein Selfmademan zu sein. Früher war man als so ein Außenseiter ein Ausnahmemensch, von dem jeder sprach. Man war zum mindesten eine Persönlichkeit, die sich aus der Masse hob. Heute ist man im besten Falle der Typ einer Massenneuerscheinung.«
»Das kannst du doch von dir nicht sagen.«
»Auch du heißt Morener – und ich wünschte, daß man es auch von dir nicht sagte.«
»Wenn die Baronin von Nedlitz meine Frau wird . . .« Er erschrak. »Jetzt habe ich ihren Namen genannt.«
»So wird man sagen: wieder eine Adlige, die sich an einen Neureichen verkauft. Wenn du aber die Tochter des verstorbenen Kommerzienrats Reichenbach heiratest . . .«
»Du hast diese Idee noch immer nicht aufgegeben?«
». . . so wird es heißen: die Reichenbachs und die Moreners bleiben unter sich. Und da die Reichenbachs Patrizier sind, so wird man sehr bald auch die Moreners dazu rechnen.«
»Ein sonderbarer Ehrgeiz, Onkel – und, glaube mir, ein sehr unzeitgemäßer.«
»Ein sehr gesunder, mein Junge! wenn unsere demokratische Zeit auch kein Verständnis dafür hat. Tradition ist das einzige, was man nicht kaufen kann. Das sieht man am besten an uns. Selbst da bedarf es noch einer Generation – und bleibt auch dann noch immer eine Täuschung. Wenn du aber Hanni Reichenbach heiratest, haben wir, was wir brauchen – und es macht nichts aus, daß sie arm ist. Denn unter uns, mein Junge, die Millionen, die hier verankert sind, gehören ihr so gut wie mir. Ja, ich habe das Gefühl, sie erst durch diese verwandtschaftliche Verbindung mit Reichenbachs rechtmäßig zu besitzen und hier Herr im Haus zu sein.«
»Das ist übertrieben und weit hergeholt, Onkel! Früher hattest du weniger Bedenken. Ich erinnere mich an Fälle, wo selbst ich . . .«
»Ich weiß – und will mich nicht daran erinnern. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Der alte Reichenbach hatte schon recht, wenn er von dem Geist des Hauses sprach, dem auch der Stärkste sich nicht entziehen kann.«
»Wenn es so ist, wie du sagst, dann solltest du die Kommerzienrat Reichenbach um ihre Hand bitten.«
»Unmöglich! Daß du das nicht fühlst! Die Witwe eines Kommerzienrat Reichenbach, die einen Morener heiratet, schadet sich, ohne mir zu nützen.«
»Das ist wahr.«
»Gerade das Gegenteil von dem, was ich anstrebe, würde erreicht: die Familie Reichenbach, die ich mir nutzbar machen will, ginge damit in der zur Zeit wirtschaftlich stärkeren Familie Morener unter.«
»Und bei mir wäre das anders?«
»Was sich die Jugend erlauben darf, paßt nicht für das Alter. Du könntest dich im Fall dieser Ehe: Karl Morener-Reichenbach nennen. Niemand wird Anstoß daran nehmen. Täte ich das, so würde man lächeln. Die Gesellschaft hat für solche Dinge eine feine Nase. Bei euch jungen Menschen aber, die man seit Jahren zusammen beim Golf und Tennis sieht, wird man den Zusammenschluß als etwas Natürliches und Gegebenes hinnehmen und sagen: sie lieben sich.«
»Was also soll ich tun?«
»Die Baronin Nedlitz in meinem Namen bitten, morgen abend um sieben an einem kleinen Familienessen auf Schloß Reichenbach teilzunehmen.«
»Und wer wird außer dir und ihr noch an diesem Familienessen teilnehmen?«
»Frau Kommerzienrat Reichenbach mit Tochter – und du.«
»Das kann ja sehr gemütlich werden.«
»Gemütlich kaum – aber vielleicht für uns alle von Bedeutung. – So! und nun geh!«
Karl erhob sich und ging hinaus. – Heinrich Morener lehnte sich in den Sessel zurück und war zufrieden, die Angelegenheit, die ihn schon lange beschäftigte, endlich in Fluß gebracht zu haben.
Am nächsten Abend aber . . .
3.
Am nächsten Abend aber fand sich auf Schloß Reichenbach eine Gesellschaft von sechs Personen ein, die nach Geburt und Weltanschauung, sowie nach den sozialen Verhältnissen, in denen sie lebten, ganz und gar nicht zusammengehörten.
Schloß Reichenbach lag in einem alten Park, der zu dem gleichnamigen Rittergut gehörte. Wenn man von Berlin aus durch Brandenburg fuhr, etwa einen Kilometer hinter dem Zuchthaus, bog eine Landstraße links ab, die zu beiden Seiten von hohen, Jahrhunderte alten Bäumen bewachsen war. Nach ein paar hundert Metern begann links vom Fahrweg eine mannshohe Mauer zu laufen, die Bäume zur Rechten hörten auf, der Weg führte immer dichter zur Havel heran. Schließlich befand man sich vor einem hohen, zu beiden Seiten von dichtem Wald umgrenzten Eisentor, das über die ganze Breite der Landstraße reichte und den Weg versperrte, so daß man unwillkürlich an die schweren Tore des Brandenburger Zuchthauses zurückdachte, an denen man vor kaum zehn Minuten mit beklommenem Herzen vorübergefahren war.
Wenn das Tor sich aber öffnete, sah man märchenhaft – bei einem Sonnenuntergang wie heute abend – tief im Grünen Schloß Reichenbach liegen. Man glaubte sich um Jahrhunderte zurückversetzt. Die Zeit schien stillzustehen. Von dem Hasten und dem Lärm da draußen spürte man nichts. Und die beiden Autos, die jetzt über den Rasen glitten, wirkten in der Stille dieser in das tiefe Rot der untergehenden Sonne getauchten Landschaft wie Gespenster.
In dem ersten großen und geschlossenen Auto, das Heinrich Morener gehörte, saß die verwitwete Frau Kommerzienrat Reichenbach mit ihrer Tochter. Morener hatte sie in seinem Wagen aus der Stadt holen lassen. Das zweite offene Auto war der Sportwagen Karl Moreners. Er saß am Steuer, neben ihm die Baroneß von Nedlitz, eine große, schlanke, rassige Frau, die kein Auge von dem etwa fünfzig Meter vor ihnen fahrenden Auto ließ.
»Daß Sie sich dazu hergeben, hätte ich nicht gedacht,« sagte die Baronesse – und es klang vorwurfsvoll.
»Warten Sie ab,« erwiderte Karl Morener. »Wenn mein Onkel mit Ihnen gesprochen hat, geben vielleicht auch Sie sich dazu her.« – Er wiederholte ganz bewußt ihre Worte und betonte sie.
»Möglich! Aber bei einer Frau ist das ganz etwas anderes.«
»Finden Sie?«
»Ich als Frau habe keine große Auswahl. Ich bin an Luxus gewöhnt und kann mich nur durch eine Ehe in ein standesgemäßes Leben retten. Ein Mann wie Sie aber hat tausend Möglichkeiten.« –
»Sie haben sich also so halb schon mit dem Gedanken abgefunden?«
»Ja.«
»Ich warne Sie, Hedda!«
»Keine Drohung, bitte!«
»Wenn Sie sich an ihn wegwerfen.«
»Wie geschmacklos! – so eine Redensart! – Oder wollen Sie damit etwa sagen, daß dann auch Sie entschlossen sind, sich wegzuwerfen?«
»Dann heirate ich Hanni Reichenbach.«
Das geschlossene Auto hielt vor der Einfahrt des Schlosses. Hanni hielt die Hand ihrer Mutter.
»Nimm es nicht so schwer, Mama!« sagte sie zärtlich.
»Zum erstenmal nach vier Jahren. Ich habe nicht geglaubt, daß ich das Schloß jemals wieder betreten werde.«
»Du konntest es Herrn Morener nicht abschlagen.«
»Er hätte es mir nicht zumuten dürfen.«
»Er fühlt ja nicht wie wir. Er glaubte, dir etwas Gutes zu tun.«
»Etwas Gutes,« wiederholte Frau Reichenbach und sah zur Treppe des Schlosses empor, die Heinrich Morener soeben herunterstieg, um seine Gäste zu empfangen: »Als ob von da etwas Gutes kommen könnte!«
»Er war doch nicht schuld an dem Zusammenbruch.«
»Du verteidigst ihn noch?«
»Der oder ein anderer. Wenigstens wurde unser guter Name gerettet.«
»Du hast recht, Kind! Und ich danke dir, daß du mich gerade in dieser Stunde daran erinnerst. Ich werde den Abend nun leichter überstehen.« –
Ein paar Sekunden später – und Morener begrüßte seine Gäste.
»Ich bin sehr glücklich,« sagte er zu Frau Reichenbach, als sie ihm die Hand reichte – »und ich hoffe, es hat Sie nicht zu viel Überwindung gekostet.«
»Das erstemal ist es ja schwer,« erwiderte sie und lächelte – wenn auch gezwungen.
»Aber nur das erstemal!« gab er zur Antwort. »Sie dürfen nun nicht wieder Jahre verstreichen lassen.«
»Sie sind sehr freundlich, und ich muß Ihnen danken.«
»Wenn einer zu danken hat, bin ich es.«
»Wir sind uns gegenseitig nützlich gewesen.«
»Ich konnte Ihnen helfen, weil man mich die Kunst, Geld zu verdienen, von der Wiege an gelehrt hatte. Aber in der sehr viel größeren Kunst, die kaufmännische Würde in jeder Lebenslage zu wahren, ist mir Ihr Gatte Vorbild gewesen. Ich eifre ihm nach – freilich ohne Aussicht, ihn je zu erreichen.«
»Sie machen es mir und meinem Kinde leicht, uns bei Ihnen wohl zu fühlen,« erwiderte Frau Reichenbach. Ein fünfter Gast erschien. Einer, der auch nicht gern gekommen war. Heinz Reichenbach, Frau Reichenbachs Neffe. Er hatte die Bahn bis Brandenburg benutzt und war dann zu Fuß gegangen. Denn das Gehalt, das er in dem Bankhaus Reichenbach bezog, reichte gerade für das Leben eines jungen Mannes aus gutem Hause aus, der leidenschaftlich altes Porzellan sammelte, den Sport liebte und seinem Namen ein gewisses äußeres Auftreten schuldig war. Man sah ihm, der wie Karl Morener so um die fünfundzwanzig herum war, die gute Herkunft an. Das schmale, feine Gesicht, die ungezwungene Art, sich zu bewegen, der natürliche, unerlernbare Takt, die angeborene Höflichkeit, die ganz unbewußt differenzierte und distanzierte – alles das deutete auf die Kultur von Generationen. Selbst jetzt, wo er seit vier Jahren zum ersten Male wieder die ehemalige Villa seines Onkels betrat, um dem neuen Besitzer den ersten Besuch zu machen, überlegte er nicht einen Augenblick lang, wie er sich zu benehmen hatte. Diese Sicherheit verblüffte Heinrich Morener. Der hatte sich, wie für Frau Reichenbach, so auch für ihn ein paar nette Worte zurechtgelegt, mit denen er dem, seinem Empfinden nach etwas deklassierten jungen Mann über das Peinliche der Situation hinweghelfen wollte. Er hielt daher das Benehmen Reichenbachs, der so sicher auftrat, als wenn er täglich hier ein und aus ginge, für bewußt und überheblich und darauf gerichtet, ihn zu kränken. Es war daher kein Wunder, daß er selber begann, sich unsicher zu fühlen – um so mehr, als jetzt auch sein Neffe Karl und die Baroneß Nedlitz erschienen, denen gegenüber er sich auch nicht gerade in starker Position befand.
Als Karl Morener seinem Onkel die Baronin vorstellte, die, im Gegensatz zu den vornehm aber einfach gekleideten Reichenbachschen Damen, in ganz großer Abendtoilette war, sagte die:
»Ich hätte Sie gern erst bei mir gesehen, Herr Morener! Aber die Welt steht auf dem Kopf – und da braucht man es wohl auch mit den Formen nicht so genau zu nehmen.«
Ein faux pas! schoß es Morener durch den Kopf. Eine verfehlte Börsenspekulation konnte ihn nicht schwerer treffen. Etwas gezwungen klang es, als er jetzt sagte:
»Mein Neffe glaubte, es auf Grund Ihrer sportlichen Kameradschaft wagen zu dürfen.«
»Er trainiert nicht genug. Er trinkt und raucht – vor allem aber, er arbeitet zuviel. Wenn wir im Doppel um die Meisterschaft von Berlin Chance haben sollen, so müssen Sie ihn für die nächsten vier Wochen beurlauben.«
»Die Baroneß hat recht,« erwiderte Karl, »unser Prestige steht auf dem Spiel! Auch das deine, Onkel! Denn die Paarung Baroneß Nedlitz–Morener interessiert sportlich und gesellschaftlich gleich stark!«
»Und wer sind Ihre gefährlichsten Gegner?«
Hedda Nedlitz wies auf Hanni und Heinz Reichenbach und sagte:
»Ein sonderbares Zusammentreffen.«
»Wie? – Sie, Fräulein Hanni . . . und Sie . . . Herr Reichenbach? Ja . . . haben Sie denn . . . die Zeit und die . . . Mittel?«
Heinz Reichenbach fuhr auf und wollte erwidern. Aber seine Tante, die es ahnte, kam ihm zuvor und sagte:
»Wir sind Ehrenmitglieder des Klubs, den mein Mann vor vierzig Jahren mitbegründet hat!« – Morener, der fühlte, wie taktlos seine Frage war, zuckte zusammen – und Frau Reichenbach fuhr fort: »Sonst könnte es sich meine Tochter natürlich nicht erlauben – und mein Neffe wohl auch nicht.«
»Ich wollte damit nicht etwa sagen . . . im Gegenteil, es wäre mir eine Freude – und eine selbstverständliche Pflicht, wenn Sie etwa – aus Gründen materieller Art –«
»Ich sagte ja schon, daß wir es nicht zu bezahlen brauchen.«
»Mir liegt das Prestige des Namens Reichenbach genau so am Herzen wie das eigene.«
»Unser Name wird durch einen Sieg oder eine Niederlage im Tennisturnier keine Veränderung erfahren,« erwiderte Frau Reichenbach. Und wenn sie es auch nicht aussprach, so hieß das doch: Ihr Prestige hingegen . . .
Das hörte auch Heinrich Morener heraus und sagte:
»Eben deshalb bitte ich, daß mein Neffe mit Ihrer Tochter spielt. Mir liegt an der Verbindung der Namen Reichenbach–Morener . . . auch außerhalb des Geschäftlichen.«
»Ihr Neffe und ich sind aufeinander eingespielt,« widersprach die Baroneß. Aber Heinrich Morener erwiderte:
»Das Paar Reichenbach vermutlich auch.«
»Seit zehn Jahren,« bestätigte Hanni.
»Also sind die Chancen ausgeglichen.«
»Ich möchte aber nicht gegen meinen Vetter spielen.«
»Wenn der Herr Morener es wünscht,« sagte Frau Reichenbach – »und auf diese Äußerlichkeit Wert legt.«
Hanni schwieg. Morener trat an sie heran und sagte:
»Damit Sie sich an meinen Neffen gewöhnen, gnädiges Fräulein, wird er Sie jetzt zu Tische führen – und Sie, Herr Reichenbach, führen die Baronin.« Er selbst reichte der Frau Kommerzienrat den Arm und sagte: »Bitte!«
Das Gespräch um den runden Tisch herum drehte sich während der ganzen Mahlzeit um die üblichen Dinge: Sport – Mode – Reise und Theater. Nach dem Essen aber . . .
4.
Nach dem Essen ging die Jugend in den kleinen Saal, aus dem schon, als die Diener die Speisen reichten, die Klänge einer bekannten Jazz-Band zum Tanze lockten. Heinrich Morener aber führte die Frau Kommerzienrat Reichenbach in den Salon. Ziemlich unvermittelt begann er, als sie sich gesetzt hatten.
»Sie sehen, ich habe die Räume hier unverändert gelassen.«
»Man hatte es mir erzählt – und ich habe mich darüber gefreut.«
»Die Ehrlichkeit verlangt zu sagen, daß es nicht aus Pietät geschah.«
»Also teilen Sie den schlichten Geschmack meines seligen Mannes?«
»Ich verstehe nicht viel davon. Aber ich habe mir gedacht: wer weiß, wer nach mir hier leben wird.«
»Ihr Neffe vermutlich.«
»Gewiß. Er hat die größte Chance – vorausgesetzt, daß er meinen Wunsch erfüllt –« Er hielt inne, weil er hoffte, daß Frau Reichenbach ihn fragen würde: welchen Wunsch? Da das nicht geschah, so fragte er: »Sie erraten es nicht?«
»Sie wünschen sich vermutlich, daß er heiratet.«
»Und zwar so, daß die Reichenbachs hier wieder zu Hause sind.« – Er erwartete eine Antwort. Da sie ausblieb, so fuhr er fort: »Das, gnädige Frau, ist der Grund, aus dem ich mir die Freiheit nahm, Sie zu mir zu bitten.«
»Das heißt doch nicht, daß meine Tochter . . .?«
»Überrascht Sie das? Es ist nur folgerichtig. – Oder würden Sie es lieber sehen, wenn ich Sie um Ihre Hand bitte?«
Frau Reichenbach erhob sich und sagte kalt:
»Sie werden mich in diesem Hause nicht beleidigen.«
»Ich finde den Gedanken weniger kränkend als die Art, in der Sie ihn ablehnen.«
»Ich habe den Wunsch, den Namen meines Mannes bis an mein Ende zu tragen.«
»Niemand begreift das mehr als ich. Ich habe daher auch niemals den Versuch gemacht.«
»Sie vergessen schnell, Herr Morener!«
»Für einen Menschen wie mich ist es Bedingung, schnell zu handeln und ebenso schnell zu vergessen. Denn ich muß erlernen, was Ihnen im Blute liegt.«
»Um so vorsichtiger sollten Sie alles vermeiden, was möglicherweise Anstoß erregt.«
»Gerade aus seinen Verstößen lernt man am schnellsten. Aber indem man sie begeht und erkennt, muß man sie auch schon hinter sich haben.«
»Das gilt für Sie – aber nicht für Ihre Opfer.«
»Fällt es Ihnen so schwer, zu vergessen, daß ich Sie vor Jahren einmal begehrt habe?«
»Begehrt? – Berechnet haben Sie!«
»Gnädige Frau!«
»Sie glaubten, Ihr Geschäft mit meinem Mann zu einem schnelleren und für Sie günstigeren Abschluß zu bringen, wenn Sie in mir Ihre Verbündete hätten.«
»Ich habe heute den Mut, zu bekennen, daß es so war. Aber ich kann mein Gewissen nicht mit Fehlern belasten, die Jahre zurückliegen.«
»Sie verfolgen mit der Ehe Ihres Neffen und meiner Tochter nur den Zweck, die Distanz zwischen unseren Familien zu verwischen. Aber Sie dürfen das gleiche Interesse nicht bei uns voraussetzen.«
»Sie sind sehr stolz.«
»Stolz nicht, aber bitter. Und diese Bitterkeit Menschen wie Ihnen gegenüber, mag sie noch so ungerecht sein – ist das einzige, was uns dies veränderte Leben erträglich macht.«
»Durch diese Ehe würden sich die Verhältnisse mit einem Schlage ändern.«
»Ich glaube, daß meine Tochter in einem solchen Falle nur ihr Herz befragen wird.«
»Nicht einmal ich fühle mich stark genug, eine Entscheidung von dieser Bedeutung nur nach dem Gefühl zu treffen.«
»Sie, Herr Morener, hat der wirtschaftliche Aufstieg zu einem unfreieren Menschen gemacht als uns der Zusammenbruch. Früher hätten Sie eine Dame vom Varieté heiraten können – niemand hätte es Ihnen verübelt. Heute ist der Stammbaum für Sie wichtiger als der Mensch.«
»Es handelt sich nicht um uns, sondern um Ihr Kind und meinen Neffen.«
»Das müssen die beiden jungen Leute untereinander ausmachen. Ich bin in Sachen des Herzens nicht Anwalt meines Kindes.«
»Über meinen Neffen bin ich im klaren. Wenn Sie also glauben, daß auch das Herz Ihrer Tochter noch frei ist?«
»Sie hängt an ihrem Vetter.«
»An Heinz Reichenbach? – Aber liebe, gnädige Frau, das hieße ja Ihre finanzielle Misere verewigen.«
»Möglich, daß es nicht mehr ist als verwandtschaftliches Gefühl.«
»Würden Sie dann bitte Ihr Fräulein Tochter zu uns bitten?«
»Wie denn? Ich soll in Ihrer Gegenwart . . .«
»Sie könnte Fragen stellen, die nur ich beantworten kann.«
»Wie wenig kennen Sie mein Kind!«
»Lassen wir es darauf ankommen.«
Frau Reichenbach ging zur Tür und verständigte sich durch einen Blick mit ihrer Tochter, die gerade mit Reichenbach tanzte.
Heinrich Morener erhob sich, als Hanni ins Zimmer trat.
»Setz dich, bitte!« sagte die Mutter.
Aber Hanni, der man die innere Erregung ansah, erwiderte:
»Ich kann nicht – diese Baroneß!«
»Was ist mit ihr?« fragte Morener.
»Gleich nach dem Essen nahm sie mich beiseite und sagte: ›Haben Sie es bemerkt? Man will uns verkuppeln.‹«
»Was ist das für ein Wort!« rief Frau Reichenbach und wandte sich an Morener.
»Ich habe keine Silbe mit der Baroneß gesprochen, das Sie nicht gehört haben. Aber ich bin überzeugt, sie meint das ganz harmlos.«
Die beiden Frauen sahen ihn an, und Morener fuhr fort:
»Was kann sie anders meinen, als daß ich Sie bat, auf dem Tournier der Leute wegen auf seiten meines Neffen zu kämpfen?«
»Der Leute wegen?«
»Vielleicht auch mit Rücksicht auf die Gefühle meines Neffen.«
»Was sind das für Gefühle? – und was haben sie mit dem Sport zu tun?«
»Mein Neffe liebt Sie!«
»Das ist nicht wahr!«
Heinrich Morener ging zur Tür und rief:
»Karl!« – Dann wandte er sich wieder zu Hanni: »Er wird es Ihnen selber sagen.«
Als Karl Morener in den Salon trat, ging Hanni auf ihn zu, sah ihn scharf an und sagte:
»Mama fühlt sich nicht wohl! Wollen Sie uns bitte an den Wagen begleiten.«
Heinrich Morener warf den Kopf zurück und sagte:
»Ja – was heißt denn das?« – während Karl der Frau Kommerzienrat den Arm reichte und sie hinausführte.
Hanni blieb zurück, ging auf Morener zu und sagte:
»Sie wollten mich also doch verkuppeln.«
»Ich wollte Ihnen wieder emporhelfen – Ihnen und Ihrer Frau Mutter!«
»Danke,« erwiderte Hanni. »Ich habe nicht das Gefühl, daß wir gesunken sind.« Sie bewegte leicht den Kopf, wandte ihm den Rücken und ging.
Während Karl die beiden Damen an das Auto begleitete, saß Morener nachdenklich im Salon und sagte sich: Was hat man nun von seinem Geld, man bleibt diesen Menschen gegenüber doch, was man war. – Aber diese Erkenntnis war für ihn nur ein Grund mehr, um sich der Baroneß Nedlitz zu nähern – zumal sie ihm gefiel und der Aufmerksamkeit nach, die sie ihm während des Diners zuwandte, auch an ihm Gefallen zu finden schien.
Obgleich die Jazz-Kapelle, in dem Gefühl, von Morener überbezahlt zu werden, ohne Pausen spielte, tanzten die Baroneß und Reichenbach nicht mehr, sondern zogen sich in eine Nische des kleinen Saales zurück. Sie hatten sich zuvor viel voneinander erzählt. Nun aber sprachen sie nicht mehr, da die Baroneß mit den Vorgängen im Salon beschäftigt war und Reichenbach über die Gründe nachdachte, die Heinrich Morener veranlaßt haben könnten, seine Familie nach vier Jahren plötzlich ohne äußeren Anlaß einzuladen.
Da er es aber als unhöflich empfand, schweigend neben der Baroneß zu sitzen, so sagte er unvermittelt:
»In diesem Schloß habe ich meine Jugend verlebt – aber ich gebe mir Mühe, nicht daran zu denken.«
Hedda Nedlitz wandte sich zu ihm und erwiderte:
»Und ich sage mir jeden Tag und jede Stunde: denke daran, daß deine Vorfahren in Schlössern lebten – und ruhe nicht, bevor auch du wieder in dem Stil lebst, der dir zukommt.«
»Mit welchem Recht zukommt?« fragte Heinz Reichenbach. »Gerechterweise kommt einem doch nur zu, was man durch seine eigene Tüchtigkeit erworben hat.«
»So etwas sagen Sie?« erwiderte Hedda entsetzt. »Menschen, die ans Familien kommen wie wir. Menschen mit unserer Kinderstube, die vom ersten Tage verwöhnt worden sind und nie damit gerechnet haben, je Geld verdienen zu müssen – wo sollen wir denn die Tüchtigkeit hernehmen?«
»Für eine Frau wie Sie mag es nicht zutreffen. Da entscheidet das Schicksal – von dem wohl auch für uns mehr abhängt als von unserer Tüchtigkeit.«
»Ich verlasse mich lieber auf meinen Verstand.«
»Wir streiten uns um Begriffe – aber Sie haben schon recht: Menschen wie wir zwei mögen in allen nebensächlichen Dingen des Lebens noch so verschieden urteilen und handeln – in allem Wesentlichen stimmen wir doch überein.«
»Was nennen Sie das Wesentliche?«
»Die großen Momente im Leben – in denen die wahre Natur in uns so unvermittelt hervorbricht, daß wir die Äußerlichkeiten des Lebens völlig vergessen.«
»Wenn ich das große Los gewänne oder der Maharadscha von Johore um meine Hand anhielte – das wären für mich die großen Momente.«
»Bei denen Sie innerlich unbeteiligt blieben. – Nein! von innen muß es geschehen – nicht von außen –, daß Ihnen plötzlich die Erleuchtung kommt: alle bisherigen Vorstellungen von Welt und Menschen waren falsch – daß Sie mit einem Schlage ein anderer Mensch werden.«
»Einen solchen Moment wird es für mich nie geben.«
»Das bestimmen nicht Sie!«
»Sie sind ein Phantast! – Mit diesen Ideen werden Sie es nie zu etwas bringen.«
»Für jeden Menschen kommt einmal dieser Augenblick. Wissen Sie, was ich mir wünsche – ich möchte dabei sein dürfen, wenn Sie diese Stunde erleben.«
»Das klingt ja beinahe, als wenn Sie Ihr Schicksal mit meinem verknüpfen wollen.«
»Das Schicksal geht seinen Weg und kümmert sich nicht um unsere Wünsche.«
»Philosophierst du schon wieder,« sagte Karl, der eben mit Heinrich Morener in die Nische trat.
»Spielen Sie lieber eine Partie Schach mit meinem Neffen,« bat Heinrich Morener.
»Sie spielen Schach, Herr Reichenbach?« fragte Hedda erstaunt. »Mit dem Gefühl? – oder nehmen Sie da ausnahmsweise den Verstand zu Hilfe?«
»Für das Spiel reicht der Verstand aus,« erwiderte Heinz, »aber das Leben setzt sich darüber hinweg.«
»Ist das auch Ihre Meinung?« fragte Hedda und wandte sich an Heinrich Morener.
»Ich stehe auf dem Standpunkt, gescheit zu handeln ist besser als gescheit zu reden.«
»Also handeln wir!« sagte Hedda und sah Morener so scharf an, daß der verlegen sagte:
»Darf ich Sie noch ein Viertelstündchen langweilen?«
»Ich werde genau nach der Uhr sehen und nicht eine Minute länger bleiben,« erwiderte Hedda lächelnd.
Morener erschrak und sagte:
»So war das nicht gemeint.«
Er bot ihr den Arm und führte sie in den Salon.
»Ein sonderbarer Mensch, dieser Herr Reichenbach,« sagte Hedda.
»Etwas selbstbewußt – aber gewissenhaft.«
»Ich finde, er hat so etwas, was in die Zukunft weist.«
Morener lachte laut auf.
»Der und in die Zukunft weisend! Das dürfen Sie vielleicht von mir sagen – denn ich sehe darin keine Schmeichelei. Aber Heinz Reichenbach? Wenn der überhaupt irgendwohin weist, dann in die Vergangenheit.«
Im Salon vertauschte Morener schnell den Sessel, auf den sich Hedda eben setzen wollte, mit einem etwas tieferen, der daneben stand – und sagte:
»Hier sitzen Sie besser.«
»Also abergläubisch! Das hätte ich von Ihnen nicht gedacht.« – Und da Morener tat, als verstände er nicht, so fügte sie hinzu: »Auf dem Sessel, den Sie mir da eben entzogen haben, saß vorhin die Frau Kommerzienrat.«
»Allerdings.«
»Ich hatte mir gedacht, daß es nicht glücken würde.«
»Mein Neffe scheint Sie ja eingehend informiert zu haben.«
»Er nimmt Ihnen die Arbeit ab, das ist ja wohl seine Aufgabe.«
»Ich wünschte, er nähme es in geschäftlichen Dingen auch so genau.«
»Ist es Zufall, daß Sie die Beschwerden über Ihren Neffen bei mir anbringen?«
»Nein! denn ich glaube, daß Sie Einfluß auf ihn haben.«
»Während der Sommermonate.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Solange wir zusammen reiten und Tennis spielen.«
»Es gäbe ja eine Möglichkeit, diesen Einfluß auch auf die Wintermonate auszudehnen.«
»Indem Sie uns zum Wintersport nach St. Moritz schicken.«
»Als was – sollten Sie – ihn begleiten?«
Wieder sah Hedda ihm scharf in die Augen und sagte bestimmt:
»Als seine Tante.«
Morener sprang auf.
»Auch das hat Ihnen mein Neffe gesagt?«
»Wäre ich sonst hier?«
Morener konnte seine Erregung nicht verbergen.
»Sie könnten sich also entschließen . . .?«
»Wir sprachen vom Wintersport in St. Moritz, Herr Morener.«
»Ich weiß – aber Sie sagten . . .«
»Ich fragte, ob Sie zu Ihrem Neffen das Vertrauen hätten, ihn mit seiner Tante nach St. Moritz zu schicken?«
»Wenn Sie diese Tante wären?«
»Ich setz' den Fall.«
»Und Sie wünschen eine Antwort? Da ich die Zuneigung meines Neffen zu Ihnen kenne, so wäre ich mitschuldig, wenn ich Sie und ihn der Gefahr aussetzte . . .«
»Sie halten die Gefahr in Berlin für weniger groß?«
»Allerdings! Und zwar im selben Verhältnis, in dem die Gefahr der Entdeckung größer ist. Und da mein Neffe trotz allen guten Gefühlen – die er – was ich durchaus verstehe – für Sie hat, in letzter Linie ein Rechner ist, so würde er – was er in dem sehr viel sichereren St. Moritz wahrscheinlich nicht täte – sich in Berlin berechnen, was für ihn dabei auf dem Spiele steht.«
»Und meine Gefühle interessieren Sie gar nicht?«
»Für diesen besonderen Fall nicht. Denn, wenn Sie sich entschließen sollten, meine Frau zu werden, so weiß ich, daß Sie diesen Schritt nicht aus Liebe tun, sondern ans Klugheit.«
»Und wenn es so wäre?«
»Ihre Liebe könnte mir jeder rauben, der um dreißig Jahre jünger ist als ich. Nicht aber Ihre Klugheit. Sie ist mir im Gegenteil Gewähr dafür, daß Sie im Augenblick der Gefahr sich sagen werden: dazu haben Sie das Opfer nicht gebracht und mich geheiratet, um einer Liebelei wegen die Vorteile dieser Ehe aufs Spiel zu setzen.«
»Wie ist es möglich, daß Sie mich so richtig beurteilen, wo Sie mich gar nicht kennen?«
»Ich kenne Sie nicht erst seit heute, Baroneß.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Man hat Sie mir – natürlich ohne Ihr Wissen – von verschiedenen Seiten angetragen.«
»Mich – Ihnen? – Das ist unmöglich!«
»Verwandte von Ihnen, die es gut mit Ihnen meinen.«
»Doch nicht etwa meine Tante, die Gräfin . . .«
»Aber nein!«
»Was hat sie Ihnen von mir erzählt?«
»Daß Ihre Gläubiger im selben Augenblick aufhören werden, Sie zu belästigen, in dem ich meine Verlobung mit Ihnen bekanntgebe.«
»Glauben Sie das auch?«
Morener mußte über die Frage lächeln und erwiderte:
»Ich bin überzeugt davon.«
Hedda schien alles das schon viel zu lange zu dauern.
»Ich glaube, die Viertelstunde ist jetzt herum,« sagte sie.
Morener stand auf, trat vor den Sessel und fragte:
»Baroneß, darf ich Sie als meine Braut betrachten?«
Hedda erhob sich. Sie standen sich dicht gegenüber.
»Was werden die Leute sagen, wo wir uns heute zum ersten Male sehen?« fragte sie. »Aber das braucht ja niemand zu wissen. Wir können uns ja schon von meiner Tante her kennen.« – Sie sah ihn an. – »Ich hatte Sie mir – ja, wie sag ich nur? – viel härter und derber vorgestellt«. – Sie wies auf seinen Bart: »Der muß ab. Das ist das erste Opfer, das Sie mir bringen müssen.«
Morener versuchte eine schwache Verteidigung.
»Es gibt Frauen,« sagte er, »die lieben das.«
»Was können das schon für Frauen sein?« erwiderte sie. »Aus meinen Kreisen sicherlich nicht. – Da fällt mir ein . . .« – sie zögerte und trat einen Schritt zurück.
»So reden Sie!« drängte Morener.
»Sie heißen Morener.«
»Der Name ist ja wohl das einzige an mir, was Ihnen nicht fremd war.«
»Gewiß! – aber der Gedanke, daß ich in ein paar Wochen statt Hedda Hildegard Luise Baroneß von Nedlitz-Tornau-Neukirch einfach – Morener heißen werde . . .«
»Die Vornamen bleiben Ihnen.«
»Nein! Hedda Hildegard Luise – Morener, das klingt nicht! das ist unmöglich!«
»Das wäre doch bei meinem Neffen genau dasselbe gewesen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Er hat mich doch mit Ihrem Wissen gestern gebeten, in die Verbindung mit Ihnen einzuwilligen.«
»Selbstverständlich.«
»Und wenn ich ja gesagt hätte?«
»Wenn ich nicht genau gewußt hätte, daß Sie nein sagen, hätte ich ihn nicht zu Ihnen geschickt.«
»Das beruhigt mich. Aber warum haben Sie es dann getan?«
»Erraten Sie es wirklich nicht?«
»Nein! – Bitte sagen Sie's mir!«
»Dazu muß ich erst wissen, ob wir denn nun wirklich verlobt sind.«
»Ich für meine Person bin es! Aber da zu einer Verlobung unbedingt zwei gehören . . .«
Sie streckte ihm die Hand hin und sagte:
»Abgemacht!«
Jetzt war der Augenblick da, wo er sie – im Leben wie im Roman – an sich drücken und ihr einen Kuß – zum mindesten auf die Stirn drücken mußte. Beide hatten diesen Gedanken. Und während ihr das Wort: »später« auf den Lippen lag, lenkte er ab, indem er das Gespräch von zuvor wieder aufnahm, und fragte:
»Und jetzt darf ich auch wissen, weshalb . . .« Er bekam das »Du« nicht über die Lippen.
»Ich Ihren Neffen zu Ihnen schickte?« fiel sie ihm ins Wort. »Um Sie aufzumuntern. – Ich wußte, er würde Ihnen nur Gutes von mir erzählen.«
In diesem Augenblick hatte Morener so etwas wie eine Gemütsbewegung. Aber es war wohl mehr Eigenliebe als ein gutes Gefühl, als er jetzt den Arm um Hedda legte und mit veränderter Stimme beinahe zärtlich fragte:
»Dann hast du es dir wohl gar gewünscht, meine Frau zu werden?«
Hedda lächelte verschmitzt, legte kokett den Kopf an seine Schulter, sah zu ihm auf und erwiderte zärtlich:
»Ich habe damit gerechnet.« –
Im selben Augenblick sagte Heinz Reichenbach laut:
»Schach dem König!« und setzte seinen Gegner matt.
»Das klingt ja wie bestellt!« meinte Heinrich Morener und sah verdutzt nach der Ecke, in der die beiden spielten.
»Schon wieder abergläubisch?« fragte Hedda und rief dann zu dem Tisch hinüber:
»Wir haben unsere Rollen vertauscht, Herr Reichenbach. Sie haben mit dem Verstand gesiegt – bei uns hat das Herz entschieden,« – sie wies dabei auf Heinrich Morener, dessen Hand sie nahm und sagte: »Wir haben uns soeben verlobt.«
Die beiden jungen Leute sprangen auf. Reichenbach, dem es unerwartet kam, blieb beherrscht. Er trat an Hedda heran, verbeugte sich und wünschte Glück. Er reichte erst ihr, dann Morener die Hand.
Und Karl, dem diese Augenblicke Zeit ließen, sich zu sammeln, sagte scherzend:
»Also auch die Partie verloren.«
»Ich freue mich, daß du es nicht tragisch nimmst,« erwiderte Morener – »und werde dir das nächste Spielgewinnen helfen, indem ich dein Gehalt verdoppele.«
Er läßt mich meine Abhängigkeit fühlen, dachte Karl und dankte lächelnd. Aber Hedda trat an ihn heran, legte die Hand auf seine Schulter und sagte:
»Sie sehen, Karl, daß ich Ihnen auch als Tante nützlich sein kann.«
Morener trug dem Diener auf, Champagner zu bringen – und als Heinz Reichenbach sagte:
»Ich störe vielleicht bei dieser Familienfeier« – und sich zurückziehen wollte, rief Morener ihm zu:
»Was soll das heißen? Sie gehören zur Familie! – genau wie mein Neffe!« – Er erhob sein Glas. – »Die Familien von Nedlitz, Reichenbach und Morener gehören zusammen! Jeder für sich hat zwar eine Bedeutung – aber erst zusammen sind sie eine Macht und ein Programm: Sie sollen leben!«
»Hoch! – noch einmal hoch! – und zum dritten Male hoch!!« riefen alle. –
Eine Viertelstunde später fuhren zwei Automobile von Schloß Reichenbach über Brandenburg nach Berlin.
In dem einen saß Baroneß Nedlitz mit Heinrich Morener. Sie nahm den Verlobungskuß, den ihr Morener mehr feierlich als zärtlich nun doch auf die Lippen drückte, wie etwas Notwendiges entgegen, lehnte den Kopf an seine Schulter, sagte:
»Ich bin sehr müde – darf ich?« und schloß die Augen.
Dreißig Meter zurück am Steuer des offenen Sportwagens saß, wie auf der Hinfahrt, Karl Morener. Aber auf dem Sitz daneben, von dem noch ein Duft von Puder und Parfüm aufstieg, saß jetzt Heinz Reichenbach. Er wies auf das geschlossene Auto, das vor ihnen fuhr und fragte:
»Glaubst du, daß die beiden glücklich werden?«
»Darauf kann ich dir vielleicht in zwei Jahren einmal Antwort geben,« erwiderte Karl.
Zweiter Teil
1.
Zwei Jahre war es her, daß aus Hedda Baroneß von Nedlitz-Tornau-Neukirch eine Frau Bankdirektor Hedda Morener geworden war. Eine mustergültige Ehe, deren äußere Erscheinungsform einmal die Hebung des gesellschaftlichen Niveaus auf Schloß Reichenbach, in dem jetzt der Adel dominierte, des weiteren aber die veränderte Lebensweise Moreners war, den man nun jeden Morgen um sieben Uhr neben seiner Gattin auf dem Hippodrom zu Pferde sah, bartlos und in einer Haltung, als ob er auf dem Rücken eines Pferdes zur Welt gekommen wäre. – Mit diesen Worten schmeichelte ihm Hedda – und wenn das vielleicht auch übertrieben war, so mußten selbst die, die ihm sein Glück nicht gönnten, zugeben, daß er den Eindruck eines um zehn Jahre Verjüngten machte. Ja, Frau Hedda mußte es sich gefallen lassen, daß man sie in den Salons den weiblichen Voronoff nannte. Aber so sehr sich alte und weniger alte Herren um die Gunst bemühten, von Frau Hedda in das Geheimnis der Verjüngung eingeweiht zu werden – sie blieb allen Annäherungsversuchen gegenüber unnahbar. Auch nachmittags auf dem Golfplatz in Westend sah man die beiden täglich zusammen. Und wenn Morener auch häufig durch Konferenzen vom Spiel abgehalten wurde, so verging doch kein Nachmittag, an dem er nicht wenigstens auf eine halbe Stunde auf dem Golfplatz erschien. – Das Leben auf Schloß Reichenbach war völlig verändert. Nicht nur im Vergleich zu den vier Jahren, in denen Morener hier Herr war. Auch alles, was an den hundertfünfzigjährigen Besitz der Reichenbachs erinnerte, fiel dem Ehrgeiz Heddas zum Opfer, das Schloß ihrer Väter hier neu erstehen zu lassen. Etwas stillos. Denn, während sie einen Teil des Schlosses in eine Art Burg mit alten Rüstungen, Waffen und Ahnenbildern verwandelte, die teilweise kaum noch erkennen ließen, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Nedlitz handelte, stattete sie die Schlaf- und Gesellschaftsräume völlig modern aus. Morener ließ sie gewähren. Nur, als die Reichenbachschen Bilder denen der Nedlitz Platz machen sollten, hatte er moralische und wohl auch geschäftliche Bedenken. Denn der Wunsch und Wille, als der natürliche Erbe der Reichenbachs zu gelten, beherrschte ihn so stark, daß er diesen Bildern gegenüber eine gewisse Pietät empfand und den Wiederaufstieg des Bankhauses Gebrüder Reichenbach & Co. teilweise auf diese Kontinuität – wie er es nannte – zurückführte. Aber es gab Dinge, wie eben diese, in denen die sonst so nachgiebige Frau Hedda ihren Willen durchsetzte. »Pah!« sagte sie, »was sind deine hundertfünfzig Jahre im Vergleich zu den achthundert Jahren der Nedlitz, die mit dem Markgrafen von Hessen zusammen Jagd auf Menschen gemacht haben.«
So wohl es Heinrich Morener tat, daß sie ihm die hundertfünfzig Reichenbachschen Jahre anrechnete – was wohl klug berechnet von ihr war –, so schwer trafen ihn die Worte: »Jagd auf Menschen machten«. – Gerade das hatte man dem Großspekulanten Morener früher nachgesagt: daß er über Leichen gehe und Jagd auf Menschen mache. – Diesem übertriebenen Geschwätz von Leuten, die weniger klug und erfolgreich waren als er, verdankte er seinen schlechten Namen, für dessen Besserung ihm kein Opfer zu groß war. Und nun kam seine Frau und sagte ihm, daß der achthundertjährige Ruhm in ihrer Familie seinen Höhepunkt in dieser Jagd auf Menschen habe. War das für ihn eine Entlastung oder trieb das Schicksal ein Spiel mit ihm, indem es seinen schlechten Ruf auf diese Art verewigen wollte?
Diese Gedanken beschäftigten ihn so stark, daß er seinen Widerstand aufgab und die Bilder mit einem Schreiben an Frau Kommerzienrat Reichenbach sandte, in dem er seiner Freude Ausdruck gab, durch notwendig gewordene Veränderungen nunmehr in der Lage zu sein, den Wunsch ihres verstorbenen Gatten zu erfüllen. – Frau Reichenbach, die sofort die Zusammenhänge erkannte, erwiderte: »Welches auch immer die Gründe für die Überlassung der Gemälde sein mögen – meiner Tochter und mir haben Sie damit die erste frohe Stunde seit dem Tode meines Mannes bereitet. Wenn die Wände in meiner jetzigen Wohnung auch nicht ausreichen, um die Bilder unterzubringen, so macht uns doch das Gefühl glücklich, sie bei uns zu haben.«
Aber kaum waren die Bilder fort, da bereute Morener auch schon seinen Entschluß und machte Frau Hedda Vorwürfe.
»Daß du mich dazu veranlaßt hast,« sagte er, »zeigt, wie wenig du mich kennst. – Du sollst aber endlich wissen, wie es in mir aussieht – selbst auf die Gefahr hin, daß du mich auslachst.«
»Ich lache dich nicht aus, aber ich begreife nicht, wie man sich die Wände mit den Porträts einer Familie behängen kann, die einem völlig fremd ist.«
»Die Reichenbachs sind für mich mehr als nur eine Familie.«
»Was soll denn das heißen?«
»Sie sind ein Begriff – und wer wie ich diesen Begriff nach außen hin sichtbar repräsentiert, ist eben ein Reichenbach.«
»Auch, wenn er Morener heißt?«
»Auch dann.«
»Das begreife ich nicht.«
»Wenn ich heute Papst würde, hörte ich dann nicht auf, Morener zu sein? Wäre ich dann nicht der natürliche Nachfolger all derer, die vor mir Papst waren? – Die Reichenbachs – das ist für die Bankwelt genau so ein Begriff, wie für die katholische Welt der Papst. – Alles, was über hundert Jahre lang den Reichenbachs gehörte, gehört heute mir, ihr Einfluß, ihre Macht ist auf mich übergegangen. Wenn es mir gelingt, ihr Ansehen zu erringen, dann bin ich ihnen ähnlicher als allen Moreners, die je gelebt haben. Der Unterschied zwischen dem Heinrich Morener von vor zehn Jahren und dem von heute ist jetzt schon größer als zwischen einem Reichenbach und mir. Es gehört nur der Glaube und ein starker Wille dazu – und Morener und Reichenbach sind ein und derselbe Begriff.«
»Heinrich, ich bitte dich, rede dich nicht in diese krankhafte Vorstellung hinein!«
»Statt mir zu helfen, erschwerst du es mir.«
»Du hast alles erreicht, was du erreichen konntest. Sei damit zufrieden, statt nach Unmöglichem zu streben.«
»Für einen Willen wie meinen gibt es nichts, was nicht erreichbar wäre. Ist aus einem Bohlen-Hallbach nicht ein Krupp geworden? Warum soll aus einem sehr viel stärkeren Morener nicht ein Reichenbach werden?«
»Dann hättest du eine Reichenbach heiraten sollen. Mit der nächsten Generation hätte sich dann dein Wunsch erfüllt – daß Morener gleich Reichenbach wäre.«
»Es muß auch anders gehen.«
»Es geht nicht! Gib es auf! Du machst dich krank!«
»Ich zwinge es – und schrecke vor nichts zurück. – Laß mich nicht allein in diesem Kampf! Ich habe das Gefühl, als wenn du mir helfen könntest.«