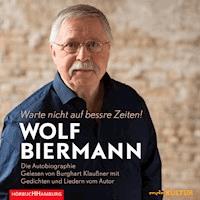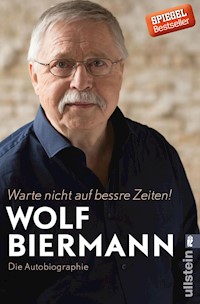16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolf Biermann erzählt von unerhörten Liebesgeschichten und außergewöhnlichen Menschen, deren Schicksale seinen Lebensweg gekreuzt und die ihn in besonderer Weise angerührt haben. Da ist Ruth Berlau, die tragische Geliebte Brechts, die sich von Biermann ihre übermächtige Feindin Helene Weigel nicht kleinreden lassen will. Und schon gar nicht klein singen! Da ist der galante Kohlen-Otto, der sich nie ohne Schnittblumen den Damen nähert – ein plebejischer Flaneur, der im VEB-Knast verblüht. Die beißwütige Barbara in Biermanns Lotterbett. Der Stricher, dessen Frau Monika ihm aus Eifersucht ein Messer in den Rücken rammt. Miriam Makeba, die Biermanns langen Kummerton im Liebeslied richtig deuten kann. Biermanns Sohn Manuel, der von einem Löwen geleckt wird. Der Mann, der sich für Rembrandt hält. Der Vater, der seinem Sohn den Rücken zudreht, damit er nicht die Finessen seines Gitarrenbaus ablernen kann. Oder der SS-Mann, der in Ostberlin fragt: Bin ick'n Mensch? Erstmals erzählt Biermann von der Hochzeit seiner Oma Meume, von Sexualaufklärung und warum seine Mutter ihn ein einziges Mal ohrfeigte. Und da ist Biermanns Geliebte Garance, die sich nach dem Bau der Mauer in den Fesseln der Stasi in Westberlin prostituiert und die ihm offenherzig versichert: "Dass du Jude bist, stört mich überhaupt nicht." Eindringlich, bewegend, komisch und liebevoll erzählt Wolf Biermann diese und andere Geschichten vom mächtigsten aller Gefühle, der Liebe, und von tapferen Menschen in bewegten Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
»Barbara« versammelt unerhörte Herzblatt-Novellen von außergewöhnlichen Charakteren, denen Wolf Biermann begegnet ist. In 18 oft hinreißend kuriosen, oft zärtlich-rabiaten Erzählungen führt uns der Poet seine Zeitgenossen vor Augen: berühmte wie unberühmte. Da ist Ruth Berlau, die tragische Geliebte Brechts, die sich ihre übermächtige Feindin Helene Weigel nicht kleinreden lassen will – und schon gar nicht kleinsingen! Biermann erzählt die wahre Geschichte von der »beißwütigen Barbara« und vom Mann, der sich für Rembrandt hält. Vom Ostberliner Stricher, dessen Frau Monika ihm das Brotmesser in den Rücken rammt, oder von seiner Liebesaffäre mit einer zerbrechlichen Geigen-Gitarre. Der nette alte SS-Mann in Ostberlin fragt: Bin ick’n Mensch? Und unvergesslich: Biermanns im doppelten Sinn schlagfertiger Freund Manfred Krug, der einen Volkspolizisten in den Wahnsinn treibt. Erstmals erzählt Wolf Biermann von proletarischer Sexualaufklärung und warum seine Mutter ihn ohrfeigte, ein einziges Mal. In seinem Ostberliner Lotterbett liegt die traumhafte Geliebte Garance, die sich an der langen Leine der Stasi in Westberlin prostituieren muss. In diesen und weiteren Storys zeichnet Wolf Biermann ein berührendes, vielfältiges Bildnis von der Liebe und von tapferen Menschen in bewegten Zeiten.
Der Autor
Der 1936 geborene Dichter und Liedermacher Wolf Biermann war die Stimme des Widerstands in der DDR. Seit seiner Ausbürgerung 1976 gibt er Konzerte in manchen Ländern der Welt. Aufsehen erregen auch seine tagespolitischen Essays. Für seine Werke wurde er vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Büchner-, dem Heine- und dem Hölderlin-Preis.
Wolf Biermann
Barbara
Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2016-8
© Wolf Biermann und Pamela Biermann© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinLektorat: Christian SeegerUmschlaggestaltung: Rudolf LinnVorderseite Gestaltung: Pamela Biermann(unter Verwendung eines Fotos der Ballettänzerin D. M.)Umschlagfoto: privatE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Widmung
Garance comme une fleur
Die Liebe ist eine Produktion
Der kleine Versager
Die sieben Finger von Ekkehard Schall
Bin ick ’n Mensch?
Monika. Das leuchtende Kind vom Hinterhof
Das Gedicht vom Fisch, der zerschnitten wird
»Dis is jarkeen Leben, dis is ploß Kunst!« – Oma Meume
Wo is mein Kohlen-Otto bloß jeblieben?
Raubtiere in der Manege
Das weiche Herz
Die Verhaftung der Schuldigen
Miriam Makeba
Seelengeld
Die beißwütige Barbara
Zwei Selbsthelfer
Wolf, die Ratte
Meine Geigen-Gitarre
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Garance comme une fleur
Nach dem Bau der Mauer, und noch lange vor meinem Verbot 1965 im Dezember, bot mir ein Bett im Krankenhaus eine willkommene Klausur. In der Charité, zwischen Luisenstraße und Mauer, entfloh ich den Vorhaltungen meiner einzigen Brigitte. Ich hatte sie mal wieder betrogen mit gleich zwei jungen Frauen, die es mir zudem komisch bequem machten, denn beide hießen Ingrid. Und ich genoss dabei den Kitzel einer politischen Eroberungsromantik: Der Rebell raubt seinen Widersachern, den übermächtigen Ober-Genossen, die Weiber. Es waren zwei bildhübsche Töchter der Nomenklatura.
Unhaltbar wurde diese wacklige Konstruktion aber, als die beiden Studentinnen sich eines schönen Tages gegen mich verbündeten. Gemeinsam suchten sie mich heim. Mir halfen keine charmanten Lügen mehr, keine Macho-Ausrederein. Kaltherzlich setzten sie mich auf’n Topp. Peinlich! Pein-lich! Pein, also Schmerz. Und schmerzlich, besonders für meine leidgeprüfte Brigitte.
Ich haderte mit meinem Katzenjammer, will sagen: ein selbstmitleidiger Katerjammer. Schluss mit all diesen Larifari-Liebeleien! Eine Ohrenentzündung hatte mich aus dem Verkehr gezogen. Im Krankenhaus besuchte mich Freund Robert. Dem Havemann klagte ich mein banales Leid. Und berühmte mich bei dieser günstigen Gelegenheit mit einer billigen Beknirschung. Ich beteuerte: »Nee, Robert. Von jetzt an nie wieder …« Genauso moral-schlitzohrig nahm der Freund mich in Schutz: »Jeder ist auf der Suche nach der idealen Frau seines Lebens!« Und er lachte: »Das kenn ich! Die Sehnsucht des Mannes nach Monogamie befällt ihn immer nur im schwachen Zustand, wenn er der liebevollen Pflege bedarf!«
Ich sollte noch zwei Wochen zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Zeit kroch dahin. Die Langeweile, mon dieu! Lahm und taub lag ich in strenger Betthaft und vertrieb mir die Ewigkeiten durch Lesen in Hölderlins Hyperion. Leere Blicke auf die rote Apfelsinensonne im Fenster nach Westen. Der kühle Herbst flammte in seinen warmen Friedhofsfarben, das tröstete mich nicht.
An einem dieser düsteren Tage aber ging mir die Sonne auf. Eine Krankenschwester erschien in meinem Zimmer. Sie wollte Blutdruck messen. Nur zu! Als ich die Neue sah, erzitterte mein Herz. Galant zog ich die große, butterbleiche Frau ins Gespräch. Zog sämtliche Register, die zum Repertoire eines ausgekochten Verführers gehören. Fragte sie im Frauenversteher-Ton nach ihrem Leben. Und auch das kommt immer gut: Ich machte paar Witzchen auf eigene Kosten.
Mein Katerjammer? – vergessen! Beknirschung? – passé! Diese schöne Helena stachelte all meine Lebensgeister. Ich gockelte, ich schnurrte und schmeichelte dumm rum wie ein gewiefter Weiber-Leiber-Zeitvertreiber. Und nannte mich einen Dichter. Einen Liedermacher. Sie kannte weder dieses sonderbare Wort noch irgendwas von irgendeinem Wolf Biermann.
Nach ihrem Namen fragte ich die Schöne nicht, weil den wusste ich sofort: Garance! Sie war es. Endlich! die Blume meines Lebens, Garance comme une fleur … Ironischerweise war es ausgerechnet ma chère Madame Brigitte gewesen, die ihren Hamburger Fischkopf Biermann vor paar Jahren nach Westberlin in ein kleines Kunst-Kino auf’n Ku’damm gezottelt hatte. Sie zeigte mir ihren Lieblingsfilm, »Les Enfants du Paradis«. Alles französisch. Und meine gelernte Pantomimin Brigitte übersetzte mir die hinreißenden Dialoge des Poeten Jacques Prévert. Die Hauptrolle des Pantomimen Baptiste im Theater der Seiltänzer spielte der geniale Jean-Louis Barrault, den scheuen Star des »Théâtre des Funambules« am Boulevard du Temple in Paris.
Ich erkannte in dem leuchtenden Madonnengesicht dieser Krankenschwester sofort die Schauspielerin Arletty. Ihre Rolle in diesem Jahrhundertfilm »Die Kinder des Olymp« ist die einer Bohème-Halbhure. Die Geschichte des Films spielt in genau den Jahren, als unser Heinrich Heine dort lebte, nicht etwa »wie Gott in Frankreich«, sondern göttlicher: »wie Heine in Paris«. Die Arletty spielt diese Rolle der Garance als ein bon vivant Ur-Weib. Und zugleich kuschelig, also chaud comme une caille! Seit ich diesen Film gesehn hatte, suchte ich – mag sein hinter dem eigenen Rücken – meine DDR-Garance.
Und nun stand sie vor mir. Trotz ihrer Krankenschwesterkluft sah ich genug. Ihre Haut schimmerte perlmuttern. Ihre Hände wie Mai-Schollen. Fett war diese Ostberliner Garance nicht, aber üppig. Das Fleisch! die Poesie! die Philosophie! Das Gesicht! Der beseelte Blick! Mich überflutete eine Begeisterung, die herrlich hysterisch war: Die Begierde hat gute Gründe, ist aber maßlos übertrieben. Im Krankenbett niedergestreckt, glotzte ich die Schöne romantisch an: nicht irgendeine Frau, die man verführen will, sondern die Frau!!
Ich weiß nicht, warum grad kleine Männer so scharf sind auf größere Menschinnen. Mit meinen gierigen Augen roch ich beides, ihre Lebenslust und zugleich eine wunderbar tiefe Melancholie. Ihr bittersüßer Kussmund holte mir das geschliffene Wort von Victor Hugo aus dem Gedächtnis hoch: »Melancholie ist das Vergnügen am Traurigsein.« Genau das suchte ich. Endlich, hier in der Hals-Nasen-Ohrenklinik der Charité, hatten die Götter des Olymp mir meine Garance zugespielt. Kein Traumbild, die Frau war aus Fleisch und Blut. Nur verkleidet als Krankenschwester. Ich hatte Glück: Sie fiel auf mich rein. Und mein extravaganter Kosename Garance gefiel ihr sogar.
Nebbich – ich wurde wieder kregel. Nach noch ein paar Tagen entließen mich die Ärzte. Und meine große bleiche Garance versprach mir, mich zu besuchen. Ein paar Lieder würde sie sich gerne mal anhören. Allein die Aussicht machte mir Hoffnung. Diese blonde Üppige wollte ich unbedingt verschlingen. Und als sie dann verlegen in der Tür stand – war im Grunde schon alles klar. Im Flur nahm ich ihr den Mantel ab, wir gingen ins Zimmer. Mit eleganter Drehung schwang sie ihr göttliches Hinterteil in den großen ledernen Ohrensessel und schmiegte ihren Lockenkopf an die Lehne. Sie lächelte sibyllinisch. Und kaum hatten wir die obligate Tasse schwarzen Tee mit Sahne und Kluntjes ausgetrunken, fielen wir übereinander her.
Und wie wunderbar sie auch im Dunkeln war! Ich entdeckte verblüfft etwas an ihr, was ich noch nie erlebt hatte. In meiner Venus wohnte tief innen ein Raubtierchen. Ein saftiger Schwellkörper vielleicht, nein, ein seltener Muskel musste das sein. Der schnappte nach meinem Will, zog ihn immer noch tiefer rein und massierte mein Zentralorgan im aufreizenden Rhythmus. Eine Fellatio naturalissimo! Es war das Paradies! Wir spielten das Spiel aller Spiele: Tier mit zwei Rücken. Making the beast with two backs – so flogen wir über die Dächer von Berlin-Mitte und hoch über die Mauer hin. Und landeten nach unserem rüden Ritt rücklings auf weichen Kissen. Ich klappte die Augendeckel hoch. Von der Häuserfront gegenüber schien eine Leuchtreklame durch das Fenster. Das Rot an der Wand über meinem Lotterbett. Darin schwamm meine Garance. Ich war selig.
Meine Frau im Nebenhaus – wir lebten wie verheiratet – merkte von meinem neuen Glück zum Glück nichts. So weit lief meine leichtsinnliche Fremdgeherei wieder mal bestens. Immer kam Garance zu mir, nie besuchte ich sie. Den Grund sollte ich bald wissen: Sie hatte einen kleinen Sohn, um den sich auch ihre Mutter kümmerte. Und nach ein paar Wochen beichtete Garance mir die unerhörte Geschichte einer Erpressung.
Ein Gynäkologe vom Krankenhaus Friedrichshain hatte sie geschwängert. Als das Kind geboren war, heiratete er sie nicht, sondern haute paar Monate später ab nach Westen. Kurz darauf wurde die junge Mutter »zur Klärung eines Sachverhalts« zum Magistrat bestellt. Ein Genosse ohne Gesicht, im typischen, im auffällig unauffälligen Anorak, holte sie ab. Er brachte sie zum Verhör in die Volkspolizei-Zentrale Keibelstraße. Ein kurzer Fußweg in die Unterwelt der Macht. Der Mann hinterm Schreibtisch spielte mit offenen Karten: »Ich bin Offizier des MfS. Wir sind hier bei den Genossen der Kriminalpolizei zu Gast, damit es für Sie etwas netter ist als bei uns im Ministerium für Staatssicherheit.«
Dann hielt er ihr eine kleine Rede: »Tja, Frau Schröder, Ihr Leben ist nicht einfach. Das Kind, die Arbeit in der Charité. Der Kindsvater, Herr Doktor Karl-Heinz Schweger, hat die DDR verraten. Er ist in den Westen abgehaun, obwohl er unserem Staat sein teures Studium verdankt. Republikflucht, das wissen Sie, ist in der Deutschen Demokratischen Republik bei Strafe verboten. Ihr sauberer Herr Doktor ist übergelaufen in das Land der Krupps und Thyssens und Schlotbarone, wo die faschistischen Revanchisten mit der NATO den nächsten Weltkrieg vorbereiten … Wir wissen, dass Herr Dr. Schweger sich inzwischen nach Dortmund abgesetzt hat. Da bemüht er sich im Hospital um eine Stelle in der Gynäkologie. Natürlich hat er seine Flucht mit Ihrer Hilfe vorbereitet. Und nun spekulieren Sie darauf, dass er Sie im Zuge der Familienzusammenführung nachholt. Aber daraus wird nichts! Beihilfe zur Republikflucht kostet in der Regel zwei Jahre Gefängnis. Oder ein paar Jahre mehr, je nach Schwere der persönlichen Schuld.«
Die junge Frau war geschockt. Sie beteuerte, dass der Vater des Kindes ihr im Vorfeld nichts von seinen Fluchtplänen erzählt habe. Sie wisse nicht, wie es ihm hatte gelingen können, abzuhaun. Und sie log mit der Lüge, der Arzt habe sie heiraten wollen. Da grinste der Offizier und schnarrte: »Wer’s glaubt, wird selig!« – Noch ein Tritt.
Doch die getretene Seele hielt sich tapfer. Garance weinte nicht. So eröffnete der Stasimann routiniert die nächste Runde in diesem perversen Schachspiel. Es war absurd, denn meine Garance spielte nicht taktisches Schach, sondern naives Mensch-ärgere-dich-nicht. Sie blieb bei der Wahrheit, einfach, weil es die Wahrheit war. Der Vater des Sohnes hatte ihr wirklich kein Wort gesagt. Wer weiß, wahrscheinlich hatte der Mann sie einfach nur schützen wollen, und auf jeden Fall sich selbst.
Der Verhörer ätzte: »Wenn Sie wirklich nichts gewusst haben, ist das ja wohl rein menschlich auch ein Verrat an Ihnen und Ihrem gemeinsamen Kind!« – »Ja, da haben Sie leider recht«, stammelte die Verlassene. Der Mielke-Mann trieb sein Rollenspiel weiter: »Schau’n Sie, wenn Sie so offen und ehrlich mit mir reden, will auch ich ehrlich und offen mit Ihnen sein. Unserem Staat steht das Wasser bis zum Hals. Das Gesundheitswesen ist in Gefahr. Sie als Krankenschwester haben einen gewissen Einblick. Die medizinische Versorgung, um die uns die Werktätigen in Westdeutschland beneiden, bricht zusammen, wenn immer mehr Ärzte sich von den kapitalistischen Kopfjägern abwerben lassen. Ihr Herr Doktor hat seine Patienten hier im Stich gelassen! Gegen den hippokratischen Eid! Aus reiner Gier!«
»Wir haben daran Interesse«, fuhr der Offizier fort, »die Fluchtwege und Organisationsstrukturen dieser kriminellen Fluchthelfer aufzudecken. Skrupellose Menschenhändler machen ein Geschäft daraus, immer neue Schlupflöcher im Antifaschistischen Schutzwall zu finden. Falsche Pässe, präparierte Personenwagen mit eingebauten Hohlräumen. Grenzdurchbrecher mit gepanzerten Lastkraftwagen, die das Leben ihrer eigenen Kinder aufs Spiel setzen. Wir haben etliche Schleusertunnel nach Westberlin aufgespürt. Jeder kennt doch solche Geschichten, man hört schließlich auch mal den RIAS, oder? All das gefährdet den Weltfrieden und schadet unserem Friedensstaat.« Garance nickte zögerlich.
»Diesen Feinden der DDR müssen und werden wir das Handwerk legen. Und wenn Ihr feiner Herr Doktor Schweger Sie mit dem Kind wirklich so schäbig sitzen gelassen hat, wie Sie jetzt behaupten, dann müssen Sie das auch beweisen. Wir geben Ihnen die Chance dazu. Das entspricht dem humanistischen Menschenbild unserer Partei.«
Er schob ihr ein Stück Papier zu. »Sie schreiben jetzt hier, an meinem Schreibtisch, handschriftlich einen hübschen Liebesbrief an den Herrn Doktor nach Dortmund: ›Mein geliebter Karl-Heinz … Ich liebe Dich immer noch … Du fehlst mir … Unser Kind braucht seinen Vater … Hole mich und unser Kind bitte so schnell wie möglich hier raus … Du wirst schon die richtigen Helfer finden und die Wege wissen. Und gib mir dann irgendwie Nachricht … Ich sehne mich nach Dir … Deine Dich liebende‹, na ja, und so weiter. Wie Sie das genau formulieren, ist uns egal, geht mich nichts an. Aber in diesem Sinne. Und dann schicken wir den Brief nach drüben. Seine Adresse haben wir, er wohnt noch zur Untermiete. Und alles Übrige erledigt sich dann von selbst. Wenn er Kontakt mit Ihnen aufnimmt, um die Flucht zu organisieren, sind wir am Ball und spielen von Anfang an mit.« Der Offizier in Zivil grinste zufrieden.
Wie betäubt schrieb Garance den Lockbrief. Der Offizier blieb höflich und geduldig. Er korrigierte paar Kleinigkeiten. Sie musste dann alles noch mal ordentlich abschreiben. Aber endlich klebte er das Kuvert zu, und sie war entlassen. Sie hetzte das Treppenhaus runter. Der Vopo im Glaskasten unten am Haupteingang drückte den Türsummer. Zehn Minuten später umarmte sie ihr Kind und erzählte unter Tränen alles der Mutter.
So weit – so schlecht. Immerhin hatte Garance sich die Adresse ihres Einstmals-Zukünftigen gemerkt. Traurig, aber wahr: Dieser Schuft hatte sich bei ihr wirklich nie gemeldet. Trotzdem schrieb sie ihm nun eine Postkarte: »Lieber Karl-Heinz, ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt noch lieben. Egal, wie es mit uns weitergeht, ich will nicht, dass Du in die Falle tappst. Die Schweine haben mich unter Druck gesetzt. Den Brief an Dich musste ich unter Aufsicht schreiben … Unser Paulchen ist süß, er kann bald laufen …«
Diese Karte warf sie natürlich nicht in irgendeinen Postkasten. Zwei Wochen später, zu Weihnachten, kam mit einem Tagesvisum die alte Elli aus Westberlin zu Besuch, Schwester der Mutter. Der Tante konnte Garance vertrauen. Die Alte schob sich die Post ins Unterhemd. So wurde die heikle Nachricht nach Westberlin geschmuggelt. Dort hatte Tante Elli die Karte ordentlich frankiert in den Kasten gesteckt. Es war gelungen, Karl-Heinz zu warnen. »Ich war unendlich erleichtert!«, erinnerte sich Garance.
Vier Wochen später jedoch wurde sie zu einem nächsten Verhör abgeholt. Diesmal in die Stasizentrale in der Magdalenenstraße. Der Offizier zischte: »Tja, das ist ja gar nicht nett, was Sie da gemacht haben!« Er legte eine Postkarte auf den Tisch. »Schau’n Sie mal hier, darf ich vorlesen …? ›Lieber Karl-Heinz, ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt noch lieben. Egal, wie es mit uns weitergeht, ich will nicht, dass Du in die Falle tappst …‹«
Die Karte lag vor ihr. In Westberlin eingesteckt von der Tante. Was niemand – schon gar nicht Garance – damals für möglich hielt: Die Staatssicherheit operierte in Westberlin so selbstverständlich wie im eigenen Vorgarten. Jedes Blumenbeet unter Kontrolle. Der Offizier sagte: »Ja, das sieht für Sie jetzt aber gar nicht gut aus, Frau Schröder, das wird teuer. Viel teurer als nur Beihilfe! Sie haben ja mit krimineller Energie versucht, die Strafverfolgung eines Verbrechers zu vereiteln, der die DDR verraten hat. Rein menschlich hab ich mich sehr getäuscht in Ihnen.«
Die junge Frau irre vor Angst. Wie kann das sein? Wie war die Staatssicherheit an diese Karte gekommen?, dachte Garance. Der Mielke-Offizier versprach ihr drei bis vier Jahre Knast. Nicht Republikflucht, sondern schlimmer: Agententätigkeit. Die Allmacht dieses Mannes lähmte Garance. Es gab keinen Ausweg. Nichts war mehr zu leugnen. Sie konnte sich nicht verstecken. Es war ihre Karte, ihre Schrift – es waren ihre eigenen Worte. Sie saß in der Falle.
Tja, und wieder konnte der Stasimann ihr einen Vorschlag zur Güte machen. Die Schönheit war ihre Chance. Sie sollte sich im Auftrag der Staatssicherheit in Westberlin um interessante Männer kümmern. Eine Art Betreuung im Zwischenmenschlichen. Politiker, Wirtschaftsbosse, Sportler, Künstler. Der Offizier lächelte: »Wir müssen uns wehren, liebe Frau Schröder! Und da wäre es uns eine gute Hilfe, wenn so eine schöne junge DDR-Bürgerin, attraktiv wie Sie, die intelligent ist und auch mal mit gebildeten Leuten reden kann, uns dabei unterstützt! Überlegen Sie es sich gut. Sie könnten sich jetzt erkenntlich zeigen! Sie helfen uns, mit einigen wichtigen Leuten in Kontakt zu kommen, und Sie liefern uns verwertbare Informationen.« Er lächelte: »Sie müssen ja nicht jedes Mal mit solchen Männern gleich …«
Garance unterbrach ihn schroff. Niemals werde sie solche Schmutzarbeit machen. Da schmeichelte der Offizier: »Sehen Sie, das gefällt mir an Ihnen … Ihre Ehrlichkeit. Aber leider kann ich Ihnen dann nicht mehr helfen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wir zwingen niemanden … Ich bin eben kein Schwein, wie Sie sich auf dieser Karte hier ausdrücken. Unter uns – ich persönlich halte solche Beleidigungen aus. Aber die Genossen Richter und der Staatsanwalt denken da bestimmt anders. Schweine … Tja, mit mir Schwein hätten Sie Schwein gehabt … Hahaha«, grunzte das Schwein, »aber dieses dumme Wort wird Sie wohl ein Jahr extra kosten. Da wäre so ’n netter Abend in Westberlin doch viel angenehmer …«
»Ich bin Krankenschwester«, sagte Garance, »keine Hure!« Der Stasi griff den Gedanken auf: »Eben. Im Kalten Krieg sollten Sie als Krankenschwester für die DDR ihren Dienst leisten.«
Garance geriet in Panik. »Schauen Sie«, flötete der Mann, »ich bin wirklich kein Schwein, wir können uns diese Menschlichkeit leisten. Ich gebe Ihnen drei Tage Zeit. Sie müssen mit den Männern in Westberlin nicht immer gleich ins Bett gehen. Ich bin ja auch kein Zuhälter. Die Staatssicherheit ist schließlich kein Bordell.« Er griente: »Im Gegenteil, ich würde sagen, ich bin eher ein Offenhälter. Hahaha! Ja, ein Offenhälter! Hahaha … Ich halte Ihnen die Tür noch offen!« Der Stasimann fand sich witzig. Er lachte sich in den fetten Hals. »Aber nu mal im Ernst«, redete er weiter, »Ihr Kind und Ihre Mutter sind ja bei uns in sicherer Obhut. Um Ihren kleinen Paul wird sich unser Staat kümmern. Kein Problem …, es wird sich eine Familie finden, die dafür Sorge trägt, dass der Junge nach den Prinzipien unserer sozialistischen Menschengemeinschaft erzogen wird.«
Garance verstand. Die junge Frau brauchte keine Bedenkzeit mehr. »Ich mach das«, sagte sie kalt. Der Mann grinste: »Wir vertrauen Ihnen, liebe Frau Schröder! Eine Mutter lässt ihr Kind nicht so leicht im Stich wie ein Mann eine Frau …«
Von solchen »Einsätzen im Operationsgebiet«, die Garance nun gezwungen war auszuführen, hatte ich schon läuten hören. Eine Meldung war grad eben durch die Westpresse gegangen. Auf internationalen Druck war der frühere Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, Heinz Brandt, ein ehemaliger Auschwitz-Häftling, nach drei Jahren aus der DDR-Haft in den Westen freigelassen worden. Der alte Kommunist war 1958 aus Ostberlin geflohen. Und 1961 in Westberlin in eine Falle gegangen. Ein Stasispitzel hatte ihm einen Whisky zugespielt, der mit einem Betäubungsmittel angereichert war. Als der Gekidnappte wieder zu sich kam, wachte er in einer Zelle in der Untersuchungshaftanstalt in Hohenschönhausen auf. Am Fußende seines Bettes stand Stasiminister Erich Mielke persönlich. Und spottete: »Tja, so sieht man sich wieder, Genosse Brandt.«
Mir dämmerte, in welch tragischer Konfliktsituation meine Flamme gefangen war. Um ihr Kind zu behalten, um selbst nicht im Knast zu landen, ging sie gelegentlich für die Stasi auf den Strich in Westberlin. Das Kind als Geisel im Osten. Sie poussierte mit Männern, die für das MfS von Interesse waren. Sie filterte konspirativ Informationen aus den Gesprächen. Die Erpresste verabredete sich mit ihren »Verehrern«, die natürlich nichts ahnten, zu einem Theaterbesuch, einem Abendessen. Sie trank ein Glas Wein und blieb nüchtern im Dienst. Sie tat, was sich daraus ergeben musste.
Was genau sie neben der Arbeit im Krankenhaus hatte machen müssen, danach fragte ich sie nicht. Ich wollte sie nicht beschämen. Was tun? Was lassen? Ich klagte: »Ach! ach! ach! meine Arme, meine Schöne, meine Liebe!«
Ich war über beide Ohren in sie verliebt. Stasi hin, Stasi her. Ich verdrängte meine Ängste. Ich hielt sie für meine Garance. Wofür sie mich hielt, weiß ich nicht. Vielleicht noch schlimmer als meine erotische Projektion, womöglich hielt sie mich für den Mann, mit dem sie von nun an ein neues Leben anfängt. Ich war vor allen Dingen eins: unglaublich scharf auf sie. Dass sie als Hure missbraucht wurde, tat mir nur leid und nur weh.
Garances Geständnis machte mich hilflos, gewiss. Ich versuchte sie zu trösten. Ihr Vertrauen berührte mich, ihre fatale Geschichte stachelte mich an. Jetzt erst recht, bildete ich mir ein, müsste ich ihr nicht nur beiliegen, sondern auch beistehn. Wir blieben ein heimliches Liebespaar. Sie besuchte mich in regelmäßigen Abständen, meine »liaison dangereuse« blühte im Verborgenen »comme une fleur«. Allerdings eine Fleur du Mal. Die Blume des Charles Baudelaire blühte mir im Schatten der Westsonne hinter dem Eisernen Vorhang zwischen Ost- und Westberlin.
Eines Abends kam Garance mal wieder nach ihrem Dienst in der Charité bei mir vorbei. Die Klamotten waren schnell abgestreift. Wir trieben die vertraute Sache. Und es lief so aufregend gut wie immer. Sie war so weich, so bleich und so stark. Und ich war so stark, so wild und schön hart. Ich vergrub meinen Kopf in ihre drallen Schenkel. Ihre Beine umschlangen mich. Ich hielt ihren bebenden Hintern. Diese Frau war einfach der saftigste Pfirsich, den ich je gepflückt hatte. Sie juchzte, und ich stöhnte. Ich zappelte als Fisch in ihrer Reuse. Sie küsste mich. Und flüsterte mir heiß ins Ohr: »Weißt du, und dass du ein Jude bist … mich stört das nicht!«
Und weil ich so wahnsinnlich klug bin, begriff ich sofort, dass meine Garance das überhaupt nicht schlecht meinte. Im Gegenteil! Sie meinte es gut, mir zugewandt. Eigentlich, hämmerte es mir durch den Kopf, will meine Schöne mir damit nur sagen, wie umwerfend sie mich findet! Und was für ein toller Liebhaber! So scharf, wie auch ich sie finde!
Natürlich hatte ich gemerkt, dass diese paar Worte ein bisschen blöde waren. Ziemlich dumm sogar. Himmelschreiend dämlich, genau genommen. Aber nein, ich wollte nicht darüber nachdenken noch rechten. Ich wollte mit meiner Paradiesblume weiter diese himmlische Sache treiben. Aufgeheizt, wie ich war, verteidigte mein Kopf die üppige Geliebte. Um nichts in der Welt wollte ich mir diese göttliche Liebschaft verderben lassen! Also: Weg mit diesem Satz! Vergessen! Jude … Jude … – was geht’s mich an?
Jedoch, ich hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mein Kopf wollte verdrängen. Mein Schwanz nicht. Er machte schlapp. Er spielte einfach nicht mehr mit. Er war beleidigt. Eingeschnappt. Mein dummer Schwanz hatte plötzlich einen schärferen Verstand als mein verliebter Kopf. Und das erwies sich als das Ende meiner seligen Illusion Garance.
Was konnte ich tun? Ich hörte auf mein kluges Freundchen. Ich zog mich an und ließ Garance halb angekocht liegen. Sprang zwei Treppen runter auf die Chausseestraße. Und eine Treppe im Nebenhaus wieder hoch. Ich legte mich ins Bett meiner liebsten Brigitte. Die schlief schon. Kein Palaver. Sie schlief schnell weiter. Und ich schlief ein.
Als ich am nächsten Morgen wieder rüber in meine Bude kam, war das Bett gemacht. Und die große schöne Frau, die bleiche Garance, sah ich nie wieder.
Die Liebe ist eine Produktion
SHAKESPEARE, SONETT 66
Müd müd von all dem schrei ich nach dem Schlaf im Tod
Weil ich ja seh: Verdienst geht betteln hier im Staat
Seh Nichtigkeit getrimmt auf Frohsinn in der Not
Und reinster Glaube landet elend im Verrat
Und Ehre ist ein goldnes Wort, das nichts mehr gilt
Und einer Jungfrau Tugend wird verkauft wie’n Schwein
Und weil Vollkommenheit man einen Krüppel schilt
Und weil die Kraft dahinkriecht auf dem Humpelbein
Gelehrte Narrn bestimmen, was als Weisheit gilt
Und Kunst seh ich geknebelt von der Obrigkeit
Und simple Wahrheit, die man simpel Einfalt schilt
Und Güte, die in Ketten unterm Stiefel schreit
Von all dem müde, wär ich lieber tot, ließ ich
In dieser Welt dabei mein Liebchen nicht im Stich
(Nachdichtung Wolf Biermann)
Auch in den schlimmsten Weltuntergängen der Hitler-Stalin-Epoche, in den Fährnissen auf der Flucht vor den Faschisten, haben die Freunde Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht und Hanns Eisler sich natürlich über die Gräuel des Krieges ausgetauscht, aber daneben, das berichtete mir Eisler, auch immer über die Feinheiten der Kommasetzung bei Shakespeare. Für seinen erschütternden Roman »Exil« hatte Lion Feuchtwanger Shakespeares 66. Sonett ins Deutsche übertragen. Diese Feuchtwanger’sche Fassung ist es, die Eisler am 3. November 1939 in New York komponierte.
Es gibt kein Shakespeare-Sonett, das so stark und außerdem so berühmt ist und seit Jahrhunderten, so oft wie kein anderes, ins Deutsche übersetzt wurde. Feuchtwangers Version ist halb abgeschrieben von dem Versuch des Stefan George. Das ist schade, aber viel schlimmer als die stefangeorgelte Übersetzung ist dies: Die letzten beiden Zeilen des Originals – sie fehlen! Feuchtwanger hat sie einfach weggestrichen. Verwirrend, dass auch der Komponist Hanns Eisler das Sonett dermaßen kastriert übernommen hat.
Denn der tiefsinnige Witz dieser zwölfmaligen politischen Weltklage – die Welt ist schlecht, die Welt ist brutal, die Menschheit ist verdorben – ist in diesem Sonett ja einzig der Bruch nach der zwölften Zeile in das Allerprivateste:
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that to die, I leave my love alone
Die ganze große Klage kulminiert in eine ergreifende Liebeserklärung: Ich halte die grauenhafte Welt nur aus, weil ich diesen einen Menschen liebe. Allein die Liebe ist der Grund, warum ich mich aus diesem Jammertal nicht davonmache in den Tod.
Den zum Marxismus konvertierten bürgerlichen Intellektuellen Eisler und Feuchtwanger passte diese Haltung offenbar nicht, weder in den Katechismus ihrer neuen kommunistischen Religion noch in ihre neue Moral, noch in die neu eroberte Denkschablone. Die Flucht ins Private galt den bildungsbürgerlichen Kopfkommunisten, mit oder ohne Parteibuch, als ein feiges Desertieren im Freiheitskrieg der Menschheit. Nicht »spießbürgerlich« eine bestimmte Frau, kein noch so heiß begehrter Mann, kein herzliebstes Kind – es musste im radikalen Marxismus der Glaube an den Fortschritt der Menschheit sein, die Treue zur Arbeiterklasse, die Parteidisziplin, das Ethos der Weltrevolution oder sonst etwas Hochpolitisches, was den Sinn fürs Weiterleben liefert. Das Credo hieß: Die Liebe, teure Genossen, lieben auch wir! Aber doch immer mehr die Liebe zur Menschheit als zu einem einzelnen Menschenexemplar.
Insofern war es logisch, dem Shakespeare den subjektivistischen Plot abzuschneiden. Dumm nur: Die Streichung der letzten beiden Zeilen macht den Geist geistlos. Die Amputation lässt den Text zu einem langweilig monotonen Klagegesang verkümmern. In der Hegel’schen Logik heißt das: die schlechte Unendlichkeit. Die radikale Streichung dokumentiert den totalitären Zeitgeist, der selbst unter den brillantesten Linken wütete, in den Köpfen von Brecht und seinen Gefährten, zu denen auch Ruth Berlau gehörte.
Ich weiß nicht, wer heute noch und überhaupt etwas über die Lebensgeschichte der Ruth Berlau kennt oder hören will. Der Brecht-Archivar Hans Bunge hat ein schönes Buch über sie verfasst: »Brechts Lai-Tu«.
Berlau, 1906 in Kopenhagen geboren, war Schauspielerin am Königlichen Theater und eine unternehmungslustige und lebenshungrige Schönheit. 1930 fuhr die wunderbar Neugierige mit dem Fahrrad! von Kopenhagen nach Moskau zu einem internationalen Theatertreffen. Der Aufenthalt in der Metropole der Weltrevolution erwies sich als Wendepunkt ihres Lebens. Direkt nach ihrer Rückkehr trat sie der Kommunistischen Partei bei. Sie gründete das erste Arbeitertheater Dänemarks.
Die taffe junge Frau wollte unbedingt den Dichter Bertolt Brecht kennenlernen, vor allen Dingen dessen Erfindung, das epische Theater, interessierte sie. 1933 traf sie den Dramatiker und seine Frau Helene Weigel im Hause der Schriftstellerin Karin Michaelis auf der dänischen Insel Thurø. Hier hatte das Paar auf der Flucht vor Deutschlands Nationalsozialisten Unterschlupf gefunden. Auch Margarete Steffin, Brechts Mitarbeiterin und Geliebte, war nach Dänemark emigriert.
Das Interesse am revolutionären Theater verband den Dichter und die junge, vielseitig begabte Berlau. Im Laufe der kommenden Jahre sollte Ruth, neben Steffin, zu seiner wichtigsten Mitarbeiterin werden. Und damit auch seine Geliebte. Brecht schrieb für seine »Lai-Tu« zahlreiche Geschichten. Und sie ließ sich in Kopenhagen von ihrem Mann scheiden.
Als 1939 Brecht, Helene Weigel und Margarete Steffin zunächst nach Schweden, ein Jahr später nach Finnland flohen, schrieb Brecht: »Von jetzt ab warte ich auf dich, wohin immer ich komme, und ich rechne immer mit dir. Und ich rechne nicht wegen dir auf dein Kommen, sondern wegen mir, Ruth.« Im Sommer 1940 war es so weit. Berlau verließ ihr Theater, ihre Existenz und ihre Heimat, um neben Margarete Steffin als Brechts Geliebte Nummer zwei weiter an seinen Theaterstücken mitzuarbeiten.
Wie der Dichter und seine Frau Helene Weigel, die Kinder Stefan und Barbara und die beiden Zuarbeiterinnen Steffin und Berlau in dem strohgedeckten Landhaus der Dramatikerin Helle Wuoijoki in Marlebäck zwischen den finnischen Birken miteinander auskamen, kann ich nur dunkel erahnen. Brechts Haltung zur Liebe war, wie er als Neu-Kommunist einmal murxistisch postulierte, nüchtern: Liebe ist eine »Produktion«, und sein Verhältnis zu ihr von der »dritten Sache« geprägt. Der Klassenkampf. Die kommunistische Weltrevolution.
Als die deutschen Nationalsozialisten drohten, auch Finnland einzunehmen, floh die kleine Brecht-Compagnie 1941 über Leningrad nach Moskau. Dort verabschiedete Brecht sich von der an TBC erkrankten, todgeweihten Margarete Steffin. Ausgerechnet den Kommunisten Brecht zog es in das Land des Klassenfeindes, in die USA. Ahnte er, dass die »Brecht’sche Großfamilie« in der Sowjetunion Gefahr lief, im Gulag zu landen? Acht von zehn kommunistischen Exilanten, die sich vor Nazi-Deutschland nach Russland geflüchtet hatten, wurden in den brutalen dreißiger Jahren verhaftet und in Schauprozessen von Stalins Lemuren gefoltert, verurteilt und liquidiert.
Seine treue Ruth folgte Brecht und Helene Weigel bis nach Los Angeles, ging dann aber nach New York. Sie ergatterte eine gut bezahlte Festanstellung als Rundfunkjournalistin im »Office of War«. Die Beziehung zu Brecht war geprägt von ihrem brennenden Wunsch, Unabhängigkeit zu leben – was ihrem Meister missfiel –, aber auch vom leidenschaftlichen Interesse an der Arbeit mit dem Dramatiker an seinen Stoffen. Das Leben im Exil war hart. Das größere Elend aber war: Als sie schwanger wurde, verlor sie das gemeinsame Kind. Der kleine Michel kam viel zu früh auf die Welt. Ruth Berlau zerriss der Verlust, sie erlitt einen Nervenzusammenbruch. Selbstmordgefährdet blieb sie längere Zeit in einer geschlossenen Nervenheilanstalt.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.