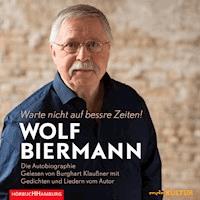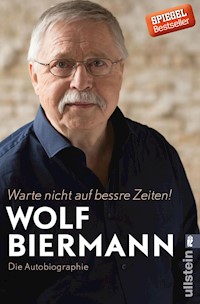
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Selten sind persönliches Schicksal und deutsche Geschichte so eng verwoben wie bei Wolf Biermann. Ein Leben zwischen West und Ost, ein Widerspruchsgeist zwischen allen Fronten. Mit sechzehn ging er in die DDR, die er für das bessere Deutschland hielt. Hanns Eisler ermutigte ihn, Lieder zu schreiben, bei Helene Weigel assistierte er am Berliner Ensemble. Dann fiel er in Ungnade, erhielt Auftritts- und Publikationsverbot. Die Stasi observierte ihn rund um die Uhr, während er im Westen gefeiert und geehrt wurde. Die Proteste gegen seine Ausbürgerung 1976 gelten als Anfang vom Ende der DDR. Eindringlich erzählt Biermann vom Vater, der als Jude und Kommunist in Auschwitz ermordet wurde, von der Mutter, die ihn aus dem Hamburger Bombeninferno rettete, vom väterlichen Freund Robert Havemann, mit dem er das Los des Geächteten teilte. Er führt uns in die absurde Welt der DDR-Diktatur mit ihren Auswüchsen, aber auch ihren täglichen Dramen menschlicher Widerständigkeit. Und er erzählt von seinen in den Westen geschmuggelten, im Osten heimlich kursierenden Liedern, deren »Verskunst, robuste Rhetorik und gewaltige Sprachkraft« Marcel Reich-Ranicki lobte. Bei aller Heftigkeit des Erlebten lesen sich Biermanns Erinnerungen wie ein Schelmenroman in bester schweijkscher Manier. Ein einzigartiges Zeitzeugnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Mit sechzehn ging er in die DDR, weil er sie für das bessere Deutschland hielt. Hanns Eisler ermutigte ihn, Lieder zu schreiben, bei Helene Weigel assistierte er am Berliner Ensemble. Dann fiel er bei den Parteibonzen in Ungnade, erhielt Auftritts- und Publikationsverbot. Die Stasi observierte ihn rund um die Uhr, während er im Westen geehrt wurde. Die Proteste gegen seine Ausbürgerung 1976 gelten als Anfang vom Ende der DDR.
Mit der ihm eigenen Sprachkraft erzählt Wolf Biermann vom Vater, der als Kommunist eingekerkert und als Jude in Auschwitz ermordet wurde. Von der Mutter, die ihn 1943 aus dem Hamburger Bombeninferno rettete. Vom väterlichen Freund Robert Havemann, mit dem er in der DDR das Los des Geächteten teilte. Er führt uns in die absurde Welt der rotgetünchten Diktatur, erzählt von den alltäglichen düsteren Dramen und von den Sternstunden des Widerstands. Und er berichtet von seinen in den Westen geschmuggelten, im Osten heimlich kursierenden Liedern und Gedichten, deren »Verskunst und robuste Rhetorik« Marcel Reich-Ranicki feierte.
Bei aller Heftigkeit des Erlebten lesen sich Biermanns Erinnerungen mitunter wie ein großer Schelmenroman. Zugleich sind sie eine authentische Lebenserzählung über den schicksalsschweren kommunistischen Jahrhunderttraum, der sich als Illusion erwies.
Der Autor
Wolf Biermann, Dichter und Liedermacher, wurde 1936 in Hamburg geboren. Er war die Stimme des Widerstands in der DDR und wurde 1976 ausgebürgert. Seitdem gibt er Konzerte in manchen Ländern. Für seine Dichtung wurde er vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Georg-Büchner-, dem Heinrich-Heine- und dem Hölderlin-Preis.
www.wolf-biermann.de
Wolf Biermann
Warte nicht auf bessre Zeiten!
Die Autobiographie
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1425-9
© 2016 Wolf Biermann und Pamela Biermann © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld Titel-, Autorenbild: © Hans Scherhaufer
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Weggerissen wurde der Vater mir, als ich vier Monate alt war. Diesen Schmerz soff ich am Busen meiner Mutter bei der Gestapo in Hamburg, in der Untersuchungshaftanstalt nahe Planten un Blomen, wohin Emma Biermann zu Verhören einbestellt wurde. Den gleichen Kummer schlürfte ich mit der Kunsthonigmilch in meinem Zimmerchen im Häwelmann-Bett über dem Gustavkanal, wenn unten im Fleet der kleine Schlepper mit eingeknicktem Schornstein die Schuten unter die Brücke Schwabenstraße in Richtung zum Mittelkanal zog. Diese heillose Wunde blieb lebenslänglich offen, denn ich kann diesem frühen Tod nicht entfliehen. Der Kummer um den Kommunisten, den Arbeiter, den Juden Biermann ist meine Schicksalsmacht, mein guter Geist, mein böser. Er ist das Gesetz, nach dem ich angetreten bin. So muss ich sein, so bleibe ich. Marx hin, Marx her – ich konnte auf meinem langen Weg an keiner Wegscheide je diesem Fatum entfliehen. Mein Kummer blieb lebendig und machte Metamorphosen durch. Er stumpfte nicht. Er hat sich bis heute immer wieder erneuert, hat sich gewandelt, zusammen mit mir, im Umbruch der Zeiten. Durch ihn bin ich ein frecher Zweifler geworden, dann ein frommer Ketzer, ein tapferer Renegat des Kommunismus. Ein todtrauriges Glückskind in Deutschland, ein greises Weltenkind. Dieser eingeborene Kummer um den Vater war mein Luftholen seit 1937, war mein asthmatisches Japsen seit den Bombennächten in Hammerbrook 1943. Dieser eine Grundkummer ist mein Schreien, mein Quasseln, mein Stottern, all mein Singen, mein Mut, mein Übermut, mein Gelächter, mein Schweigen. Dieser polit-genetisch gezeugte Kummer wurde all mein vegetativer Hass, aber auch meine angelernte Lust am Leben. Der Kummer um meinen Vater blieb meine verwüstbare Hoffnung, meine bedrohte Liebe.
Die Wahrheit mit der Muttermilch
Familie und kommunistischer Widerstand
Karl-Wolf. So steht es geschrieben in meiner Geburtsurkunde. Nicht Wolf, sondern Karl-Wolf Biermann. Im vierten Jahr des Tausendjährigen Reiches, am 15. November 1936, wurde ich in Hamburg geboren, genau fünf Minuten nach zwölf. Ich war – auf den Tag genau – ein Achtmonatskind. Meine Mutter flüsterte die Standardfrage. Die Hebamme des Sankt-Georg-Krankenhauses durchschnitt die Nabelschnur und knurrte: »… is ’n Junge.« Emma gluckste vor Glück. Ausgerechnet die Arbeiterin Emma Biermann tirilierte das blöde Liedchen »Ja, wir haben einen Sohn, einen Erben für den Thron …« Die Hebamme war womöglich genervt. Sie sagte mit spitzer Zunge: »Der hat ja ’ne kleine Judennase!« War das nun die Diagnose einer erfahrenen Geburtshelferin? Oder der blinde Affekt einer missgelaunten Nazi-Hippe?
Am Abend dieses Sonntags, direkt nach seiner Sonderschicht auf der Deutschen Werft, kam mein Vater in Arbeitskluft zur Klinik. Dagobert hatte Augen nur für seine Emma. Vom Balg nahm er freundlich Notiz. Ja, er war glücklich mit ihr, war verliebt in seine Frau. Und: Er war ihr dankbar. »Du bist nicht nur mein Lieb, sondern der beste Kamerad, den ich je hatte«, schrieb er später in einem Brief aus dem Gefängnis.
Dagobert Biermann hatte Schlosser und Maschinenbauer erlernt. Aufgewachsen war er im »Lazarus-Gumpel-Stift zur Unterstützung bedürftiger Juden« in der Schlachterstraße 46, nahe dem Hamburger Michel, in einer Hinterhofwohnung, in die nie ein Sonnenstrahl fiel. Eine meiner ersten Erinnerungen: drei Treppenstufen hoch am Geländer. Gleich vorne die düstere Wohnstube. Großvater schlief auf dem Sofa, mit einem Hut auf’m Gesicht. John Biermann, meines Vaters Vater, war ambulanter Elektrikermeister mit nur einem Angestellten: er selber. Seine ganze »Firma« bestand aus einem wohlgeordneten Holzkasten fürs Handwerkszeug, dazu eine Stehleiter, ein paar Kabelrollen und eine schwere Kiste voll mit elektrischem Kleinkram. Großvater ging in die Häuser und reparierte den Leuten die Leitungen. Meines Vaters Bruder Karl war zwei Jahre jünger und wurde auch Elektriker. Die hübsche Schwester Rosa, die Hutmacherin, war ganze zwölf Jahre jünger. Weil Großmutter Louise aus einer orthodoxen Familie Löwenthal kam, schickte sie ihre Kinder auf die Talmud-Tora-Realschule, gleich neben der Synagoge am Grindel.
Gewiss Hebräisch, ja, Tora, ja, Talmud. Aber dann ging Dagobert mit vierzehn Jahren in die Lehre auf der Werft Blohm & Voss. Noch lieber als Jude sein wollte er Mensch werden. Er trat der Metallarbeitergewerkschaft bei. Seine Religion war fortan der Kommunismus. Und weil er nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut reden konnte, wählten die Lehrlinge ihn zu ihrem Sprecher. Durch sein unerschrockenes Auftreten zog er den scharfen Blick der Werftleitung auf sich. Nach vierjähriger Lehrzeit kriegte er, trotz allerbester Prüfungen, mit dem Gesellenbrief zugleich die Entlassungspapiere. Er landete außerdem auf der »schwarzen Liste«. Und das bedeutete für viele Jahre, auch nach der tiefen Werftenkrise, Arbeitslosigkeit.
Dagobert traf Emma Dietrich im Jugendverband der KPD, der »Kommunistischen Jugend Deutschlands« (KJD). Sie bewunderten einander. Er ihre Schroffheit, sie seine Geduld. Emmas Realschullehrerin hatte die Eltern besucht und gesagt: »Die kleine Emma sollte weiterlernen. Sie könnte Lehrerin werden.« Aber der alte Dietrich knurrte: »Wir können uns keine Gräfin erlauben.«
1919 begann das Mädchen eine Lehre als Maschinenstrickerin. Nach zweijähriger Ausbildung arbeitete sie im Akkord und verdiente gutes Geld. Dann strickte sie elegante Modekleider auf Sylt. Aber 1924 kam es für sie noch besser: Sie wurde von der Hamburger Blindenanstalt eingestellt. Dort baute sie in eigener Verantwortung eine neue Blindenwerkstatt für Maschinenstrickerei auf. Und das war ihre Idee: Die Arbeitsgänge wurden, im Sinne einer Manufaktur, so unterteilt und die Maschinen so eingerichtet, dass die Blinden und Halbblinden nach ihren Möglichkeiten in ausgetüftelter Zusammenarbeit etwas wirklich Brauchbares produzieren konnten. Emma liebte diese Arbeit und war stolz.
Das Liebespaar heiratete 1927. Beide waren inzwischen in die KPD eingetreten und standen aktiv in der Arbeiterbewegung. Emma und ihre jüngeren Geschwister Lotte und Karl, genannt Kalli, und ihr Dagobert verstanden sich bestens, sie waren ja beides: Familienbande und Genossen. Auch Emmas Eltern, Karl Dietrich und Martha.
Die Dietrichs waren aus Sachsen über Kiel nach Hamburg gezogen. In der Schmiedelehre in Halle an der Saale hatte Emmas Vater durch einen glühenden Eisenspan ein Auge verloren, so dass er beim Hämmern nicht mehr den Abstand in der dritten Dimension sehen konnte. Er arbeitete fortan als Steineträger auf Baustellen. Immer fünfundzwanzig Ziegelsteine mit dem Schulterbrett die Bauleitern hoch. So trug er sich krank und krumm. Der Sachse wurde in Hamburg ein führender Kader des Rotfrontkämpferbundes der KPD, und Ernst Thälmann war sein vertrauter Genosse. Karl galt als der beste Schütze unter den Mitgliedern des RFB. Immerhin, so spotteten die Genossen, musste er sein Glasauge beim Zielen nicht zukneifen. Das war vielleicht sein einziges Privileg im Leben: Er gewann jedes Jahr den ersten Preis, einen ganzen Schinken, beim fröhlichen Wettschießen für den Sieg der Weltrevolution.
An den Wochenenden fuhren die jungen Kommunisten mit der Vorortbahn in die Lüneburger Heide. Sie waren begeistert von der Wandervogelbewegung. Der neueste Schrei: FKK – Freikörperkultur. Emma übte sich im Ausdruckstanz à la Mary Wigman. Sie sangen gemeinsam »Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all« oder das von Rosa Luxemburg aus dem Polnischen übersetzte Lied: »Des Volkes Blut verströmt in Bächen, / Und bitt’re Tränen rinnen drein. / Doch kommt der Tag, da wir uns rächen, / Dann werden wir die Richter sein …« Na ja. Und die Kitschlieder von Hermann Löns: »Ja grün ist die Heide / Die Heide ist grüüüüün …« Der Maschinenschlosser »Dago« zupfte dazu die Gitarre, die Maschinenstrickerin »Emsch« die Waldzither.
Die Nationalsozialisten griffen zu Beginn der dreißiger Jahre nach der Macht. Als die SA, der Rotfrontkämpferbund und die Kampfgruppe »Eiserne Front« sich gegenseitig verprügelten und die Vereinslokale demolierten, machte Dagobert sich einen Namen, weil er es schaffte, mit jungen, bürgerlichen Nazis immerhin unblutige Streitgespräche zu führen, statt immer nur »Eins-in-die-Fresse-mein-Herzblatt!«. 1932 wurde mein Vater von den Thälmann-Anhängern als »Abweichler« gebrandmarkt. Er war der Meinung, die KPD sollte verbündet mit der SPD gegen die Nazis kämpfen. Sein Schwiegervater Karl Dietrich wütete gegen den Abweichler. Als Dago und seine Emsch an der Wohnungstür klingelten, riss der Alte die Tür auf, schwang ein Beil überm Kopf und brüllte einen Satz, der von da ab zur geflügelten Phrase unserer Familiengeschichte gehörte: »Ich! dulde! in meinem Hause!! keine konterrevolutionäre!!! Brut!!!« Die Frauen kreischten und schimpften. Sie rissen dem Berserker mit vereinten Kräften das Beil aus den Händen. An diesen acht Wutworten war wirklich alles falsch. Von wegen »Ich dulde nicht …«. Der Alte musste es dulden, denn schon gleich danach saßen sie wieder zusammen bei Kaffee und Bienenstich am Küchentisch. Auch war sein Schwiegersohn keine »konterrevolutionäre Brut«. Und dann noch das große Wort »in meinem Hause!«. Dieser herzkranke Steineträger Karl Dietrich war froh, wenn er die Miete zahlen konnte.
Er hatte Glück, er starb an seinem schweren Herzfehler schon 1932. Als die Überfallkommandos der NSDAP nach Hitlers Machtergreifung 1933 mehrmals an Oma Meumes Wohnungstür standen, um den Alten zu verhaften, rannte Oma Meume ins Schlafzimmer und zerrte wütend die vertrockneten Kränze von seiner Beerdigung unterm Ehebett hervor. Sie zeigte auf die zerknitterten Kranzschleifen und schrie auf Sächsisch: »Der is doooot! Den gönnd ihr nich mehr dotschlagn!«
Anders als die Sozialdemokraten war die KPD sofort verboten worden, und damit auch ihr Parteiblatt, die Hamburger Volkszeitung. Die Genossen arbeiteten illegal weiter. Meine Eltern und Emmas Bruder Kalli waren in der Parteigruppe St. Georg organisiert. Doch bereits am 8. Mai 1933 wurde mein Vater verhaftet. Die Polizei ertappte ihn auf frischer Tat. Im Atelier des Kunstmalers Arnold Fiedler vervielfältigte er mit einer primitiven Druckmaschine die Notausgabe des verbotenen Parteiblattes, die illegal verteilt werden sollte. Weil die eigentlichen Redakteure schon seit März als »Schutzgefangene« im KZ Fuhlsbüttel saßen, hatte Dagobert auch den Leitartikel verfasst. Darin berichtete er über den unmittelbar anstehenden Prozess zum Altonaer Blutsonntag. Ein knappes Jahr zuvor, am 17. Juli 1932, war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der SA und den Kommunisten gekommen. Achtzehn Menschen waren erschossen worden. Kaum an der Macht, stellten die Nationalsozialisten den Klempner Bruno Tesch, den Packer Walter Möller, den Schuhmacher Karl Wolff und den Seemann August Lütgens als Schuldige vor ein schnell eingerichtetes Sondergericht. Alle vier wurden ohne Beweise zum Tode verurteilt, das Urteil wurde am 1. August 1933 vollstreckt. Da saß mein Vater schon in Haft. Zwei von den Angeklagten waren erst neunzehn Jahre alt, nach damaligem Gesetz noch nicht volljährig.
Eine unerhörte Begebenheit bei der Hinrichtung hatte sich rasch herumgesprochen. Der beamtete Henker der Hansestadt stand grade nicht zur Verfügung. Ein junger Schlachtermeister aus Wandsbek war eingesprungen, ein Mitglied der NSDAP. Die Exekution fand auf dem Hinterhof des Gerichtsgebäudes in Altona statt. Einer nach dem anderen wurde von dem Ersatzhenker mit dem Handbeil geköpft. Als zuletzt dem Schuhmacher Karl Wolff befohlen wurde, seinen Kopf auf den Hackblock zu legen, bat er um eine letzte Gunst. Sie wurde ihm gewährt, wer weiß, vielleicht von einem Hanseaten, der sich erinnerte, dass auch dem berühmten Seeräuber Störtebeker ein letzter Wunsch erfüllt worden war.
Der junge Schuster aus Altona bat darum, ihm die Fesseln auf dem Rücken zu lösen. Er wolle, sagte er, sich nur noch einmal im Leben richtig ausrecken können. Doch kaum war die erste Hand befreit, schlug er dem nächsten Beamten die Handschellen in die Zähne. Diese letzte Rebellion im ewigen Freiheitskrieg der Menschheit verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Kundschaft im Stadtteil Wandsbek blieb dem Schlachter, nachdem er seinen Parteigenossen den Schlächter gemacht hatte, weg. Die meisten Kunden hatten nichts gegen die Nazijustiz. Aber sie ekelten sich bei dem Gedanken, dass Menschenblut an den Händen oder an den Werkzeugen des Hilfshenkers klebt und bei ihnen mit dem Schweinebraten auf den Tisch kommt.
Mein Vater wurde am 14. August 1933 zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Er hatte gelogen, alle Artikel der illegalen Ausgabe seien von ihm verfasst. Dadurch konnte er seine zwei Mittäter entlasten. Seine Frau wurde am Tage der Veröffentlichung des Urteils fristlos entlassen. Alle Bewerbungen um eine neue Arbeitsstelle wurden abgelehnt. Nach Monaten vermittelte ihr das Arbeitsamt eine primitive Hilfsarbeit in einer Fabrik.
Bald darauf brachte Emmas Bruder Kalli einen Genossen mit. Es war der ältere Bruder von Karl Wolff. Arbeiter auch er, Kommunist im Rotfrontkämpferbund und, wie die meisten Genossen, auf der Flucht vor den Nazis. Emma sollte diesem Hans Wolff zwei, drei Tage Unterschlupf geben, bis die Fluchtwege im Hamburger Hafen frei waren, um nach Dänemark zu entkommen. Sie versteckte den Wolff-Bruder. Am Tag des Aufbruchs wickelte sie drei Wurstbrote in einen Bogen legales Zeitungspapier und sprach ein großes Wort gelassen aus: »Genosse! Wenn mein Mann in eineinhalb Jahren wieder aus dem Knast kommt … und wenn ich dann schwanger werde … und wenn es ein Sohn wird …, dann nennen wir ihn nach deinem Bruder. Und so machen wir uns einen neuen Karl Wolff!«
Der Bruder des Geköpften rettete sich nach Dänemark, er verschwand auf Nimmerwiedersehn. Bis zur Entlassung von Dagobert war es noch lange hin. Eines Sonntags, am Nachmittag, ging die Strohwitwe Emma über den Jungfernstieg, als eine SA-Kolonne mit Tschingdera und Gegröle vorbeimarschierte. Und so blühte ein junges Glück auf im Unglück: Emma verliebte sich in einen anderen Mann. Was ihn verzauberte? Die junge Frau mit den weichen Locken riss als Einzige in der Menge am Straßenrand nicht den Arm hoch zum Heil-Hitler-Gruß. Er zog sie ins Gespräch. Er lockte sie in den Alsterpavillon. Hübscher Zufall: genau der magische Ort, an dem Heinrich Heine hundert Jahre vorher mit seinem Verleger Julius Campe Rheinwein getrunken und Austern schlampampert hatte.
Der schicke Kerl an der Binnenalster erwies sich als ein gebildeter Mann, ein wohlhabender Mann und ein Anti-Nazi. Paar Jahre jünger als Emma. Friedel Runge war eine Mischung aus Sozialdemokrat und Dandy und Kommunist. Ein linker Einzelgänger. Er arbeitete als Handelsvertreter und fuhr damals schon ein eigenes Auto. Er lockte die Frau des Schlossers Dagobert Biermann bald in die Oper, bald ins Bett. An den Wochenenden flanierte das Paar plebejisch an der Bille, bürgerlich an der Alster. Sie wanderten ins Alte Land auf der anderen Elbseite. Friedel tauchte um die Wette mit seinem Freund unter einem Schlickrutscher in der Elbe durch, eine Art freiwilliges Kielholen im Übermut. Er war stark, er war sanft, er liebte das blonde Kommunistenweib Emma Biermann. Ihr Ehemann saß im Gefängnis, gewiss, aber sie wollte es wissen, sie wollte alles wissen. Emma war so schön, und so schön begeistert, und so schön allein.
Jeder liefert im Spiel der Geschlechter eben das, was er hat. Emma besaß ein geklinkertes Holzboot, ein Kajak für zwei Paddler, es lag an der Bille im Schuppen des Bootsbauers Willi Schulz. Und sie konnte dem Anderen auch ein Stückchen Welt liefern! Sie hatte Russisch gelernt für eine Reise in die Sowjetunion vor ein paar Jahren. In der Kommunistischen Partei hatte sie »Lohnarbeit und Kapital« von Karl Marx studiert. Sie kannte die romantischen Gedichte von Heinrich Heine. Das »Buch der Lieder« hatte ihr Dagobert zur Verlobung von einem Genossen in rotes Leder binden lassen.
Ein ewiges Jahr dauerte die Himmelhölle dieser Liaison. Doch die Zeit erwies sich als grausam kurz. Als der 8. Mai 1935 näher kam, der Tag, an dem Dagobert Biermann aus der Haft entlassen werden sollte, graute seiner Frau vor diesem heiklen Freudentag. Emma hatte alles tausendmal her und hin überfühlt, hatte hin und her überlegt. Dann auferlegte sie sich selbst den Parteiauftrag: Verzicht! Aus Treue zur Partei – und aus Achtung vor ihrem Genossen Ehemann. Einen Tag vor der Entlassung traf sie den Anderen ein letztes Mal. Sie küssten sich, sie redeten, sie weinten, sie schwiegen. Dann riss sie sich das Herz aus dem Leibe, und sie riss sich Büschel ihrer goldblonden Locken vom Kopf.
Am Morgen fuhr Emma mit der U-Bahn raus nach Fuhlsbüttel. Sie holte ihren gehörnten Ehemann ab. Er kam ihr schon auf der Straße entgegen mit seinem Bündel, denn er war zehn Minuten zu früh entlassen worden. Scheues Küsschen, aber kein Kuss. Noch auf der Straße gestand sie ihm alles. Sie sagte: »Wenn du willst, wenn du es aushalten kannst, bleibe ich bei dir. Wenn nicht, dann gehe ich mit dem Anderen.« Er entschied sich gegen die Scheidung. Aber als er Emma, zurück in der Wohnung, aufs Bett legen wollte, sagte sie: »Nein, nicht! Noch nicht. Bitte! Ich liebe noch immer den Anderen.« Dagobert richtete sich sein Bett in der Küche. Er ertrug seine Einsamkeit, weil er nicht vereinsamen wollte. Er umklammerte sein Herz, er war todtraurig von alledem und trotz alledem froh.
Warum und wie Emma ihrem Mann das Zeichen gab, dass endlich! aus dem Genossen auch wieder ihr Bettgenosse werden durfte, weiß ich nicht. Weil ich aber auf den Tag genau ein Achtmonatskind sein soll, kann ich mir ausrechnen, wann es passierte: am 15. März 1936. Seit Dagoberts Entlassung war fast ein Jahr vergangen, so grausam lange hatten die beiden in kommunistischer Keuschheit nebeneinanderher gelebt. Er hatte nichts erzwingen können, und sie musste ihm nichts abschlagen. Alles hat eben seine Zeit. Sie streichelten sich, sie küssten sich, sie umarmten sich. Und danach? Sie schwiegen. So lagen sie zum ersten Mal seit fast drei Jahren innig beieinander. Alles war wieder gut. Er lächelte. Dann brummte er: »Ich hab aber nicht aufgepasst!« Emma sprang – in ihrem Jargon: wie von der Tarantel gestochen! – mit einem Schrei aus dem Bett. Sie rannte rüber in die kleine Küche. Ran an den Handstein! Wasser aufgedreht. Sie ritt wütend über dem gusseisernen Ausguss, ihrem Proletarier-Bidet. Sie schimpfte und greinte, sie lachte böse und weinte wirre Wortfetzen und fluchte aus sich raus und klagte in sich rein, trocknete sich ab, saß nackt am Küchentisch und schwieg feindselig. Doch der Zorn meiner Mutter wandelte sich wie von selber in eine Glückseligkeit. Bald schon pries die Frau ihren Mann für seinen Mangel an Rücksicht und lachte vor Freude. Und natürlich hielt Emma ihr Versprechen, und die beiden nannten mich Karl-Wolf.
***
Mein Vater fand Arbeit auf der Deutschen Werft. Er war Spezialist für die »Laufkatzen«, die auf den Stahlseilen zwischen den mächtigen Torpfeilern der Hellinge den Schiffsbauern die Bauteile ranschaffen. Der Führer brauchte jede Hand für Kraft-durch-Freude-Dampfer und neue Kriegsschiffe. Dagobert brachte seiner Frau jedes Wochenende die Lohntüte – ungeöffnet. Für sich behielt er in seinem kleinen, abgenuddelten Lederportemonnaie nur paar Groschen für den Pfennig-Skat in der Mittagspause.
Meine Eltern und Onkel Kalli gehörten einer Widerstandsgruppe an, die Sabotage betrieb. Onkel Kalli und Dagobert spionierten während ihrer Arbeit im Hafen harmlose Handelsschiffe aus, die heimlich Panzer, Flugzeugteile und Munition nach Franco-Spanien bringen sollten. Heimlich, denn der Völkerbund hatte zum Spanischen Bürgerkrieg, der seit 1936 tobte, das Prinzip der Nichteinmischung beschlossen. Hitler hatte dem Putschgeneral Franco eine Elitetruppe, die Legion Condor, geschickt. Antifaschisten aus aller Welt, Demokraten, Kommunisten, Anarchisten, gründeten daraufhin die Internationalen Brigaden, die auf Seiten der Spanischen Republik kämpften – jeder schickte eben seine Elite in die Schlacht. Den Verbündeten auf Seiten der Republik wollte die Widerstandsgruppe diejenigen Schiffe verraten, die Waffen transportierten. Meine Mutter arbeitete als Kurier von Informationen, einmal entging sie nur knapp der Verhaftung. Ein Genosse hatte ihr eine falsche Hausnummer genannt. Genau das stellte sich als Glück heraus, denn in der Wohnung mit der richtigen Hausnummer saß ein Gestapomann, es war eine Falle.
Die Gruppe flog dann doch durch einen Spitzel auf. Die Gestapo stürmte im März 1937 die Wohnung meiner Eltern. Sie verhafteten meinen Vater, meinen Onkel und wollten auch Emma mitnehmen. Doch Emma schrie: »Mein Kind! Mein Kind!« Die Beamten glotzten in meine Wiege, berieten sich, und der Chef entschied: »Dann bleiben Sie erst mal hier, aber halten Sie sich bereit!« Emma stand unter Hausarrest. Mein Vater drehte sich in der Wohnungstür um, zog den Ehering vom Finger, holte sein kleines Portemonnaie aus der Tasche und legte beides auf den Küchentisch. Dann packten die Beamten ihn und Kalli, prügelten die Verhafteten die Treppen runter, pferchten sie ins Auto und brachten sie ins Gefängnis Fuhlsbüttel. Dort wurden Dagobert und Kalli voneinander getrennt und in Kellerzellen mit Ketten an die Wand gefesselt. Sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Nacheinander wurden sie zu Verhören geholt. Sie wurden schwer misshandelt. Vier Monate blieb Onkel Kalli angekettet, Dagobert musste neun Monate diese Qual aushalten.
Emma steckte sich den Ring ihres Mannes auf den Finger und setzte den eigenen davor. Sie nahm ihren Säugling mit zu den endlosen Verhören bei der Gestapo und stillte mich dort. Sie log das Blaue vom Himmel, verstellte sich als tumbes Muttertier, ahnungslos und absolut unpolitisch, und konnte uns so retten. Emma sah ihren Mann vier Monate nicht und wusste auch nicht, wo er war. Dann wurde Dagobert auf einmal während eines Verhörs meiner Mutter in den Raum geführt. Die Gestapo hoffte, dass meine Eltern sich irgendwie verraten. Aber sie hatten damit kein Glück, die beiden sahen sich nur an – und verstanden sich.
Mein Vater wurde in das Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis verlegt. Insgesamt zwei Jahre vergingen von der Verhaftung bis zum Prozess. Alle vier bis sechs Wochen konnte Emma mit mir zusammen Dagobert besuchen. Einmal kriegte sie dabei raus, auf welcher Seite des Gebäudes seine Zelle lag. Freitags war im Gefängnis Fensterputzen angesagt. Meine Mutter ging fortan jeden Freitag mit mir zu der Straßenseite des Gebäudes, zu der die Zelle meines Vaters lag. Und mein Vater putzte nun jeden Freitag besonders gründlich und zeitaufwendig das Fenster. So konnte er erleben, wie sein Wölflein die ersten Schrittchen am Gefängniszaun übte. Ein halbes Jahr dauerte unser kleines Glück, dann beobachtete uns ein Wärter, und mein Vater wurde in eine Zelle verlegt, die nicht zur Straße ging.
Die Anklage gegen meinen Vater lautete: Vorbereitung zum Hochverrat und Landesverrat. Bei der Verhandlung im Januar 1939 kam es zu einem Zwischenfall, den meine Mutter nie vergessen sollte und der ihr den Schlaf raubte. Mein Vater wurde aufgerufen: »Dagobert Biermann, aufstehn!« Er stand auf. Nun rappelte der Richter runter: »Dagobert Biermann, Beruf: Maschinenschlosser. Verheiratet mit Emma Biermann, geborene Dietrich. Wohnhaft Schwabenstraße 50 in Hamburg. Geboren am 13.11.1904. Religion: keine.« Doch statt seine liebe Schnauze zu halten und seinen kleinen Judenhintern zu retten, fiel mein Vater dem Beamten ins Wort und warf in den Saal drei Worte: »Ich! bin! Jude!« Meine Mutter hat sich zeitlebens gefragt, wie ihr Leben weitergegangen wäre, wenn er diesen Satz nicht rausgehaun hätte.
Der Volksgerichtshof verurteilte den Angeklagten zu sechs Jahren Zuchthaus. Zu Emma sagte Dagobert: »Die sitze ich auf einer Arschbacke ab.« Der Kopf der Widerstandsgruppe, der Rechtsanwalt Herbert Michaelis, wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Onkel Kalli kam frei, weil sein Schwager ihn entlastet und alle Schuld auf sich genommen hatte.
***
Obwohl meine Eltern strenge Atheisten waren, ließen sie mich, Karl-Wolf Biermann, das jüdische Kommunistenkind, taufen. Täufling wurde ich aber erst, als ich schon längst laufen und plappern konnte. Mein Vater war zum Absitzen seiner Strafe ins Zuchthaus Bremen verlegt worden. Kinderbesuche waren dort nicht erlaubt, und für meine Mutter war es teuer und mühsam, nach Bremen zu kommen. Beim »Sprecher«, so nennt man den Besuch im Gefängnis, konnte Emma ihren Ehemann immerhin fragen, ob er einverstanden sei, dass sie den Sohn taufen lässt. Unter den gegebenen Zeitumständen fand er die Taufe vernünftig. Ich galt nach den Nürnberger Rassengesetzen als Mischling ersten Grades. Wohlmeinende Genossen hatten Emma dringend geraten, mich taufen zu lassen. So sollte ich nicht als Halbjude, sondern als halber Arier gelten.
Die Taufe fand am 30. Juli 1939 statt, ein Dreivierteljahr nach den Pogromen der sogenannten Reichskristallnacht. Es muss ein Sonntag gewesen sein, denn wochentags arbeitete meine Mutter inzwischen in der größten Hamburger Reinigungsfirma, bei Dependorf. Zuerst als Putzfrau, dann als Expedientin. Der Pastor wird geahnt haben – nein, er hat wohl gewusst –, warum eine fremde kommunistische Arbeiterfrau, deren jüdischer Mann als Häftling im Gefängnis sitzt, zu ihm in die Sankt-Annen-Kirche kommt. Die Taufe sollte mich schützen vor Diskriminierungen, retten vor befürchteten Maßnahmen des Nazi-Staates.
Die Kirche Sankt Annen am breiten Mittelkanal in Hammerbrook lag nur zwei Straßen entfernt von unserer Wohnung. Der Herr Pastor, ein Dr. Ernst Smechula, erwartete uns an der großen, halboffenen Kirchentür, vermutlich nach der Predigt, denn die Kirche war leer. Damals begriff ich wenig von der verrückten Situation, ein herzzerreißend komisches Kapitel aus dem tragischen Familienroman vom Überleben in der Hitlerzeit. Ich hatte mein Spielzeug dabei, wir wollten anschließend mit der S-Bahn ins Grüne fahren, ans Ufer der Bille, wo schöner Sand war. Ich zog mein vertrautes Leiterwägelchen hinter mir her, in dem ein bunter Blecheimer schepperte, dazu Backebackekuchenformen, ein Schaufelchen und ein Sandsieb aus Draht. Der Leiterwagen wurde vor der mächtigen Kirchentür in einer Nische abgestellt.
Der Pastor war ein großer, dunkler Mann mit einer weichen, warmen Hand, die einfach meine Hand umschloss. So schritt er mit mir durch das Kirchenschiff zum Altar. Gottes Haus leuchtete im Schimmerlicht. Hinter uns liefen Mama und Oma Meume. Martha »Meume« Dietrich, die in ihrer langen Proletarierkarriere tausend Kilometer Schafs- und Schweinedärme gewaschen, abgemessen und gebündelt hatte für die Wurstproduktion, spielte die Taufpatin. Die beiden gottlosen Weiber setzten sich in die erste Reihe. Seitwärts links das hohe steinerne Taufbecken. Dort stand ich nun mit dem dunklen Mann. Er hielt eine kleine Predigt, deren Sinn mich nicht erreichen konnte, aber ich erinnere, dass er zwischen den Worten immer wieder sang. Ohne Orgel, versteht sich. Begleitet wurde er nur von einem unhörbaren Engelschor und von Oma Meume.
Meine Oma war damals Mitte fünfzig. Sie sang voller Inbrunst dem Prediger hinterher, sie kannte alle Strophen. Diese Kirchenlieder hatte sie in ihrer Kindheit in Halle gelernt, bei den pädagogischen Pietisten im Waisenhaus der berühmten Franckeschen Stiftungen. Ja, meine Oma Meume sang, wie es in Heines Wintermärchen über das kleine Harfenmädchen heißt: »Sie sang mit wahrem Gefühle / Und falscher Stimme, doch ward ich sehr / Gerühret von ihrem Spiele.« Die Arbeiterin aus dem stinkenden Darmkeller sang so laut »Aus tiefer Not schrei ich zu DIR!«, sie plärrte so unbekümmert daneben, dass es meiner Mutter nicht etwa das Herz rührte. Emma Biermann war eine stolze, eine vernunftgebrannte Gottesleugnerin und viel zu musikalisch. Sie knuffte ihrer Mama in die Seite und zischte: »Du singst falsch!«
Doch diese Zurechtweisung hatte eine unerwartete, eine fatale Wirkung: Die christliche Kommunistin Oma Meume wurde aus ihrem beseelten Mitsingen rausgerissen und lachte sich zitternd ihre Angst aus dem Hals, bis ihr Lachen übermächtig wurde. Sie wollte natürlich – um Gottes willen! – die Zeremonie nicht stören. Sie unterdrückte dieses absurde, peinigende Lachen. Doch der Affekt schaukelte sich hoch. Je mehr die arme Alte gegen den Drang ankämpfte, desto schmerzhafter schüttelten sie die Eruptionen ihres Zwerchfells. Emma haute ihrer Mutter abermals mit dem Ellenbogen in die Seite. Nun schon hilflos brutal. Beiden Frauen war bewusst, worum es hier ging. Beide hatten die panische, nein, die begründete Angst, dass der wohlwollende Herr Pastor Smechula – beleidigt über so viel Mangel an Respekt – den Taufakt abbricht.
Oma Meumes Kampf gegen den übermächtigen Lachreiz war offenbar nicht zu gewinnen. Plötzlich entdeckte meine Mutter, dass die lachende Alte, im Krampfkampf gegen das Lachen, nun auch noch das Wasser nicht halten konnte. Ein Rinnsal pieselte ihr vom Fuß auf den kalten Steinboden und bewegte sich schleichend, unaufhaltsam, auf das nahe Taufbecken zu. Emma geriet in ein blankes Entsetzen. Der gute Hirte jedoch tat unerschütterlich dem Ritus Genüge, so, als lenkte ihn eine fromme Furcht vor dem HErrn, der womöglich eine hastige Schludrigkeit der vorgeschriebenen Szenerie nicht straflos hinnehmen würde. Der Gottesmann griff in das steinerne Becken und benetzte meinen kleinen Kopf – Gottes Dolmetzsch würde sagen: Er taufte mit »durchgottet Wasser«. Und als ich mit heller, klarer Kinderstimme fragte: »Onkel, warum machstu mich nass?«, da kippte auch meine Mutter ins Lachen über, es gab auch für sie kein Halten mehr. Die Junge nun wie die Alte, beide krümmten sich und kämpften immer aussichtsloser gegen die unbesiegbaren Erschütterungen in ihrem Inneren an.
Kaum zu glauben, dass der Pastor dies alles nicht bemerkt haben sollte, doch der Mann führte unbeirrt seine Zeremonie zum Ziel. Am Schluss griff er sich wieder meine Hand und ging mit mir gemessenen Schrittes den langen Weg, den Mittelgang zwischen den leeren Bänken, zurück. Die Frauen liefen, wie zu Beginn, hinter uns her, eine kleine Prozession. Als wir an das schwere Kirchentor kamen, stemmte der Mann den Türflügel auf, und das Sonnenlicht flutete ins Kirchenschiff. Er verabschiedete sich von uns. Das Tor fiel wieder ins Schloss. Ich ging zu meinem Leiterwägelchen.
Wir standen allein auf der Straße, und nun brachen beide Frauen, Mutter und Großmutter, in ein haltloses Schluchzen aus, in ein hemmungsloses Gewein, nein, schlimmer: in ein tiermenschliches Heulen. Solche tiefen Schreckenstöne waren mir neu und ängstigten mich. Verrückt verschieden haben diese beiden Frauen gelacht und geweint. Oma Meume war als Waise aufgewachsen in Halle an der Saale. Ihre Mutter war noch im Kindbett an Tuberkulose gestorben. Der Vater verlor gleich darauf seine rechte Hand in einer Maschine und soff sich fortan zu Tode mit der linken. Die kleine Martha Schimpf vegetierte mit Stiefvater Gott allein im Waisenhaus. Da gab es zu wenig zu essen, zu viele Gebete und noch mehr Prügel. Und darum sang sie so laut und lachte so verzweifelt und weinte so hemmungslos bei der Taufe ihres Enkels. Es kam aus tief kindlichem Kummer. Gott hatte sie dermaßen schäbig im Stich gelassen, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg – Gott sei’s geklagt! – in die Kirche des Kommunismus hatte eintreten müssen.
Im klassenbewussten Herzen ihrer Tochter aber, in Emma Biermann, wütete Zorn, schwelte ein Hass und brannte die Scham. So weit war es also gekommen mit ihrem Leben, mit der stolzen deutschen Arbeiterklasse, ja, mit der ganzen Weltrevolution, so weit, dass sie im Freiheitskampf der Menschheit als Kämpferin für den Kommunismus nun der Kirche unter den Rock kriechen musste, nur um das Leben ihres Kindes vor dem Hitlerstaat zu retten.
Der ein Rauch ward aus den Schornsteinen in Auschwitz
Besuch im Gefängnis. Deportation der jüdischen Familie. Tod des Vaters.
Meinen allerersten Auftritt als Liedersänger erlebte die Welt im Winter 1940/41. Ich war vier Jahre alt. Hitlers Blitzkrieg an allen Fronten war längst im Gange. Die »Luftschlacht um England« tobte. Die »Goebbelsschnauze«, so hieß im Volksmund der Standard-Radioapparat der Deutschen, spuckte Siegesmeldungen, kotzte Führerreden und kreischte Marschmusik. Mein Vater hatte nach drei Jahren Einzelhaft einen Antrag auf Gemeinschaftshaft gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt. Stattdessen kam Dagobert jetzt öfter zu Arbeitseinsätzen in das Arbeitslager Teufelsmoor, wo politische und kriminelle Häftlinge zusammengelegt waren. Die Arbeit war hart. Die Häftlinge mussten elf Stunden am Tag Torf stechen. Mein Vater brach zweimal wegen völliger Entkräftung zusammen.
Im Oktober 1940 erhielt meine Mutter einen Brief vom Amt für Statistik, adressiert an meinen Vater. Dagobert sollte Angaben zu seiner Abstammung machen, ob seine Großeltern Arier seien oder nicht. Kurz darauf wurde er innerhalb des Zuchthauses verlegt, in die Judenabteilung. Meine Mutter war besorgt, doch er fand es gar nicht so schlecht. Er schrieb, es herrsche dort eine wunderbare Kameradschaft.
Dreimal im Jahr gab es einen Besuchstermin für jeweils eine halbe Stunde. Aufregend die Eisenbahnfahrt von Hamburg nach Bremen. Dieses einzige Mal nahm meine Mutter mich einfach mit. Es war ein kalter Wintertag. Mein Vater war beim Arbeitseinsatz im Moor. Kilometerweit tippelte ich an der Hand meiner Mutter im Schnee durch die märchenhafte Moorlandschaft. Vorbei an überzuckerten Birken, an Pyramiden aus Torfstücken, die zum Trocknen aufgestapelt waren. Endlich standen wir vor dem Tor. Stacheldraht, Wachturm, Baracken, Appellplatz. Der Posten wollte mich nicht mit reinlassen. Kinder ins Lager mitzubringen war verboten. Ich weiß nicht, wie meine Mutter es schaffte, den Posten zu bezirzen, zu rühren, zu besabbeln, zu bestechen. Ich kann nicht wissen, ob er bei seinem Vorgesetzten um eine Sondergenehmigung nachfragte. Schließlich aber durfte ich doch mit rein.
So lief ich mit meiner Mutter in das Lager. Wir kamen zu einer Baracke. Rechts von der Tür sah ich ein sonderbares Fenster. Es war von innen mit ausgemergelten Männergesichtern ausgefüllt. Die Häftlinge drängelten, jeder wollte ein echtes Kind und eine echte Frau sehen. Mitten im Lager eine Frau und ein Kind! Dieses Fenster, ein originales Kunstwerk des Postkartenmalers aus Wien, ging mir nie wieder aus dem Kopf.
Wir kamen in den Aufenthaltsraum des Wachpersonals. Fußlappenschweiß. Kalter Zigarettenrauch. Zwei Stühle, getrennt durch einen langen Tisch. Ein Uniformierter links am Schreibtisch. Ich saß auf dem sicheren Schoß meiner Mutter. Mein Vater wurde hereingeführt. Ich kannte ihn nicht. Ich fremdelte nicht, denn er war mir so nah wie die Mama. Sie hatte mir jeden Abend von ihm eine Gutenachtgeschichte erzählt und jeden Morgen eine Gutenmorgengeschichte, bevor sie zur Arbeit ging. Jeden Morgen, wenn ich die Haustür öffnete, stand da mein Leiterwägelchen im dunklen Treppenhaus, beladen mit einem Stück Zucker oder mit einer Murmel, mit einer Feder, einem Brummkreisel, einem lieben Nichts. Das glaubte ich meiner Mutter: Der Papa hatte mir das Geschenk über den Mondstrahl geschickt.
Nun saß dieser innig vertraute fremde Mann uns gegenüber. Er lächelte. Er war stark. Er roch. Er hatte an der Seite einen Goldzahn. Sein Kopf war geschoren. Mein Vater schenkte mir eine Tüte Bonbons. Erst später, als ich älter wurde, habe ich gefragt, wieso der Häftling im Lager Bonbons haben konnte. Meine Mutter hatte sie dem Posten gegeben, damit er die Tüte dem Gefangenen zusteckte, damit der dann seinem Kind eine Freude machen konnte. Auch diese Schweine waren ja Menschen. Mein Vater reichte mir also die Tüte über den Tisch. Ich nahm ein Bonbon raus und gab es ihm. Das fand er gewiss gut. Ein zweites Bonbon stopfte ich in den Mund meiner Mutter. Dann fingerte ich ein drittes Bonbon raus. Meine Hand wanderte in Richtung des Uniformierten, der uns bewachte. Ich guckte ihn misstrauisch an und zog die Hand wieder zurück. Ich war mir unsicher. Mein Vater lachte und sagte: »Du kannst ihm ruhig eins geben.« Also schwenkte ich mit dem Bonbon in Richtung des Wächters, zuckte aber zurück und steckte es mir schnell selbst in den Mund. Und wieder lachte mein Vater.
Emma erzählte ihm, dass die Leute im Hinterhaus mich alle den kleinen Sänger nennen. Immer nämlich, wenn sie kurz nach fünf in der Früh mit der Straßenbahn zur Arbeit in die Reinigungsfirma Dependorf fuhr, lag ich zwei Stunden allein in der Wohnung in meinem Bett. Dann sang ich, bis Tante Lotte, die in der Wohnung gegenüber wohnte, mich zu sich rüberholte. »Sing doch deinem lieben Papa mal was Schönes vor!«, sagte Emma. Ich schmetterte sofort los: »Hörst du die Motoren brüllen: Ran an den Feind / Hörst du die Motoren brüllen: Ran an den Feind / Booomben! Booomben! / Bomben auf Engellant, Bumm! Bumm!«
Mein erster Auftritt war also nicht gelungen, er war eine Katastrophe. Der Gefangene musste sich ausgerechnet dieses Lied von mir anhören. Da kommt sein eigen Fleisch und Blut und singt ihm hinterm Stacheldraht das Kriegslied seiner Todfeinde vor! Wir haben später im Kreis der Familie immer mal wieder über diese eine und einzige Begegnung, an die ich mich erinnern kann, gestritten. Ich sagte meiner Mutter: »Es muss ihm furchtbar weh getan haben, dass sein eigen Kind ihm ein Nazilied vorquäkt.« – »Quatsch«, erwiderte sie, »der war doch kein Idiot, er hat es verstanden.« – »Jaja«, sagte ich, »wie es bei Brecht heißt: Und er, der es begriff, begriff es auch nicht …« Aber meine Mutter sagte: »Ach, du immer mit deinem Brecht! Du hast die eine Hälfte vergessen und die andre falsch behalten. Dein Vater hat gegrinst. Er wusste, dass du das aus der Goebbelsschnauze kennst. Der war froh, dass er so ein waches Kind hat. Er wusste, dass ich dir schon die richtigen Lieder beibringe. Unsre!«
***
Emma besuchte regelmäßig ihre Schwiegereltern am Hamburger Großneumarkt. Der alte Biermann ergatterte als Jude keine Aufträge mehr. Oma Louise klapperte die Geflügelläden ab und bettelte um die abgehackten Füße und Hälse der Hühner und Enten. Meine Mutter sagte immer, wenn wir Hühnersuppe aßen: »Deine Oma konnte aus den Abfällen eine bessere Suppe kochen als ich aus dem ganzen Huhn.«
Mit meinem Cousin Peter, dem Sohn von Dagoberts Schwester Rosi, spielte ich manchmal auf der Straße. Er war ein halbes Jahr älter als ich und trug einen schönen gelben Stern an der Jacke. Ich, das Halbjüdlein, der Mischling ersten Grades, trug keinen Stern. Wir tollten zum Spielen aus der Wohnung im Erdgeschoss die drei, vier Stufen runter auf den Hinterhof, der mit Katzenköppen gepflastert war. Wir sprangen durch ein hohes Tor raus auf den breiten Bürgersteig einer großen Straße. Peter hatte eine bunte Papierschlange, die er wunderbar schwenkte. Und er gab sie mir endlich doch ab, damit ich sie auch mal schlenkern konnte. Da war ich so glücklich.
Im November 1941 erhielten meine Großeltern John und Louise Biermann, der Bruder meines Vaters Karl mit seiner Frau Hanna und deren Tochter Ruth sowie Rosi mit ihrem Mann Herbert Weiss und Peterchen plötzlich den Bescheid, sich innerhalb von vierundzwanzig Stunden für einen Transport nach Polen bereitzuhalten. Der »Evakuierungsbefehl der Hamburgischen Geheimen Staatspolizei«, der den Juden zugeschickt wurde, war Büroprosa nationalsozialistischer Poesie: »Ihr und das Vermögen Ihrer oben genannten Angehörigen gilt als beschlagnahmt. Sie haben sich … in dem Hause Moorweidenstraße 36 (Logenhaus) einzufinden … 1. Koffer mit Ausrüstungsgegenständen bis zu 50 kg. 2. Vollständige Bekleidung. 3. Bettzeug mit Decke. 4. Verpflegung für 3 Tage … Zahlungsmittel bis RM 100.-. Sonstiges Bargeld ist bei der Kontrolle abzugeben … Verboten ist die Mitnahme von: 1. Wertpapieren, Devisen, Sparkassenbüchern usw. 2. Wertsachen jeder Art aus Gold, Silber, Platin mit Ausnahme des Eherings. 3. Lebendes Inventar …« Die Koffer mussten mit Evakuierungsnummer und Evakuierungsadresse versehen sein.
Meine Mutter war alarmiert, die Familie in heller Aufregung. Wie alle Juden waren die Biermanns aufgefordert, bei Aufbruch ihren Wohnungsschlüssel samt einer genauen Liste des gesamten verbleibenden Inventars der Wohnung auf der nächstgelegenen Polizeiwache abzugeben. Manche besonderen Dinge, die am Herzen lagen oder kostbar waren, wurden hastig verschenkt. Louise legte hellsichtig für Emma ein paar Fotos und Dokumente beiseite.
In schwindenden Bildern erinnere ich mich daran, wie wir an einem düsteren Morgen losfuhren. Meine Mutter wollte den Biermanns Socken, Pullover und wollene Unterwäsche bringen, die sie in verzweifelter Hast die Nächte durch auf ihrer kleinen Strickmaschine gestrickt hatte. Ratsch-ratsch, ratsch-ratsch. Sie schleuderte den Handhebel mit hartem Schwung hin und her und hin und her, selbst eine kleine Maschine. Sie strickte so wild, weil uns das Gerücht erreicht hatte, dass alle Juden zu harter Arbeit in den kalten Osten geschickt werden.
Wir fuhren zur Moorweide, einer parkähnlichen Wiese mit mächtigen Bäumen, direkt neben dem Hauptgebäude der Universität am Bahnhof Dammtor. Hier versammelten sich die Juden. Meine Großeltern waren Anfang sechzig. Beide hatten einen Vogel – jeder einen anderen. Meine Großmutter Louise hatte eigensinnig, ja irrsinnig statt des Koffers ihren kleinen Vogelkäfig mitgenommen. Darin saß ein Wellensittich, dem sie im Laufe der Jahre den Schnack beigebracht hatte: »Butsche Biermann! Butsche Biermann! Schlachterstraße! Schlachterstraße!« Die beiden alten Biermanns wurden von den anderen für verrückt erklärt. Dabei war meine Großmutter wahrscheinlich realistischer als die Spötter. Ahnte sie, dass sie am Ziel dieser Reise keinen Koffer mehr brauchte?
Auch mein Großvater John wurde auf der Moorweide für verrückt erklärt und von den verzweifelten Schicksalsgenossen wütend als ein unerträglicher Panikmacher beschimpft. Er hatte geklagt: »Die werden uns alle noch erschießen!« Starres Entsetzen. Wie konnte man so ein Wort in die Welt setzen? Ein Mann blaffte ihn an: »Du hascha ’n Vogel, das geht doch gaanich!« Beide Männer behielten Recht. Die Handarbeit, jeden Einzelnen zu erschießen, kostete bald schon zu viel Zeit, zu viel Nerven, zu viel Schnaps für die deutschen Soldaten, die immer dringender an der Front gebraucht wurden.
Emma übergab die Wollsachen, die hastig in die Koffer gestopft wurden. Wir verabschiedeten uns, beteuerten, dass wir bald voneinander hören würden. Peterchen hielt seine Papierschlange fest. Wir umarmten uns, wir schwiegen, wir lächelten, wir winkten hilflos. Dann schleppten sie ihre Koffer zum prächtigen Logenhaus, stellten sich an zur Registrierung und zur Gepäckkontrolle. Jeder unterschrieb, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibt und sein Restvermögen dem deutschen Staat überlässt.
Emma und ich fuhren nach Hause zu Oma Meume und Tante Lotte, die mit ihren Kindern Hilde, Susi und Ille auf uns warteten. Dagoberts Cousin, Alfons Ganser, und seine Frau Else hatten wir auch vor dem Logenhaus getroffen. Tante Lotte bekam zwei Tage später eine Postkarte von Else, geschrieben direkt im Logenhaus:
Meine lieben alle!
Wir sind registriert, und schon haben wir jeder ein Bett wie im Luftschutzkeller. Bisher hat alles geklappt. Nun haben wir Lotte noch folgendes zu sagen. Es hat großen Krach gegeben wegen der Nähmaschine zwischen Alfons Schwester Erna und dem Alten. Erna wollte die Nähmaschine haben. Nun möchte ich Dich, liebe Lotte, bitten, meiner Schwägerin Erna Deine Nähmaschine zu überlassen. Würdest Du das tun? Bitte. Sie will jetzt auch nähen lernen. Sonst hätte ich keinen Wunsch mehr. … Frl. Gans hat Selbstmord begangen, indem sie sich vom Balkon gestürzt hat. Sie sollte auch weg mit ihrem Bruder. Es hat uns den Rest gegeben, als wir das sahen.
Ja, liebe Leute, nun müssen wir weg. Hier sind noch und noch Bekannte. Biermanns haben wir auch gesehn. Meine Lieben, Emmi, Meume, Hilde, Susi und Lotte, Ille und Wölflein, bleibt gesund und munter, wie wir es auch vorhaben. Morgen früh geht es los und Dienstag sollen wir da sein. Drückt uns die Daumen. Herzlichst grüßen Euch Else und Alfons.
Wir wussten damals nicht, dass unsere Familie nach Minsk ins Ghetto deportiert wurde. Sie wurden alle ermordet, in die Grube geschossen, im Lastwagen vergast. Alfons lebte noch eine kurze Weile, er war Tischler, aber auch er überlebte das Ghetto nicht. Wir ahnten zwar Schlimmes. Aber keiner wusste was Genaues. Das sollte auch so sein. Emma erhielt zwei Wochen später eine Postkarte. Poststempel vom 22.11.41, Berlin-Charlottenburg, 19-20 Uhr. Darauf handschriftlich in viel zu großen altdeutschen Lettern mein Großvater John: »Dienstag 11.11.41, 9½ Uhr. Reise gut überstanden. Biermann.«
***
Das Jahr 1942 neigte sich, es näherte sich das Ende der sechsjährigen Haftzeit, die mein Vater in Bremen-Oslebshausen absaß. Nur ein knappes halbes Jahr stand noch aus. Ich war inzwischen schon sechs geworden. Wir freuten uns auf den Tag seiner Entlassung. Und ich auf eigene Weise: Ich sammelte kostbare Eisenteile für ihn. Ich suchte zwischen den Gleisen auf dem nahen Hannoverschen Güterbahnhof am Kanal allerhand Liegengebliebenes. Weggeworfene Schwellenschrauben, öligen Eisendraht, schwere Federringe, rußschwarze Bretter mit Bolzen und Muttern. Sogar einen Vorschlaghammer ohne Stiel schleppte ich an und eine festgerostete Kneifzange. Ich hob meine Beute sorgfältig auf, alles für den lieben, lieben Papa. Dieser Schrott lag neben dem Spielzeug im Kinderzimmer. Mit der glänzenden Lok auf der Kommode durfte ich nicht spielen. In der Lehre auf der Werft Blohm & Voss hatte mein Vater sie als Gesellenstück für Maschinenbauer gebaut: das Modell einer Dampflokomotive. »Einmeterzwölf lang!«, sagte meine Mutter stolz. »Wenn Papa kommt, wird er dir zeigen, wie die Lok richtig dampft und fährt.«
Im Dezember ’42 erschütterte uns eine Neuigkeit aus Bremen. Mein Vater ließ seiner Emma über die Mutter eines Mithäftlings, eine Frau Laser, einen Kassiber zukommen. Darin schrieb er in knappen Worten, die meine Mutter ihr Leben lang immer wieder mal zitierte, es stehe ihm »eine nichts Gutes versprechende Reise bevor. Forsche immer nach unserm Verbleib!«. Und auch in seinem folgenden, dem letzten normalen Knast-Brief, der durch die Zensur im Zuchthaus ging, erwähnte er die Hauptsache wie nebenbei, eine bevorstehende Reise:
Zuchthaus und Strafgefängnis Bremen Oslebshausen, 10. Januar 1943
Meine Zwei, nein, nun erst der Sohn. Hat mir einen so feinen, lieben Brief geschrieben. Hab mich so dazu gefreut.
Mein Junge, Dein Papi hat viel Sehnsucht nach Dir. Möchte auch so gerne mal mit Dir spielen und schön spazieren gehen. Aber unsere süße Mutti muß immer dabei sein … Warte nur, Wölflein, wenn ich wieder komme, dann bauen wir uns ein großes Schiff und ein Auto und dann fahren wir alle immer damit aus. Aber mußt mir auch helfen beim Arbeiten … Bist Du auch immer artig und lieb zur Mutti? Sei nur recht lieb zu Mutti und auch zu Oma Meume und Tante Lotte. Sonst ist unsere Mutti traurig und weint und das willst Du doch nicht. Wölflein, gib Mutti doch mal einen recht schönen Kuß, hab sie tüchtig lieb und sag Mutti, den sollst Du ihr von Papi geben und dann laß Dir dasselbe gleich von Mutti zurückgeben. Und wenn ich bald wieder komme, werde ich Angelegenheiten dieser Art persönlich erledigen. Ja, meine Emsch, hoffe, Du wirst Dich dann damit abfinden. Die kleine Inge werden wir ja streichen müssen. Aber wir haben ja uns und unseren Jungen. Genug, um unser Leben schön und glücklich zu machen. Viel Schweres bringt uns diese Zeit und doch ist es notwendig. Wenn sie nur das Gute in ihrem Gefolge hat, und es kann und wird nicht anders sein, so wollen wir schon zufrieden sein. Mir jedenfalls hat sie schon Dich gebracht. Kleine, bin noch hier. Wie lange noch und wann, wohin – weiß ich nicht. Kann morgen schon losgehen, aber auch später. Nun, werden ja sehn. Für mich nicht so schlimm. Wär ja sowieso bald weg gekommen. Mache mir auch keine besonderen Kopfschmerzen darum. Man muß erstmal die Dinge an sich heran kommen lassen, und bin ich bis jetzt – und gut – klargekommen, werde ich es auch weiterhin … Bin zäh und gesund und habe die feste Absicht, für meine Zwei wieder zu kommen … Meine, könnte ich Euch doch nur helfen – bei Euch sein. Seid mir doch so viel und Du bist so lieb zu mir. Bin so glücklich darüber. So recht meine kleine süße Frau. Das tut so gut. Meine Zwei, seid vielmals gegrüßt,
Euer Dagob.
Alarmiert durch diese bedrohlichen Andeutungen, wandte sich Emma an die Gefängnisleitung und erbat einen vorverlegten Besuchstermin »zur Regelung einer dringenden familiären Angelegenheit«. Statt einer Antwort schickte das Zuchthaus ihr den normalen Besuchsschein für den 7. Februar 1943. Als sie an diesem Tag dort erschien, wurde ihr von einem Beamten mitgeteilt, dass Dagobert Biermann nicht im Gefängnis sei. Und wo er nun sei, darüber könne er leider keine Auskunft geben. Emma rannte zum Vorgesetzten. Der sagte kühl: »Einen Dagobert Biermann gibt’s hier nicht.« Alles Nachfragen, alles Wohin, alles Warum, alles Seit-wann nützte nichts. Keine Antwort. Meine Mutter stürzte in panische Angst. Verwirrt und nun schon wutverweint, wie sie war, drängte man sie aus dem Gefängnis. Der letzte Beamte, ein schon etwas älterer, der ihr ein kleines Nebentor zur Straße öffnete, flüsterte: »Es ist ein Transport nach Auschwitz gegangen.« Dann schlug er schnell die Tür zu. Damals hörte meine Mutter zum ersten Mal dieses Wort: Auschwitz.
Emma lief sofort zum Bremer Gefängnispastor. Der hatte Zeit für sie. Er hatte ja seit Jahren den Briefwechsel meiner Eltern gelesen, weil es seine Aufgabe war, die Post zu zensieren. Sie bat ihn um Rat und fragte nach den Effekten des Häftlings Biermann. Der gute Mann versprach, sich danach zu erkundigen. Er riet, einen Brief direkt an das Konzentrationslager, das KL Auschwitz, zu schreiben.
Zurück in Hamburg, fragte meine Mutter Freunde und Arbeitskollegen in der Reinigungsfirma Dependorf. Keiner kannte einen Ort Auschwitz. Emma verfasste ein Schreiben an den Lagerkommandanten persönlich: »Ich bitte höfl. mir mitzuteilen, wo mein Mann sich aufhält und ob er Post oder Päckchen erhalten darf und unter welcher Anschrift.« Sie legte einen Brief an ihren Mann Dagobert bei und brachte den Einschreibebrief zum Hauptpostamt »Hühnerposten« am Hauptbahnhof. Der Postbeamte sagte: »Den Brief kann ich gaanich annehmen, ich weiß ja gaanich, wo das is. Kommen Sie morgen ma wieder, ich erkundige mich.« Als Emma am nächsten Tag vor ihm stand, sagte er freudig: »Gefunden! Auschwitz! Das liegt in Oberschlesien, da, Richtung Pooln!«
Mein lieber Mann, liebster Papi,
am Sonntag den 7.2., als ich Dich in Bremen besuchen wollte, hörte ich, dass Du fort bist. War nicht schön. Meiner, wir denken immer an Dich u. wissen, dass auch Deine Gedanken u. Wünsche bei uns sind. Wir bitten Dich von ganzem Herzen, Dir um uns keine Sorgen zu machen. Alle nehmen Anteil an unserem Leid. Aber wir haben keinen Grund zum verzweifeln. Bleibe uns nur gesund. Ich werde stets bemüht sein, das Kind u. mich für unseren geliebten Papi zu erhalten. Denke Du auch an Dich. Gern würden wir Dir etwas schicken. Diesen Brief lege ich einem Schreiben bei, worin ich anfrage, wo Du bist. Hoffentlich erhalte ich bald Antwort. Meine Mutter, Geschwister und alle Freunde lassen Dich grüßen. Dir lieber Papi viele liebe Grüße von Deiner Emmi und Wölflein.
Wochen wartete Emma auf Antwort. Von Dagoberts Eltern, von seiner Schwester und seinem Bruder und deren Familien hatten wir seit November 1941 nichts mehr gehört. Und nun wusste Emma nicht mal, wo suchen. Die Wut der Verzweiflung trieb sie zur Hamburger Gestapo ins Stadthaus. Sie wurde von Zimmer zu Zimmer geschickt, kein Aas wusste was. Endlich landete sie bei irgendeinem Oberen. Aus dem Gefängnis in Bremen sei im Februar ein Transport mit Häftlingen nach Auschwitz gegangen, sagte sie ihm. Ob er darüber etwas wüsste? Der Gestapochef war ein Gemütsmensch: »Ich will Ihnen mal was sagen, beste Frau: Sie können damit rechnen, dass Ihrem Mann dort leider etwas zustößt.« Emma entgegnete: »Mein Mann ist aber gesund und hat den festen Willen, wiederzukommen.« Darauf er: »Tjaaa, beste Frau, so was haben wir schon oft gehabt, dass Leute kurz vor ihrer Entlassung krank wurden und nicht wiederkamen. Wenden Sie sich am besten an die Gestapo Bremen.«
Warum, weiß ich nicht, aber meine Mutter nahm mich mit, als sie sich nun auf den Weg machte mit der Bahn nach Bremen zur Gestapo. Vielleicht hielt sie sich an mir fest, vielleicht hatte sie mich nicht anders unterbringen können, vielleicht erhoffte sie sich durch das Dabeisein eines Kindes etwas mehr Mitgefühl. Sie fand die Gestapo nicht gleich, das Amtsgebäude war von einem Volltreffer ausgebombt worden. Die Gestapo war nun provisorisch im Bremer Polizeipräsidium »Am Wall« untergebracht, genau dort, wo auch heute noch die Polizei residiert. Ein mächtiges Haus mit einer breiten Treppe rund ums Eck.
Reingelassen ins Hauptgebäude wurden wir nicht. Wir warteten lange. Dann erschien ein Beamter in dem Vorraum beim Pförtner. Kaltkorrekt ballerte der Mensch sein Buchstabenmagazin leer: »Ihr Mann ist am 22. Februar morgens um 7 Uhr an Herzklappenschwäche verstorben.« Emma schrie leise auf und wurde ohnmächtig. Sie fiel neben mir einfach um wie erschossen. Sie lag da, Beine breit. Sie lag den Leuten im Weg. Sie hatte meine Hand gehalten. Nun hielt ich ihre. Der Uniformierte fasste ihr von hinten unter die Arme, zerrte sie halb hoch und schleppte sie zur Seite. Er lehnte sie mit dem Rücken gegen die Wand. So war sie wenigstens aus dem Weg. Ich stand neben ihr und hielt immer noch ihre Hand fest. Das dauerte. Als sie wieder zu sich kam, hievte der Uniformierte sie sachte auf einen Stuhl. Nach einer Weile hakte er sie unter, führte uns behutsam zur großen Ausgangstür und bugsierte uns raus.
Da standen wir auf der breiten Treppe mit dem Eisengeländer in der Mitte, zum Bürgersteig runter. Wieder schrie meine Mutter auf. Sie weinte und krallte sich mit der linken Hand am Treppengeländer fest. Mit der anderen Hand hielt sie mich. Der Beamte zerrte sie vom Geländer los und keuchte: »Sei’n Sie doch nicht so sentimental!« Aber meine Mutter riss sich los, schrie wieder und krallte sich an die Stange. Ja, sie hatte Riesenkräfte, grade in den Händen, vielleicht, weil sie jahrelang im Akkord in der Fabrik als Strickerin gearbeitet hatte. Der Beamte zerrte mit beiden Händen Emmas Linke vom eisernen Handlauf. Doch wie eine Furie in der Verzweiflung krallte sich diese kleine Frau wieder und wieder mit wütendem Eisengriff an dem Treppengeländer fest. Gleichzeitig hielt sie mit ihrer anderen Hand meine kleine Kinderhand mütterlich und sanft. So stieß uns der Beamte, Stufe um Stufe, bis runter auf die Straße. Als wir endlich unten auf dem Bürgersteig standen, gab meine Mutter auf.
Niedergeschlagen fuhren wir nach Hamburg zurück. Meine Mutter schrieb ihrem Bruder die schreckliche Nachricht. Onkel Kalli galt als verurteilter Nazigegner eigentlich als »wehrunwürdig«. Er war aber Ende 1942 in das eigens für solche Kandidaten geschaffene »Strafbataillon 999« der Wehrmacht eingezogen und dann zum normalen Soldaten begnadigt worden. Er kämpfte an der Front nicht für Hitlers Endsieg, sondern ums Überleben.
Hanau, den 12. April 1943
Liebe Emsch!
Dein Brief vom 10.4. erreichte mich heute … Schon im Urlaub, wenn ich es Dir andeutete, merkte ich, Du hast deine Schwester nicht unterschätzt … Ja, Emsch, für uns lebt er … Vom Endsieg war er überzeugt. Das, was unserem Dagobert schwer fiel, waren seine Gedanken an Frau und Kind. Darum Emsch, bleibe weiterhin tapfer, denn das sind wir ihm schuldig. Meine Emsch, dann haben wir heute wenigstens die Beruhigung, er ist erlöst von dieser Folter. Auch seine Eltern u.s.w. werden heute nicht mehr unter den Lebenden sein. Ich weiß, Emsch, es ist hart, doch wir wollen und müssen noch härter sein. Dein Bruder Kalli
PS: Was sagt Wölflein?
Emma war im Schock, halb rastlos, halb gelähmt. Dieses Mal riss sie sich nicht die Haare vom Kopf, sie fielen ihr über Nacht aus. Es dauerte vier Wochen, da hatte sie sich von Genossen im Untergrund einen Bericht über das Lager Auschwitz verschafft. Nun wusste sie genau, was mit meinem Vater passiert war. Sie war am Ende.
Eines Tages kam dann doch Antwort, zwei Briefe sogar. Der Pastor aus Bremen schrieb Emma, er habe keine persönlichen Sachen von Dagobert gefunden. Dem Brief legte er aber das Foto meines Vaters bei, ein kleines schwarzweißes Porträt, das ihn mit kurzgeschorenen Haaren in Häftlingsklamotten zeigt. Emma rechnete es dem Pastor hoch an, dass er das »Verbrecherfoto«, so nannte sie es, aus der Häftlingsakte rausgerissen hatte. Sie war überzeugt davon, dass er es wagte, weil er jahrelang die innigen Liebesbriefe meiner Eltern durchgelesen hatte.
Der zweite Brief kam direkt vom Standesamt Auschwitz. Briefmarke mit Hitlerkopf. Im Briefumschlag – ohne Kommentar – ein Dokument: eine ordentliche Sterbeurkunde mit vorgedrucktem Briefkopf. Das Blatt sah so vertrauenserweckend aus. Unlesbare Unterschrift, Behörden-Stempel: »Der Standesbeamte in Auschwitz«. Das konnte ganz zivil aus jeder normalen deutschen Kleinstadt kommen. Und günstig: Am unteren Rand der Urkunde, unter der Unterschrift, ein absurder Witz aus dem Holocaust: »Gebührenfrei«.
Englische Bomben, wie Himmelsgeschenke
Operation Gomorrha – der Feuersturm in Hamburg. Evakuierung nach Deggendorf.
Und weil ich unter dem Gelben Stern
In Deutschland geboren bin
Drum nahmen wir die englischen Bomben
Wie Himmelsgeschenke hin …
Im Stadtteil Hammerbrook lag ich im Sommer 1943 im Zentrum des Fegefeuers unter dem Bombenteppich, den die Alliierten mit der »Operation Gomorrha« über die Hansestadt ausgebreitet hatten. Meine Mutter freute sich über die englischen Bomben. Es war nur so unpraktisch, dass sie uns auf den Kopf fielen. Komplizierte private Interessenlage im welthistorischen Kuddelmuddel. Ich verstand nichts im Luftschutzkeller, außer Luftholen und Mamas Hand. Die Menschen verbrannten zu Tausenden in den von Bombenfeuern erleuchteten Nächten. Kein Gesicht, keine Farbe, keinen Geruch, kein Geräusch, keine Situation habe ich je aus dem Gedächtnis verloren. Die Erinnerung an dieses Inferno ist mir eingebrannt wie nichts sonst.
Wir schliefen jede Nacht voll angezogen in den Betten. Ein Fliegeralarm riss uns mal wieder hoch. Meine Mutter drückte mir einen Henkeltopf voll Mirabellenkompott in die Hand. Wir stürzten runter in den Luftschutzkeller. Und schon fielen die Bomben. Als das Haus über uns niederbrannte, schlug der Luftschutzwart mit einer Spitzhacke den dünn gemauerten Durchgang zum Nebenkeller auf.
Das ist meine Erinnerung: Urvertrauen. Ich drückte mein Gesicht in den weichen Mantel der Mutter, so konnte ich atmen. Geborgenheit mitten im Weltuntergang. Mama. Wir zwei blieben allein sitzen. Kein Mensch mehr da. Die Kellertreppe brannte schon. Die Hitze. Der Qualm. Wir tappten endlich doch den anderen hinterher, raus aus dem Keller durch das Mauerloch in den Keller des Nachbarhauses – von da nach oben. Dann Augen zu und durch die Feuerwand im Toreingang. So sprangen wir auf die Straße. Luft holen! Wassertuch vor die Nase!
Wenn ganze Straßenzüge brennen, entsteht ein gewaltiger Luftsog. Die heiße Luft rast nach oben, frische Luft strömt von allen Seiten ins Zentrum. Straßen, die in der Richtung des Luftsogs liegen, wirken wie riesenhafte Düsen. In solchem Gebläse brennt alles weg wie Zunder. Der Feuersturm riss ein brennendes Dach über den lodernden Häusern hoch und schleuderte es durch die Luft. Brüllende Blechpappe. Ein Stück Asphalt kochte, eine Frau blieb mit den Schuhen in der schwarzen Pampe stecken und sank um. Die Schwabenstraße, in der wir wohnten, lag günstig, quer zum Sturm. Funkenflug, glühende Holzteilchen brannten sich in die Kleider ein. Das nasse Tuch vorm Gesicht trocknete schnell aus, kein neues Wasser. Schwächere Menschen drehten sich lieber mit dem Rücken zum Sturm und ließen sich treiben.
Wir erreichten den Fabrikhof Ecke Nagelsweg. Die Panik, als irgendwelche Fässer explodierten. Berstende Chemie. Schönste Farbenspiele. Meine Mutter zerrte mich in ein riesiges Fabriklager, ein niedriger Raum voll mit Fässern. Schmale Gänge, aber frische Luft. Ein Däne aus der Nachbarschaft mit seiner Frau. Die beiden. Wir beiden. Wir suchen frisches Wasser für die Tücher. Nichts. Säure. Ätzende Flüssigkeiten. Das Tuch ist versaut. Dann eine Explosion. Der Raum schlägt voll schwarzen Rauch. Keine Hand vor Augen zu sehn, kein Weg zu finden durch die Tonnen, kein Ausgang, keine Luft. Das ist der Tod.