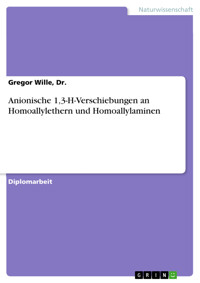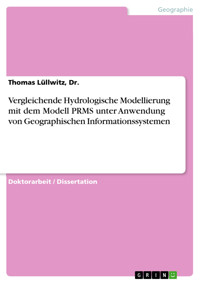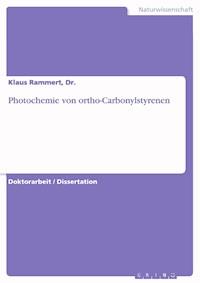Bäuerinnen in der Lebensmitte - Biografische Zusammenhänge ihrer Lebenskonflikte und deren Konsequenzen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen E-Book
Dr., Andrea Hötger
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Doktorarbeit / Dissertation aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: magna cum laude, Universität Bielefeld (Pädagogische Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: In der Zeit der Individualisierung könnte vermutet werden, dass milieuspezifische Unterschiede, sei es zwischen Stadt und Land, zwischen Landwirtschaft und anderen Berufszweigen, oder Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr relevant seien und insofern das Thema dieser Arbeit obsolet sei. Tatsächlich haben sich viele äußere Umstände der Bäuerinnen zum Positiven verändert: Die finanziellen Verhältnisse der noch existierenden Höfe sind oft gut, die Technisierung entlastet von starkem körperlichem Einsatz im Beruf, das Bildungsniveau der Frauen ist nicht niedriger als das der Männer, die Generationen leben in der Regel nicht mehr in einem Haushalt und können von daher einander ausweichen - wieso sollten die Bäuerinnen in der Lebensmitte noch spezifische Lebenskonflikte haben? Den mehrfach vorgebrachten Einwänden entgegen führt die Erfahrung in der Bildungsarbeit mit westfälischen Bäuerinnen in der Lebensmitte zu der These, dass diese Frauen immer noch von besonderen, mit der bäuerlichen Kultur zusammenhängenden Problemen betroffen sind. Gerade in der Lebensmitte stehen die bisherigen Lebensmuster aufgrund äußerer Veränderungen zur Disposition, und neue Entwürfe sind oft nicht vorhanden. Während die Bäuerinnen nach außen die Akzeptanz der Lebenssituation und die eigene Leistungsfähigkeit betonen, sind in informellen Situationen immer wieder Bedrücktheiten und Traurigkeiten zu spüren, die sich durch verschämtes Weinen, vorsichtiges Erzählen familiärer oder betrieblicher Gegebenheiten oder aber die Abweisung genau solcher Themen äußern. Die Erzählungen ranken sich im Alter von ca. 50 Jahren häufig um den bevorstehenden Generationenwechsel im Betrieb oder aber um längst vergangene Zeiten. Die im informellen Bereich der Seminare angesprochenen Themen nehmen jedoch im Seminarprogramm der Landvolkshochschulen nur wenig Raum ein. Angebot und Nachfrage richten sich vorwiegend auf zweckorientierte Seminare, wie z.B. Rhetorik für Vorstandsfrauen, allgemeine landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Kurse oder aber auf gesundheitsbezogene Veranstaltungen, religiöse Seminare und Einkehrtage. Die Bäuerinnen kommen gern und sooft ihre Familien oder sie selbst es sich erlauben, und nach den Veranstaltungen melden sie zurück: „Jetzt ist mein Akku wieder geladen“, oder: „Das Seminar war wie eine Oase für mich“. Die Bildungsangebote helfen den Frauen, die bestehende Situation besser zu ertragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Bäuerinnen in der Lebensmitte
Biografische Zusammenhänge ihrer Lebenskonflikte und deren Konsequenzen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen
Gutachterin: Prof. Dr. Katharina Gröning
Gutachter: Prof. Dr. Hans-Uwe Otto
Page 3
2.3.2 Entwicklungsaufgaben der Frauen... 69
2.3.3 Spezifische Herausforderungen für Bäuerinnen... 73
2.3.4 Folgerungen für die Entwicklungsaufgaben der Bäuerinnen2.4 Grundlagen der Forschung zur Moral der Bäuerinnen80 2.4.1 Moralentwicklung 81
2.4.2 Tabus
2.4.3 Moralvorstellungen der Bäuerinnen
2.4.4 Folgerungen für die Moral der Bäuerinnen
2.5 Agrarsoziologische Sicht auf Bäuerinnen110
2.5.1 Agrarsoziologie in der Bundesrepublik Deutschland 111
2.5.2 Der landwirtschaftliche Familienbetrieb
2.5.3 Frauenleitbilder im ländlichen Raum 120
2.5.4 Folgerungen für die Frauenleitbilder für Bäuerinnen2.6 Grundlagen der Theorie zur Landfrauenbildung in Landvolkshochschulen137
2.6.1 Die zwei Seiten des Bildungsbegriffes 137
2.6.2 Professionalität der Bildungsinstitutionen 138
2.6.3 Subjektivitätsförderndes, identitätsstärkendes Lernen 141
2.6.4 Frauenbildung
2.6.5 Landvolkshochschulbildung
2.6.6 Folgerungen für die Landfrauenbildung der
Page 4
3 Das Forschungsdesign155
3.1 Der Forschungsansatz
3.1.1 Biografieorientierte qualitative Sozialforschung 3.1.2 Theorie-Empirie-Relation3.2 Die Datenerhebung3.2.1 Interviewte und Interviewerin 3.2.2 Das narrative Interview3.3 Die Auswertung3.3.1 Rekonstruktive Fallanalyse 3.3.2 Darstellung der Ergebnisse
4 Fallanalysen168
4.1 Elisabeth Schweizer: „Einen Bauern heiratest du nie!“
4.1.1 Text- und thematische Feldanalyse 4.1.2 Rekonstruktion der Lebensgeschichte
4.1.3 Kontrastierung: Ich fühle mich wohl, wenn ich etwas tun kann,versus:Ich habe Sehnsucht danach, in Ruhe gelassen zu werden. 186
4.2 Anita Sauermann: „[E]rben möchte das jeder, aber bewirtschaften will es keiner“
4.2.1 Text- und thematische Feldanalyse 4.2.2 Rekonstruktion der Lebensgeschichte 4.2.3 Kontrastierung: Ich will eine perfekte Bäuerin sein,versus:Ich will in meiner Individualität anerkannt werden. 206
4.3 Margarete Tönnismann: „Eigentlich sollte ich ja den Hof mal übernehmen“
4.3.1 Text- und thematische Feldanalyse 4.3.2 Rekonstruktion der Lebensgeschichte 4.3.3 Kontrastierung: Ich habe alles im Griff,versus:Ich darf an
4.4 Typologie
5 Zusammenführung der Ergebnisse aus Empirie und Theorie232
5.1 Die Sozialisation der Bäuerinnen
5.2 Das Erbe der Bäuerinnen 5.3 Entwicklungsaufgaben der Bäuerinnen 5.4 Moral der Bäuerinnen 5.5 Frauenleitbilder der Bäuerinnen
6 Theoretische Verallgemeinerungen und Perspektiven253
6.1 Ergebnisse253
6.1.1 Lebenskonflikte der Bäuerinnen in der Lebensmitte
6.1.2 Entstehungszusammenhänge6.2 Offene Forschungsfragen
6.3 Eckpunkte für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen 6.4 Fazit
Literatur
Anhang4
Page 5
1 Einführung
1.1 Problemstellung
In der Zeit der Individualisierung könnte vermutet werden, dass milieuspezifische Unterschiede, sei es zwischen Stadt und Land, zwischen Landwirtschaft und anderen Berufszweigen, oder Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht mehr relevant seien und insofern das Thema dieser Arbeit obsolet sei. Tatsächlich haben sich viele äußere Umstände der Bäuerinnen zum Positiven verändert: Die finanziellen Verhältnisse der noch existierenden Höfe sind oft gut, die Technisierung entlastet von starkem körperlichem Einsatz im Beruf, das Bildungsniveau der Frauen ist nicht niedriger als das der Männer, die Generationen leben in der Regel nicht mehr in einem Haushalt und können von daher einander ausweichen - wieso sollten die Bäuerinnen in der Lebensmitte noch spezifische Lebenskonflikte haben?
Den mehrfach vorgebrachten Einwänden entgegen führt die Erfahrung in der Bildungsarbeit mit westfälischen Bäuerinnen in der Lebensmitte zu der These, dass diese Frauen immer noch von besonderen, mit der bäuerlichen Kultur zusammenhängenden Problemen betroffen sind. Gerade in der Lebensmitte stehen die bisherigen Lebensmuster auf-grund äußerer Veränderungen zur Disposition, und neue Entwürfe sind oft nicht vor-handen. Während die Bäuerinnen nach außen die Akzeptanz der Lebenssituation und die eigene Leistungsfähigkeit betonen, sind in informellen Situationen immer wieder Bedrücktheiten und Traurigkeiten zu spüren, die sich durch verschämtes Weinen, vorsichtiges Erzählen familiärer oder betrieblicher Gegebenheiten oder aber die Abweisung genau solcher Themen äußern. Die Erzählungen ranken sich im Alter von ca. 50 Jahren häufig um den bevorstehenden Generationenwechsel im Betrieb oder aber um längst vergangene Zeiten.
Die im informellen Bereich der Seminare angesprochenen Themen nehmen jedoch im Seminarprogramm der Landvolkshochschulen nur wenig Raum ein. Angebot und Nachfrage richten sich vorwiegend auf zweckorientierte Seminare, wie z.B. Rhetorik für Vor-standsfrauen, allgemeine landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Kurse oder aber auf gesundheitsbezogene Veranstaltungen, religiöse Seminare und Einkehrtage. Die Bäuerinnen kommen gern und sooft ihre Familien oder sie selbst es sich erlauben, und nach den Veranstaltungen melden sie zurück: „Jetzt ist mein Akku wieder geladen“, oder: „Das Seminar war wie eine Oase für mich“. Die Bildungsangebote helfen den Frauen, die bestehende Situation besser zu ertragen. Neben dieser entlastenden Funktion geschieht allerdings keine Veränderung der Umstände; statt dessen lässt das „Auftanken“ die Bäuerinnen weiterhin innerhalb der genannten Aufgaben „funktionieren“. Emanzipation im Sinne der Befreiung aus Abhängigkeiten erfolgt nicht. Das Phänomen der „geheimen“, aber tiefgründigen Lebenskonflikte der Landfrauen und die Hilflosigkeit der Bildungsarbeit der Landvolkshochschulen im Umgang mit diesen Themen ist der Anlass, die wissenschaftliche Forschung auf die bisherigen Erkenntnisse zu diesem Problem zu befragen. Insgesamt fällt bei der Literaturrecherche folgendes auf: Die Frauenforschung bietet reichlich aufschlussreiche Literatur über die weibliche Sozialisation, die Moral der Frauen und die Entwicklungsaufgaben der Frauen im allge-
Page 6
meinen. Die besondere Situation der Landfrauen wurde in diesem Bereich jedoch nicht behandelt.
Aus der vorwiegend durch Agrarwissenschaftler vertretenen agrarsoziologischen Richtung liegen verschiedene Untersuchungen der Situation auf dem Land und der Landfrauen vor. Darin geht es um Bestandsaufnahmen beispielsweise der Modernität des Landes, der wirtschaftlichen Situation der Landfrauen und des Wertes ihrer Arbeit. Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Individuum werden jedoch kaum hergestellt, Ursachenforschung wird wenig betrieben und auf die Frauenforschung wird bis auf wenige Ausnahmen kein Bezug genommen. Weder die vorliegende wissenschaftliche Literatur noch der Verband ländlicher Heimvolkshochschulen haben einen Bildungsansatz für Bäuerinnen vorzuweisen. Um in der Bildungsarbeit jedoch einen über eine momentane Entlastung hinausgehenden Effekt zu erreichen, bedarf es eines nachhaltigen, einen bewussten Umgang der Bildungsinstitutionen mit den Lebenskonflikten der Bäuerinnen und deren Entstehungszusammenhängen voraussetzenden Bildungsbegriffs. Diese Forschungs- und Konzeptlücke begründet das Thema: „Bäuerinnen in der Lebensmitte. Biografische Zusammenhänge ihrer Lebenskonflikte und deren Konsequenzen für den Bildungsbegriff in Landvolkshochschulen“ als Gegenstand einer Dissertation. Um Missverständnissen hinsichtlich des Inhalts der vorliegenden Arbeit vorzubeugen, ist die Terminologie des Themas zu definieren.
Mit dem Begriff Bäuerin werden in dieser Untersuchung Frauen bezeichnet, die auf Höfe geheiratet haben und mehr oder weniger eine Rolle im landwirtschaftlichen Betrieb einnehmen. In Regionen mit vorwiegend moderneren landwirtschaftlichen Betrieben wird das altmodisch anmutende Wort gern vermieden, da sich in Identifikation mit industrieller Produktion auch die Bauern lieber als Landwirte und ihre Frauen entsprechend mit „Landfrau“ bezeichnen. Der Begriff „Landfrau“ jedoch wird vor allem innerhalb des großen Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes (WLLV) längst nicht mehr nur für Frauen auf Höfen, sondern allgemein für Frauen auf dem Land verwendet. Als im Titel der Untersuchung verwandte Bezeichnung würde er Irritationen stiften. Innerhalb der Arbeit werden jedoch die Begriffe Landfrau und Bäuerin gleichbedeutend im oben genannten Sinne benutzt.
Die Lebensmitte der Frauen liegt angesichts einer statistischen Lebenserwartung von ca. 80 Jahren rein rechnerisch bei einem Alter von ca. 40 Jahren. Die vorliegende Untersuchung bezieht sich allerdings eher auf das „mittlere Erwachsenenalter“ (vgl. Erikson 2000) um die 50 Jahre. Ich halte im Titel dennoch an dem zum einen geläufigeren Begriff der Lebensmitte fest, weil zum anderen die Phänomene der Lebensmitte immer später anzutreffen sind (vgl. Nuber 2002, 25). In der vorliegenden Arbeit sind die Begriffe Lebensmitte und mittleres Erwachsenenalter bedeutungsgleich benutzt vorzufinden. Als Biografie wird in der vorliegenden Untersuchung die Lebensgeschichte der Bäuerinnen bezeichnet. Herauszustellen für das Verständnis des Begriffs ist seine individuelle wie auch kulturell-gesellschaftliche Dimension (vgl. Rosenthal 1995). Konflikte beinhalten das Zusammenstoßen unterschiedlicher Interessen und Motive. Diese können zwischen verschiedenen Menschen, einem Menschen und seiner Kultur, aber auch innerhalb eines Menschen vorhanden sein. In der vorliegenden Untersuchung
Page 7
geht es um Konflikte der Bäuerinnen, die zwar insbesondere in der Lebensmitte zu Tage treten, jedoch latent das ganze Leben durchziehen und deshalb als Lebenskonflikte bezeichnet werden.
Mit dem Wort Bildungsbegriff wird verdeutlicht, dass es sich bei den ausgeführten Perspektiven für die Bildungsarbeit weniger um ein ausgearbeitetes praktisches Bildungskonzept handelt als vielmehr um die grundlegende Ausrichtung der Bildung. Mit dem Ziel, den Bäuerinnen zum einen zu einer nachhaltigen Entlastung zu verhelfen und zum anderen eine Entwicklungsperspektive für ihre Persönlichkeit wie auch für die sie umgebenden Strukturen aufzuzeigen, werden Eckpunkte eines gesellschaftskritischen Bildungsbegriffs formuliert.
Landvolkshochschulen sind ländliche Heimvolkshochschulen, d.h. Bildungsinstitutionen mit mehrtägigen Seminaren für die ländliche Bevölkerung. Näheres zur Genese und Bestimmung folgt in Kapitel 2.6.5.
1.2 Theoretische Anlage und Aufbau der Arbeit
Hinsichtlich der Lebenskonflikte der Bäuerinnen in der Lebensmitte ist anzunehmen, dass für die bedrückte Stimmung der Frauen nicht nur sichtbare Faktoren wie das Arbeitsaufkommen, die wohnliche Situation oder der körperliche Zustand relevant sind. Für die Einzelne wirken sich meines Erachtens darüber hinaus unsichtbare Mechanismen insbesondere innerhalb der Familie, des Betriebs und der bäuerlichen Gesellschaft aus. Die Vergangenheit der betroffenen Bäuerin, ihre Sozialisation, ist in diesem Zusammenhang ebenso wichtig wie die Vergangenheit des Betriebs, seine Tradition, sein Erbe. Insofern grenzt sich die vorliegende Arbeit von rein deskriptiven, beispielsweise von der traditionellen Agrarsoziologie vorgelegten Studien ab. Sie vermeidet es, mit Hinweis auf die Freiheit des Individuums die Ursache der Probleme einzig bei diesem selbst zu suchen, und unterlässt es ebenso, diese allein gesellschaftlichen Gegebenheiten zuzuschreiben. In der vorliegenden Arbeit wird die gegenseitige Beeinflussung von Subjekt und Gesellschaft zu Grunde gelegt. Dadurch können im Bildungsprozess die gewonnenen Erkenntnisse den Bildungsinstitutionen als Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Individuum optimal dienlich sein. Auf der Grundlage der genannten Korrelation sind Theorien möglicher Entstehungszusammenhänge ausgewählt worden sowie ein biografieorientierter qualitativer empirischer Ansatz, der die Forschungslücke hinsichtlich der speziellen Situation der Bäuerinnen - hier am Beispiel westfälischer Bäuerinnen - füllen soll. Auch der Bildungsbegriff leitet sich von diesem Verständnis ab. Aufgrund der Forschungslücke hinsichtlich der Ursachen der Situation der Bäuerinnen werden im theoretischen Teil allgemeine Erkenntnisse zu bestimmten Themenbereichen mit Ergebnissen der Frauenforschung und Untersuchungen zum bäuerlichen Milieu in Beziehung gesetzt. Um biografischen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, interessiert als erstes die in Kapitel 2.1 dargestellte Sozialisation der Bäuerin. Die Zusammenhänge zwischen Kultur und Individuum werden durch das zu Grunde gelegte Habituskonzept Pierre Bourdieus (1997) berücksichtigt.
Kapitel 2.2 stellt die besondere Bedeutung des Erbes und die damit verbundene Verknüpfung der Generationen dar. Dieser Themenbereich tritt in informellen Gesprächen
Page 8
mit Bäuerinnen, insbesondere wenn der Generationenwechsel ansteht, häufig zu Tage. An Bourdieus Theorie anknüpfend wird die von Marianne Kosmann (1998) herausgearbeitete Frauenperspektive auf Erbangelegenheiten als Erkenntnisgrundlage hinzugezogen.
Da das Erkenntnisinteresse an der Lebensmitte eine Lebensstufe betrifft, werden in Kapitel 2.3 Entwicklungsaufgaben insbesondere nach der Theorie Erich H. Eriksons (2000) dargestellt. Aufgrund der besonderen Situation der Einheirat der Bäuerinnen in die Schwiegerfamilie wird ein weiteres Augenmerk auf die Phase des frühen Erwachsenenalters gelegt.
Das beobachtete Phänomen der allzeit verfügbaren Bäuerin legt eine in Kapitel 2.4 beschriebene Auseinandersetzung mit der Moral und den Tabus der Frauen und insbesondere der Bäuerinnen nahe. In Hinsicht auf die Moralentwicklung der Frau wird das Modell Carol Gilligans (1988) betrachtet und in Bezug auf die Bäuerin diskutiert. Die Frage der Tabus wird unter anderem mithilfe des ethnopsychoanalytischen, den Zusammenhang zwischen einer Kultur und den vorzufindenden Tabus beschreibenden Ansatzes Mario Erdheims (1997) betrachtet.
Nach diesen theoretischen, auf mögliche Entstehungszusammenhänge der Lebenskonflikte der Bäuerinnen hin befragten Ansätzen wendet sich Kapitel 2.5 den bereits vor-handenen agrarsoziologischen Erkenntnissen über Bäuerinnen zu. Nach der Einordnung der wissenschaftlichen Ausrichtung der Agrarsoziologie werden die grundlegende Kate-gorie des „landwirtschaftlichen Familienbetriebs“ mit seinen Konsequenzen für die Rolle der Bäuerin beleuchtet sowie die Frauenleitbilder des landwirtschaftlichen Milieus herausgearbeitet und diskutiert.
Der Frage nach dem Bildungsbegriff der Landvolkshochschulen folgend befasst sich Kapitel 2.6 mit Bildungsbegriffen im Allgemeinen, der Rolle der Institutionen und pädagogischen Kräfte im Bildungsprozess, feministischen Frauenbildungsansätzen sowie der Geschichte und dem Status quo der Landvolkshochschulen und ihrer Frauenbildungsansätze.
Nach diesen die Theorie betreffenden Darstellungen und Diskussionen folgt der empirische Teil der Studie, dessen Forschungsdesign in Kapitel 3 als biografieorientierte qualitative Sozialforschung in Anlehnung an Gabriele Rosenthal (1995) vorgestellt wird. Drei der narrativen Interviews werden in Kapitel 4 mithilfe der Darstellung und Kontrastierung erlebter und erzählter Lebensgeschichte analysiert. In Kapitel 4.4 werden die drei Typen des Umgangs der Bäuerinnen mit der Situation der Lebensmitte und dessen Ursachen und Konsequenzen für mögliche Lebenskonflikte voneinander unterschieden. Im Anschluss an die Empirie werden in Kapitel 5 die theoretischen und empirischen Ergebnisse miteinander verglichen und Übereinstimmungen wie Abweichungen beschrieben. Weitere zum Verständnis notwendige Theorieelemente werden ergänzt. Aus der Zusammenführung aller herausgearbeiteten Erkenntnisse ergeben sich theoretische Verallgemeinerungen hinsichtlich der Lebenskonflikte der Landfrauen und deren Entstehungszusammenhänge sowie weitere offene Forschungsfragen, die in Kapitel 6 nachzulesen sind. Auf die Problemstellung des fehlenden Bildungskonzeptes für die Arbeit mit Bäuerinnen in Landvolkshochschulen antwortet Kapitel 6.3 mit einem Plädoyer für
Page 9
einen gesellschaftskritischen Bildungsbegriff. Die aufgezeigten Eckpunkte intendieren neben einer nachhaltigen Erleichterung der Bäuerinnen durch die Integration bisher ungelebter Anteile auch deren Emanzipation in ihrem konkreten Umfeld - nicht zuletzt innerhalb der Bildungsinstitution. Sie beinhalten neue Herausforderungen hinsichtlich der Bewusstmachung automatisierter Vorgänge für die Bildungsinstitutionen und die darin arbeitenden Pädagoginnen und Pädagogen.
Page 10
2. Vorliegende Theorien relevanter
Themenkomplexe
2.1 Grundlagen der Forschung zur Sozialisation der
Bäuerinnen
Da die spezifischen Sozialisation der Bäuerinnen in der wissenschaftlichen Literatur noch nicht bearbeitet wurde, werden in diesem Kapitel sich daran annähernde Theorien behandelt. Im Zentrum der allgemeinen Grundlagen der Sozialisation in Kapitel 2.1.1 steht das als Basis für das Verständnis milieuspezifischer Sozialisation dienende Habituskonzept Pierre Bourdieus (1997a). Kapitel 2.1.2 enthält wesentliche Theorien der weiblichen Sozialisation, in der Annahme, dass diese mit einigen Abweichungen auch auf Bäuerinnen zutrifft. Die ländliche Sozialisation wird in Kapitel 2.1.3 beschrieben und umfasst neben geschlechtsunabhängigen Aspekten auch die Sozialisation der Mädchen auf dem Land. Die Folgerungen dieser Theorien für die Sozialisation der Bäuerinnen finden sich in Kapitel 2.1.4.
2.1.1 Allgemeine Grundlagen
2.1.1.1 Definition
„Sozialisation ist nicht einfach die (freiwillige oder erzwungene) Übernahme gesellschaftlicher Erwartungen in psychische Strukturen, sondern ein Prozess der aktiven Aneignung von Umweltbedingungen durch den Menschen“ (Tillmann 2000,12),
so die klassische Definition Klaus-Jürgen Tillmanns in seinem Werk „Sozialisationstheorien“. Die gesellschaftlichen Erwartungen, die Umweltbedingungen bilden also trotz der „aktiven Aneignung“ des Menschen die Voraussetzung für die jeweilige Sozialisation. Im Zusammenhang mit dem Stichwort der Moderne „Individualisierung“ werden kulturelle Eigenheiten schnell unterbewertet. Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim (1994) definieren Individualisierung wie folgt:
„Individualisierung meint zum einen dieAuflösungvorgegebener sozialer Lebensformen - zum Beispiel das Brüchigwerden von lebensweltlichen Kategorien wie Klasse und Stand, Geschlechtsrollen, Familie, Nachbarschaft usw.; oder auch, wie im Fall der DDR und anderer Ostblockstaaten, der Zusammenbruch staatlich verordneter Normalbiographien, Orientierungsrahmen und Leitbilder.“ (Beck/Beck-Gernsheim 1994, 11)
Aus dieser Betonung der „Brüchigkeit“ lebensweltlich bedingter Normen1wird für die heutige Zeit oftmals absolute Freiheit unabhängig von Bindungen durch von Klasse und Geschlecht gefolgert. Demnach erübrigte sich die Frage nach einer geschlechts- und milieuspezifischen Sozialisation. Die sozialen Voraussetzungen der „Genese der Persönlichkeit“ (Tillmann 2000, 12) werden unter der Bedingung grenzenloser Freiheit jedoch unterbewertet, wenn nicht gar nivelliert. Tillmann hingegen geht in der o.g. Definition von durch Umweltbedingungen geprägten „Sozialcharakteren“ aus. Im Rahmen der vorliegenden, sich mit Frauen eines bestimmten Milieus beschäftigenden Studie wird eine
1Beck selbst beschreibt jedoch schon 1986 die durch sekundäre Instanzen geprägten „Widersprüche im Individualisierungsprozeß“ (Beck 1986, 211).
Page 11
starke Prägekraft des menschlichen Umfelds vorausgesetzt, die individuelle Entwicklungsspielräume in eher begrenztem Maße zulässt.
Tillmanns Unterscheidung der primären, d.h. familiären, durch Bindung und sekundären, d.h. durch Institution und Gesellschaft ausgelösten Sozialisation ist innerhalb von Biografien als Chronologie zu verstehen. Zu beachten ist, dass bereits die familiäre Konstellation gesellschaftlich bedingt und Familie, vor allem die Landwirtsfamilie als Einheit von Betrieb und Familie, eine Institution ist.
Für die Auswahl der dargestellten Sozialisationstheorien wird folgende Definition zugrunde gelegt:
„Sie [die Sozialisationstheorie, A.d.V.] hat zum einen die eher psychologische Frage aufzuklären, wie sich Subjekte ihre unmittelbare soziale Umwelt aneignen und dabei ihre Persönlichkeitsstrukturen ausbilden. Zum anderen hat sie das eher soziologische Problem zu behandeln, welche Zusammenhänge zwischen diesen Umweltbedingungen und umfassenderen gesamtgesellschaftlichen Strukturen bestehen.“ (Tillmann 2000, 17)
2.1.1.2 Das Habituskonzept
Dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) ist ein Konzept über die Wechselwirkung zwischen der prägenden Kraft der Gesellschaft und dem Individuum zu verdanken. Da er die einzelnen Entwicklungsphasen des Menschen außer Acht lässt, handelt es sich nicht um einen Sozialisationsansatz im eigentlichen Sinne. Seinem Selbstverständnis entsprechend, eher Kultursoziologe oder Ethnologe als Sozialisationsexperte zu sein (vgl. Liebau 1997, 52), spart er z.B. den Bereich der Familie in seinen Untersuchungen aus und bezeichnet dies selbst als „Lücke“ (vgl. Liebau 1987, 80). Erst Eckart Liebau (1997) untersuchte ausführlich Bourdieus Ausführungen auf die Konsequenzen für die Sozialisation hin. Das Habituskonzept ist insofern für diese Studie ausführenswert, als es sowohl zur Erklärung der geschlechtsspezifischen Sozialisation als auch der bäuerlichen Sozialisation angewandt wurde - allerdings noch nicht in der Kombination weiblichundbäuerlich.
Der Habitus eines Menschen wird nach Bourdieu (1997a) durch seine eigene Vergangenheit und die seiner Kultur, seiner Familie geprägt:
„Wesenist was gewesen ist.Es ist wahr, daß das gesellschaftliche Sein das ist, was gewesen ist, aber auch, daß das, was einmal gewesen ist, für immer nicht nur in die Geschichte, was sich von selbst versteht, sondern in das gesellschaftliche Sein, in die Dinge und auch die Körper eingeschrieben ist.“ (ebd., 51)
Gesellschaftliche Geschichte manifestiert sich in der Person. Relevant für die Sozialisation sind gruppen- bzw. klassenspezifische Unterschiede. Statt von „Klassen“ spricht Bourdieu allerdings von „sozialen Räumen“, in denen sich vermehrt bestimmte Praktiken und Geschmäcker, sog. „Dispositionen“, ausbilden, weil die jeweiligen Individuen sie „inkorporiert“, d.h. in den Körper aufgenommen haben. Dieser Logik folgend kann ein mangelndes Zugeständnis an eigene Gestaltungsmöglichkeiten der Individuen hinsichtlich ihrer Entwicklung vermutet werden. Tatsächlich wird im Habituskonzept eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten des Menschen durch kulturelle - nicht etwa biologische - Festlegungen zu Grunde gelegt. Inwieweit der Habitus in Folge der genannten
Page 12
Umschreibungen deterministisch ist, wurde schon vielfach diskutiert.2Bourdieu geht mit Leibniz davon aus, dass drei Viertel unserer Handlungen unbewusst sind (vgl. Liebau 1987, 59). Die Vollzüge des Habitus sind in erster Linie unbewusste Handlungen:„Die habituellen Dispositionen sind auf eine derart fundamentale Weise im Körper verankert, dass sie bis in die entwicklungspsychologisch grundlegende Schicht der motorischen Schemata reichen und dadurch die menschliche Existenzweise von Grund auf prägen.“ (Schwingel 2000, 62)Bourdieu wehrt sich gegen den Vorwurf des Determinismus, ohne die Determinanten zu leugnen. Sein Ziel ist es, diese aufzudecken. Der primäre Habitus, die ältesten inkorporierten Dispositionen, sind zwar nicht als Verhängnis, jedoch als schicksalsprägend zu bezeichnen. Der Habitus stellt die Vermittlung zwischen Struktur und Subjekt dar, welches als „sozialer Akteur“ bezeichnet wird, und
„fragt nach den Bedingungen und Formen der alltäglichen Praxis und ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Reproduktion und die individuellen, gruppenspezifischen Lebensstile und Lern-formen“ (Liebau/Müller-Rolli 1985, 273).
Der Habitus sagt weniger über den ganzen Menschen aus als vielmehr über den gesellschaftlich gewordenen „sozialen Akteur“ und geht folglich nicht von einem normativen Subjekt-Modell aus:
„Habitus ist der Begriff, mit dem Bourdieu die im Individuum gewordene Gesellschaft zu rekonstruieren versucht, genauer: die Individuum gewordene Gestalt von Gesellschaft. Habitus ist also ein Begriff, mit dem nicht etwa eine vollständige Bestimmung des Subjekts versucht wird, sondern dieser Begriff analysiert das Subjekt nur als sozialen Akteur, also unter der soziologischen Perspektive. Es ist der Mensch als Zustand des Sozialen, der mit diesem Begriff thematisch wird, nicht der ganze Mensch oder das Subjekt im normativen Sinn.“ (Liebau 1987, 61)Der Habitus beinhaltet für den „sozialen Akteur“ ein Gesetz der Notwendigkeit, die eine Möglichkeit der Freiheit enthält. Die Freiheit liegt im Erkennen genau dieses Gesetzes:„Die Freiheit besteht nicht darin, diese Notwendigkeit magisch zu verleugnen, sondern darin, sie zu erkennen, was keineswegs dazu verpflichtet und berechtigt, sie anzuerkennen. Die wissenschaftliche Erkenntnis der Notwendigkeit schließt die Möglichkeit einer Aktion ein, die darauf abzielt, sie zu neutralisieren und mithin eine mögliche Freiheit, während das Nichterkennen der Notwendigkeit deren Anerkennung in uneingeschränkter Form impliziert.“ (Bourdieu 1997b, 57)Die „sozialen Akteure“ handeln nach den oft unbewussten Regeln des jeweiligen „sozialen Raumes“ strategisch nach den Prinzipien des „sozialen Sinns“. Gleichzeitig vermitteln sie die übernommenen Regeln weiter. Damit wird der Habitus „generativ“ und „reprodukiv“. Gerhard Portele (1985) spricht in diesem Zusammenhang von „Zirkularität“:„Die ‚objektiven Strukturen’ der Gesellschaft, die ‚Existenzbedingungen’ generieren den Habitus im einzelnen, der Habitus generiert die Praxis, die Praxis generiert die objektiven Strukturen.“ (Portele 1985, 303)
Der Mensch ist gleichzeitig Objekt und Subjekt der Strukturen. Die Entwicklung des Einzelnen geschieht auf dem „Weg durch den sozialen Raum“ (Liebau 1987, 90). Durch den Erwerb einer Position - sei es eine formelle oder informelle -, die andere Dispositionen voraussetzt, als sie der soziale Akteur mitbringt, ist er gezwungen, dazuzulernen. Er hat nicht nur die Freiheit, sondern vielmehr die Pflicht, sich den entsprechenden Erwartungen anzupassen. Für ein Gelingen dieses Prozesses darf allerdings der Abstand zwischen „positioneller Kompetenz“ und „individueller Kompetenz“ nicht zu groß sein.3Der Weg zu neuen Habitusformen wird jedoch nicht zuletzt deshalb oft nicht gegangen, weil er viel Energie kostet:
2Vgl. Gerhard Portele und Gottfried Pfeffer (1985); Liebau (1984; 1987); Bourdieu in einem Interview (1997, 31ff); Mathilde Kreil (1995, 40f).
3Zur Doppeldeutigkeit des Kompetenzbegriffs ausführlicher Liebau (1987, 72ff).
Page 13
„Unter sozialisationsökonomischen Gesichtspunkten ist der Erwerb nichtredundanter Habitus-formen immer mit einem erheblich größeren Aufwand verbunden als eine bloße Kompetenz-Komplettierung innerhalb im ganzen redundanter Habitusformen. Das liegt nicht nur daran, daß ggf. das Risiko des Fehlschlags sehr viel größer sein kann[...],sondern liegt daran, daß der Erwerb nicht-redundanter Habitusformen mit einer Transformation der Gestalt des Individualhabitus verbunden ist.“ (Liebau 1987, 92)
Nicht zuletzt wird in durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen hervorgerufenen Krisen die „Doxa“, d.h. die im Habitus verankerte Selbstverständlichkeit bestimmter Handlungen hinterfragt. Die Krise führt insofern vom Unbewussten zum Bewussten und damit zu etwas, was den Menschen nicht mehr selbstverständlich führt. Darüber hinaus kann die „Entfremdung“ der eigenen Erfahrung z.B. durch die Spiegelung eigenen Verhaltens zur Bewusstwerdung führen, deren Bedeutung Bourdieu betont: „Dabei denke ich allen Ernstes, dass die Intention der Aufdeckung gesellschaftlicher Zwänge emanzipatorisch ist.“ (1997b, 46)
Dennoch genügt zur Veränderung des Habitus Einsicht allein nicht. Bourdieu versteht seinen auf empirischer Grundlage entstandenen (vgl. Bourdieu 1982) Ansatz des Habitus nicht als Theorie, sondern bezeichnet ihn als „Praxeologie“, d.h. sein Konzept hat die Praktiken des Menschen zum Ausgangspunkt. Der Habitus wird durch praktisches Handeln inkorporiert. Insofern macht Bourdieu als „Praxeologe“ darauf aufmerksam, dass sich ein bereits erworbener Habitus erst durch wiederholtes Tun in einer fremden Kultur verändern kann. Darum muss ein „Übergang vom Einzelnen zu einer Gruppe“ (Bourdieu, zit. nach Liebau 1987, 96) geschaffen werden. Die praktische körperliche Arbeit im bäuerlichen Milieu, die Kinder durch ihre Mithilfe (vgl. Kutsch 2000) bereits früh mit vollziehen, legt dieses praxeologische Konzept als Grundlage der vorliegenden Untersuchung besonders nahe.
2.1.2 Weibliche Sozialisation
2.1.2.1 Ansätze der Frauenforschung
Die Schwierigkeiten einer geschlechtsspezifischen Sozialisationstheorie sind vielfach diskutiert worden (vgl. Hoffmann 1997, 2000). Helga Bilden (1991) beschreibt deren mögliche Konsequenzen für das Menschen bzw. Frauenbild: Neben der Vorstellung vom Individuum als Objekt von Sozialisationsprozessen und der der Entstehung einer stabilen Persönlichkeit befürchtet sie aufgrund der Beschreibung geschlechtsspezifischer Sozialcharaktere einen „schematisierendenDualismus von männlich-weiblich“(dies., 279). Um einer Unmöglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung entgegen zu wirken, ist in den Theorien die aktive Seite der Sozialisation zu beachten. Die komplementäre Sichtweise des Geschlechts beinhaltet in patriarchalen Verhältnissen eine Unterordnung der Frauen. Durch die Veröffentlichungen geschlechtsspezifischer Untersuchungen werden allerdings Zusammenhänge aufgedeckt, die das bestehende Geschlechterverhältnis reproduzierende Verhaltensweisen in Frage stellen und die Suche nach Alternativen forcieren.
Innerhalb der Frauenforschung nimmt die geschlechtsspezifische Sozialisation großen Stellenwert ein. Die Theorien reichen von Gleichheits- bis zu Differenzansätzen. Ein Beharren auf den Differenzen der Geschlechter innerhalb einer männerdominierten
Page 14
Gesellschaft führt in der Praxis immer zu einer Zweitrangigkeit der Frauen. Eine Gleichheitsideologie bedeutet hingegen eine Anpassung an die durch Männer repräsentierten Verhaltensformen bei Nichtachtung andersartiger Möglichkeiten. Annedore Prengel (1990) entwirft hingegen das Modell der „Demokratischen Differenz“. Es beinhaltet die Anerkennung der Unterschiede bei gleicher Teilhabe an Ressourcen. So sehr diese Perspektive den Menschenrechten entspricht, geht sie nach wie vor von - wenn auch gewachsenen - Unterschieden aus.
Die Unterscheidung zwischen dem biologischen, körperlichen Geschlecht „sex“ und dem kulturellen, sozialen Geschlecht „gender“ bringt eine neue Differenzierungsmöglichkeit mit sich. Ursprünglich stammt diese Unterscheidung aus der medizinischpsychiatrischen Diskussion der fünfziger Jahre um die Transsexualität. Die feministische Theorie hat in den siebziger Jahren das Konzept aufgegriffen, um die immer wieder mit der „Natur der Frau“ begründeten Diskriminierungen zu entlarven (vgl. Becker-Schmidt/Knapp 2000, 69).
Heute wird u.a. die „Dekonstruktion“4der Geschlechterverhältnisse propagiert. Die Zweigeschlechtlichkeit im Sinne von „sex“ gilt demnach bereits als kulturell konstruiert und fällt damit in die Kategorie „gender“. Es ist folglich nicht weiter von Geschlechtsdifferenzen auszugehen, da die Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit durch die Unterscheidung nur manifestiert wird. Diese Sicht beinhaltet allerdings eine von Metz-Göckel nicht geteilte Ignoranz gegebener und letztlich prägender Unterschiede: „Aus der Perspektive der Frauen- und Geschlechterforschung zur Sozialisation von Mädchen und Jungen ist von einem Nebeneinander von höchst Unterschiedlichem auszugehen.“ (Metz-Göckel 2000, 111) In Anlehnung an diese Sicht wird in der vorliegenden Untersuchung von der „Konstruktion“ der Unterschiede ausgegangen. Im deutschsprachigen Raum befasst sich Carol Hagemann-White seit den achtziger Jahren mit dem „kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit“. Es beinhaltet für jedes Geschlecht die Erwartung bestimmter Verhaltensformen und Persönlichkeitsmerkmale. Je nach Geschlecht werden bestimmte Handlungen belohnt oder sanktioniert. In einer patriarchalen Gesellschaft führt dies zur Zweitrangigkeit der Frauen:
„So gilt recht allgemein, daß der Tätigkeitsbereich der Männer übergreifend ist und gewissermaßen den der Frauen umfaßt. Wird der öffentliche Bereich den Männern und der häusliche Bereich den Frauen zugewiesen, ist Öffentlichkeit als Sorge um das Gemeinwohl (also auch um die Bedingungen der Möglichkeit häuslichen Wirtschaftens) gedacht, während Frauenarbeit als Zuarbeit oder als Sorge um das Besondere, um die eigenen Angehörigen, das eigene Haus erscheint.“ (Hagemann-White 1984, 80)
Frauen sind jedoch nicht als passive Opfer5zu sehen, sondern arbeiten aktiv an der Geschlechtersozialisation mit. Diese Fortführung der Geschlechterverhältnisse nennen Hagemann-White und nach ihr weitere Frauen (vgl. Bührmann u.a. 2000, 106ff) „doing gender“.
„Geschlechtersozialisation besteht dann darin, dass Jungen und Mädchen ein Regelsystem übernehmen, mit dessen Hilfe sie lernen, sich in den vielfältigen Interaktionen und sozialen Situationen als Junge oder Mädchen darzustellen und voneinander abzugrenzen, so dass sie ‚eindeutig’ geschlechtlich identifiziert werden können und die entsprechende soziale Anerkennung finden.“ (Metz-Göckel 2000, 108)
4Vorreiterin in diesem Bereich ist die Amerikanerin Judith Butler (1991).5Vgl. auch die Theorie Christina Thürmer-Rohrs von der „Mittäterschaft“ der Frau (dies. 1989)
Page 15
Frauen wie Männer reproduzieren durch ihre Interaktionen die Verhaltensformen und geben sie an die kommenden Generationen weiter. Dies schließt jedoch kein gleichförmiges Verhalten aller Frauen ein. Die Unterschiede zwischen Frauen und wie sie zustande kommen bedürfen innerhalb der Frauenforschung eines besonderen Augenmerks, um gezielt die Reproduktionskreisläufe durchbrechen zu können.
2.1.2.2 Geschlechtsidentitätsentwicklung nach der
Objektbeziehungstheorie
Sigmund Freud hat als erster den Erwerb der Geschlechtsidentität durch die Objektbe-ziehungstheorie beschrieben (ders. 2000). Seine Ausführungen sind vielfach zitiert6und kritisiert worden. Dennoch ist diese Theorie von weitreichender Bedeutung für die primäre Sozialisation:
„Im Unterschied zu anderen Sozialisationstheorien, etwa lerntheoretisch fundierten, wird in der Psychoanalyse die emotional-affektive und interaktionsdynamische Basis des Erwerbs von Selbst-und Fremdkonzepten der Geschlechtsrollenidentität herausgearbeitet.“ (Scarbath 1992, 116)Freud beschreibt in den „[d]rei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ die psychosexuelle Entwicklung des Jungen und des Mädchens als „zweizeitig“ (vgl. ders. 2000). Die erste Phase ist die der ödipalen Situation, die zweite die der Pubertät. In der ödipalen Phase geht es um die Bindungen der Objektbeziehungen. Bis zur genitalen Phase (2.-5. Lebensjahr), also in der oralen und analen Phase, ist die Entwicklung bei Junge und Mädchen relativ identisch. Ca. ab dem 5. Lebensjahr beginnt beim Jungen die sogenannte ödipale Situation. Die Ödipuseinstellung schließt den kindlichen Wunsch ein, die eigene genitale Sexualität mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil auszuleben. Der Junge fürchtet als Folge seiner Mutterverliebtheit die Kastration7. Er gibt die libidinöse Objektbesetzung zur Mutter auf und internalisiert durch die angedrohte Kastration das Inzesttabu. Er wendet sich dem Vater zu, möchte so sein wie er und zeigt verstärkt „männliches Verhalten“. In dieser schockartigen Abwendung von der Mutter wird das Über-Ich aufgerichtet (vgl. Tillmann 2000, 65). Beim Mädchen wird ebenfalls von einer prä-ödipalen Bindung an die Mutter ausgegangen. Durch das Entdecken der eigenen Penislosigkeit entwickelt das Mädchen Penisneid und wendet sich von der Mutter ab und dem Vater zu. Aus dieser Position heraus beginnt sich das Mädchen mit der Mutter zu identifizieren. Es will so werden wie sie, um vom Vater geliebt zu werden. Die ödipale Situation wird im Gegensatz zu der des Jungen nur langsam verlassen. Deshalb ist nach Freud die Über-Ich-Aufrichtung weniger eindeutig als beim Jungen, bei dem dies geradezu schockartig geschieht.8
Freud leitet von der Unterschiedlichkeit der Jungen und Mädchen innerhalb der ödipalen Phase eine gebrochene Identität der Mädchen ab (vgl. Tillmann 2000, 69).„Charakterzüge, die die Kritik seit jeher dem Weibe vorgehalten hat, daß es weniger Rechtsgefühl zeigt als der Mann, weniger Neigung zur Unterwerfung unter die großen Notwendigkeiten des
6Beispielsweise durch Tillmann (2000).
7Freud geht davon aus, dass dem Jungen bei seiner frühen Onanie die Kastration als Strafe angedeutet wurde (vgl. Freud 2000 Bd. 1, 522).
8Eva S. Poluda-Korte geht im Gegensatz zu Freud von einem strenger entwickelten Über-Ich bei Mädchen aus, das durch die aus der heterosexuellen Geschlechterordnung resultierenden Aggressionen entsteht (dies. 1998, 151).
Page 16
Lebens, sich öfter in seinen Entscheidungen von zärtlichen und feindseligen Gefühlen leiten läßt, fänden in der oben abgeleiteten Modifikation der Über-Ichbildung eine ausreichende Begründung.“ (Freud 2000 Bd. V, 266)
Freud folgert im Weiteren aus der Identifikation von Töchtern mit ihren Müttern die Übernahme der weiblichen Passivität und der Unterordnung der Frau (vgl. Freud 2000 Bd. I, 563f).9Dass er aus biologischen Beobachtungen soziologische Folgerungen zieht, ist allerdings kritisch zu betrachten. Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren der Prägung. Horst Scarbath erklärt Freuds Interpretationen mit dem Zeitgeist:
„Solches Denken entspricht nicht nur den bürgerlichen Rollenbildern bzw. -klischees der Jahr-hundertwende, sondern auch - was oft übersehen wird - einem für das biologische, anthropologische und entwicklungspsychologische Denken des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts typischen Konzept: dem eines‚psychophysischen Parallelismus’,wonach biologischen (insbesondere anatomischen) Phänomenen eine Indikatorfunktion für psychosoziale Sachverhalte zukommt. Die (zumal in der damaligen sexuellen Interaktion ‚normale’) aktiv-eindringende Funktion des Phallus und die passiv-aufnehmende der Vagina wurden offenbar auch vonFreudals Indi-katoren für eine grundsätzliche Geschlechter- und Lebenspolarität aufgefaßt.“ (Scarbath 1992, 119)
Erwartungsgemäß äußern gerade feministische Autorinnen Kritik an dieser Deutungsweise. Die Psychoanalytikerin Nancy Chodorow beispielsweise folgert aus der Objektbe-ziehungstheorie wertschätzende Konsequenzen für Mädchen. In ihrem Werk „Das Erbe der Mütter“ (1994) knüpft sie ebenso wie Freud an der Ablösung des Kindes von der Mutter an. Der Individuationsprozess findet schon nach Freud bei Mädchen allmählich statt. Da sich die Tochter gleichzeitig von der Mutter abwenden und mit ihr identifizieren muss, bleibt trotz aller Trennung auch Bindung erhalten.
„Doch - völlig anders als bei Freud - entsteht auf diese Weise nicht eine charakterliche Minderwertigkeit des Weibes, sondern - eher im Gegenteil - ein weitaus höheres Maß an Empathie und Beziehungskompetenz bei den Mädchen: Weil Knaben die Lösung von der Mutter eher als Abtrennung und Verdrängung bearbeiten, Mädchen hingegen sich mit der Ambivalenz dieser Lösung fortdauernd beschäftigen (müssen), schließen Mädchen ‚diese Periode mit einer in ihrer primären Definition des Selbst eingebauten Grundlage für >Empathie< ab, die bei Knaben nicht in der gleichen Weise entsteht.’ (Chodorow 1990, 217)“ (Tillmann 2000, 74)Darum haben nach Chodorow Frauen die besseren Fähigkeiten zu „muttern“. Chodorow sieht dies als eine besondere, sich bei den Töchtern reproduzierende psychologische und soziale Fähigkeit der Frauen (vgl. Chodorow 1986, 267). Sie sieht allerdings auch die Gefahr der Reproduktion der Geschlechterverhältnisse durch die beschriebene Praxis:„Die soziale Reproduktion ist also asymmetrisch. In ihrer häuslichen Rolle reproduzieren Frauen Männer und Kinder in körperlicher, psychologischer und emotionaler Hinsicht. In ihrer Rolle als Hausfrauen bauen sich Frauen selbst Tag für Tag wieder auf und reproduzieren sich selbst emotional und psychologisch in der nächsten Generation als Mütter. Dadurch tragen sie zum Fortbe-stand der eigenen sozialen Rollen und Positionen in der Geschlechter-Hierarchie bei.“ (Chodorow 1994, 270)
Die Objektbeziehungstheorie ist Kritik verschiedener Seiten ausgesetzt. Da von der Mutter als Primärobjekt des Kindes ausgegangen wird, gilt diese Theorie - ob bei Freud oder bei Chodorow - vor allem in einer klassisch bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Bilden 1991, 295). Sie wird hinfällig, wenn beispielsweise der Vater die frühkindliche Betreuung übernimmt, sie relativiert sich bei Nicht-Stillen oder schwacher körperlicher Bindung zur Mutter. Bilden (1991) kritisiert die mangelnde Berücksichtigung gesellschaftlicher Aspekte:
9Vgl. dazu die Kritik von Marlene Stein-Hilbers (2000, 39).
Page 17
„Biographische Brüche, situationsspezifische Anforderungswechsel, gesellschaftlicher Wandel haben in Chodorovs schematisierender Sicht keinen Platz. Es erscheint mir daher dringend erforderlich, diese einfache Theorie stärker sozialwissenschaftlich einzubinden, wozu Hagemann-White’s Konzept sich anbieten würde. Allerdings müßte dabei der Bezug auf das materielle System der Arbeitsteilung sowie auf Macht und Gewalt im Geschlechterverhältnis stärkeres Gewicht erhalten als bisher.“ (ebd., 296)
Hagemann-White bestätigt zwar Chodorow darin, dass die psychische Abtrennung von der Mutter für Mädchen schwieriger ist als für Jungen, begründet dies jedoch damit, dass die Mutter der Tochter nicht vermittelt, dass sie „etwas anderes“ ist; „ihre psychische Abtrennung wird im günstigen Fall von der Mutter angenommen, aber nicht vorangetrieben“ (Hagemann-White 1984, 87). Das sozialkonstruktivistische Konzept des „doing gender“, demzufolge Geschlecht vor allem im Handeln zum Ausdruck kommt, Frauen folglich aktiv die Geschlechterdifferenz reproduzieren, kritisiert ein auch von Chodorow dargestelltes Festhalten am Mutterideal:
„So ist gesellschaftlich gesehen gerade die Befreiung der Männer von der Last der Reproduktionsarbeit, ihr höherer Status, für wichtigere Dinge als Flaschen und Windeln zuständig zu sein, also kurzgefaßt ihre objektive Macht der Grund, warum innerpsychisch die Idee der unendlichen und überwältigenden Macht der Mütter erhalten bleiben kann. Die Macht der Mütter ist im genauen Sinne eine ideologische Verkehrung.“ (ebd., 89)
Wenn Frauen ihre Stärken idealisieren, verbleiben sie auf unterbewerteten, in einer patriarchalischen Kultur von Männern definierten und nicht bezahlten Plätzen. Der geschlechtliche Unterschied wird zur Ungerechtigkeit, zur „Differenz-Falle“ für Frauen, solange sie sich in einem System der hierarchischen Differenz bewegen (ebd.). Festzuhalten bleibt, dass unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen mit der Mutter als Primärobjekt des Kleinkindes Jungen eher zu Trennung und Abgrenzung animiert werden als Mädchen. Das doppelte „Nein-sagen-müssen“ des Jungen bei seiner Individuation hingegen umfasst eine doppelte Abgrenzung: Während der Junge die Mutter als von sich verschieden erfährt, sie also penislos als „nicht-Mann“ zu sehen ist, muss er sich von ihr abgrenzen: „Mann=nicht-nicht-Mann“ (ebd. 43). Dem entgegen geschieht die Individuation des Mädchens durch Identifikation mit der Mutter statt durch Abgrenzung.
2.1.2.3 Die Adoleszenz als „zweite Chance“ der Geschlechtsidentitätsentwicklung
Freud geht davon aus, dass die Geschlechtsidentität in einer zweiten Phase, nämlich der Pubertät, weiter entwickelt wird. Dieser zweite Schub „bestimmt die definitive Gestaltung des Sexuallebens“ (Freud, zit. n. Erdheim 1997, 273). Mario Erdheim (1997) hat sich mit Psychoanalyse und Kultur verknüpfendem ethnopsychoanalytischem Blick besonders der hinsichtlich der geschlechtlichen Identität Umstrukturierungsmöglichkeiten bereithaltenden Adoleszenz gewidmet:
„Der erste Triebschub, der von der ödipalen Phase aufgefangen wird, führt zur Anpassung an die stabile, konservative Familienstruktur, der zweite, der in der Pubertät anfängt, zur Anpassung an die dynamische, expansive Kulturstruktur.“ (Erdheim 1997, 277)10
10Erdheim betont, dass „Anpassung“ als aktiver Prozess im Sinne von „Mitarbeit an den sich verändernden Strukturen der Gesellschaft“ verstanden werden soll (ders. 1997, 278).
Page 18
Die Chance dieser Phase liegt darin, dass narzisstische Kränkungen durch den Ödipuskonflikt „verflüssigt“ werden können (vgl. Flaake/King 1989).11Zum einen kann sich der/die Jugendliche durch neue Objektbesetzungen von den Eltern ablösen. Zum anderen spielt die Arbeit eine große Rolle für die Entwicklung des Selbstbewusstseins einer jungen Frau.12Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die jungen Frauen in einer sich vom familialen System unterschiedenen Kultur bewegen, wie auch Karin Flaake und Vera King (1989) zur Thematik der „zweiten Chance“ einräumen:„Allerdings verringern sich die Veränderungspotentiale der Adoleszenz in dem Maße, in dem sich Institutionen (wie z.B. Schule, Militär, Kirche etc.) aufgrund ihrer Strukturen dafür ‚anbieten’, familiale Erfahrungen auf den institutionellen Kontext zu projizieren bzw. die Abhängigkeit von der Familie darauf zu übertragen. Diese institutionellen Strukturen verhindern von daher eine wirkliche Ablösung, und die gesellschaftliche Reproduktion von Machtverhältnissen steht aus dieser Perspektive in engerem Zusammenhang mit der Eingrenzung der adoleszenten Dynamik.“ (Flaake/King 1989, 30)
Genügend „Freiraum“ ist folglich die Bedingung für die Orte, an denen die junge Frau andere Erfahrungen machen kann als im Elternhaus. Ein wichtiges Erfahrungsfeld für Frauen sind selbstbestimmte Arbeitsfelder, um ihre eigene Individuation voranzutreiben und die Bindungen an die Familie zu lockern, oder, wie Hagemann-White es ausdrückt:„Die Chance aber - das ‚Rettende’ der Kultur gegenüber der Familie in Erdheims Begriffen - besteht darin, daß Anteile aus dem pubertären Narzißmus mit dem Erleben eigener Kompetenz und dem Spaß am Gelingen einer Aufgabe zusammenfließen und eine Zukunftsperspektive in der Arbeit schaffen können.“ (Hagemann-White 1998, 67).
Sie stellt fest, dass in den Aufgaben der Adoleszenz, wie Klaus Hurrelmann (1991) sie darstellt, die „nicht-erwerbsförmige Haus- und Erziehungsarbeit“, obwohl gesellschaftlich für Frauen definiert, im Gegensatz zur Erwerbsarbeit nicht enthalten ist. Mädchen lernen häufig an unterschiedlichen Stellen Hausarbeit. Dies hilft ihnen in Bezug auf „selbstbestimmte Arbeitsfelder“ nicht weiter, denn: „Sie haben lediglich gelernt, zwei Dinge zu tun, die sich gegenseitig widersprechen.“ (Hagemann-White 1998, 69)
2.1.2.4 Geschlechtersozialisation nach dem Habituskonzept
Eckart Liebau (1992) hat sich unter geschlechtsspezifischer Perspektive mit dem Habitus-Ansatz beschäftigt. Hinsichtlich der weiblichen Sozialisation ist zunächst festzustellen, dass Geschlecht nureinKriterium des Habitus-Erwerbs ist.13Dennoch ist es zu beachten, wie auch Thomas Fliege (1999) konstatiert: „Da Sozialisation immer auch in geschlechtsspezifischen Bahnen verläuft, ist ‚Geschlecht’ eine zu berücksichtigende Dimension bei der Herausbildung des Habitus.“ (Fliege 1999, 105) Das Kind reagiert auf die geschlechtsspezifischen Anforderungen:
„Das Kind wird also von Anfang an in die Bedingungen einsozialisiert, in die es hineingeboren ist; und es wird im Lauf der Zeit genau jene Kompetenzen erwerben, die ihm eine aktive Bewältigung seiner Lebenslage ermöglichen.“ (ebd. 139)
Das Kind ist nicht reines Objekt, sondern auch Subjekt der Bedingungen. Die Einflussnahme zwischen Umfeld und Mensch verläuft zirkulär: Der Habitus der Eltern wirkt auf das Kind. Das Kind praktiziert und reproduziert damit diesen Habitus. Es hat jedoch nur
11Auch Erich H. Erikson (2000) beschreibt diese Funktion der Pubertät (vgl. Kapitel 2.3.1.1).12Vgl. Flaake/King (1998, 31) und Hagemann-White (1984, 67).
13Dies ist ein wichtiger Hinweis im Rahmen der Frauenforschung, die zunehmend die Unterschiede zwischen Frauen zum Thema macht, wie es u.a. auch das Anliegen dieser Untersuchung ist. Zur Differenz unter Frauen vgl. Becker-Schmidt/Knapp (2000, 103ff).
Page 19
den Ausschnitt der Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, den es in der Praxis seines Umfeldes wahrnimmt. In der Jugend allerdings gibt es wesentliche kulturelle Freiräume, unbeaufsichtigte Bewegungsmöglichkeiten und darin die Möglichkeit, alternative Geschlechtsrollenleitbilder kennen zu lernen. Die nach der Reproduktionstheorie Bourdieus zu vermutende Einschränkung der Sozialisation relativiert sich. Darum unterscheiden sich die Verhaltensweisen der Kinder immer von denen der Eltern:
„Ihre [der Jugendlichen; A.d.V.] Habitusformen können - im Gegensatz zu Bordieus oben zitierter Auffassung - daher gar nicht ein bloßes Abziehbild der Habitusformen der Elterngeneration sein: Nicht nur unterscheidet sich die jeweilige Gegenwart, es unterscheidet sich auch die erwartbare Zukunft.“ (Liebau 1992, 144)
Töchter verhalten sich nicht uneingeschränkt nach dem Vorbild der Mütter, da ihnen die Jugendphase Freiraum zu unterschiedlichen Möglichkeiten bietet. Zwar erhalten heute Frauen wie Männer eine Chance zur Ausbildung, doch wird ihnen von der Mutter in der Regel der Haushalts- und Erziehungsbereich nahe gebracht. Wie schon Hagemann-White beschreibt auch Liebau:
„Frauensozialisation hat heute in der Regel die Doppelperspektive von Haushalt bzw. Familie und Beruf; Männersozialisation ist perspektivisch nach wie vor eher berufs- und öffentlichkeitszentriert.“ (Liebau 1992, 139)
Der Habitus der Töchter wird auch in der Pubertät von der Mutter geprägt, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse jedoch modifiziert:
„Die Töchter beerben also die Mütter durchaus direkt! Aber diese Erbschaft äußert sich nicht als unveränderte Reproduktion, sondern als Adaption unter modernisierten Lebensverhältnissen.“ (ebd., 145)
2.1.3 Ländliche Sozialisation
2.1.3.1 Sozialgeschichtliche Bedingungen
Die Basis ländlicher Sozialisation ist die bestimmte Verhaltensnotwendigkeiten produzierende Kulturgeschichte des Landes. Ein ethnologisches und sozialgeschichtliches Werk Beate Brüggemanns und Rainer Rhieles (1986) steht darum im Zentrum dieses Abschnittes. Während sich seit den fünfziger Jahren die Agrarsoziologie darum bemüht, das Land als modern darzustellen und mögliche Unterschiede zur Stadt zu nivellieren, gibt es seit Ende der siebziger Jahre sozialgeschichtliche Studien über das Dorf14mit der Intention, dörfliche „Eigenheiten“, den dörflichen „Eigen-Sinn“ (Brüggemann/Rhiele 1986) aufgrund der bäuerlichen Geschichte festzustellen. Die Autoren wohnten über einige Zeit in einem Dorf, das sie Walddorf nennen. Es liegt im südlichen Schwarzwald, hat 3000 Einwohner (im größten Teil 1100) und noch 100 landwirtschaftliche Betriebe, davon ca. die Hälfte Vollerwerbsbetriebe. Sie gehen davon aus, dass das Dorf, insbesondere die Bauern, sich wie eine Kolonie an die Herrschenden, die industriellen Städter, anpassen mussten. Dennoch haben sich viele alte Formen gehalten:
„Was wir vorfanden, war [...] eine sich als äußerst stabil erweisende Sozialform Dorf, keineswegs dessen Ende, wenngleich der äußere Anschein sich ‚industriell’ angepaßt zeigt und, sofern man es so sieht, den Schluß auf das Ende des Dorfes nahe legt.“ (Brüggemann/Rhiele 1986, 224)
Die Geschichte der Landwirtschaft und damit der früheren Kerngruppe des Dorfes ist von Abhängigkeiten geprägt. Weil Landwirte erst im 19. Jahrhundert „eigene Bauern auf
14So z.B. Utz Jeggel und Albert Illien (1978).
Page 20
eigener Scholle“ werden konnten und auch, weil sie immer abhängig waren von der Witterung, verinnerlichten sie eine Ohnmacht gegenüber gegebenen Umständen mit der Folge mangelnder, sich politisch wie innerfamiliär auswirkenden Konfliktfähigkeit:„Gespräche zwischen Eheleuten im Sinne von Auseinandersetzung und Überzeugungsarbeit sind selten. Positionsbedingt und -bestimmt hat jedes Familienmitglied seine Meinung, hierarchisch geordnet und abgefragt.“ (ebd., 172)
„Eigener Bauer auf eigener Scholle“ zu sein schließt zudem eine zwangsläufig Immobilität nach sich ziehende Orientierung an Grund und Boden ein. Land hatte auch in unsicheren Zeiten wie Krieg und Währungsreformen „Ewigkeitswert“. Der Erhalt des Besitzes als Grundlage der selbstständigen Existenz der Bauern hatte höchste Priorität. Dementsprechend waren Heirat und Nachkommen weniger von Emotionen bestimmt als vielmehr orientiert auf den Erhalt oder das Mehren des Besitzes. Insgesamt ließen schwierige Verhältnisse Gefühle teilweise verkümmern, wie es das folgende Zitat dokumentiert:
„Die Beziehungen aller zueinander waren kaum emotional, sondern instrumental geprägt. [...] Heirat diente und dient auch heute noch in erster Linie zum Erhalt des Hofes.[...] Heirat stiftete Kontinuität und garantierte Arbeitsfähigkeit.“ (ebd., 145f)
Die Arbeit stand über allem, nach ihr war alles andere ausgerichtet. Gesinde und Kinder waren gleichgestellt: gab es weniger Kinder, wurden mehr andere Arbeitskräfte gebraucht. Die Zeit war von der Arbeit bestimmt und diese wiederum von der Natur. Die Natur bot viel Unvorhergesehenes, aber auch verlässliche Rhythmen wie den Tages-oder Jahreslauf. Daraus entwickelte die Bauernfamilie Regeln zum „richtigen Verhalten“. Manche dieser Regeln, die einen konfliktfreien Alltag garantieren sollen, finden sich auch heute noch im bäuerlich geprägten Kern des Dorfes wieder:„Diese bäuerliche Vergangenheit hat einen Typus von Orientierung und Wahrnehmung, von Kommunikation und Interaktion hervorgebracht, ein soziales Regelwerk, das in der Lage ist, Wandel und Veränderung weitgehend konfliktfrei, wenn auch damit nicht automatisch widerspruchsfrei, zu integrieren. Gerade der auffallende Mangel an Konfliktfähigkeit kennzeichnet diese Sozialform.“ (ebd., 125)
Innerdörflich ist damit eine die Art der Kommunikation und des Verhaltens bestimmende soziale Kontrolle über die Einhaltung des komplexen Regelwerks verbunden. Die einheitlichen Regeln im Dorf wirkten früher wie auch heute
identitätsstiftend. Die damit verbundene Sicherheit hat sich in Zeiten der Not z.B. in Form der Nachbarschaftshilfe als wichtig erwiesen.15Die Identifikation mit dem Dorf steht über der Individualität:
„Das Dorf als Lebenszusammenhang ist nicht nur Sozialisationsinstanz, sondern auch Identifikationsobjekt und Identitätsstifter, indem es Zusammenhang und Einheit bietet und seine Bewohner mit einem ausgrenzenden Selbstbewußtsein ausstattet [...] Dieses stabile und zugleich labile Selbstbewußtsein des Dorfes und des Einzelnen ist zugleich Ursache und Folge der Unfähigkeit, scheinbar Selbstverständliches kritisch und distanziert zu hinterfragen sowie Unbekanntes als möglicherweise richtig zu akzeptieren. Statt dessen wärmt man sich lieber im Vertrauen, auch um den Preis partieller Selbstaufgabe.“ (Brüggemann/Rhiele 1986, 148ff)Individualität wird also oftmals dem Regelsystem unterworfen, denn: „Bäuerliches Arbeiten und Leben ließ kaum Raum für die Ausbildung von Individualität, von individuel-
15Illien(1978) hat das dörfliche Beziehungsgeflecht trefflich „Not- und Terrorgemeinschaft“ genannt.
Page 21
len Bedürfnissen und Verhaltensweisen.“ (ebd., 225)16Traditionen nehmen einen großen Raum ein, um eine kollektive Identität, eine Identität des Dorfes, der Sippe etc. darstellen zu können. Dennoch bringt das Leben im Dorf und insbesondere auf dem Hof oft eine Isolation mit sich. Die Modernisierung verstärkt durch die rückläufige Zahl der Landwirte und die Technisierung der Arbeitsabläufe diesen Trend, da quantitativ weniger Hilfe und damit Kontakt zu anderen eingefordert werden muss und kann. Die Qualität der Kontakte ist eher zweckgebunden.
Als traditionell kann trotz ihrer Veränderungen auch die Frauenrolle bezeichnet werden:„Die soziale Stellung der Bäuerin hat sich nicht in gleichem Maße verändert wie der bäuerliche Betrieb insgesamt. Das sicherlich gewachsene Selbstbewußtsein, die kleinen
Emanzipationsschritte sind aber geknüpft an den Preis der Mehrarbeit.“ (ebd., 171)17Die Sozialisationsinstanz Dorf umfasst also tendenziell Elemente wie Tradition, Besitz-orientierung, mangelnde Emotion, Isolation, mangelnde Konfliktbereitschaft, klare Regeln, Rhythmen und Positionen, soziale Kontrolle sowie Identität und Sicherheit auf Kosten der Individualität.
2.1.3.2 Das dörfliche Verwandtschaftssystem
Die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb des Dorfes bringen ein besonders dichtes Sozialisations- und Erziehungsnetz mit sich. Anhand des Wandlungskonzeptes und des Figurationsmodells Norbert Elias’ erforscht Ingeborg Meyer-Palmedo (1985) die Verwandtschaftsstrukturen als Prozess. Sie hat Hof- und Verwandtschaftspläne graphisch erfasst und die Positionen in der Vergangenheit wie Gegenwart zusammengetragen. Im Nachvollzug der Dorfgeschichten arbeitete sie die vier Bedeutungsfaktoren Kontinuität, Öffentlichkeit, Autonomie und Ganzheitlichkeit verwandtschaftlicher Bindung heraus. Im Folgenden wird zuerst der Sinn dieser Faktoren vorgestellt, bevor die Folgen für die Erziehung aufgezeigt werden.
In Zeiten des Wandels gibt Verwandtschaft Kontinuität und Festigkeit. Meyer-Palmedo stellte die zahlreichen Verbindungen der Familien fest:
„Will man den Werdegang einer beliebigen Familie oder eines ihrer Mitglieder verfolgen, so muß man fortwährend zwischen diesen Plänen hin und her wechseln. Man spürt dabei geradezu sinnlich, wie vielfältig sich die Fäden sowohl in ihren Querverbindungen als auch in den Längslinien im Zeitenablauf verschlingen - die Dorfbewohner wissen es.“ (ebd., 175)Diese innerdörflichen Linien einer Familie geben Stärke und Sicherheit, können sich die Dorfbewohner doch auf ihre Geschichte, ihre Wurzeln und ihren Clan berufen. Ver-wandtschaft bedeutet in Zeiten der Privatsphäre auch Öffentlichkeit. Mit der Aufgabe der Selbstverwaltung und z.T. unkonventionellerer Möglichkeiten der Mitbestimmung im Dorf und nach dem Verlust der Homogenität der Dorfstruktur und der Selbstverständlichkeit alter Regeln ist es umso wichtiger, mit Hilfe des Verwandtschaftsnetzes eine gewisse Öffentlichkeitsinstanz darzustellen. Die durch dieses Netz bewirkte Präsenz im Dorf bewirkt,
16Vgl. die ältere sozialgeschichtliche Dorfstudie Illien/Jeggles (1978, 174), die schon in den 1970er Jahren feststellt, dass früher überlebensnotwendige Gesetzmäßigkeiten in veränderten Verhältnissen weiter wirken.
17Obgleich meines Erachtens in der Darstellung Brüggemann/Rhieles insgesamt die Flexibilität der Menschen auf dem Land unterbewertet wurde, halte ich diese These für besonders verfolgenswert.
Page 22
„daß die Dorfbevölkerung dank der ‚verwandtschaftlichen Öffentlichkeit’ unbewußt das Gefühl hat, in gewisser Hinsicht weiterhin tatsächlich ‚beteiligt’ zu sein, obgleich auf kommunaler Ebene die Erfahrungen seit dem letzten institutionellen Zentralisierungsschub ganz andere Schlüsse nahe legen müßten“ (ebd., 177).
Das gilt auch, obgleich es eine „reduzierte“ Öffentlichkeit ist. Ein weiterer Bedeutungs-faktor der Verwandtschaft ist die in erster Linie durch Besitz zustande kommende Autonomie. Besitz schließt Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ein und verleiht dadurch einen gewissen Status. Er wird nicht nach marktwirtschaftlichen Gesetzen erworben, sondern weitervererbt oder wechselt durch diverse „Tauschgeschäfte“ den Besitzer. Früher handelte es sich vorrangig um bäuerlichen Besitz, während heute ebenso Bau-grundstücke oder Häuser innerhalb der Verwandtschaft weitergegeben werden. Unterstützung und Zwänge liegen da nah beieinander:
„Und dieses persönliche Eigentum schreibt sich zum einen aus der verwandtschaftlichen Herkunft her und ist zum anderen mit familiärer Hilfe und Anteilnahme - damit natürlich auch mit deren Zwängen - eng verknüpft.“ (ebd.)
Verwandtschaft im Dorf zu haben bedeutet auch, überall „ganz“ bekannt zu sein. Es ist nicht möglich, an verschiedenen Orten unterschiedliche Gesichter aufzusetzen. Da privater, verwandtschaftlicher Raum mit dörflichem Raum stellenweise deckungsgleich ist oder es zumindest Durchlässigkeiten gibt, sind die Einzelnen bekannt und anerkannt so wie sie sind. Schwächen zu vertuschen ist nicht möglich. Insofern bietet die Verwandtschaft Ganzheitlichkeit in Zeiten der Segmentierung der Gesellschaft. Jeder kennt jeden und seine Schicksale.
„So spielt die Verwandt- und Nachbarschaft noch immer die Rolle der primären Sozialisierungs-und Enkulturierungs-Institution, indem sie die unmittelbaren Zusammenhänge der Reproduktion, der Fortdauer der Gesellschaft vermittelt.“ (ebd., 179f)Meyer-Palmedo kommt ebenso wie die Landjugendforschung zu dem Ergebnis, dass die Verwandtschaft im Dorf besonders enge Sozialisationsstrukturen
mit sich bringt. Zwar gibt es in der heutigen „regionalen Dorfgesellschaft“ (Herrenknecht 1998) ein breiteres Spektrum anerkannter Verhaltensmöglichkeiten18, doch ist im traditionellen Teil des Dorfes eine Annäherung an die Zeiten anzunehmen, in denen noch die alte Ordnung galt. Aufgrund der guten Kenntnis der einzelnen Person und der ganzen Familie wird an die einzelne Person eine bestimmte Erwartung gestellt, deren Nicht-Erfüllung sanktioniert wird:
„Wer aber anders war oder sein oder werden wollte, als das Urteil der Dorfgenossen über ihn entschieden hatte, dem war es schwer, wenn nicht unmöglich, sich zu behaupten. Letztlich blieb u.U. nichts anderes übrig, als auszubrechen und den bergenden Rahmen ganz zu verlassen - eine traurige Alternative, die der Betreffende bestimmt nicht leichten Herzens wählte. So band das Dorf den einzelnen in die Gemeinschaft ein und lieferte ihn ihr zugleich erbarmungslos aus.“ (Meyer-Palmedo 1985, 181)
Die Zugehörigkeit zum Dorf kann durch konformes Verhalten signalisiert werden. Trotz des Bewusstseins des Dorfes, dass der Einzelne auch nichtkonforme Anteile hat, ist innerhalb des Dorfes die Konformitätsregel einzuhalten. Die Einzelnen müssen die Spannung zwischen dörflichen und modernen Regeln ausbalancieren. Das Verwandtschaftssystem repräsentiert durch seine Wurzeln in der Vergangenheit die traditionellen Inhalte. Davon sind gerade die landwirtschaftlichen Familien betroffen, da sie aufgrund der
18Albert Herrenknecht unterscheidet die „Alt-Dörfler“, die „Wohnstandort- und die Wohnstandard-Dörfler“, die „Emanzipierten Dörfler“ und die „Neuen Dorf-Rand-Gruppen“ (vgl. ders. 1998, 25 sowie Kapitel 2.5.1.2).
Page 23
Landbewirtschaftung und damit verbundener Besitzorientierung in der Regel seit Generationen im Dorf etabliert sind und ein entsprechendes Verwandtschaftssystem aufzuweisen haben.
2.1.3.3 Soziale Kontrolle
Das Verwandtschaftssystem innerhalb des Dorfes hat weitreichende Folgen für die soziale Kontrolle. Während diese in der Agrarsoziologie als nahezu unwirksam dargestellt wird (vgl. Hainz 1999), beschreibt die lebensweltorientierte Landjugendforschung, insbesondere Heide Funk (1991), deren Funktionsweise vor allem für die Mädchen im Dorf. Die Dorfbewohner sind in diesem Kontrollsystem Kontrollierte und Kontrollierende:„Soziale Kontrolle ist vor allem als nachbarschaftliche Kontrolle gewachsen bzw. informell organisiert; die Dorfbewohner fürchten sich in der Regel vor dieser nachbarschaftlichen Kontrolle, während sie sich gleichzeitig an ihr beteiligen. Dieser traditionelle Zirkel, der in kleinen Dörfern bis heute kaum durchbrochen ist, führt dazu, daß die Dorfbewohner sich relativ starr an einer traditionalen Normalität orientieren und eifersüchtig darüber wachen, daß sie nicht verändert wird.“ (ebd., 32)
Die Veränderung der Normen ist relativ gering. Der angesprochene „traditionelle Zirkel“ wird durch das Verwandtschaftsnetz gestützt. Zwar weist der von Gebhard Stein (1991) benannte „Normalitätsdruck“ nach dem zweiten Weltkrieg auch in den Dörfern eine gewisse Brüchigkeit auf. Doch hat sich die traditionelle Dorfbevölkerung nicht gleichermaßen mit den Verhaltensweisen der „Zugezogenen“ durchmischt, sondern weist nach wie vor zwar veränderte, aber dennoch eigene, an die Tradition anknüpfende Formen auf. Die Gruppierungen stehen nebeneinander und bitten beispielsweise einander nicht um Rat. Familien und ihre Verwandtschaft reproduzieren durch das Bezogensein auf sich selbst eigene Verfahren. In der Erziehung traditioneller Landfamilien kann diese Solidargemeinschaft auch dazu benutzt werden, den Normalitätsdruck an Kinder weiterzugeben. „Was sollen die Leute sagen?“, heißt es, und oft ist gerade ein Verwandter zur Kontrolle der Kinder in der Nähe. Die Erziehenden delegieren ihre Maßnahmen an die Dorfgemeinschaft:
„[J]ede Einschränkung der eigenen Freiheit kann auf das Gerede im Dorf abgewälzt werden, Eltern entziehen sich damit der Auseinandersetzung mit ihren Töchtern und verschieben diese auf einen geringer spürbaren Konflikt der Mädchen mit der Dorföffentlichkeit.“ (Gfrörer 1991, 240)Damit wird das Individuum, in diesem Fall das des Elternteils, in den Hintergrund gedrängt, was wiederum als Vorbild für die Kinder gilt.
Teilweise spielen die aufgrund mangelnder Ausweichmöglichkeiten der Beobachtung umso mehr ausgelieferten Mädchen auch mit dem Wissen um die Kommunikationsstrukturen des Dorfes und legen evtl. sogar die ein oder andere falsche Fährte (vgl. Funk 1993 sowie Funk/Huber 1990), wodurch die Schlichtheit des Systems deutlich wird. Dieses Spiel mit den Kommunikationsstrukturen kann auch als Racheakt verstanden werden, denn das Dorf und die darin verwobenen Familienbeziehungen engen den Erfahrungsraum der Mädchen tatsächlich ein:
„Weitgehend bestimmend dabei ist - vor allem bei jüngeren Mädchen - die Reaktion der Eltern, engeren Bekannten und Verwandten, die den Mädchen wichtig sind. Achten diese stark auf das absolute Einhalten der traditionell gültigen, jedoch auf ihre aktuelle Zweckmäßigkeit hin meist nicht überprüfbaren Normen, werden ihre Kinder, und vor allem ihre Töchter, in ihrem Handlungsspielraum stark eingeschränkt. Für die Mädchen bedeutet dies ein gewisses Maß an Erziehung zur Anpassung und Beschneidung ihrer Entscheidungsfähigkeit, vor allem in bezug auf Kleidung, Freizeit und Verhalten in der Öffentlichkeit.“ (Gfrörer 1991, 240)
Page 24
Festzuhalten bleibt, dass Kinder traditioneller Familien auf dem Land durch das System der sozialen Kontrolle, insbesondere durch die Verwandtschaftsbeziehungen in ihrem Sozialisationsspielraum beschnitten sind. Da Mädchen sowohl im Dorf als auch in der Familie privatere, familiärere Räume zugewiesen werden, ist deren Einengung umso stärker.
2.1.3.4 Der bäuerliche Habitus
Das Habituskonzept Bourdieus geht von spezifisch prägenden Momenten innerhalb eines „sozialen Raumes“ aus. Während der Agrarsoziologe Hainz (1999; 2000) in seiner empirischen Studie aufgrund der Individualisierung eine Angleichung von Stadt- und Landbevölkerung annimmt (vgl. Hainz 2000, 39) stellt Bourdieu Ähnlichkeiten der „sozialen Akteure“ bei ähnlichen Positionen fest:
„[D]ie Akteure, die in diesem Raum benachbarte Positionen einnehmen, stehen unter ähnlichen Bedingungen und unterstehen deshalb ähnlichen Bedingungsfaktoren: Sie werden demzufolge mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ähnliche Dispositionen und Interessen haben und dementsprechend Vorstellungen und Praktiken ähnlicher Art produzieren.“ (Bourdieu 1997a, 109).Innerhalb eines bestimmten „sozialen Raumes“ handeln die Menschen unbewusst nach den Prinzipien des „sozialen Sinns“. Durch die Selbstverständlichkeit der Handlungen entziehen sie sich dem Bewusstsein, der Diskussion und der eigenen Steuerung. Eine Feststellung des Habitus aber bringt die Möglichkeit einer neuen Wahlfreiheit der Handlungsmuster mit sich.
Aus der Handlungsorientierung des Habitusansatzes folgert Mathilde Kreil (1985) seine besondere Eignung als Sozialisationsmodell für Kinder des bäuerlichen Milieus:„Für die Bauernkinder ist der produktive Bereich direkt und sinnlich zugänglich, einsehbar und sie können diesen Bereich aktiv-tätig und begreifend aneignen. Viele Eindrücke und Tätigkeiten des täglichen Umgangs mit der Arbeit können sich deshalb tief einprägen, ‚inkorporieren’, wie Bourdieu es ausdrückt.“ (Kreil 1985, 39)
Soziale Werte wie Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen und Pflichterfüllung werden durch die Praxis auf dem Hof inkorporiert (ebd., 99). Die praktische Mithilfe der Kinder ist auf dem Bauernhof aktuelle Realität.19Dementsprechend ist das „praxeologische“ Habitus-Konzept für die bäuerliche Sozialisation anwendbar. Auf dieser Grundlage wurde in zwei Untersuchungen der neunziger Jahre der bäuerliche Habitus untersucht. Kreil (1995) wertete in ihrer Studie über bäuerlich sozialisierte Jugendliche 40 themenzentrierte, leitfadengestützte Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Bayern der Jahrgänge 1955-1969 im Alter von 18-32 Jahren unter bestimmten Fragestellungen aus. Fliege (1998) arbeitete den Lebensstil von Bauernfamilien in Oberschwaben
19Thomas Kutsch (2000), der zum einen aus Zeiterfassungsbögen von Schülerinnen aus Ballungszentren im Vergleich zu denen von Kindern landwirtschaftlicher Familien bestehende und zum anderen um eine Landfrauenbefragung erweiterte Erhebungen von 1996 und 1997 zusammenführt, sieht die Veränderungen in der Mitarbeit der Bauernkinder im Vergleich zu früheren Zeiten vor allem in dem fehlenden expliziten „Zwang“. Die Hilfe wird heute ausgehandelt. Dennoch ist für über die Hälfte der Mütter in der Landwirtschaft die Übernahme bestimmter Aufgaben seitens der Kinder selbstverständlich. Der größte Unterschied zu den städtischen Kindern ist bei den Jungen festzustellen, da diese in städtischen Haushalten wenig einbezogen werden. Aber auch der klassische Frauenbereich verlangt in landwirtschaftlichen Familien mehr Hilfe, denn: „Landwirtschaftliche Familien sind im Durchschnitt größer als nicht-landwirtschaftliche Familien. Kinder in größeren Familien müssen früher mehr Verantwortung zumindest für ihren eigenen Bereich übernehmen.“ (Kutsch 200, 86)
Page 25
mit Hilfe biografischer und themenzentrierter Interviews heraus. Auf der Grundlage beider Studien werden im Folgenden einzelne Kriterien zusammen gestellt:
- Der Hof stellt für den Bauern die Grundlage des Lebens dar. Familie ist ohne Hof nicht denkbar und umgekehrt. In der Vergangenheit stand das „Denken vom Hofe her“ über individuellen Aspekten des Lebens: „Sozialisation, Arbeit, Sexualität, Partnerwahl und Heirat ordnen sich dem Ziel der Erhaltung und Fortführung des Hofes unter.“ (Fliege 1999, 168)
- Der zu dem Hof gehörige Besitz an „Grund und Boden“ „verleiht ihr [der Landwirtschaft, A.d.V.] nach außen hin Ansehen und verstärkt das bäuerliche Selbstbewusstsein“ (Fliege 1999, 172). Um den Hof zu betreiben, wird in der Landwirtschaft zudem die körperliche Arbeitsfähigkeit benötigt. Das „Arbeitsethos“ der Bauernfamilie erklärt sich daraus, dass „[k]örperliche Arbeit [...] in der agrarischen Welt die zentrale Voraussetzung der materiellen Existenzsicherung“ (ebd., 246)20war. Geistige Arbeit hingegen wird als solche nicht wirklich anerkannt. Fliege sieht darin im Sinne der „feinen Unterschiede“ Bourdieus ein „Distinktionsmerkmal“ der „Klasse“:
„Körperliche Stärke, Kraft und Ausdauer werden als ‚Kapital’, als Distinktionsmerkmal hervorgehoben. Diese hohe Bewertung von physischer Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit entspricht dem Wertehorizont einer ‚arbeitenden Klasse’, einer Berufsgruppe, die sich mit ihrer Hände Arbeit etwas geschaffen hat.“ (ebd., 248)
- In diesem Bewusstsein entwickelt sich ein nach Eva Wonneberger (1991; 1995) vor allem bei Bäuerinnen bestätigtes „Durchhaltevermögen“.21Die positive Seite besteht im Wissen um die Überlebensfähigkeit durch die eigene Arbeit. Kreil (1995) fand bei bäuerlich sozialisierten jungen Erwachsenen auf dieser Grundlage eine Krisenresistenz heraus:
„Von mehreren Befragten wurde betont, daß das Wissen um die eigenen Fähigkeiten für sie eine starke innere Sicherheit bedeute. Durch ihr Arbeitsvermögen würden sie sich in der Lage fühlen, alle möglichen Arbeiten zu verrichten und müßten dadurch keine tieferen Existenzängste haben, da sie in Krisenzeiten mit jeglicher Art von körperlicher Arbeit Geld verdienen könntennotfalls auch am Fließband.“ (ebd., 126)
- Andererseits führt dieses von Kreil in ihrer Stichprobe im Vergleich zu Bundesstatistiken als überdurchschnittlich nachgewiesene Arbeitsethos dazu, dass „Untätigsein“ und „Ruhe“ auch bei momentan fehlendem Arbeitsaufkommen oft mit einem „schlechten Gewissen“ verbunden sind. Fliege spricht gar von einem vormodernen Gesundheitsbewusstsein und begründet diesen für die aktiven Bäuerinnen und Bauern folgendermaßen:
„Einen Bauer, eine Bäuerin kann so schnell nichts umwerfen, das Eingestehen von Krankheit würde ja Schwäche beinhalten, würde ja beinhalten, dass man ein schlechter Bauer, eine schlechte Bäuerin ist. Die Bäuerinnen und Bauern haben bei aller Wertschätzung ein eher instrumentelles Verhältnis zum Körper entwickelt, in dessen Rahmen Krankheit nur bei wirklicher physischer Arbeitsunfähigkeit als solche akzeptiert wird.“ (Fliege 1999, 249)
- Eng verknüpft mit der Arbeit ist der Umgang mit der Zeit. Kreil beschreibt den stark vom Lohnarbeitsdenken abweichenden Zeitrhythmus der Bauernfamilien. Es handelt sich um eine sich nach den natürlichen Erfordernissen richtende „aufgabenorientierte Zeitgliederung“ (Kreil 1995, 64; Fliege 1999, 216). Wichtiger als die Arbeitsstunden
20Ein bäuerliches Arbeitsethos ist aufgrund der indirekten Entlohnung heute rational betrachtet kein Zukunftsgarant mehr.21Vgl. Kapitel 2.4.3.2.