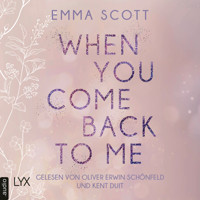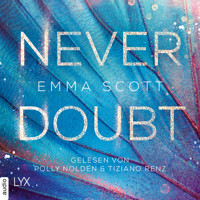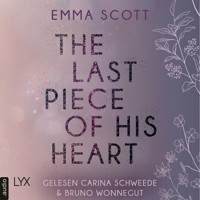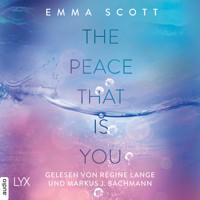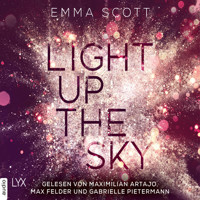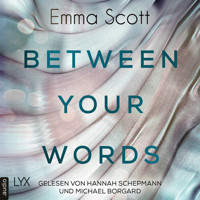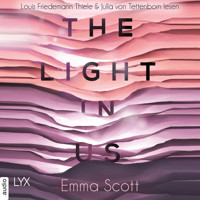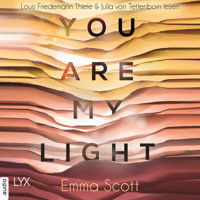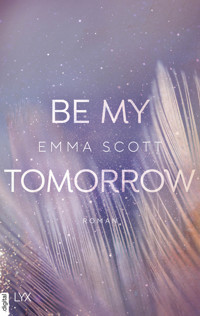
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Only Love
- Sprache: Deutsch
Nur die Macht der Vergebung kann ihrer Liebe Flügel verleihen ...
Vor zehn Jahren wurde Zeldas Leben zerstört. Ihren Schmerz verarbeitet sie in ihrer Graphic Novel - aber kein Verlag will ihre Geschichte veröffentlichen. Doch dann trifft sie in New York auf Beckett - auch er trägt eine Last, die ihn nicht loslässt. Da sie sich keine eigene Wohnung in New York leisten kann und Beckett mit der Miete im Verzug ist, überredet sie ihn, sie als Mitbewohnerin aufzunehmen. Aus ihrer Zweckgemeinschaft wird schon bald viel mehr, und Zelda und Beckett beginnen ihr Herz füreinander zu öffnen - bis zu dem Moment, an dem sie gezwungen werden, sich zu entscheiden, ob sie an ihrem Schmerz festhalten oder dem Glück eine Chance geben wollen.
"Eine wunderschöne Geschichte, einfach nur perfekt! So viele Gefühle, so viel Hoffnung und Schmerz und Glück!" BIANCA von BJ‘s BOOK BLOG
Band 1 der ONLY-LOVE-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leserhinweis
Playlist
Widmung
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teil 2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Teil 3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
Emma Scott
Be My Tomorrow
Roman
Ins Deutsche übertragen von Stephanie Pannen
ZU DIESEM BUCH
Vor zehn Jahren wurde Zeldas Leben zerstört, seitdem versucht sie vergeblich, mit der Trauer und der Schuld klarzukommen. Ihren Schmerz verarbeitet sie in einer Graphic Novel. In der Hoffnung, dort einen Verlag zu finden, fährt sie nach New York. Doch niemand will ihre Geschichte veröffentlichen. Als sie auch noch ausgeraubt wird, ist Zelda völlig am Boden zerstört. Aber dann trifft sie auf Beckett, der zwei Jahre im Gefängnis saß und sich nun als Fahrradkurier mehr schlecht als recht über Wasser hält. Auch er trägt die Last einer Schuld, die ihn nicht loslässt. Da Beckett mit der Miete im Verzug ist, überredet Zelda ihn, sie als Mitbewohnerin aufzunehmen. Aus ihrer Zweckgemeinschaft wird schon bald Freundschaft, und Zelda merkt, dass sie es mit Becketts Hilfe endlich schafft, der Geschichte ihrer Graphic Novel das Leben einzuhauchen, das ihr fehlte. Zum ersten Mal seit Jahren verspürt sie Hoffnung auf Vergebung … und vielleicht sogar Liebe. Zelda und Beckett beginnen ihre Herzen füreinander zu öffnen – bis zu dem Moment, an dem sie gezwungen werden, sich zu entscheiden, ob sie an ihrem Schmerz festhalten oder dem Glück eine Chance geben wollen.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
PLAYLIST
21 Pilots: Heathens
Journey: Don’t Stop Believing
Frank Sinatra: My Way
Prince: Purple Rain
Blondie: One Way Or Another
Chicago: You’re The Inspiration
Frank Sinatra: I’ll Be Home For Christmas
Oasis: Wonderwall
Fitz and The Trantrums: HandClap
Rag ’n’ Bone Man: Human
The Cinematic Orchestra: To Build A Home
Für Robin, meinen Leuchtturm im Nebel.
Ich mag gelegentlich vom Weg abgekommen und ziellos umhergewandert sein, doch dank dir war ich nie verloren.
TEIL 1
»Meine Rache ist meine Schuld.«
Ovid: Metamorphosen
1
Zelda
29. November
»Kein Herz«, flüsterte ich in meinen Mantelkragen.
Ein eisiger Wind heulte durch die belebte New Yorker Straße, peitschte meine langen schwarzen Haare nach hinten und riss mir die Worte aus dem Mund. Meine Augen brannten, aber das kam nur vom Wind. Ich weinte nicht. Nie. Nicht mal, nachdem ich von drei der größten Comic-Verlage in Manhattan abgewiesen worden war. Meine Augen tränten vom Wind.
Drei Absagen in zwei Tagen. Die leitenden Redakteure der einzelnen Verlage verschmolzen in meiner Erinnerung zu einem einzigen Mistkerl, der mit arrogant hochgezogenen Augenbrauen meine Arbeit betrachtete. Ein bisschen beeindruckt, aber nicht beeindruckt genug.
»Interessantes Konzept und ausgezeichnetes Artwork. Aber nein.«
Die dritte Absage, von BlackStar Publishing, wurde jedoch von einem winzigen Hoffnungsschimmer begleitet. Der leitende Redakteur war zwar nicht interessiert, doch nach dem Treffen zog mich seine Assistentin beiseite. Iris Hannover wirkte kaum älter als ich mit meinen vierundzwanzig Jahren, mit dunklem Haar, rotem Lippenstift, modischer Brille und hartem Blick. Einem harten Blick, aber keinem gemeinen. Sondern eher einem, als würde sie mich mustern.
»Es ist noch nicht mal Dezember, aber alle sind schon im Feiertagsmodus«, hatte Iris gesagt. »Wenn Sie es noch einmal überarbeiten und mir innerhalb der nächsten paar Wochen die Storyboards liefern können, sorge ich dafür, dass mein Chef einen zweiten Blick darauf wirft.«
»In welche Richtung soll ich es überarbeiten?«, fragte ich.
»Sie haben da etwas Interessantes.« Iris tippte auf meine Zeichenmappe. »Ihr Stil ist fantastisch, aber der Story fehlt etwas. Sie ist reine Prämisse, sie hat keinen Herzschlag. Finden Sie das Herz!«
»Kein Herz«, flüsterte ich erneut.
Blinzelnd sah ich auf die 6th Avenue, wo sich ein langsamer Tross aus Pkws und Taxis in Richtung Uptown bewegte. Alles war grau. Der Himmel, der Bürgersteig, die Gebäude. Eine trostlose Stadtlandschaft in Kohle und schwarzer Tinte, in der das einzige Detail, an das sich der Kolorist erinnert hatte, das Gelb der Taxis war. Passanten rempelten mich an, gegen die Kälte dick eingemummelt mit Mützen und Schals. Sie eilten vorbei, denn anders als ich wussten sie, wohin sie gingen und was als Nächstes kam.
Ich presste meine Zeichenmappe fester an mich. Darin befand sich meine Seele. Die Skizzen für meine Graphic Novel Mutter, darf ich …?
Und sie hat kein Herz.
Ich musste zugeben, dass sie nicht rührselig oder gefühlsbetont war. Keine Romanze, keine Tränen. Es war pure Gewalt und Action. Eine dystopische Zeitreisegeschichte über blutige Rache. Die Mission meiner Heldin bestand darin, Pädophile und Kindesentführer aufzuhalten, bevor diese zuschlagen konnten. Sie tat es, um ihre Seele vor der Schuld und der Reue zu retten, mit der sie seit der Ermordung ihres eigenen Kindes leben musste. Es gab keinen Ritter in glänzender Rüstung, der auftauchen und das für sie erledigen würde.
War es nicht das, was die Leser wollten? Eine Jessica Jones oder Black Widow? Eine toughe Heldin, die ihren Gegnern in den Hintern trat und keinen Mann brauchte, sondern sich selbst rettete? Nein, sie wollten Herz. Viel Glück damit. Mir hatte man das Herz aus der Brust gerissen, als meine damals neunjährige Schwester Rosemary an einem Sommernachmittag vor zehn Jahren aus einem Supermarkt in Philadelphia entführt wurde. Dort, zwischen den Regalen mit Müsli und Suppen, hatte eine Horrorshow begonnen, der ich hilflos hatte zusehen müssen, ohne sie aufhalten zu können. Ich hatte sie hängenlassen, und die Schuldgefühle fraßen mich seitdem von innen auf wie ein Krebsgeschwür. Mutter, darf ich …? war aus diesem unerträglichen Schmerz heraus entstanden.
Es hieß entweder zeichnen oder meinen verdammten Verstand verlieren.
Iris, die Assistentin bei BlackStar, wollte in ein paar Wochen die überarbeiteten Storyboards haben. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das Herz der Geschichte finden sollte, und auch keinen guten Arbeitsplatz dafür. In den letzten drei Tagen hatten mein Essen, die Taxigebühren und die Miete des heruntergekommenen Hostels, in dem ich untergekommen war, meine Ersparnisse aufgefressen wie ein Heuschreckenschwarm. Ich könnte nach Las Vegas zurückkehren, doch das würde sich wie die absolute Niederlage anfühlen.
Ich brauchte einen ruhigen Ort, um einen klaren Kopf zu bekommen. Diese Ecke der 6th Avenue war dafür nicht geeignet. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die brennenden Augen – blöder Wind – und trat mit erhobener Hand an die Bordsteinkante, um ein Taxi zu rufen. Dann fielen mir meine schwindenden Finanzmittel ein.
Keine Taxis mehr, Miss Money Bags, schalt ich mich selbst. Ich würde mich der U-Bahn oder dem Bussystem stellen müssen.
Ich überquerte die Straße zur U-Bahn-Station und nahm die Treppe nach unten. Es war nur eine kurze Fahrt von Midtown bis zum Hostel in der Nähe von Port Authority. Ich stieg an der richtigen Station aus und ging die Straße voller Pornoläden, Headshops und Kautionsagenturen entlang.
Es gab keinen Park in der Nähe des Parkside Hostels, dafür befand es sich aber über einem winzigen Laden, der Touristenkitsch verkaufte: Sweatshirts und Schneekugeln, Schlüsselanhänger und Spardosen in Form der Freiheitsstatue.
Als ich hier vor drei Tagen das erste Mal aus dem Taxi gestiegen war, hatte mich der ganze Touristennepp zum Lächeln gebracht. Ich war so naiv gewesen, eine geschmacklose Postkarte mit der Aufschrift »Ich komm groß raus im Big Apple!« zu kaufen. Sie war unglaublich kitschig, aber sobald mich einer der großen Verlage für Mutter, darf ich …? unter Vertrag genommen hatte, wollte ich diese Postkarte Theo schicken, meinem Freund und ehemaligen Boss aus dem Tattoostudio in Vegas, in dem ich gearbeitet hatte. Sie hätte ihn zum Lachen gebracht.
Nach zwei Schritten in den schmuddeligen Eingangsbereich des Hostels mit seinen dreckigen Fliesen und flackernden Halogenlampen konnte ich bereits Gebrüll und laute Musik von oben hören. Ich konnte kaum hier schlafen, geschweige denn arbeiten.
In meiner ersten Nacht im Parkside hatte ich das Zimmer für mich gehabt. Ich hatte die langen Stunden wie Tom Hanks in Big verbracht: die wacklige Kommode vor die Tür geschoben und in Embryonalstellung auf dem Bett liegend. Ich hatte versucht, mich so klein wie möglich zu machen, während ich einer Küchenschabe dabei zugesehen hatte, wie sie über den Boden gerannt war. Starr vor Angst.
Aber ich hatte nicht geweint.
Ich schloss die Tür zu meinem Zimmer auf. Das helle Rot und Gelb der Postkarte, die ich für Theo gekauft hatte, war das Erste, was mir ins Auge fiel. Das Zweite war, dass abgesehen von dem, was ich am Leibe trug, alle Kleidungsstücke, die ich nach New York mitgebracht hatte, auf dem Boden verstreut lagen, zusammen mit meinen Reisefläschchen Shampoo, Seife und Lotion, ja sogar dem Etui mit der Antibabypille. Das Zimmer hatte zwei Schließfächer. Die Tür des mir zugewiesenen war aufgebrochen und hing nur noch an einer Angel. Am zweiten Abend war eine Zimmergenossin hereingestürmt, hatte ihren Namen gebrummt – Jane – und einen verschlissenen Schlafsack auf ihr Bett fallen lassen. Dann hatte sie einen blauen Seesack in das andere Schließfach gestopft und war wieder verschwunden. Seitdem hatte ich sie nicht mehr gesehen.
Jetzt war ihr ganzes Zeug weg.
»Was zum …?«
Mein Herz begann zu rasen, und ich lief schnurstracks nach unten zum Empfang, der eher einem Kartenschalter in der U-Bahn glich. Mit zitternder Hand klopfte ich gegen die Plexiglasscheibe, um den Manager auf mich aufmerksam zu machen. Es handelte sich um einen gelangweilt wirkenden Typen mit beginnender Glatze und Bierbauch. Er blätterte gerade durch ein Pornomagazin und paffte einen Zigarrenstummel. Der Rauch erfüllte das Häuschen, in dem er saß, und quoll aus dem runden Loch, durch das Geld und Schlüssel gereicht wurden.
»Mein Zimmer«, sagte ich. »Jemand ist in mein Zimmer eingebrochen. Die haben meine Sachen durchwühlt. Die Frau, die auch da geschlafen hat, ist weg, genau wie ihre Sachen. Vielleicht war sie es?«
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte – vielleicht das gleiche Maß an Empörung. Oder zumindest ein wenig Besorgnis. Stattdessen seufzte der Kerl laut auf und legte sein Magazin beiseite. »Meine Güte. Haben Sie daran gedacht, die verdammte Tür Ihres Fachs abzuschließen?«
Ich starrte ihn an. »Was? Ja. Natürlich«, sagte ich und fühlte, wie ein Teil meiner Angst durch Wut ersetzt wurde. »Ja, ich hab die verdammte Tür abgeschlossen, aber jemand hat sie aufgebrochen.«
»Scheiße«, sagte der Kerl. »Wurde was gestohlen?«
»Ich weiß nicht«, gab ich zu. »Ich bin ausgeflippt und direkt hergekommen.«
Seit ich hier angekommen war, hatte ich viele dumme Dinge getan, doch zumindest hatte ich mein Geld nicht in diesem Hostelzimmer gelassen. Das befand sich in einer flachen Gürteltasche, die ich unter meiner schwarzen Hose trug. Meinen Laptop und meine Zeichenmappe trug ich bei mir. Die einzigen anderen Wertgegenstände waren meine Zeichenutensilien …
Oh mein Gott.
Ich spürte, wie mir das Blut aus dem Kopf wich, als wäre ich eine Skizze, aus der man die Farbe zog. »Oh nein. Oh scheiße, nein.«
Panik trieb mich wieder nach oben. Ich war mir undeutlich der schweren Schritte des Managers hinter mir auf der Treppe bewusst. Ich ging meine Sachen durch, und die Vorstellung, dass irgendein Fremder meine Kleidung – meine Unterwäsche – angefasst hatte, verursachte mir Übelkeit. Aber es war noch alles da. Wertvoll waren nur mein Caban-Mantel und meine Stiefel, die ich natürlich trug. Doch meine Zeichenutensilien waren weg. Mein tragbares Zeichenbrett, meine Stifte, mein Zeichenblock …
Warum? Warum stiehlt jemand Papier und Stifte?
Weil sie teuer waren. Mein wertvollster Besitz. Die Werkzeuge, mit deren Hilfe ich meine Kunst erschuf. Es fühlte sich an, als ob mir plötzlich Finger fehlten.
»Ist was weg?«, fragte der Manager.
»Alles.« Mir drehte sich fast der Magen um, und ich konnte kaum noch atmen. »Sie haben alles gestohlen.«
Der Manager gab ein skeptisches Brummen von sich. »Sieht gar nicht so aus für mich. Da ist doch noch jede Menge Zeug.«
Es ist aus. Es ist alles aus.
Ich schluckte die Tränen herunter und begann meine Kleidung auf einen Haufen zu werfen.
»Rufen Sie jetzt die Polizei?«, fragte ich beiläufig, während ich meine Habseligkeiten zusammensuchte. »Oder hat hier jeder freien Zugang zu den persönlichen Gegenständen Ihrer Gäste?« Ich hielt inne und sah mich um. »Moment. Wo ist mein Koffer? Wo zum Teufel ist mein Koffer?«
Von meinem brandneuen schwarzen Rollkoffer – einem Geschenk von einem meiner Mitbewohner, als ich Vegas verließ – fehlte jede Spur.
»Der wurde auch mitgenommen«, sagte ich. »Irgendjemand hat meinen Koffer und meine Zeichenausrüstung gestohlen.« Ich drehte mich zu dem Manager um. »Nein, nicht irgendjemand. Sie. Die Frau, die Sie zu mir ins Zimmer gesteckt haben. Die muss es gewesen sein, richtig?«
»Wahrscheinlich.« Der Manager seufzte und zog ein Handy aus seiner Tasche.
Eine halbe Stunde später trafen zwei Polizisten ein. Ich hatte in der Lobby gewartet, meine Kleidung und Toilettensachen in einem schwarzen Müllsack auf meinem Schoß. Die Cops nahmen meine Aussage auf und meinten, sie würden die anderen Zimmer durchsuchen, fanden aber nichts.
»Die andere Frau hat unter Jane Doe eingecheckt«, sagte der Manager. »Geschrieben D-O-U-G-H.«
»Jane Dough?« Ich warf dem Manager einen finsteren Blick zu. »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
Der Kerl zuckte mit den Schultern. »Sie hat bar bezahlt. Da hätte sie sich von mir aus auch Mutter Teresa nennen können.«
Mutter Teresa hatte irgendwann heute Morgen ausgecheckt und war bereits über alle Berge.
»Wir lassen Sie es wissen, falls wir etwas herausfinden«, sagte einer der Polizisten. Sein Lächeln war aufrichtig, aber ich konnte den Subtext hören. Machen Sie sich bloß keine Hoffnungen.
Der Manager hob abwehrend die Hände, um zu verdeutlichen, dass er mit der ganzen Angelegenheit nichts zu schaffen hatte. Der Haftungsverzicht, den ich beim Check-in unterschrieben hatte, sicherte ihn rechtlich ab, und das wusste er. Doch nachdem die Cops gegangen waren, sah er mich mit diesem verdammten Müllsack auf dem Schoß allein herumsitzen, und sein Gesichtsausdruck wurde ein bisschen freundlicher.
»Hey, Kleine«, sagte er. »Wie wäre es mit einer kostenlosen Übernachtung? Ist das Mindeste, was ich tun kann.«
Fast hätte ich ihm gesagt, wohin er sich seine kostenlose Übernachtung stecken konnte, doch die Sonne ging bereits unter. Wo hätte ich sonst hingehen sollen?
Philadelphia ist mit dem Zug nur zwei Stunden entfernt.
»Meinetwegen«, blaffte ich den Manager an, um den Gedanken nicht weiterführen zu müssen. »Ich nehme die kostenlose Übernachtung, aber ich will ein Einzelzimmer.«
Er kratzte sich mit seinen dicken, wulstigen Fingern das Kinn, dann nickte er. »Ja, ja, okay.«
In meinem neuen Zimmer warf ich den Müllsack auf das Doppelbett und sah mich um. In einer Ecke standen ein winziger Schreibtisch und ein Stuhl, aber in der Schublade war kein Schreibzeug.
Ich habe weder Stift noch Papier.
Während ich mich bemühte, meine Tränen zurückzuhalten, benutzte ich mein Handy, um meine Optionen durchzurechnen. Ich hatte noch siebenhundert Dollar. Wenn ich nach Vegas zurückfuhr – Bloß nicht heulen, Rossi! –, würden schon mal dreihundert Dollar für das Busticket draufgehen. Noch mal dreihundert für mein Zimmer in der Wohngemeinschaft.
Wenn ich in New York blieb, würden meine siebenhundert Dollar keine vierundzwanzig Stunden reichen. Wohnungskautionen waren hier so teuer, dass ich den restlichen Monat kein Geld mehr hätte. Und hier in diesem Hostel konnte ich auf keinen Fall bleiben und versuchen, meine Graphic Novel zu überarbeiten.
»Womit denn auch?«, fiel mir verbittert ein. Meine Zeichenutensilien waren weg. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, versetzte es mir einen Stich ins Herz, gefolgt von der schmerzhaften Erkenntnis, dass es mich mindestens fünfzig Dollar kosten würde, Papier und Stifte zu besorgen, die nicht totaler Mist waren.
Ich ließ mein Handy auf die steife orangefarbene Bettdecke fallen, denn meine Berechnungen waren fertig. Das Fazit: Ich war erledigt. Ich würde nach Las Vegas zurückkehren müssen, in mein altes Zimmer in dem überbelegten Apartment mit den ständig wechselnden Mitbewohnern. Theo würde mich bestimmt wieder im Tattoostudio anstellen, aber ich wollte nicht. Ich hatte die Schnauze voll von Tätowierungen. Ich hasste es, meine Kunst aufstehen und aus der Tür spazieren zu sehen, um auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Ich wollte etwas, was ich in Händen halten konnte. Etwas, das die ganze Welt sehen konnte …
Deine Blödheit wird nur noch von deinem Stolz übertroffen.
Wieder drohten mir Tränen in die Augen zu steigen, also stand ich vom Bett auf, bevor ich losheulte. Ich stopfte den Müllsack mit meinen Habseligkeiten in das Schließfach und schlug es zu. Zeit fürs Abendessen.
Ich musste mich geschlagen geben, fand aber, dass mir die Stadt zumindest noch eine anständige Mahlzeit schuldete, bevor ich nach Vegas zurückkehrte. Ich schnappte mir meine Zeichenmappe und verließ das Zimmer.
2
Zelda
29. November
Rupert, einer meiner Mitbewohner in Vegas, hatte mir erzählt, dass das East Village der Ort war, um ein künstlerisches Gefühl für die Stadt zu bekommen. Zwar fühlte ich mich gerade alles andere als künstlerisch, aber ein Ziel zu haben war besser, als sich vollkommen ahnungslos und verloren zu fühlen. Ich ging zur U-Bahn-Station zurück und nahm einen Zug in südöstliche Richtung. An der Astor Place Station stieg ich aus und ging die St. Marks entlang Richtung 2nd Avenue.
Ich versuchte, mir meine Umgebung einzuprägen – Hipster-Bars und Hipster-Cafés –, während ich nach einem Restaurant suchte, das einigermaßen in Ordnung war, ohne meinen mageren Geldbeutel zu plündern.
Vor einem kleinen italienischen Bistro blieb ich stehen. Auf einer rot-weißen Markise stand Giovanni’s.Wie klischeehaft, dachte ich, während ich mich von dem warmen Duft einhüllen ließ, der auf die Straße drang. Tomatensoße und Knoblauch, Basilikum und Rosmarin …
Rosmarin.
Plötzlich überkam mich ein so starker Anflug von Heimweh, dass mir schwindlig wurde. So hatte vor langer Zeit die Küche meiner Mutter gerochen.
Ich presste meine Zeichenmappe wie einen Schutzschild an meine Brust und drückte die Eingangstür auf. Das Bistro war winzig – fünfzehn Tische, auf denen jeweils eine einsame Kerze in einem Glas brannte. Rot-weiß karierte Plastiktischdecken, Plastiktrauben an den Wänden und schlecht gemalte italienische Landschaften.
Es war alles so kitschig, doch das Essen roch genauso köstlich wie das meiner Mutter. Der Duft hüllte mich ein und versetzte mich in Erinnerungen an ihre Küche zurück, zu einer Zeit, als ich noch eine Schwester hatte. Als wir beide uns noch gezankt und an den Haaren gezogen hatten, um dann dem Holzlöffel meiner Mom auszuweichen, die sich beschwerte, weil wir neben dem heißen Herd wie die Tiere balgten.
Fahr nach Hause, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Setz dich in einen Zug, und fahr nach Hause.
Aber dieses Zuhause gab es so nicht mehr. Rosemarys Entführung hatte meine Familie aus Wärme und Liebe wie aus großer Höhe in einen schwarzen Abgrund fallen lassen, auf dessen Boden wir wie Glas zerschellt waren. In uns allen war etwas zerbrochen – in meinen Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln … Meine große, laute italienische Familie war durch das Undenkbare verstummt.
Kochte meine Mutter inzwischen wieder? Ich kannte die Abläufe im Haushalt nicht mehr, denn ich war vor sechs Jahren ausgezogen. Ein selbst auferlegtes Exil. Meine Schuld, mein unvorstellbares Versagen gegenüber Rosemary, hatte mich zu einer Ausgestoßenen gemacht. Das sanfte Drängen meiner Mutter lockte mich zurück, und ein, zwei Mal im Jahr gab ich nach und stattete ihnen einen Besuch ab, immer in der Hoffnung, dass ich ihnen diesmal glauben würde, wenn sie sagten, dass es nicht meine Schuld gewesen war. Doch die Erinnerungen, die das Gegenteil schrien, versetzten mich jedes Mal in Panik und ließen mich zerstört zurück. Diese Erinnerungen waren es, die mich aus der idyllischen Vorstadt von Philadelphia in die Wüste von Nevada getrieben hatten, wo nichts vertraut aussah.
Das Giovanni’s sah vertraut aus.
Trauer und Heimweh waren inzwischen wie eine Flutwelle, und fast wäre ich rückwärts wieder rausgegangen. Doch in diesem Moment rief mir der Barkeeper, der hinter der langen Mahagoni-Theke des Restaurants stand, zu: »Wie viele, Miss?«
Mir war das Risiko klar gewesen, an einen Ort im Osten zu gehen, der so nah an Philadelphia lag, doch der Ansturm von Erinnerungen war in diesem Moment fast zu viel für mich. Ich war kein Feigling. Mein Dad hatte mich immer ein »toughes Mädel« genannt. Ein toughes Mädel, das niemals klein beigibt. Ich würde mich nicht von Erinnerungen zurück in den kalten New Yorker Abend treiben lassen.
»Eine Person«, sagte ich dem dicklichen Mann mit den hochgekrempelten Ärmeln, der Weste und der Krawatte mit den Trauben darauf.
Er deutete auf einen kleinen Tisch im hinteren Teil des Restaurants, wo ich Platz nahm. Meine Zittrigkeit ließ nach, als mir klar wurde, wie hungrig ich war.
Ich schaffe das. Normal sein. Was essen.
Ich legte meine Zeichenmappe neben meine Füße. Die Kerze flackerte in ihrem Glas auf dem Tisch. Während ich die Speisekarte überflog, stellte eine Küchenhilfe wortlos einen Plastikbecher mit Wasser und zwei Eiswürfeln vor mir ab.
Schließlich nahm eine Kellnerin – eine freundliche junge Frau mit dunkler Turmfrisur und goldenen Ohrringen – meine Bestellung auf: Ziti und ein Glas Hauswein. Ich schlug mich angesichts der Situation eigentlich ganz gut, bis sie zurückkam und das dampfende Essen vor mir abstellte. Genau wie zu Hause, dachte ich, außer dass meine Mutter viel zu viel Basilikum genommen hätte, woraufhin sich meine Großmutter beschwert hätte und die beiden den restlichen Abend damit verbracht hätten, sich zu streiten …
Plötzlich verschwamm der Raum vor meinen Augen, ich hatte ein beklemmendes Gefühl in der Brust und bekam keine Luft mehr. Ich sprang auf und lief in den schmalen Gang, der zu den WCs führte. Doch die Damentoilette war abgeschlossen.
»Scheiße.«
Ohne nachzudenken, rannte ich durch die zu helle Küche, vorbei am Dampf und Reinigergeruch der Spülmaschine und durch die Hintertür in eine winzige Gasse, die von einem wackligen Holzzaun gesäumt wurde. Ein Müllcontainer stand hier, der Deckel von Plastiktüten angehoben. Mein Atem gefror, während ich hyperventilierte und in der klirrenden Kälte die Arme um mich schlang.
Reiß dich zusammen, dachte ich. Meine Güte, es ist doch nur Essen. Es ist nur … diese Stadt. Dann hast du eben versagt, na und? Du bist nicht der erste naive Idiot, den New York zerkaut und wieder ausgespuckt hat, und du wirst auch auf keinen Fall der letzte sein.
Große Worte, aber bedeutungslos. Das, was so weh tat, war nicht, dass meine Graphic Novel abgelehnt wurde. Ich hätte sogar verkraften können, dass mein Stil nicht gut genug war. Aber zu hören zu bekommen, dass sie kein Herz hat …
Kein Herz. Es war nicht mein Herz; es war meine Lunge, die nach Luft gejapst hatte, während ich dem Lieferwagen hinterhergerannt war. Es war meine Stimme, die um Hilfe schrie – Bitte, hilf mir doch jemand! –, weil ich nicht schnell genug rennen konnte. Ich hatte nicht laut genug geschrien. Damals hatte ich Rosie im Stich gelassen, und nun hatte ich erneut versagt. Dabei versagt, ihre Geschichte zu erzählen. Das Buch war eine Entschuldigung, ausgebreitet über hundert Seiten in Schwarzweiß, getuscht mit Reue und koloriert mit Tränen. Alles, was ich an jenem Tag nicht getan hatte, war in die Zeichnungen eingebettet, und die Wut meiner Heldin – ihr gnadenloser Rachedurst – war meine einzige Erleichterung.
Und es war abgelehnt worden.
»Was soll ich jetzt nur machen?«, flüsterte ich.
»Keine Ahnung«, sagte eine gedämpfte männliche Stimme hinter mir. »Vielleicht nicht in dieser stinkenden Gasse erfrieren?«
Ich erschrak fast zu Tode und wirbelte herum. Ein großer, schmaler Mann ungefähr in meinem Alter stand mit einer Mülltüte in der Hand in der Hintertür des Restaurants. Er hatte blonde Haare, einen Dreitagebart und trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und eine weiße Schürze. Die Küchenhilfe.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ich hätte Ihretwegen fast einen Herzinfarkt bekommen.«
»Entschuldigung.« Er stopfte den Müll in den Container und zog dann aus seiner Gesäßtasche eine Packung Zigaretten. »Was machen Sie hier draußen?«
Ich zuckte mit den Schultern und machte mich so groß, wie es meine ein Meter sechzig erlaubten. »Dieser Ort ist so gut wie jeder andere«, sagte ich.
Der junge Mann steckte sich eine Zigarette an. »Haben Sie sich verlaufen?«
Ja, auf jede erdenkliche Art.
»Nein, ich brauchte nur ein bisschen frische Luft.«
Er sah mich skeptisch an. »Ein bisschen frische, nach Müll stinkende Luft?«
Ein Klugscheißer. Ganz nach meinem Geschmack. Aber nicht das, was ich gerade brauchte. Ich begann in Richtung Hintertür zu gehen. »Ist ja auch egal. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe.«
»Sie stören mich nicht.« Er blies Rauch aus seiner Nase. Der vermischte sich in der kalten Luft mit seinem Atem. Er sagte nichts mehr, beobachtete mich aber mit seinen dunkelblauen Augen. Beiläufig, aber stirnrunzelnd.
»Müssen Sie nicht arbeiten?«, fragte ich.
»Raucherpause.« Er hob seine Zigarette. »Ich dachte, das wäre ziemlich offensichtlich.«
»Touché.«
»Wollen Sie auch eine?«
»Ich rauche nicht.«
»Ist bestimmt besser. Ihr Essen wird kalt.«
»Und dann bekomme ich keinen Nachtisch?«
Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Schmunzeln, und er setzte sich auf eine der drei Stufen, die zur Hintertür des Restaurants führten. »Was ist denn los?«
»Ich brauchte einfach nur kurz einen Moment für mich«, antwortete ich. »Aber ich schätze, das kann ich wohl vergessen.«
»Schätze ich auch.«
Ich riss die Augen auf. »Meine Güte, sind Sie nervig.« Trotz meines Mantels zitterte ich, und mein Magen knurrte laut. Da fiel mir ein, dass Zigaretten appetithemmend waren. »Okay, ich nehme doch eine.«
Er zog die Packung wieder heraus und rutschte beiseite, um mir auf der Stufe Platz zu machen. Ich setzte mich neben ihn und strich meine langen Haare aus dem Weg. Dann nahm ich mir eine Zigarette und beobachtete ihn, während er mir Feuer gab. Im Licht des Feuerzeugs hatten seine Augen ein dunkles Kristallblau, wie ein Saphir mit Hunderten Facetten …
Der Rauch in meiner Lunge brachte mich zum Husten.
»Alles okay?«
Ich nickte eifrig. »Ist ’ne Weile her«, stieß ich trotz des Hustens hervor. Mir tränten die Augen. Jetzt erinnerte ich mich wieder, warum ich das Rauchen aufgegeben hatte. »Das schmeckt schrecklich.«
Der Mann grinste. »Dann machen Sie sie vorsichtig aus, und ich nehme sie zurück.«
»Nein, schon gut. Ich glaube, ich brauche das jetzt.« Ich inhalierte erneut, und beim Ausatmen löste sich auch ein Teil meiner Anspannung. Mein knurrender Magen beruhigte sich ebenfalls.
Eine Minute lang saßen die Küchenhilfe und ich schweigend auf der Treppe und rauchten. Ich musterte ihn aus dem Augenwinkel. Unter seinem langärmeligen Shirt schien er überraschend muskulös zu sein. Sein Kinn war markant und die ansonsten gerade Linie seiner Nase von einer kleinen Delle unterbrochen. Seine blonden Haare waren oben länger und an den Seiten kurz. Sein Gesicht … Gott, sein Gesicht …
Er ist übertrieben attraktiv. Zu perfekt. Wie ein Comicheld.
»Haben Sie auch einen Namen?«, fragte er, den Blick in die Gasse gerichtet.
»Zelda«, antwortete ich.
Er sah mich verwundert an. »Zelda? Wie …«
»Wie in dem Spiel The Legend of Zelda?« Ich schnaubte Rauch aus der Nase. »Hab ich schon tausend Mal gehört.«
Der junge Mann zuckte mit den Schultern. »Ich wollte sagen, wie F. Scott Fitzgeralds Frau.«
»Oh«, sagte ich. »Also, eigentlich … ja. Meine Mutter liebte Fitzgerald. Ich bin tatsächlich nach seiner Frau benannt. Meine Schwester …« Ich musste husten und tat so, als wäre der Rauch schuld. »Rosemary. Sie ist nach einer Figur aus einem seiner Bücher benannt.«
»Tender is the Night.« Er registrierte meinen überraschten Gesichtsausdruck und sah weg. »Ich hatte in den letzten Jahren viel Zeit zum Lesen.«
Ich nickte. Ich fragte nicht nach dem Grund, und er fragte mich nicht nach meiner Schwester. Ein guter Deal.
»Und wie heißen Sie?«, fragte ich.
»Link«, antwortete er. Dann wich er lachend vor meinem tödlichen Blick zurück. »Beckett. Ich heiße Beckett.«
Passt perfekt zu ihm, dachte ich und schalt mich sofort dafür. Woher willst du das wissen? Sei nicht dämlich, nur weil er hübsch aussieht.
»Und wie lautet Ihre Geschichte, Zelda?«, fragte Beckett.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte ich. »Ich kam, ich sah, mir wurde in den Arsch getreten. New York ist ein ziemlich brutaler Ort.«
»Sind Sie Schauspielerin?«
»Künstlerin.«
Beckett nickte und stieß Rauch aus.
»Sind Sie Schauspieler?«, fragte ich. Er sah auf jeden Fall gut genug dafür aus, so viel war sicher.
Er schüttelte den Kopf. »Fahrradkurier.«
»Oh, cool. Fahrradkurier und Küchenhilfe.« Beckett warf mir einen scharfen Blick zu, und ich hob meine Hände. »Beides ehrliche Arten, sein Brot zu verdienen.«
Er schnaubte. »Ja klar. Ehrlich.« Er spie das Wort regelrecht aus und schwieg einen Moment. »Außerdem helfe ich hier nur zweimal in der Woche aus. Um mir ein bisschen dazuzuverdienen.«
»Ich hab gehört, die Mieten hier sind total irre.«
»Haben Sie richtig gehört.«
Ein kurzes Schweigen entstand zwischen uns, das überhaupt nicht unangenehm war. Wieder studierte ich unauffällig Becketts Kinn und das Dunkelblau seiner Augen. Sie strahlten selbst im schäbigen Licht der Lampe über der Tür. Er war größer als ich, und sein Körper strahlte Sicherheit aus. Es kam mir vor, als wäre er so etwas wie ein Fels, der mich vor dem kalten Wind der Stadt schützte. Zumindest eine Zigarettenlänge lang.
»Wohnen Sie in Manhattan?«, fragte ich.
»Nein. Brooklyn.« Er warf mir einen amüsierten Blick zu. »New York City ist mehr als der Times Square und das Empire State Building, wissen Sie?«
Ich verdrehte die Augen. »Ach was? Ich wollte Sie gerade fragen, ob in der Freiheitsstatue Wohnungen vermietet werden.«
Fast hätte er gelächelt. »Suchen Sie nach einer?«
»Nein, ich bin hier fertig«, sagte ich. »Mein Budget ist aufgebraucht.«
Beckett nickte. »Kenn ich gut. Ich hab zwei Jobs, und trotzdem fehlen mir diesen Monat achtzig Mäuse. Ich werde Blut spenden müssen.«
Ich riss die Augen auf. »Sie müssen Blut spenden, um Ihre Miete zu bezahlen?«
»Gelegentlich. Ist keine große Sache. Die Klinik auf der 17th zahlt fünfunddreißig Dollar.«
»Dann fehlen Ihnen immer noch fünfundvierzig.«
»Dann gehe ich zu einer anderen Klinik.« Als Beckett meinen entsetzten Gesichtsausdruck sah, lachte er heiser auf. »War nur ein Scherz. Dann verkaufe ich irgendwas. Vielleicht eines meiner Alben, was echt scheiße wäre.«
»Alben? So richtige Vinylplatten?«
Er nickte. »Ich habe ein paar Klassiker, hauptsächlich von meinem Großvater. Als Gramps starb, habe ich seine Sammlung geerbt. Andere hab ich von Flohmärkten. Die Leute wissen nicht, was sie da haben, und verkaufen ihre Schätze unter Wert.«
Ich zog leicht an meiner Zigarette. So langsam wurde mir übel davon. Oder vielleicht war es die Vorstellung, dass dieser arme Kerl seine wertvollen Sammlerstücke verkaufen musste – ganz zu schweigen von seinem Blut –, um seine Miete zahlen zu können.
Er musste meinen bestürzten Gesichtsausdruck bemerkt haben, denn mit einer Geste vertrieb er den Rauch und meine Sorge. »Ist wirklich keine große Sache.«
»Warum legen Sie sich keinen Mitbewohner zu?«, fragte ich.
»Ich wohne in einer siebenunddreißig Quadratmeter kleinen Wohnung. Mir ist noch niemand begegnet, mit dem ich mir so wenig Raum teilen könnte, ohne ihn nach einer Woche umbringen zu wollen.«
Ich nickte. »In Vegas hatte ich mein eigenes Zimmer in einem Haus mit etwa zehn Mitbewohnern. Nur zwei von denen konnte ich leiden, und das auch nicht immer.« Ich legte den Kopf in den Nacken und schaute in den Nachthimmel. Doch durch die Lichter der Stadt waren keine Sterne zu sehen, und er kam mir unendlich tief und leer vor. »Warum bleiben Sie, wenn es so schwierig ist, hier zu leben?«
Beckett zog an seiner Zigarette, als ob er vor seiner Antwort Zeit schinden wollte.
»Bin in Brooklyn geboren und aufgewachsen«, sagte er schließlich, ohne den Blick von der Gasse abzuwenden. »Was wäre die Alternative? Andere Stadt, gleiche Probleme.« Endlich sah er mich an. »Sie verschwinden also wieder?«
»Morgen, mit dem Bus«, sagte ich. »Ich kann nicht bleiben. Ich hatte hier eine Art Vorstellungsgespräch und bin durchgefallen.«
»Für was für einen Job?«
»Sie werden es bestimmt für bescheuert halten.«
»Ja, wahrscheinlich schon.« Er lächelte ironisch.
Ich musste lachen. »Klugscheißer. Ich zeichne Graphic Novels.«
Er starrte mich ausdruckslos an.
»Comicbücher, die eine längere Geschichte erzählen«, erklärte ich.
»Wie The Walking Dead?«
»Genau. Ich habe den Entwurf für eine und kam her, um sie ein paar Verlagen vorzustellen. Alle haben mich abgewiesen. Na ja, einer nur halb, aber es spielt keine Rolle. Ich kann nicht lange genug in der Stadt bleiben, um meinen Entwurf zu überarbeiten, und selbst wenn, wüsste ich gar nicht, was für Änderungen ich vornehmen sollte.«
Beckett studierte die Zigarette zwischen seinen Fingern. »Warum können Sie nicht bleiben?«
»Wo soll ich anfangen?« Ich trat meine Zigarette aus. »Bei meiner schlechten Planung? Meinem schwindenden Budget? Der Tatsache, dass ich heute ausgeraubt wurde? Oder dass ich naiverweise gehofft hatte, dass die Verlage meine Arbeit lieben und mich auf der Stelle engagieren würden? Suchen Sie sich was aus.«
Beckett verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Warten Sie … Was? Sie wurden ausgeraubt?«
Ich nickte und vertrieb mit einer Handbewegung den letzten Rest Rauch. Dabei wünschte ich mir, mein Versagen könnte sich ebenso leicht in Luft auflösen. »Ich bin hergekommen als naive Idiotin mit einem Traum und bin mit fliegenden Fahnen untergegangen.«
»Wenigstens haben Sie es versucht. Das ist mehr, als die meisten Leute zustande bringen.«
»Ich habe es versucht und bin gescheitert.«
»Also versuchen Sie es erneut.«
»Ich wünschte, ich könnte es«, sagte ich und ließ meinen Blick über die schäbige Gasse wandern. »Es fühlt sich so an, als wäre ich so kurz vor einem Durchbruch. Dieses letzte Vorstellungsgespräch hat mir Hoffnung gemacht. Wenn ich nur irgendwie noch ein paar Wochen hierbleiben könnte, hätte ich eine Chance. Aber das ist unmöglich. Ich muss nach Nevada zurück.«
»Und Sie haben keine Familie oder Freunde in der Nähe?«
Doch, nur eine zweistündige Zugfahrt entfernt.
»Nein«, sagte ich stattdessen, denn ich fand, dass ich einem vollkommenen Fremden schon genug erzählt hatte. Ich konnte jetzt wirklich keinen erneuten Anflug von Heimweh gebrauchen. Ich stand auf und klopfte meinen Hintern ab. »Aber es ist eben, wie es ist. Danke für die Zigarette.«
»Wurden Sie verletzt?«
Ich drehte mich um und warf Beckett einen fragenden Blick zu. »Was?«
»Sie haben gesagt, Sie wären ausgeraubt worden«, erklärte er leise und sah mir dabei in die Augen, als wollte er sich zwingen, sich das anzuhören. »Sind Sie verletzt worden?«
»Nein, ich … Nein. Ich war gar nicht da. Es war ein Einbruch.«
Er lehnte sich gegen die Wand, und sein Seufzen formte in der kalten Luft eine Dampfwolke. Es klang erleichtert. »Das tut mir leid, Zelda.«
Ich runzelte die Stirn. »Ist ja nicht Ihre Schuld. Wie ich bereits sagte, die Stadt hat mir in den Hintern getreten. Je schneller ich von hier wegkomme, desto besser für alle Beteiligten.«
Beckett stand auf, warf seine Zigarette auf den Boden und trat sie aus. Er war mindestens eins neunzig groß. Dennoch fühlte es sich nicht bedrohlich an, in seinem Schatten zu stehen, sondern …
Sicher. Ich fühle mich in seiner Nähe sicher.
»Wissen Sie, wie Sie wieder dorthin zurückkommen, wo Sie wohnen?«, fragte er.
»So, wie ich hergekommen bin, nur rückwärts«, erwiderte ich, um meine beunruhigenden Gedanken mit Ironie zu kaschieren. Denn so war es sicherer für mich.
Beckett studierte mich einen Moment und schien schließlich zu einer Art Entscheidung zu kommen. »Okay.« Er begleitete mich durch die Küche und hielt die Schwingtür auf, die zurück ins Restaurant führte. Für einen Augenblick wurde ich in seinen maskulinen Geruch eingehüllt: Zigarettenrauch und Eau de Cologne.
»Viel Glück, Zelda.«
»Danke …«, sagte ich und atmete tief ein. Einen Moment später kam ich wieder zur Vernunft und rief: »Ihnen auch«, gerade als sich die Schwingtür zwischen uns schloss.
Verglichen mit draußen, war das Restaurant gemütlich warm und zudem fast leer. Der Manager sortierte Rechnungen an der Kasse, während der Barkeeper die Spülmaschine ausräumte. Jemand hatte mir mein Essen eingepackt, und meine Zeichenmappe, die ich leichtsinnigerweise unterm Tisch gelassen hatte, war glücklicherweise noch da.
Ich hab gerade einen Lauf.
Ich bezahlte meine Rechnung und trat in die eisige Winterkälte hinaus. Mein Atem bildete genauso dichte Wolken wie vorhin beim Rauchen, und ich wickelte mich fester in meinen Mantel.
Was jetzt?
Zurück in dieses beschissene Hostel für meine Gratisübernachtung. Ich sah mich schon am nächsten Tag an der Busstation stehen, auf dem Weg zurück nach Las Vegas, mit meinem Zeug in einem Müllbeutel und mit eingezogenem Schwanz. Die Übernachtung war nicht gratis. Ich hatte sie mit meinem brandneuen Koffer, meinen Zeichenutensilien und meiner Würde bezahlt.
Meine Wangen brannten vor Scham. Ich drehte mich nach rechts und ging los. Ich hatte Beckett gesagt, dass ich die gleiche U-Bahn zurück nehmen würde, aber in Wirklichkeit hatte ich einen furchtbaren Orientierungssinn. Nichts kam mir bekannt vor, und die Gebäude ragten so hoch um mich herum auf, dass ich mich winzig fühlte. Und verloren.
An einer Ecke zog ich mein Handy heraus, um eine dieser Verkehrs-Apps zu finden, von denen mir meine Freunde erzählt hatten. Während ich darauf wartete, dass sie lud, hörte ich vor dem Restaurant Stimmen. Mit einem Fahrrad über der Schulter wünschte Beckett dem Barkeeper und der Kellnerin einen schönen Abend. Ich sah zu, wie er das Rad abstellte und den Helm vom Lenker nahm. Während er den Gurt unterm Kinn befestigte, drehte er sich zu mir um.
Schnell schaute ich auf mein Handy.
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie Beckett sein Rad in meine Richtung schob. Er hatte seine Arbeitskleidung gegen eine wetterfeste Hose und eine dunkelblaue, abgetragene Gore-Tex-Jacke getauscht. Sein kleiner Rucksack hatte einen breiten Gurt, der statt über seine Schultern diagonal über seine Brust verlief. Daran war etwas befestigt, das wie ein kleines CB-Funkgerät aussah.
»Alles okay?«, fragte er.
»Alles bestens.«
Ich tippte ein Symbol an: ein kleiner weißer Bus vor hellgrünem Hintergrund. Die App lud ein paar Bus- und U-Bahn-Linien und Haltestellen mit jeweils einer Zeit daneben.
»Rufen Sie sich ein Taxi?«, fragte Beckett.
»Nein, ich …« Es fiel mir schwer, nicht zu fluchen. Die App ergab nicht den geringsten Sinn für mich. »Ich muss nur zur Astor Station.«
»Da muss ich auch hin«, sagte er. »Ich begleite Sie.«
Ich sah auf. »Sie begleiten mich?«
»Genau das hab ich gesagt.«
»Nein, danke. Ich schaffe das schon.«
Beckett zuckte mit den Schultern. »Wie Sie meinen.«
Doch statt auf sein Rad zu steigen, begann er langsam zu gehen, und zwar in die entgegengesetzte Richtung – nicht in die, die ich hatte nehmen wollen. Schnaubend folgte ich ihm.
»Sie müssen das nicht tun.« Ich musste rufen, weil ich knapp zehn Meter Abstand zu ihm ließ.
»Was denn?« Er warf einen Blick über seine Schulter. »Warum folgen Sie mir, Zelda? Weil meine Station auch zufällig Ihre ist?«
Ich verdrehte die Augen und presste meine Zeichenmappe fester an mich. Durch eine rote Ampel schloss ich unfreiwillig zu ihm auf.
»Nur bis zur Station«, sagte ich.
Beckett nickte. Ein Schmunzeln umspielte seine Lippen. »Nur bis zur Station.«
Schweigend gingen wir den nächsten Block entlang. Dauernd stieß die Tüte mit dem Essen gegen meinen Oberschenkel, bis ich genug davon hatte und sie in die nächste Mülltonne werfen wollte. Wenn ich es nicht frisch hatte essen können, würde ich es kalt in meinem beschissenen Hostel bestimmt nicht herunterbekommen.
»Moment«, sagte Beckett. »Sie wollen es nicht?«
»Nein.«
Er streckte die Hand aus. »Dann nehme ich es.«
Ich reichte es ihm und fühlte mich wie ein Arschloch, weil ich Essen hatte wegwerfen wollen.
»Es ist nicht für mich«, sagte Beckett, ohne mich anzusehen, während er seinen Rucksack schloss und ihn wieder aufsetzte. Wir zogen weiter.
Drei Blocks später erreichten wir den Eingang der U-Bahn-Station, und ich erkannte sie wieder. Beckett schulterte sein Rad, um die Treppe nach unten zu nehmen. Die gelbe Lackierung war an ein paar Stellen abgeplatzt, und der Rückstrahler hatte einen Sprung. Es sah aus wie eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, mit geraden statt gebogenen Lenkern. Obwohl der Rahmen ein bisschen ramponiert wirkte, war an Ketten und Gangschaltung kein Rost zu sehen. Beckett kümmerte sich offensichtlich gut um die wichtigen Dinge.
»Nehmen Sie das Ding immer mit in die Bahn?«, fragte ich, während er es in der Station wieder abstellte.
»Das muss ich. Morgens ist das echt nervig, aber bis sie einen besseren Weg aus Brooklyn erfinden …« Er zuckte mit den Schultern.
»Sie wohnen in Brooklyn, arbeiten aber in Manhattan?«
»Sechs Tage die Woche.« Er wies mit dem Kopf auf eine Karte an der Zementwand der Station neben einem Fahrkartenautomaten. »Wo müssen Sie denn hin?«
Ich spitzte die Lippen. »Zum Hotel Das-geht-Sie-gar-nichts-an.«
»Sind Sie immer so unhöflich zu Leuten, die Ihnen helfen wollen?«, fragte Beckett. Seine blauen Augen strahlten im gelben Licht der Station.
»Ich bin nicht unhöflich«, entgegnete ich. »Nur vorsichtig. Großer Unterschied.«
»Das ist klug«, sagte er. »Aber Sie kennen sich hier offensichtlich nicht aus. Sagen Sie mir zumindest die Gegend, damit ich Sie in den richtigen Zug setzen kann.«
»8th Avenue, in der Nähe von Port Authority.« Ich weigerte mich, von seinem Angebot gerührt zu sein.
Beckett runzelte die Stirn. »Da kommen und gehen eine Menge Leute. Um diese Uhrzeit nicht die sicherste Gegend.«
Er schob sein Rad zu einer Bank, setzte sich und lehnte es gegen seine Knie. Dann zog er ein Handy aus seiner Tasche. »Wie heißt Ihr Hotel?«
»Es ist kein Hotel, sondern ein Hostel. Das Parkside. Aber Sie müssen nicht …«
»Cool. Ich bringe Sie hin.«
Ich blinzelte ihn überrascht an. »Sie wollen mich hinbringen?«
»Entschuldigung, mein Fehler. Ich meinte natürlich, dass ich jetzt zufällig zum Parkside Hostel muss.« Er studierte sein Handy und scrollte mit seinem Daumen. »Sie dürfen mich gern begleiten, wenn Sie möchten.«
»Sie müssen das wirklich nicht tun«, protestierte ich. »Ich kenne mich in New York nicht besonders aus, aber ich weiß, dass Brooklyn in einer ganz anderen Richtung liegt.«
»Sogar in einem anderen Bezirk«, sagte er, ohne aufzusehen.
Stirnrunzelnd überlegte ich, was ich darauf sagen sollte. Schließlich setzte ich mich neben ihn auf die kalte Steinbank. »Ich weiß gerade wirklich nicht, ob Sie supernett oder ein Stalker sind.«
»Weder noch«, sagte er. »Wenn ich morgen aufwache und in den Nachrichten höre, dass Sie auf dem Weg zum Hostel überfallen wurden, würde ich mich schlecht fühlen. Ich tue das für mich. Nicht für Sie.«
»Okaaay … danke?«
»Keine Ursache.«
Mir gingen unzählige freche Antworten durch den Kopf, aber ich bekam keinen Ton heraus. Noch nie hatte ich einen Kerl wie diesen Beckett getroffen.
»Sind alle New Yorker wie Sie?«, fragte ich.
»Wie bin ich denn?«, erwiderte Beckett, ohne aufzusehen.
»Wenn ich Sie zeichnen würde, wären Sie Enigma Man, der verirrte Frauen zu ihren beschissenen Hostels am anderen Ende der Stadt begleitet, ohne eine Gegenleistung zu wollen.«
»Soll ich dafür etwa eine Belohnung verlangen?« Bevor ich antworten konnte, bohrten sich seine dunkelblauen Augen in meine. »Und ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich das für mich mache.«
Ich schürzte die Lippen. Dahinter steckt eine Geschichte.
Ein Zug fuhr kreischend in die Station ein.
»Ist das meiner?«, fragte ich.
Beckett sah kurz zu mir auf, dann starrte er wieder auf sein Handy. »Der danach.«
Wieder verfielen wir in Schweigen. Er sah mich nicht an, und nur unsere Ellbogen berührten sich gelegentlich. Doch trotz seiner Distanziertheit hatte ich in seiner Gegenwart immer noch dieses Gefühl von Sicherheit.
Ein weiterer Zug fuhr mit einem warmen, nach Aluminium riechenden Luftzug ein.
»Das ist Ihrer«, sagte Beckett und steckte sein Handy ein.
Dann schob er sein Rad in den Zug und zwang damit ein paar Pendler in der Nähe der Tür, zurückzuweichen. Niemand machte Beckett deswegen das Leben schwer, und er wirkte ohnehin nicht so, als würde ihn das interessieren.
Ich stieg hinter ihm ein, und er wies auf einen freien Platz ein paar Reihen entfernt. Ich setzte mich, immer noch vollkommen erstaunt über seine seltsame Ritterlichkeit. Der Zug setzte sich ruckelnd in Bewegung, und ich presste meine Zeichenmappe fest an mich. Beckett hielt sich an einem Handlauf fest, das Rad leicht an seine Beine gelehnt. In den Kurven bewegte er sich mit dem Zug wie ein Matrose auf einem Schiff. Er studierte auch nicht wie besessen den Liniennetzplan in der Nähe der Tür, wie ich es tat, aber als der Zug das dritte Mal langsamer wurde, drehte er sich zu mir um.
»Ihre Haltestelle.«
Unsere Haltestelle, korrigierte ich ihn in Gedanken und folgte ihm aus dem Zug, durch die Station und die Stufen hinauf zur Straße. Zurück in die kalte Nacht.
»Welche Adresse?«, fragte er.
»Wenn ich sie Ihnen nicht sage, googeln Sie sie einfach mit dem Namen, den ich Ihnen dummerweise gegeben habe, oder?«
»Schneller, als Sie sie mir nennen können«, sagte er mit einer Spur Belustigung in der Stimme.
Ich seufzte und verriet ihm die Adresse. Sofort ging Beckett los, als wäre er schon hundert Mal am Parkside Hostel gewesen. Es war so seltsam, dass ich fragen musste.
»Haben Sie schon mal dort übernachtet?«
»Nein.«
»Und woher …«
»Ich kenne das Hostel nicht, aber ich kenne Kreuzungen.« Er klopfte auf seinen Lenker. »Ist mein Job.«
»Oh. Richtig. Klingt logisch.«
Ich beschloss, die Klappe zu halten, bevor ich noch was Dummes sagte. In Wahrheit war ich dankbar, dass Beckett bei mir war. Die Straßen waren dunkel und voller Schatten. Mit meiner Zeichenmappe dicht an mich gepresst ging ich so nah neben ihm, wie ich es wagte, ohne dass es so wirkte, als würde ich seine Nähe suchen.
Becketts Gang war selbstbewusst, aber ich bemerkte, dass er sich aufmerksam umsah. Es war, als wäre sein Körper auf Autopilot, doch sein Geist wach. Vor uns wärmte sich ein Obdachloser an einem Lüftungsschacht. Als wir näher kamen, bettelte er uns mit lauter Stimme an. Ich wich zurück. Beckett blieb ebenfalls stehen, doch nur, um ein paar Dollar aus der Hosentasche zu ziehen.
»Schönen Abend, Mann.« Er drückte dem Penner die Scheine in die Hand und ging weiter.
Der Obdachlose murmelte etwas und schlurfte in die andere Richtung davon.
Ich machte den Mund auf, um etwas zu sagen, dann schloss ich ihn wieder. ErbekommtseineMietenichtzusammen,aberverschenktseinTrinkgeld? Vielleicht hatte er nicht die Wahrheit gesagt, was seine Mietsituation anging, doch das bezweifelte ich. Er hatte dem Mann das Geld so gegeben, wie er mich zu meinem Hostel brachte – als hätte er keine andere Wahl.
Wir erreichten das Parkside. Niemand saß am Empfang, doch ich hatte einen 24-Stunden-Schlüssel.
»Okay, wir sind da«, sagte ich. »Danke fürs Begleiten, besonders, da es für Sie so weit ab vom Schuss ist.«
»Kein Problem«, erwiderte Beckett. Sein Blick wanderte von der Straße zur Tür hinter mir, runter zu seinen Schuhen und schließlich zurück zu mir. Das Schweigen zwischen uns wurde immer dichter. Die trübe Beleuchtung des Hosteleingangs ließ Becketts Augen fast lila aussehen. Er machte den Mund auf, als ob er das Schweigen brechen würde, dann klappte er ihn wieder zu.
Er stieg auf sein Rad. »Gute Nacht, Zelda.«
»Nacht.«
Mit einer Geschwindigkeit, die auf den dunklen Straßen der Stadt gefährlich wirkte, trat er in die Pedale. Sein Fahrstil war perfekt, wie der eines Fahrers der Tour de France. Er lehnte sich in die Kurven, geschmeidig wie Seide und blitzschnell. Nach wenigen Sekunden war er verschwunden.
Ich starrte auf die dunkle Stelle, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte. Ich würde ihn niemals wiedersehen und war mir nicht sicher, wie ich dazu stand. Es war kein Bedauern, das ich verspürte, sondern eher eine seltsame Form von … Nostalgie? Als ob ich ihn vermisste.
Das Gefühl von Sicherheit war weg. Das vermisste ich ebenfalls.
Ich ging ins Zimmer und ließ mich auf die dünne Matratze fallen. Die Sprungfedern quietschten unter meinem Gewicht. Ich rief Rupert an. Er war mein zuverlässigster Mitbewohner (was nicht viel hieß), und ich musste ihn bitten, mich in ein paar Tagen von der Busstation in North Vegas abzuholen.
»Oh, hey, Zel«, meldete sich Rupert. Im Hintergrund konnte ich Musik und laute Stimmen hören. »Was gibt’s? Wie läuft’s im Big Apple?«
Ich runzelte die Stirn. Er klang wie ein Typ, dessen Freundin gerade nach Hause gekommen war und der ein anderes Mädchen im Schrank versteckt hatte.
»Nicht so gut wie erhofft«, antwortete ich ehrlich. »Ich komme in ein paar Tagen zurück und wollte dich bitten, mich abzuholen.«
»Du kommst zurück?« Der Lärm hinter Rupert wurde gedämpft, und ich wusste, dass er sich in die winzige an die Küche angrenzende Vorratskammer zurückgezogen haben musste. »Scheiße, Zel, das ist jetzt echt ungünstig.«
»Wem sagst du das?«, murmelte ich, dann richtete ich mich alarmiert auf. »Moment mal. Ungünstig für mich oder dich?«
»Ähm, na ja …«
»Rupert, was ist los?«
»Ich hab irgendwie dein Zimmer vermietet.«
Fast wäre mir das Handy aus der Hand gefallen. »Du hast was?«
»Du hast gesagt, New York wäre eine sichere Sache.«
»Ich hab gesagt, es wäre wahrscheinlich sicher.« Ich stockte, als mir klar wurde, dass das überhaupt keinen Sinn ergab. Ungeduldig schüttelte ich den Kopf. »Jedenfalls habe ich auch gesagt, dass du mein Zimmer auf jeden Fall zurückbehalten sollst, bis ich dich anrufe. Das jetzt ist mein Anruf.«
»Beruhige dich. Du findest doch was anderes. Du kannst …«
»Nicht ohne Kaution und erste Miete im Voraus«, sagte ich. »Verdammt, Rupert, das ist das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann.«
»Mein Fehler, Zel. Die Couch gehört dir«, sagte er. »Für so lange du willst. Oder du tust dich mit Cheryl zusammen, bis du was Eigenes findest.«
»Wie großherzig von dir«, sagte ich und rieb mir die Augen.
»Was?«
»Nichts.«
»Du weißt doch, wie das hier läuft, Zel. Leute kommen und gehen …« Ich konnte das Achselzucken in Ruperts Stimme hören. »Wir dachten, du gehst.«
»Tja, na ja, tue ich nicht.« Ich biss mir in die Backe, bis mir die Tränen nicht mehr die Kehle zuschnürten. »Schaff deinen Arsch in drei Tagen zur Busstation. Ich rufe dich noch mal wegen der Zeit an.«
Rupert war die Erleichterung anzumerken. »Na klar. Sag mir, wann. Ich werde da sein.« Eine kurze Pause. »Und hey, Zel? Tut mir leid, dass es für dich da drüben nicht hingehauen hat. Diese Verlage wissen nicht, was ihnen entgeht.«
Ich wollte mich bedanken, doch es kam als heiseres Flüstern raus. Ich beendete den Anruf und ließ das Handy auf die schäbige Bettdecke fallen.
Dann ging ich zum Fenster und starrte auf die Wand des gegenüberliegenden Gebäudes. Ich musste mich verrenken, um den Nachthimmel zu sehen, und auch hier gab es keine Sterne. Nichts als eine dunkelblaue Leere, kalt und gleichgültig.
3
Beckett
29. November
Der Zug nach Brooklyn war für einen Freitagabend ziemlich leer. Die Straßen meines Viertels in einer zwielichtigen Ecke von Williamsburg waren ebenfalls ruhig, abgesehen von einem Typen, der im Vorbeigehen in sein Handy brüllte, und einer Sirene, die in der Ferne heulte. In New York heulte immer mindestens eine Sirene in der Ferne.
In meinem mit Graffiti besprühten alten Wohngebäude ohne Aufzug stieg ich mit meinem Rad auf der Schulter die Treppe hinauf in den zweiten Stock. In dem schmalen Flur flackerten grelle Halogenlampen. Ich blieb vor Wohnung 2C stehen und nahm Zeldas Essen aus meinem Rucksack. Glücklicherweise war der Behälter in der Plastiktüte noch intakt. Das Essen fühlte sich sogar noch ein bisschen warm an.
Ich klopfte. Dreißig Sekunden später hörte ich das Knarren von Bodendielen und wie ein Riegel zurückgeschoben wurde. Die Tür öffnete sich, so weit es die Vorlegekette zuließ, und funkelnde braune Augen spähten aus einem Nest aus Falten.
»Hey, Mrs Santino«, sagte ich. »Ich hab hier was für Sie. Ich hoffe, Sie haben Appetit auf Italienisch.« Ich warf einen Blick auf meine Uhr. »Um zwanzig nach zwölf.«
Sie schnupperte und schloss die Tür. Die Kette rasselte, und die Tür ging erneut auf, diesmal weit genug, um mir die Tüte aus der Hand zu reißen. Mit gespitzten Lippen musterte sie mich von Kopf bis Fuß. Dann schnupperte sie erneut und machte mir ohne ein Wort die Tür vor der Nase zu.
Schmunzelnd schüttelte ich den Kopf. »Gute Nacht, Mrs Santino.«
Ich ging zu 2E, schloss auf und betätigte den Lichtschalter. Meine winzige Wohnung wurde von einer einzelnen Halogenlampe in hässliches Licht getaucht. Ich schob das Rad über den dünnen Industrieteppichboden in seine Ecke in der Nähe des Badezimmers.
Zehn Schritte, und ich war in der Küche. Dort trank ich einen Schluck Wasser aus einer Flasche aus dem Kühlschrank und ging ans Fenster, um einen Blick in die Nacht zu werfen, die durch die Lichter der Stadt niemals ganz dunkel werden würde.
Zelda war da draußen, auf der anderen Seite des Flusses in Manhattan, hoffentlich sicher in dem Hostel, das sie ein Drecksloch genannt hatte. Ich atmete tief ein und langsam wieder aus. Ich hatte meine Schuldigkeit getan. Ich hatte sie sicher dorthin gebracht.
Pass auf dich auf, Zelda.
Ich setzte mich an den kleinen Tisch am Fenster und hatte plötzlich das dringende Bedürfnis zu reden. Mich auszudrücken, wie es meine Englischlehrerin Mrs Browning in der Highschool ständig von mir verlangt hatte.
Drücke aus, wie du dich fühlst, Beckett. Öffne dein Herz. Deine Worte sind wunderschön. Und sie haben Macht.
Damals hatte es für mich nach kitschigem Schwachsinn geklungen, doch der Rat meiner Lehrerin war mir nie aus dem Kopf gegangen. Ich wollte daran glauben, dass Worte Macht hatten. Macht, die Vergangenheit zu ändern. Wieder in Ordnung zu bringen, was kaputt war. Zu heilen. Indem ich die Worte zu Papier brachte, konnten sie auf den Leser eine Art Magie ausüben.
Ich hatte eine Leserin. Mrs J. Der Monat war fast zu Ende, und ich hatte ihr noch keinen Brief geschrieben. Bis heute Abend hatte ich nicht gewusst, worüber ich schreiben sollte.
Aus einer Schublade holte ich Stift und Papier.
29. November
Liebe Mrs J,
inderHighschoolgabeseinMädchennamensHannahWalters.SiewollteSchauspielerinwerden,undwennihrArschlochvonVatersienichtgezwungenhätte,Jurazustudieren,würdesiejetztHollywoodrocken.OderdenBroadway.SiehatdieHauptrolleinjedemSchulstückbekommen.Alleanderenwarenimmerneidisch,dasssiedenganzenRuhmeinheimste,abernurbiszurPremiere. Dann war offensichtlich, dass sie es verdient hatte.
Im Abschlussjahr war das Frühlingsstück der PS 241 Rashomon. Kennen Sie das? Es gibt auch eine Verfilmung. Jedenfalls ist es eine japanische Geschichte über einen Samurai, seine Frau und einen Banditen. Der Bandit tötet den Samurai und vergewaltigt seine Frau. Das ist jedenfalls eine Version. In einer anderen verführt die Frau den Banditen und hilft, den Samurai zu töten. In einer weiteren bringt sich der Samurai selbst um. Jede Figur – der Bandit, die Frau und sogar der tote Samurai durch ein Medium – erzählt eine andere Geschichte, und das Publikum fragt sich am Ende, welche denn nun stimmt.
Meine Kumpel und ich wollten uns eigentlich betrinken und uns in die Premiere schleichen. Um uns über das Stück lustig zu machen, nicht um es uns tatsächlich anzuschauen. Doch es war zu gut. Es gab nichts, worüber wir uns hätten lustig machen können. Meine Freunde wollten ihr Gesicht wahren, indem sie behaupteten, es sei langweilig, und nach dem zweiten Akt gingen. Aber ich blieb bis zum Schluss.
HannahWaltersspieltedasMedium.SiekamaufdieBühnealsdiesedurchgeknallte,fastgeisterhafteKreatur,diesich