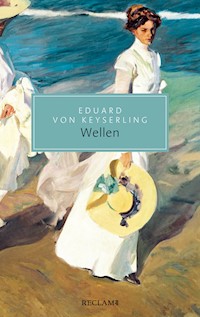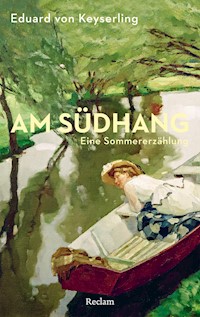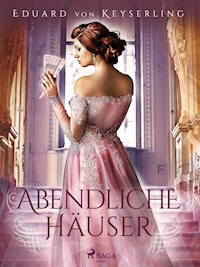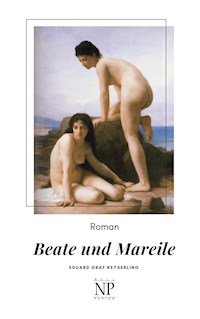
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Keyserling bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein romantischer Reigen aus Ehebruch, Verrat und Rache. Beate und Mareile sind Freundinnen seit frühester Kindheit. Beate entstammt einer adligen Familie, Mareile hingegen ist nur die Tochter des Gutsinpektors. Beate heiratet den ebenfalls adligen Günther. Mareile aber wird in Berlin zu einer gefeierten Sängerin. Jahre sind vergangen. Als Mareile ihre Familie besuchen will, trifft sie auf die nun schwangere Beate. Das Wiedersehen ist alles andere als harmlos, als Mareile erkennt, dass Günther merklich an ihr interessiert ist. Zu diesem Reigen gesellen sich alte, lüsterne Grafen, verzogene Jungfrauen, heißblütige Liebhaber und freigeistige Künstler. Im Gegensatz zu den meisten Autoren seiner Zeit hatte Keyserling keine Probleme, sexuelle Themen unverblümt darzustellen. Wenn etwa die hochschwangere Beate in Selbstekel die Ansicht von "großen, hochbusigen" Mädchen beklagt, so ist das alles andere als wilhelminisch-prüde. Und wenn Günther seiner Geliebten befiehlt, "Kehr' das Gesicht zum Feuer hin. Lass die Zöpfe über die Schultern hängen.", dann weiß der Leser genau, was gerade passiert. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eduard von Keyserling
Beate und Mareile
Eine Schlossgeschichte
Eduard von Keyserling
Beate und Mareile
Eine Schlossgeschichte
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: S. Fischer, Berlin, 1903 (143 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-38-0
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Keyserling bei Null Papier
Fräulein Rosa Herz
Wellen
Beate und Mareile
Seine Liebeserfahrung
Dumala
Abendliche Häuser
Schwüle Tage
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel
Aus dem Badezimmer erscholl ein gleichmäßiges Plätschern. Günther von Tarniff saß in seinem rotgelben Badebassin. Die lauwarme Dusche wurde in der Morgensonne ganz blank – fließendes Kristall. Das war so hübsch und angenehm, dass Günther sich nicht davon trennen konnte. Er saß da schon geraume Zeit und registrierte die behaglichen Empfindungen, die über seinen Körper hinglitten … wachsam und aufmerksam, wie er jedes angenehme Gefühl in sich zu verfolgen pflegte, als müsste aus dieser Addition sich ein Glück herausrechnen lassen.
»Ziehen Herr Graf die neuen Weißen an?« fragte Peter aus dem Nebenzimmer.
»Ja. Gefallen sie dir nicht?« rief Günther zurück.
»’ne neue Mode. Wird man sehen«, meinte Peter.
Nun musste Günther heraus. Peter rieb ihn behutsam mit einem weichen Tuch ab. Günther pflegte seinen Körper wie ein Brahmane. Er bewunderte ihn und achtete ihn, als die Tafel, auf der das Leben viele, wichtige Genüsse zu verzeichnen hat.
»Frau Gräfin waren schon auf, bei der Morgenandacht«, berichtete Peter. »Ja, bei den alten Herrschaften im Flügel ist Morgenandacht mit den Leuten vom Alten Testament, wie die Amalie sagt.«
»Teufel. Dann sind wir hier das Neue Testament – was? Bedeutend freche Jungfrau, die Amalie. Und du?«
»Gott, ich!« Peter zog die Augenbrauen über den kleinen lithauer Augen empor: »Heute bin ich dabei gewesen. So ’n mal. Sonst, der Beckmann geht nich’ –«
»– So – der Beckmann ist dein Dienerideal? – Gott! Mit dem dummen Gesicht!«
Als Peter seinem Herrn das Beinkleid reichte, nahm er ein anderes Thema auf: »Schön is hier! Das Haus, der Garten. Alles gehört uns!«
»Ja«, meinte Günther und hielt im Ankleiden inne, um seine Bemerkung Peter eindringlich mitzuteilen: »Wie dieser Anzug. Alles weich – lose. Nicht? Und die Uniform war steif – und eng. Nun also. Wenn man den Dienst aufgibt und nach Kaltin zieht, dann zieht man eben die Uniform aus und dies hier an!«
Peter war voller Bewunderung: »Wie spitzig der Herr Graf das sagen! Ja, so ’n Kopf, wie unser Graf! Aber so stramm war unser Dienst nicht.«
»Ach was, Dienst! Das Leben, verstehst du? Die Zeit vergeht und noch zu wenig, zu wenig …«
»Weiber«, half Peter ein.
»Ja, auch das. Das ist vorüber. Hier ist Ruhe.«
»Gott sei Dank«, schloss Peter die Unterhaltung.
Günther war fertig und stellte sich vor den Spiegel. Er sah gut aus, er konnte zufrieden sein: die matte Gesichtsfarbe, das schwarze Haar seiner italienischen Mutter, die braunen, blanken Frauenaugen mit den langen Wimpern, die Lippen so rot wie bei Knaben, in denen die Jugend noch wie ein Fieber brennt.
»Heute wieder wunderbar«, meinte Peter.
*
»Sie hat auf mich gewartet«, dachte Günther, als er in den Gartensaal trat und die zwei Gedecke auf dem Frühstückstische sah. Eine behagliche Rührung ergriff ihn bei diesem Anblick: »Angenehm ist das – wie – wie – reine Wäsche nach der Reise!«
Er trat auf die Veranda hinaus und blickte über die Kieswege und Blumenbeete hin. Die heiße Luft zitterte und flimmerte. Der Buchsbaum glänzte wie grünes Leder. Hinter dem Garten dehnte sich Wiesenland aus, dann niedrige Hügel, an denen die Äcker wie regelmäßige Seidenstreifen niederhingen. Unten, von der Buchsbaumhecke sah Günther seine Frau auf das Haus zulaufen. Die eine Hand hielt die Schleppe des weißen Kleides, die andere einen bunten Strauß Erbsenblüten. Ein wenig atemlos blieb Beate vor Günther stehen und lächelte. Die Gestalt schwankte leicht, wie zu biegsam.
»Riech mal«, sagte sie und hielt ihm den Strauß hin. »Das riecht wie Sommerferien, nicht?«
»Du kannst ja laufen wie ein Jöhr«, meinte Günther.
»Ja, ja!« Beate lachte: »Hier ist man wieder jung; weil alles umher so schön alt ist, so alt wie – wie Kinderfrauen.«
Sie gingen in den Gartensaal. Günther streckte sich in einem Sessel aus und ließ sich Tee einschenken.
»Gewiss! Gut ist’s hier«, begann er, die Worte langsam vor sich hinschnarrend. »Wie’s so aussieht, müsste der schon ein umgewandter Monsieur sein, der hier nicht auf seine Rechnung kommt, wie, Beating?«
Beate schlug die Augen zu ihm auf, für das schmale, weiße Gesicht sehr große Augen, durchsichtig und graublau, mit ein wenig feuchtem Golde auf dem Grunde. Eine freundliche, ruhige Ironie lag in ihrem Blick. Das machte Günther befangen. Er begann im Zimmer auf und ab zu gehen und angeregt zu sprechen: »So wie hier, das lieb’ ich; ruhige, königlich preußische Schönheit. Die ewigen Großartigkeiten fallen mir auf die Nerven. Na – ja du – du bist anders. Sorrent – Luzern – das ist dir wie dein Deputat.«
»Ja, Kaltin ist gut«, meinte Beate.
»Hier lässt man sich also nieder«, setzte Günther seine Betrachtung fort. »Das ist das Definitive – Ruhe – Abschluss.«
Beate zog die Augenbrauen empor.
»Womit schließt du denn ab? Jetzt fängt’s doch gerade an – unser Leben.«
»Für euch Frauen«, dozierte Günther mit klingender Stimme, »für euch ist die Ehe ein Anfang – der Anfang. Für uns Männer ist die Ehe auch ein Ende. Das Frühere ist zu Ende – aus; verstehst du? – Frauen unserer Gesellschaft haben kein Früher. Sie haben Gouvernanten, aber keine Vergangenheit gehabt.«
»Dieses ›Früher‹ klingt ziemlich unsympathisch«, warf Beate ein wenig gereizt ein.
Günther lachte: »Ja, das könnt ihr nun mal nicht ändern. Ihr Ehefrauen seid immer ’ne Art Hafen. Du, Beating, bist ein hübscher, glatter, tiefer Hafen, gut ausgebaggert, man sieht bis auf den Grund.«
Beate schaute in der stillverschlossenen Art vor sich hin, die sie anzunehmen pflegte, wenn sie etwas gleichsam nicht zu sich hereinlassen wollte, es ihr zuwider war. Günther sprach schon von anderem: »Müssen wir nicht zu unseren alten Damen hinüber?«
»Ja, wenn du willst.«
»Sag, ist’s dort noch so – so – düster?«
»Düster – dort?«
»Na ja, für dich – natürlich – da sind’s die Kinderzimmer und so. Die Zimmer sind’s auch nicht. Ich glaube, es ist die Tante Seneïde.«
»Tante?« rief Beate. »Aber Tante Seneïde ist doch wie – wie Mondschein im Ahnensaal.«
»So! Ist das nicht unheimlich, wenn man so ist?«
»Ach nein!« erklärte Beate. »Weißt du, wenn der Mond durch die oberen Fenster des Ahnensaals scheint, dann ist der Fußboden ganz voll von Lichtkringel. Als Kinder setzten Mareile und ich uns da mitten hinein. Tante Seneïde ging im Saale auf und ab und sagte ihre geistlichen Lieder her. Das war so echt Kaltinsch und das gehört Tante.«
»So«, meinte Günther, »als Knabe habe ich mich gefürchtet, wenn die Leute von der kranken Komtesse sprachen. Na, jetzt soll sie mir wie Mondschein im Ahnensaal sein. Komm!«
Zweites Kapitel
Lantin, das Stammgut der Tarniffs, grenzte an Kaltin, den Sitz der Losnitz’. Beate und Günther waren Nachbarskinder und verwandt. Die Tarniffs und die Losnitz’ gehörten zu dem alteingesessenen Landadel, zu den »braungebrannten Herren«, von denen Bismarck spricht: »Die man morgens früh um fünf auf ihren Feldern einhergehen oder reiten sieht.« Starke Leute, die das Leben und die Arbeit lieben, roh mit den Weibern und andächtig mit ihren Frauen umgehen und einen angeerbten Glauben und angeerbte Grundsätze haben. Der Lantiner Zweig der Tarniffs jedoch hatte durch mehrere Generationen dem Staat gute Diplomaten geliefert. Der Aufenthalt in der Fremde entrückte sie ihrem Landsitz. Die Schüler der Grumbkow, Hardenberg, Bismarck brachten etwas Fremdes in das Gleichgewicht und die ein wenig hochmütige Beschränkung der Landjunker; neue Gedanken und Appetite komplizierten ihr Seelenleben. Dazu schlossen die Herren auf ihren diplomatischen Posten Ehen mit Ausländerinnen. Das exotische Blut nagte an den starken Nerven der märkischen Rasse, erhitzte und schwächte sie mit seiner Erbschaft fremder Geschlechter.
Graf Botho, Günthers Vater, war mit einer italienischen Prinzessin vermählt gewesen; ein herrliches Geschöpf, wie Fra Sebastiano sie gerne malte: Königliche, edelsteinharte Augen, eine bleiche Gesichtsfarbe, in die sich etwas wie grünliches Gold mischt. Die schöne Römerin konnte deutsche Luft und deutsche Menschen nicht vertragen. Getrennt von ihrem Gatten lebte sie mit ihrem einzigen Kinde, dem kleinen Günther, in ihrer Heimat. Noch jung erlag sie einem Brustleiden. Lantin hatte von seiner Herrschaft wenig gesehen. Jetzt langte Graf Botho in Lantin an mit seinem Kinde, dem Sarg seiner Frau und Komtesse Benigne, seiner alten Schwester. Der Sarg wurde in der Familiengruft beigesetzt, Benigne mit dem Kinde im Schloss eingerichtet, und dann reiste Graf Botho wieder ab.
Hier verbrachte Günther seine Kindheit. Damals war es, dass er seine ersten Spiele mit Beate und Mareile, der braunen Inspektorstochter, zwischen den Levkojen und Lilienbeeten des Kaltiner Gartens spielte.
Die Baronin von Losnitz, früh verwitwet, lebte mit ihrer einzigen Tochter in Kaltin. Komtesse Seneïde Sallen, ihre Schwester, wohnte bei ihr. Irgendeine brutale Liebesgeschichte war in das stille Leben des Landfräuleins eingeschlagen und hatte es seelisch und geistig gebrochen. Jetzt lebte sie hier. Friedliche Beschäftigungen, die freundliche Narkose der Religion erhielten das Gleichgewicht dieses kranken Geistes.
Schloss Lantin wurde unterdes wieder leer. Komtesse Benigne starb, und Günther wurde in die Stadt gegeben. Lantin sah seinen Herrn zwar noch einmal, allein unter wunderlichen Umständen, wieder. Graf Botho langte mit einer fremden, schwarzlockigen Dame an. Frau Kulmann, Kastellanin und Kammerdienergattin, verstand es, ein undurchdringliches Dunkel um die Fremde zu breiten. Die Leute schüttelten die Köpfe. Begegneten sie dem Paar, dann rückten sie an den Mützen, verzogen jedoch höhnisch die Mäuler. Mankow, der Wildhüter und Vertraute des Grafen, erzählte abends im Waldkruge unheimliche Geschichten von der »verfluchten Schwarzen«. Über dem Portal des Schlosses hing in bemaltem Stein das Tarniffsche Wappen: auf dem Tartschenschilde in goldenem Felde drei schwarze Lindenblätter, darüber, auf gekröntem Stechhelm, zwischen dem offenen, goldenen Flug ein wachsender, schwarzer Brackenhals. »Die drei herzförmigen Blätter«, sagten die Lantiner, »sind die drei Weiberherzen, die jeder Tarniff bricht.« – »Ja«, sagte Mankow, »und der Hund da oben, das ist der Teufel, der sie holt. Unser Alter hat sich seinen Teufel selber mitgebracht.« Die Sache nahm kein gutes Ende: »So verfault is unser Alter auch noch nich«, meinte Mankow. »Was zu doll is, is zu doll! Das schwarze Aas hat die Reitpeitsch, die mit dem goldenen Knopf, wisst ihr, zu schmecken gekriegt.« Eine verschlossene Kutsche brachte die Schwarze eines Morgens zur Station. Der alte Herr verschloss sich in seine Gemächer, dann reiste er ab, kam wieder, vergrub sich in seine Bücher: »Alt is ’r«, sagte Mankow. »Er sagt, er hat das Leben satt. Muss der gefressen haben! Was? Jetzt sitzt er bei den Büchern, und das ist das Letzte.« Ein Schlaganfall beraubte den alten Herrn seiner Füße. Stundenlang schob Kulmann ihn im Rollstuhl die Alleen des Parkes auf und ab, und das große, bleiche Greisenantlitz wackelte missmutig und ergeben bei jeder Bewegung des Rollstuhles. Endlich kam das Ende. Kulmann hatte seinen Herrn eines Nachmittags allein im Park gelassen, um zu Hause einen Grog zu trinken. Das mochte ein wenig lange gedauert haben. Als Kulmann gegen Abend seinen Grafen aufsuchte, fand er ihn in der Herbstdämmerung tot im Rollstuhl sitzen, feucht von Abendnebeln, überstreut von Herbstblättern, und den goldenen Knopf der Reitpeitsche fest zwischen die Zähne geklemmt.
Günther mied das Schloss. Frau Kulmann kämpfte mit Staub und Motten und dachte an lustigere Zeiten, da sie jung war und dem seligen Herrn gefiel.
Günther erwuchs zu einem sehr glänzenden Ulanenoffizier. Er durchspähte das Leben mit leidenschaftlicher Hast nach Genüssen, als fürchtete er beständig, irgendein Genuss, ein seltenes Glück könnte ihm unterschlagen werden. Nach einigen Jahren hieß es, seiner Gesundheit halber müsse er den Dienst verlassen. Andere erzählten, seine Beziehungen zu einer hochstehenden Dame hätten seine Entfernung aus Berlin wünschenswert gemacht. Er ging nach Athen, bei der Gesandtschaft diplomatische Kenntnisse zu sammeln. Einige Winter später trafen die Jugendgespielen sich in Berlin. Frau von Losnitz wollte Beate in die Gesellschaft einführen. Günther befand sich gerade in einer Krisis, die bei solchen nervösen, allzu gierigen Lebenstrinkern gegen Ende der zwanziger Jahre einzutreten pflegt. Er war satt. Von jeher hatte er das Weib für die Verschleißerin der wichtigsten Genüsse des Lebens angesehen. Für jede Stimmung das richtige Weib zu finden erschien ihm als die bedeutsamste Kunst; und urplötzlich war er der Weiber so müde: »Es ist doch in der ganzen Welt immer wieder dieselbe kleine Schauspielerin mit den gemalten Augenbrauen und den geldgierigen Taubenaugen«, meinte er. »Ich kann Dir sagen«, schrieb er an den Maler Hans Berkow, seinen Freund, »ich gehe den Weibern wie einer Drehorgel, die eine zu oft gehörte Melodie spielt, aus dem Wege. Ich kann nur noch mit den stillen, kühlen Marmordamen im Museum verkehren.« In dieser Gemütslage musste Beate stark auf Günther wirken. Dieses Mädchen, mit einer stilvollen Reinheit, schien ihm ein Glück zu versprechen, das ihm wirklich bisher unterschlagen worden war. »Sie ist ja die adelige Poesie in Person«, sagte er, denn er liebte die geschmückten Redewendungen. Einen schwungvolleren Bewerber hatte die kühle Berliner Gesellschaft noch nicht gesehen: »Je nun!« sagte der Fürst Kornowitz, »wir haben bei unseren Damen schon alle möglichen Manieren versucht, Jockeymanieren, Künstlermanieren, Dekadenzmanieren. Der Tarniff scheint die Troubadourmanier aufbringen zu wollen. Keine bequeme Manier das.«
Beate nahm Günthers Werbung in ihrer wohlerzogenen Art hin. In den Schlössern unseres Landadels wachsen noch, unter feiner berechneter Obhut, solche Mädchen von wunderbar naiver Reinheit heran. Das Gute und Schöne erwarten sie von dem Leben, wie das Selbstverständliche, und Günther erschien Beate als dieses Schöne und Gute. Im Winter verlobten sie sich, im April wurden sie getraut, und im Juli des nächsten Jahres zog Günther nach Kaltin, entschlossen, dort ein glückliches Familienleben zu führen nach wohlbewährtem, altadeligem Rezepte.
Drittes Kapitel
Die alte Baronin von Losnitz saß in ihrem Voltairesessel und strickte einen blauen Kinderstrumpf. Schöne Haartrompeten, blank und weiß, rahmten das fette, weiße Gesicht ein mit den regelmäßigen Zügen. Seneïde saß am Fenster und nähte. Ihre Züge waren scharf und gezogen, die Lippen fast weiß, und die Augen lagen tief in den Höhlen und gaben dem Gesichte einen kummervoll-erregten Ausdruck. Sie legte ihren Fingerhut mit einem lauten »Klap« auf den Tisch, lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen. »Beating«, begann sie, »war heute wieder wie sonst. Gestern, da war etwas Fremdes in ihrem Gesichte – etwas – ich weiß nicht?«
Die Baronin schaute ihre Schwester über die Brille hinweg an: »Hör, Seneïdchen, du machst die Dinge gern geheimnisvoll. Für ein junges Ehepaar ist das nichts. In deiner Milchkammer rührst du auch nicht in den Töpfen herum; du wartest doch ruhig, bis die Sahne sich absteht. Na – also!«
Seneïde beugte sich still auf ihre Arbeit nieder.
Nun kamen Günther und Beate. Günther begann sofort die alten Damen zu bezaubern. Nichts im Leben war ihm ungemütlicher, als wenn er nicht gefiel. Bei der Toilette bemühte er sich, Peter zu gefallen, und auf der Reise dem Schaffner. »O Mama, wie blühend du aussiehst, hübsch und sommerlich. Und Tante – Ihr Harmonium habe ich heute früh schon im Bette gehört. Geradezu heilig hab’ ich dabei geschlafen – auf Ehre. Gott, hier muss man ja gut sein.«
Dann sprachen sie von Mareile Ziepe, der Inspektorstochter. »Oh, unsere Mareile«, rief Günther, »die ist groß! Also – nicht nur die berühmte Sängerin; sie ist die gefeiertste Schönheit der Gesellschaft – der Gesellschaft – bitte.«
Die Baronin lachte: »Meine Mareile! Die hatte immer eine feste Hand … Wenn man Ziepe heißt und dann …«
»Na ja, Ziepe«, meinte Günther, »das hat sie abgelegt. Sie heißt Cibò! Ist auch besser. Die Fürstin Elise kann ohne Mareile nicht leben, der Fürst Kornowitz schmachtet sie an.«
Durch die Seitentür kam jetzt Frau Ziepe herein. Sie wollte die jungen Herrschaften begrüßen. Erhitzt und verlegen saß sie neben Beate und sprach von ihren Zwillingen. Plötzlich verklärte sich ihr Gesicht. Mareile war genannt worden.
»Auf Ihre Tochter«, wandte sich Günther an die Inspektorsfrau, »sind wir alle stolz.«
»Danke, Herr Graf, danke.« Frau Ziepe errötete. »Und ich hab’ mich so vor der Kunst gefürchtet. Man spricht so viel. Aber Mareiling hat Charakter, Gott sei Dank.«
*
»Was tun wir?« fragte Günther seine Frau, als sie wieder allein in Beates blauem Kabinett auf den weißlackierten Stühlchen saßen. »Natürlich beieinander sein!« Er nahm Beates Hand und küsste vorsichtig jede Fingerspitze. »Ja, was tun wir?« wiederholte Beate.
Günther dachte nach. »In den Garten müssen wir, damit wir so das Sumsum des Sommers hören. Nicht? Im Park unter den Linden muss es jetzt gut sein. Suche ein Buch heraus. So was Altmodisches, ganz Süßes, weißt du. Ich bestelle die Hängematten?«
»Ah! So ist’s gut!« rief Günther, als sie beide unter den Linden in den Hängematten lagen. »Nun lies, Schatz.«
Zwischen den starken Stämmen hindurch sah Günther ein Stück des Teiches mit seinen Inseln von Froschlöffel und Wasserlinsen. Libellen, kleine blanke Lichtgestalten wiegten sich in der heißen Luft. Unter den Weiden am Ufer aber saßen die Schwäne, weiße, regungslose Gebilde. Günther blickte auf die schmale, helle Gestalt neben sich in der Hängematte. Lichter und Blätterschatten huschten über sie hin: »Gott ja!« dachte er, »unsere Frauen, die sind eigen! So ’ne kühle, klare Luft ist um sie her. Die anderen sind auch schön – o ja! Mareile zum Beispiel, aber so das – das Festliche fehlt.«
Beate hielt inne und blickte zu Günther hinüber. »Du hörst mir nicht zu. Woran denkst du?«
»Ich denke – ich denke an dich – und dass es gut ist, dass du hier in der Hängematte liegst und nicht – eine andere – Mareile oder sonst eine von den anderen.«
»Mareile? Warum?«
»Erinnerst du dich noch des Besuches der Rumpenower Kinder? Du und Mareile hattet damals lange, dünne Backfischbeine. Wir spielten Räuber im Garten. Ich weiß nicht, wie das kam, aber Mareile und ich mussten in den Rübenkeller flüchten. Kühl war’s da und roch feucht nach Gemüsen. Wir waren stark gelaufen, unsere Herzen schlugen laut – tap – tap. Mareile hatte ein weißes Kleid an – und nackte Schultern. Nun da – bog ich mich vor und küsste eine dieser spitzen, heißen Backfischschultern. Früher war mir das nie eingefallen.«
»Oh! Wirklich?« warf Beate hin.
»Ja. Sie stieß mich vor die Brust und sagte: ›Dummer Junge‹.«
»Nun – und?«
»Ach nichts! Ich dachte daran. Übrigens glaub’ ich doch, dass Mareile damals in mich verliebt war.«
»Möglich!« meinte Beate ein wenig hochmütig. »Sie sprach damals zuweilen vom Verlieben. Ich fand das lächerlich. Verlieben gehörte zur Kammerjungfer Lisette, zu Betty Ahlmeyer.«
»Ja – ja – natürlich!« rief Günther. »Das war Kaltinsch – ganz echt. Na, lies nur.« Günther schaute wieder in das Blätterdach hinauf. Ein Schwarm Mücken drehte sich wie blonder Staub in einem Sonnenstrahl. Das macht schwindelig und schläfrig.
Günther reckte sich: »Wie schön – wie schön!« Er pflegte jede Lebenslage genau auf die Summe von Befriedigung hin zu prüfen, die sie ihm bot; er stellte gern jedem Augenblick eine Zensur aus. Jetzt war er zufrieden. An dem Junggesellenleben war doch nichts Rechtes dran! Stille, helle Zimmer, gute Menschen, diese Frau – dieses beruhigende, weiße Rätsel, an dem herumzuraten eine so friedliche Beschäftigung war – das wollte er jetzt.
Das Ehejahr in Berlin zählte nicht. Was die Liebe der Junggesellenjahre lehrt, lässt sich bei den Beaten schlecht verwenden. Da muss umgelernt werden; das macht ungeschickt. Beate nahm dort etwas Erstauntes, bleich Ergebenes an; als hätte sie eine Enttäuschung erlebt. Dass er diese Enttäuschung sein könnte, war für Günther kränkend und quälend gewesen. Berlin war ohnehin für Beate nicht der rechte Hintergrund. Hier war’s gut! Er streckte seine Hand zu der anderen Hängematte hinüber.
»Du hast geschlafen?« fragte Beate.
»Ja«, sagte Günther, »und geträumt. Ein Traum, ganz weiß von dir.«