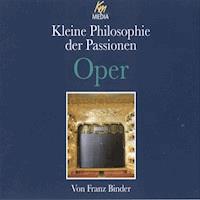Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sonnenstern-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch verbindet in zwei parallelen, miteinander verflochtenen Erzählsträngen eine ferne mythische Vergangenheit mit unserer modernen Welt. Bindeglied ist eine jahrtausendealte Liebe. „Begegnung der Zeiten“ setzt den 1989 erstmals erschienenen spirituellen Fantasy-Roman „Der Sonnenstern“ von Franz Binder fort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 769
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ayshen mit Liebe und Dank.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Einschub: Phantasie
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechundzwanzigstes Kapitel
Der Autor
Prolog
Es war eine der Nächte, in denen Geschichten vom Himmel fallen wie Kometen, Nächte, in denen die Sterne heller noch funkeln, als hätte der Atem eines Gottes ihr Feuer angefacht.
Selten nur ereignen sich solche Nächte. Bloß die Alten wussten von ihnen und sagten, ein Mensch sei gesegnet, wenn er einmal nur in seinem Leben solche Stunden der Wunder erlebe, die zur Erde regneten.
Götter werden geboren in Nächten wie diesen, raunten andere, und der Glanz ihres Erscheinens schimmere auf die Menschen herab, glimmender Sternenstaub, Schweifsterne, die Leuchtspuren am Himmel ziehen und alle Wünsche erfüllen. Fröhliche Feste feierten die Götter in solchen Nächten. Das Echo ihres Gesangs weht über die Erde und wandelt sich auf den Zungen der Erzähler zu Geschichten.
Nie aber war eine solche Nacht über dem Dorf in den Sümpfen angebrochen. Ein für immer unerfüllbares Versprechen blieb sie, wenn einer der Alten sich erinnerte an ferne Tage, als er mit einer Karawane gezogen war oder mit einer Kriegerschar. Nur dort, in geheimnisvoller Fremde, geschahen solche Wunder, die zu Geschichten werden auf den Zungen der Erzähler. Aber kein solcher war je den Wasserläufen gefolgt, die sich durch im Wind wogende Meere von Schilf und Papyrus zogen, in denen der grüne Herr des Wassers wohnte und der heilige Ibis, nie, bis zu jenem Abend, als ein Junge, kaum älter als zwölf Jahre, schlank und sehnig wie eine Gazelle, einen weißbärtigen Alten über die schmalen, bröckelnden Dämme zwischen den spiegelnden Wassern führte.
Sie schritten rasch aus, der Knabe mit federnden, prüfenden Schritten, die aufmerksam springenden Augen folgten, der Alte wie schwebend, das Haupt erhoben, ganz dem Blick seines Führers vertrauend, auf dessen Schulter seine rechte Hand ruhte, versunken im Lauschen auf Töne, die nur Blinde hören können.
Sie kamen aus dem Nirgendwo, als seien sie vom Himmel gefallen, Silhouetten vor dem Gold sinkender Sonne, denen im Wasser ein Spiegelbild an den Sohlen klebte. Mit einer Karawane seien sie gereist von weit aus dem Westen, sollte der Alte später berichten, doch bei einem Überfall von Räubern versprengt worden, ins Schilf geflüchtet. Mit knorriger Stimme sprach er, mit einer Stimme, in welcher Fügung in unabwendbares Schicksal schwang. Der Knabe nickte, den Mund ernst verschlossen, was einen Stolz auf seine Züge prägte, der seiner Jugend nicht gemäß schien. Der Blick seiner schwarzen, glänzenden Augen trieb ruhelos über die Gesichter der Fischer und Bauern, die diese Fremden bestaunten, misstrauisch erst, argwöhnisch, dann aber, als sie begriffen, dass dem Blinden und dem Knaben keine Gefahr folgte, nur neugierig. Einer der Alten, der früher selbst mit Karawanen gezogen war, bevor er sich hier im Haus seines Vaters als Fischer niedergelassen, nahm die beiden in seiner Kate aus Lehm und Schilf auf, bot ihnen ein Lager und eine Mahlzeit aus Brei und getrocknetem Fisch.
Sie aßen schweigend.
Wie von selbst, als sei es so abgemacht, traten nach Einbruch der Dunkelheit die Männer des Dorfes, junge und alte, in die Hütte, die Köpfe gebeugt in der engen niedrigen Türöffnung, einer nach dem anderen, ohne Gruß, wie Leute, die gekommen sind, etwas zu holen, das ihnen seit langem zugesprochen ist. Der Knabe sah sie erschrocken an , doch der Alte blieb ruhig, als er die Schritte der Bauern vernahm. Seine großen müden Hände lagen schwer auf den Knien, als seien sie aus Stein. Auf seinem wettergegerbten Antlitz aber wuchs ein Licht, das nur der Knabe sah und kannte, ein Schimmern, das die toten Augen sehend zu machen schien, ein Glanz, der aus den Tiefen der Herzenstille stieg, ein Leuchten, für das die edlen Herren in ihren Steinhäusern im Norden Gold gaben, Tuch und reiche Speise, doch das nicht dem Willen gehorchte und nicht dem Verlangen nach Belohnung, sondern das nur aufdämmerte, wenn das Herz bereit war, sich zu verströmen, wenn die verborgene Stimme der Stille tief innen sprechen wollte, Worte formte auf der Zunge, die nur des Atems Instrument war, wenn die blinden Augen zu sehen begannen in der Finsternis und wenn die rissigen Lippen sich bewegten, und Worte, stockend erst, langsam, widerwillig fast, zwischen ihnen hervorkamen, bis sie sich zu einem breiten, unversiegbarem Strömen formten.
Dies geschah nur in Nächten, in denen Geschichten vom Himmel fallen wie Kometen, in denen die Lippen eines von den Göttern berührten Erzählers sich öffnen, nachdem der Glanz des Wissens sein Herz berührte, jener Glanz, der sich nicht rufen lässt, sondern wie die Sonne leuchtet wo es ihm gefällt, ob im Palast eines Edlen oder in einer Fischerhütte weit in den Sümpfen. Hell und klar war die Stimme des Alten nun, als sei auch sie von diesem Glanz erfüllt, gekräftigt von schimmerndem Metall. Nicht die Stimme eines Greises erklang, sondern die eines jungen Mannes, der im Traume spricht, weil ein Wind der Liebe über sein Herz hingeht, ein Hauch der Sehnsucht, verflochten mit einem Zittern eisiger Ahnung.
Still hockten die Männer im Dunkel und lauschten, der Knabe aber, der dieses Licht auf dem Gesicht des Alten oft schon erblickt, wich zurück von der Schilfmatte, auf der sie saßen, suchte sich in der Dunkelheit zu bergen vor dem Strom der Worte, denn er wusste, dass sie machtvoll waren, dass sie zu sengen vermochten wie Feuer, dass sie stachen wie die Sonne am Mittag.
Stärker als je zuvor war das Leuchten in dieser Nacht, so dass der Knabe erschrak.
Er wusste, dass sich dieser Strom von der Lebenskraft des Alten nährte wie die Flamme vom Öl, dass es das Leuchten seines Todes war, der mit jedem Wort näherrückte, als Wegzoll, den Sterbliche zu entrichten hatten für solches Wissen.
Hinter den Bauern und Fischern barg sich der Knabe im Dunkel, zwischen ihren Gerüchen nach brackigem Wasser, nach Lehm, nach Sonnenwärme, nach Tieren, nach getrocknetem Schweiß. Hinter ihre Reihen schob er sich, damit sie wie eine Wand zwischen ihm und dem todberührten Glänzen standen.
Hinter ihnen, verloren im Dunkel, hingekauert in die Finsternis einer Nische, sah er das Mädchen, das scheue Gesicht, das er mehr erahnt als gesehen hatte beim Eintreten in die Hütte. Ebenso scheu blickten ihn nun diese Augen an, die kaum mehr als eine Ahnung waren im Dunkel und doch lächelten sie, als er vor Staunen eine Grimasse zog. Gleich aber wandten sie sich wieder dem unsichtbaren Leuchten zu, das alle in Bann schlug, das kein Abirren von Augen und Ohren duldete. Schon begannen die Lippen des Alten Worte zu formen, und alle wussten, das seine toten Augen, starr in der Dämmerung verloren, nun schauen konnten, weit und tief, in Räume und Zeiten, allen sonst verborgen.
»Die Götter aber sahen«, sprach er, »dass die Menschen abirrten, dass jedes neue Geschlecht, das aus dem Schoß der Weiber hervorging, schlechter war als jenes, das in die Verwandlung des Todes sank. Entartet waren die Menschen. Neid und Missgunst trieben sie, Gier nach Schätzen und verbotener Macht. Die finsteren Kräfte riefen diese Menschen; die Magie des Feuers und der Erde vermählten sie, um den Göttern gleich zu sein, denn in ihrer Vermessenheit wollten sie die Götter herabstürzen vom Thron des Lichts, um ihn selbst zu erklimmen als Herrscher über Himmel und Erde.
Die alte Weisheit fiel in Trümmer in diesen Tagen der Verblendung. Maat, die Krone ewiger Gerechtigkeit, wurde geschändet. Dunkelheit legte sich über das blühende Land und jene, die das reine Licht in ihren Herzen bewahrt hatten, flohen aus den Städten in die Verborgenheit, denn sie spürten den unerbittlichen Zorn der Götter. Nun aber, in jenem längst versunkenen Zeitalter, waren die Menschen gesegneter als jene, die nach ihnen kamen, denn der einzige Ra blickte mit beiden Augen herab auf die Erde. Sein rechtes Auge stieg mit der Morgenröte in den Himmel des Tages auf und sank am Abend hinab in den Westen, um das Totenreich der Duat zu erleuchten, sein linkes aber wanderte einmal im Jahr als blitzender Stern über den Himmel, leuchtend wie eine kleine zweite Sonne, heller als der Mond, zum Zeichen, dass auch in den Stunden der Dunkelheit der Wille der Götter über die Erde und alles Lebendige herrscht.
Gütig und voll Weisheit blickte dieses Sternenauge herab auf die Menschen, die es Sonnenstern nannten, doch sie verschlossen ihre Herzen in Bosheit, und jene Priester und Zauberer, die niedrigen Götzen und dunkler Magie dienten, hetzten sie auf und versprachen, die Macht der Götter für immer zu brechen und die Reichtümer der himmlischen Paläste unter allen Menschen zu verteilen.
Gebrechlich seien die Götter geworden und ihre Glieder ohne Kraft, verkündeten sie.
Da ergriff großer Zorn den Ra, und er hielt Rat mit der formlosen Mutter, aus der er einst selbst entstanden. Auch die anderen Götter waren erzürnt und drängten ihren Höchsten, die Frevler zu bestrafen.
Also befahl Ra seiner Tochter, der großen Hathor, die den Himmel nährt mit der Milch ihrer Brüste, hinabzusteigen mit dem Sonnenstern, seinem gleißenden linken Auge, um die Geschlechter der Menschen für immer auszulöschen«.
Der Knabe spürte die Angst, welche die Worte des Greises in dem Mädchen weckten. Er spürte ihre Furcht, der Zorn des Ra könnte gerade jetzt, in dieser Nacht, sich wieder regen, da ihn die Lippen des Alten beschworen, denn Worte, so wussten alle, hatten die Macht, unerhörte Dinge geschehen zu lassen.
Selbst die Zeit überwanden solche Worte, so dass sich lange Vergangenes wieder erhob, als begebe es sich noch einmal.
Ein Schaudern ging durch das Mädchen, als der Alte berichtete, wie Hathor, die Himmelskuh, das linke Sternenauge des Ra in Empfang nahm als Fackel der Vernichtung, wie die Sanfte, die Nährende, die Freudenspenderin, sich im Zorn ihres Vaters zur löwenmähnigen Sechmet wandelte, zur Brennenden, Vernichtenden, gierig nach dem Blut aller Menschen. Der Knabe sah hinüber zu dem Mädchen, fühlte ihre Angst, ihr Entsetzen, das ihr wie eisiger Hauch über die Haut lief. Sie hielt den Rücken gekrümmt, die Arme vor der Brust gekreuzt, klammerte sich an die eigenen Schultern, als suche sie Halt an sich selbst.
Ohne zu denken griff der Knabe nach einer dieser krampfenden Hände, legte die seine beruhigend darauf, spürte, wie neues Erschrecken das Mädchen fasste, ein kurzes Zucken nur, bevor sich der feste Griff löste, Weichheit zurückkehrte in die Erstarrung, Besänftigung.
»Der Sonnenstern aber, das linke Auge des Ra, stürzte herab auf die Erde als rasende Sechmet, die außer sich vor Zorn nichts anderes im Sinn trug, als das Menschengeschlecht zur Gänze zu vertilgen vom Antlitz der Welt.
Wenige nur entgingen ihrer Wut, ihrem tödlichen Tanz, wenige nur vermochten sich zu retten auf Schiffe, denn Feuerberge barsten und Flutwellen, höher als Gebirge, brachen aus dem Meer hervor und verschlangen Städte und Dörfer und Tempel. Furchtbar war das Strafgericht des Ra und erst als das gewaltige Reich versunken war unter dem Meer, als sich eine endlose Fläche des Wassers erstreckte, wo einst Völker gewohnt, verflog sein Zorn.
Ra, der Spender des Lichts, verbarg fortan sein linkes Auge, denn so schrecklich hatte die Kraft der Vernichtung gewütet, die aus ihm hervorgebrochen, dass selbst die Götter sich fürchteten«.
Reglos lauschten die Bauern. Wenn der Alte schwieg, um Atem zu schöpfen und den Blick erneut in die Abgründe der Zeit zu tauchen wie Ruder in tiefes Wasser, schien Stille herabzusinken und alle zu umschließen. Die Geräusche der Nacht, die von draußen hereinwehten, schienen wie Stimmen vom weit entfernten unerreichbaren Ufer einer anderen Welt. Wie in einem Boot, das auf dem Meer der Zeit gleitet, saßen die Bauern und Fischer und lauschten dem Alten, der das Steuer führte.
Als der Schreck über die erste Berührung verflogen war, spürte das Mädchen keine Angst mehr. Als hätte sie etwas lange Vermisstes wiedergefunden, als fühle sie Geborgenheit, wie niemals zuvor in ihrem Leben, ging plötzlich ein Atem schwerer Ruhe durch sie. Sie schloss die Augen, um den fremden Jungen nicht sehen zu müssen, denn sie schämte sich in seiner Nähe, aber es war eine süße Verlegenheit, eine jubelnde Aufgeregtheit, die sie verwirrte. Sie spürte seine Hand auf der ihren und wünschte nichts so sehr, als für immer so zu sitzen in der finstersten Nische der Hütte, die Augen geschlossen, um die Stille zu spüren und diese zarte Berührung, in der Wärme klang, Trost und unaussprechliche Süße.
Ihre andere Hand tastete nach dem Amulett, das an ledernem Band um ihren Hals hing, holte das runde Metall aus dem Gewand und drückte es, bis ihre Hand schmerzte, um ihren Herzschlag, der ihr brennend bis an den Hals pochte, zu stillen.
Der Junge ahnte diese Bewegung mehr als er sie sah, ein leichtes Zucken in der Dunkelheit, doch seine Hand folgte ihm mit dem sicheren Instinkt eines Jägers. Als er die Hand des Mädchens berührte, die sich um das Amulett krampfte, spürte er, wie ihre Finger sich lösten, wie die Hand sich drehte und ihm das warm gewordene Metall reichte. Er tastete es und erkannte es sogleich, denn Tausende Male schon hatte er es in seinen eigenen Händen gefühlt – diese kleine goldene Scheibe, in deren Mitte ein schützendes Zeichen geschnitten war. Es durchfuhr ihn siedend. Hatte sich sein eigenes Amulett vom Band gelöst und war in die Hände des Mädchens gefallen, oder hatte sie ihn gar bestohlen? Rasch griff er an die eigene Brust und erschrak noch einmal, als er sein eigenes Amulett wie immer dort fand, als er in der Rechten und der Linken das gleiche glatte metallene Zeichen fühlte.
»Aber auch viele derer, die sich retteten, waren verloren, denn die Dämonen der Großen Gewässer zerbrachen ihre Schiffe und zogen sie in die Tiefe«, sprach der Alte weiter. »Wenige nur gelangten unbeschadet über das große Wasser, niedergedrückt, denn die Sonne wollte sich nun nicht mehr erheben über dem Meer. Ewige Nacht herrschte, denn Ra verbarg beide seiner Augen und wollte die Erde strafen mit immerwährender Dunkelheit. Dumpfe Wolken brüteten über dem Meer und den Küsten, an denen die Schiffe der Menschen nach langer, entbehrungsreicher Fahrt schließlich landeten.
Früher schon waren ihre Krieger hierher gekommen, um Sklaven zu holen und Gold, nun aber kamen sie als Fliehende, deren altes Reich über dem Meer versunken war unter der Flut. Doch sie waren trotzdem mächtiger als alle anderen Menschen auf Erden. Waffen führten sie mit sich, denen niemand standzuhalten vermochte und ihre Lippen sprachen schrecklichen Zauber, denn sie besaßen Sprüche großer Macht.
Sie fuhren mit ihren Schiffen bis zur weit verzweigten Mündung der Hapi und nahmen das fruchtbare Land dort in ihren Besitz. Die Menschen aber, die immer schon dort gelebt hatten, vertrieben sie von ihren Äckern stromaufwärts nach Süden und zogen durch die Gewalt ihrer Magie einen Bannkreis um ihre neu errichtete Stadt, den niemand überschreiten durfte, der nicht eines Blutes mit ihnen war.
Doch auch die Geschlechter der Eindringlinge waren untereinander verfeindet und setzten ihre Zwiste fort, die sie auf ihren Schiffen mitgeführt aus der versunkenen Heimat«.
Der Junge hörte die Worte des Alten nicht mehr, glaubte sich versunken im eigenen Atem, der laut und heftig ging, presste die beiden Amulette in seinen Händen, bis sie ins Fleisch schnitten, bis wohliger Schmerz ihm zeigte, dass er nicht träumte, glaubte seine Hände brennen zu spüren, als würden die metallenen Zeichen in seinem Griff erglühen. Nun fühlte er die Hand des Mädchens, die seiner folgte, sie suchte, scheu berührte, innehielt. Er öffnete die seine, gab ihr das Zeichen zurück, griff nach ihrer anderen Hand, um sie zu seiner Brust zu führen und ihr sein Amulett zu geben.
So waren sie verbunden im Spiel ihrer Hände und in beiden erwachte ein Erkennen, das um keine Worte wusste, das nicht einmal zu denken war. In der Dunkelheit fanden sich nun auch ihre Augen für einen flüchtigen Blick, in dem alles zugleich lag – Angst, Erstaunen, Neugierde.
Die Worte des Alten verschwammen mit den Lauten der Nacht, die Köpfe der Bauern zerflossen in der Finsternis, einzig eine verzweifelte Ahnung blieb in dem Jungen und dem Mädchen, eine Ahnung, die tiefer und tiefer grub, ohne je ein Bild zu finden, eine Ahnung, die ungeduldig an Mauern des Vergessens schlug, nur um diese Ahnung zu vertiefen. Noch ehe sie es denken konnten, wussten sie, dass sie zueinander gehörten, dass sie von einem Fleisch, von einem Geist waren, dass sie geboren waren füreinander und dass es kein Schicksal gab, das sie je zu trennen vermochte.
Ihre Hände sagten das, die im Dunkel ineinander geschlungen waren, ihre Augen sagten es, die einander suchten, auch ihre Herzen, die heftig schlugen wie nach langem atemlosen Rennen.
»Wie heißt du«? flüsterte der Junge. »Asea«, hauchte sie. Nun glänzte in ihren Augen eine Frage auf, die der Junge ebenso leise beantwortete: »Ich heiße Nechu«. Kein Gedanke vermochte dem Sturm ihres Erstaunens standzuhalten und doch war das klare Wissen in ihnen, die jung waren, Kinder noch, dass sie in diesem Augenblick alles gefunden hatten, was ihnen im Leben je zu finden vergönnt war, dass es keinen Augenblick geben würde, der kostbarer war als dieser, dass selbst der Tod sie nicht mehr zu trennen vermochte. Sie wollten diesen Augenblick festhalten, indem sie ihre Hände hielten und immer wieder ihre Amulette tauschten. Sie wollten ihn bannen im Blick ihrer Augen, aber er verging, wie auch die Glut in den Worten des Alten verglomm, und der vage Glanz seines blinden Blickes erlosch.
*
Nechu fand den Weg über die Dämme wieder, als sei er ihm jeden Tag all die Jahre gefolgt.
Die Zweifel schwanden, als er in das Meer von Schilf tauchte, in das verlorene Land der Wasser, dessen Wege niemand suchte in diesen Tagen der Sommerhitze.
Jubel schwang sich in ihm auf, als er das Dorf sah, wie damals zusammen mit dem Alten in der Abenddämmerung, still unter rotglühendem Himmel, als sei keine Zeit vergangen zwischen diesen beiden Abenden.
Wie viele Jahre waren verflossen seither, wie oft war die mütterliche Hapi gekommen am Tag des Sothis mit fruchtbarer Flut für die Felder? Er wusste es nicht, denn die Zeit war undurchdringliches Dickicht. Auch hatte ihn niemand gelehrt, zu zählen und Zeichen zu machen, in denen sich Erinnerung festbrannte. Er brauchte sie nicht, diese Zeichen, war doch sein Geist wie eine Truhe, in welcher die Worte des Alten wie Schätze lagerten, jedes einzelne ein Stück Gold.
Trauer kam über ihn, als er an den Alten dachte, dessen Hand er noch immer auf seiner Schulter fühlte, leicht und behutsam, dessen Augen er gewesen war seit er denken konnte. Der Alte war in den Westen gegangen zwei Monde nach jener gesegneten Nacht in dem Dorf, in der sich in seinem Mund die Kraft inneren Leuchtens zum letzten Mal zu Worten geformt hatte. Ganz hatte er sich den Bauern und Fischern gegeben in jener Nacht, verbrannt war sein Herz, und am anderen Morgen, als sie weitergezogen über die schmalen Wege zwischen den Wassern, war der Alte nur mehr Asche gewesen, die den Windhauch erwartet, der sie fortbläst.
Zu einem anderen Dorf im Süden waren sie gewandert und dort hatte der Alte sich hingelegt zum Sterben, schweigend und gefügig, als sei er am Ziel einer langen Reise angelangt. Die Bauern dort kannten den Alten, betteten ihn in eine ihrer Hütten und sorgten für ihn, bis er in einer schwülen mondlosen Nacht zum letzten Mal den Atem ausseufzte.
Nechu aber, den Knaben, behielten sie auf Bitten des blinden Greises bei sich, hießen ihn ihre Tiere hüten, gaben ihm zu essen und ließen ihn in ihren Hütten und Ställen schlafen.
Nechu dachte an die langen Stunden, in denen er am Lager des Sterbenden gesessen, den Blick in die versteinerten Züge versenkt, schweigend, das Amulett umklammernd, das ihm sofort jene bange süße Stunde in der Kate des Fischers in Erinnerung rief. Und eines Abends hatte er es abgenommen von seinem Hals und dem Alten in die Hände gelegt. Der hatte es erspürt mit seinen sehenden Fingern und ein Hauch von Sorge war über sein Antlitz gehuscht. Seine Lippen bebten, als wolle er sprechen, also beugte der Junge sein Ohr so nah an den Mund des Alten, dass er dessen Atem spürte.
»Das Auge des Tigers trägst du, das Zeichen der Gesegneten. Ihre letzte Blüte bist du«, flüsterte der Alte mühsam. »Von jenen, die Not und Verfolgung litten, weil sie der Wahrheit dienten, stammst du ab. Sie haben dich mir anvertraut, um dich vor bösem Schicksal zu bewahren, denn wer achtet schon auf den Führer eines blinden Alten, der durch die Lande wandert, um vergessene Legenden zu erzählen.«
Er gab dem Jüngling das Amulett zurück. »Sie haben dir dieses Zeichen um den Hals gelegt, damit du eines Tages deiner Herkunft gedenkst.« Die Stimme des Alten wurde rau und brüchig. Sein Kopf bewegte sich zur Seite. »Gib mir zu trinken«, flüsterte er. Der Junge sprang auf, holte die hölzerne Wasserschale, führte sie vorsichtig an die Lippen des Alten und ließ ihn trinken.
Das Wasser schien ihn zu beleben. »Die Fremden, die über das Meer kamen, die Götter, die das alte Volk von den fruchtbaren Feldern verstießen und weit in den Süden drängten; sie sind mächtig, aber im Streit entzweit. Zuerst kamen jene Fremden, aus deren Stamm du hervorgegangen bist. Sie waren wirklich wie Götter, weise und gut, und sie gewannen das Vertrauen des alten Volkes.
Dann aber folgten die anderen, von dunklen Mächten besessen, auch sie mächtig wie Götter, doch diese waren Dämonen der Finsternis, zerfressen vom Bösen. Ihre Magie war stark. Sie ergriffen die Macht und sie waren es, die das alte Volk vertrieben. Gierig nach Blut waren ihre Waffen und sie begingen den Frevel, auch jene zu morden, die vor ihnen gekommen waren, obwohl die doch ihre Brüder und Schwestern waren in dem schweren Schicksal, das ihr weit entferntes Reich über dem Meer getroffen, über das der Zorn des Ra hingegangen war. Einem schwarzen, brennenden Gott huldigten sie, der ihre Grausamkeit anstachelte und ihnen hieß, jeden zu morden, der anderen Sinnes war als sie.
Die Familie aber, deren Sohn du bist, war ihnen besonders verhasst und sie tilgten sie aus ohne Gnade. Ich war in der Stadt der Götter in jenen Tagen und sah das Unheil kommen. Dein Vater aber wusste, dass es unmöglich ist, dem Schicksal zu entrinnen, welches deiner Familie bestimmt war, also gab er dich in meine Hand, um dich zu retten. Noch in derselben Nacht nahm ich dich mit mir fort und bald darauf brach das Unheil herein über die deinen.
Du warst mir mehr als ein Sohn in all den Jahren, in denen ich mit dir umherzog, du wurdest mein Augenlicht, das mich sicher führte auf allen Wegen. Sei bedankt dafür. Ich werde in den Westen gehen, in die dunklen Räume der Duat, wo allein mein Herz zu sehen vermag, wo ich keiner Führung mehr bedarf, wo das Auge des Ra mich erleuchtet, wenn seine Barke vorbeizieht. Du aber meide den Bezirk der Götter im Fruchtland der Hapi, denn erkennt man dich, bemerkt man das Zeichen, das du um den Hals trägst, so hast du dein Leben verwirkt. Denn noch immer brennt ihr Hass unerbittlich und noch immer dürsten sie nach dem Blut jener, die einst ihren schwarzen Gott verwarfen.
Man wird dich aufnehmen hier in diesem Dorf und du wirst dir dein Brot verdienen mit deiner Hände Arbeit. Doch später vielleicht, wenn der große Ra es will, wird die Gabe des Sehens in dir erwachen wie einst in mir und du wirst die Legenden, die du von mir gehört hast, auch in dir spüren, als seien sie lebendig. Du wirst sie sehen im Licht der Wahrheit und sie werden über deine Zunge fließen und die Herzen der Menschen berühren.
Erzähle sie niemals, wenn du nicht dieses Licht spürst, das von selbst aus dir hinausdrängt. Maße dir niemals an, diese Worte deinem Willen untertan zu machen. Wie zerborstene Schellen sind sie, wenn du sie sprichst, ohne dass sie gespeist werden vom Licht des Herzens, wertlose Klänge, nicht würdig, über die Lippen zu fließen. Aber wisse, dass das lichtdurchflossene Wort alles vermag.«
Seufzend bewegte er sein Haupt auf dem Strohlager. Um seinen Mund spielte ein Zucken, das der Junge nicht zu deuten vermochte. Es konnte Zeichen des Schmerzes ebenso wie Ahnung eines Lächelns sein. Es schien, als schmelze der Alte dahin in dieser Regung.
Zweimal noch hob sich sein Atem, schwer und mühevoll, dann wurde alles still. Über sein Gesicht breitete sich ein Ausdruck gelassenen Friedens. Nechu bemerkte lange nicht, dass er am Lager eines Toten wachte.
Also blieb er in dem Dorf, verdingte sich als Knecht bei den Bauern und wohnte in einer Kate aus Lehm, die er selbst erbaut hatte auf dem Fleck Erde, den man ihm zugewiesen am Rand des Dorfes. Die Bauern hatten ihn aufgenommen, um den Alten zu ehren, mit dem er gekommen war, dann jedoch erwarb er sich auch durch seinen Fleiß und die Reinheit seines Herzens die Gunst der Bauern. Sie schätzten ihn und einige waren gar bereit, ihn mit ihren Töchtern zu vermählen. Doch der Knabe, der zu einem kraftvollen jungen Mann heranwuchs, wusste, dass es seine Bestimmung war, das Mädchen wiederzufinden, welches das gleiche Zeichen trug wie er.
Unauslöschlich hatten sich jene Momente in der Hütte des Fischers in sein Herz gebrannt, in denen er neben ihr gekauert war, ihre Hand haltend, die beiden kleinen goldenen Scheiben spürend. Er sah das im Dunkel der Hütte verschwimmende Gesicht vor sich, die Augen, in denen sich Angst und Liebe mischten, die Anmut ihrer Züge, die keinem in solcher Armut lebenden Mädchen gehören konnten. Für Augenblicke hatte er geglaubt, sich selbst zu sehen, als wäre ihr Gesicht die spiegelnde Fläche eines klaren Teiches. Und die Gewissheit festigte sich in ihm, dass sie zueinander gehörten, dass sie füreinander geboren waren.
Eine Sehnsucht wuchs in ihm, die sein Herz überwucherte und eines Tages war sie so stark geworden, dass er aufbrach, das Mädchen zu suchen.
*
Die Ernte war eingebracht. Nechu hatte hart gearbeitet für die Gemeinschaft des Dorfes und auf seinen eigenen kleinen Feldern. Hatte guten Lohn erhalten, seine Vorratskammer war gefüllt, doch der Gedanke, dieses Leben weiter zu führen, sich dem Lauf der immer gleichen Monde zu überlassen, schien ihm unerträglich. So stahl er sich eines Abends fort aus dem Dorf, das ihm fast Heimat geworden, wanderte die ganze Nacht und als sich am nächsten Morgen die Sonne erhob, war ihm, als habe er sein bisheriges Leben von sich gestreift wie ein abgetragenes Gewand. Er war das Wandern gewöhnt. Als er noch mit dem Alten durch das Land gezogen war, waren sie oft tagelang gegangen, ohne anderen Menschen zu begegnen, hatten auf offenem Feld genächtigt oder in Erdhöhlen, Büschen und Hainen, hatten sich genährt von kargen Vorräten, die sie mit sich führten oder von Almosen, die ihnen die Menschen gaben, durch deren Dörfer sie kamen. Nechu wusste die rechten Vorkehrungen zu treffen, um Wüsten und Steppen zu queren, wusste sich zurechtzufinden im Schilfdickicht der Sümpfe. Und so kam es, dass er eines Abends jenes Dorf wiederfand, jene Fischerhütte auch, in deren finsterem Winkel er dem Mädchen begegnet war. Er kam, um das Mädchen zu finden, um es zurückzuführen zu seinem neuen Dorf und dort mit ihm zu leben oder auch, um hier bei ihm zu bleiben. Er konnte ihrem Vater genügend Korn bieten für sie, Tiere auch und einige Stücke des Goldes, das er am Sterbelager von dem Alten bekommen hatte. Nie hatte ein Fischer solchen Reichtum gesehen und daher würde er seine Tochter mit Freuden geben.
Frohen Mutes rannte Nechu die letzte Strecke seines Weges zu den Hütten, dann erstarrte er vor dem Gestank, der die sonnendurchwärmte Luft anfüllte. Stille lag über dem Dorf, niemand zeigte sich auf dem Weg zwischen den Hütten und aus den niedergeduckten Behausungen aus Lehm und Schilf drangen nicht die üblichen Geräusche abendlicher Geschäftigkeit.
Er fand die Hütte des Fischers, trat ein und schreckte zurück. Drei Leichen lagen auf dem Boden, blutüberströmt, von Wunden zerfleischt, halb zerfressen vom Getier, unsäglichen Gestank verströmend. Als sich eine Wolke schwarzer Fliegen von den Gesichtern der Toten erhob, erkannte er den alten Fischer und sein Weib, die ihm und dem Alten Gastfreundschaft gewährt an jenem Abend und neben ihnen lag wie in Schmerzen verkrümmt mit durchschnittener Kehle ein junger Mann in seinem Blut, vielleicht ein Sohn der beiden, ein Bruder von Asea.
Grauen fasste Nechu. Er rannte ins Freie, drang in eine andere Hütte ein, doch auch dort hatte der Tod grausame Ernte gehalten. Zwei ältere Frauen lagen neben der Feuerstelle. Sie waren gepfählt worden. An den hölzernen Türstock war mit einem durch die Brust gestoßenen kurzen Speer ein junger Mann geheftet.
Néchu ging an den Hütten entlang, begann zu rufen, zu klagen, schrie seine Verzweiflung und Angst in den Abend, der erfüllt war von giftigem Gestank.
Aus dem Winkel eines Auges nahm er eine Bewegung war, ahnte sie mehr als er sie sah und als er den Kopf umwandte, erblickte er einen Schatten hinter einer Hütte verschwinden. Er sprang ihm nach, sah einen Knaben in panischer Angst fliehen, setzte ihm nach, holte ihn ein. Das Kind jammerte vor Angst, als Néchu es am Arm ergriff, suchte verzweifelt, sich loszureißen, doch Nechu strich ihm über das Haar, beruhigte es mit leisen Worten: »Nichts wird dir geschehen«, flüsterte er wieder und wieder. »Ich bin ein Freund. Fürchte dich nicht.« Endlich beruhigte sich der Knabe.
Die Nacht war hereingebrochen, als der Knabe Néchu zu seinem Schlupfwinkel im Schilf ein Stück außerhalb des Dorfes führte. Gierig verschlang der Kleine die Speisen, die Nechu ihm von seinen Vorräten reichte. »Die Götter sind gekommen und haben alle getötet«, flüsterte der Knabe schließlich, zitternd vor Entsetzen. »Ich war fort, ein verlaufenes Tier suchen. Sie haben alle geschlachtet, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern, das ganze Dorf. Sie gingen in die Hütten und haben alle getötet. Niemand entkam, denn es waren viele und sie hatten mächtige Schwerter und Speere, und Bogen mit Pfeilen, die alles treffen. Nun sind alle tot.«
Der Knabe weinte wieder. »Nur Asea haben sie leben lassen und fortgeschleppt«, schluchzte er.
»Asea?« Als er diesen Namen hörte, durchfuhr Néchu ein Stoß von Feuer und Eis.
»Die Tochter des Fischers«, stieß der Knabe hervor. »Ihren Vater haben sie umgebracht, ihre Mutter und ihren Bruder, aber Asea ließen sie am Leben. Sie banden sie mit Stricken und schleppten sie fort. Sie hat geschrien, aber sie kümmerten sich nicht darum. Niemand konnte ihr helfen, denn alle waren tot.«
»Asea.« Nechu sprach den Namen langsam aus, wie ein Gebet, wie eine Anrufung. Sie lebte. Er würde sie finden. Er würde den Spuren dieser Mörder folgen und Asea befreien. Néchus Gedanken überschlugen sich wie in einem Fieber. Er war erschöpft von der langen Wanderung in der Hitze des Tages und niedergedrückt von dem Entsetzen, das er soeben erfahren.
Er verbrachte die Nacht im Versteck des Knaben, hielt den im Traum schluchzenden Jungen im Arm und besänftigte ihn.
Es gelang ihm kaum, die schrecklichen Bilder, die er im Dorf gesehen, aus seinem Geist zu bannen, doch als die scharfe Sichel des neuen Monds über dem Schilf aufging, nahm ihn der Schlaf fort in weite Räume, in denen er Asea sah, als junges Mädchen im Dunkel der Hütte, ängstlich ihre Hand um das Amulett klammernd, welches untrügliches Zeichen ihrer Verbundenheit war. Im Halbschlaf tastete er nach der Scheibe, die an schmalem Lederband an seinem Hals befestigt war und als er die vertraute Goldscheibe in seiner Hand spürte, ging ein warmer Strom des Glücks durch ihn, der ihn ins Dunkel traumlosen Tiefschlafs leitete.
Als er erwachte, stand die Sonne schon am Himmel. Der Knabe war fort. Nechu rief nach ihm, ging zurück zum Dorf, suchte ihn zwischen dem Gestank, der aus den Hütten drang, rief ihn wieder und wieder, schweifte durch das Schilf, doch er blieb verschwunden.
Nechu rannte den Weg zurück, den er gekommen war. Auch die Mörder mussten hier gegangen sein, denn irgendwann bog eine breite Spur ab von diesem Pfad. Ohne zu zögern schlug er diesen unbekannten Weg ein, der nach Norden führte. Er wusste, wer diese unerbittlich mordenden Götter gewesen waren, von denen der Knabe gesprochen. Sie gehörten zu den Kriegern, die das alte Volk vertrieben hatten von den fruchtbaren Böden des Nordens. Sein blinder Meister hatte oft von ihnen gesprochen und auch von den Bauern seines Dorfes hatte Nechu über sie gehört. Nie jedoch hatte er vernommen, dass sie so grausam mordeten, wenn die Steuern nicht entrichtet wurden, die sie den Bauern abpressten oder wenn sie auf ihren Jagdzügen durch ein Dorf zogen, um Vorräte zu rauben. Nechu hatte diese Fremden selbst gesehen, als er den Alten nach Norden geführt. Sie waren groß gewachsen und von hellerer Haut. Und sie bewohnten eine steinerne Stadt am Ostufer der Hapi, die größer war als jede andere Ansiedlung, die Néchu je gesehen. Er hatte sie nur schimmern sehen am anderen Ufer des Flusses, denn es war Menschen aus dem alten Volk streng verboten, sich ihr zu nähern, außer als Krieger oder Sklaven eines der Herren, die dort lebten. Aber rings um diese Stadt, im fruchtbaren Ackerland, lagen Dörfer und Anwesen, die ebenfalls von den Fremden bewohnt wurden und auch dort war er mit dem Alten gewesen, denn auch die Fremden waren begierig nach den Geschichten, die der Blinde zu erzählen wusste. Dort hatte der Alte von den Herrlichkeiten des untergegangenen Reiches über dem Meer gesprochen, von Tempeln und Palästen, von Festen und Vergnügungen und seine Zuhörer hatten ihn reich belohnt dafür, denn sie waren stolz auf ihre edle Abstammung von den Göttern jenseits des Meeres.
In der Stadt aber, so hatte der Alte erklärt, herrsche der König der Fremden, unermesslich groß in seinem Glanz, umgeben von Hohepriestern und Kriegern, doch die Dörfer rings um die Stadt gehörten Fürsten, die aus Stein gebaute Häuser bewohnten. Auch in solchen Häusern war der Alte mit seinen Geschichten zu Gast gewesen und hatte reichen Lohn empfangen.
Während er den fremden Spuren folgte, zogen Néchu diese Erinnerungen durch den Kopf. Lange wanderte er. Er mied die Dörfer, in deren Nähe er kam, nährte sich von den Resten seines Vorrats, jagte manchmal nach Wasservögeln. Nachts bereitete er sich ein Lager in Schilf und Buschwerk abseits des Weges, doch mit dem ersten Licht des Morgens folgte er erneut den Spuren der Fremden, die Asea fortgeschleppt hatten. Manchmal stiegen grässliche Vorstellungen in ihm auf, was die Fremden ihr antun könnten, doch er tröstete sich mit dem festen Glauben, dass sie noch lebte, dass die Hand eines gnädigen Gottes sie bewahrt hatte vor dem Blutbad im Dorf und dass er sie finden und befreien würde.
*
Asea durchlebte die Tage in traumgleicher Starre. Niemand im Dorf hatte die Fremden kommen sehen, niemand einen Warnruf gehört. Als man ihre Schritte vernahm, waren ihre Schwerter schon niedergesaust. Ohne ein Wort hatten sie den Vater erschlagen, die Mutter, hatten die Körper, die sich noch am Boden wanden, mit Speeren und Messern zerfleischt. Den Bruder, der gekommen war, sie zu retten, hatten sie ergriffen, die Kehle durchschnitten und mit einem Speer an den Türstock gespeßt. Der Anführer der Krieger hatte mit seinem Schwert auf Asea gezeigt. Sie hatte geschrien und sich gewehrt, als sich die Männer ihr näherten. Aber man hatte sie nicht getötet wie die anderen, sondern sie auf eine Trage aus Ästen und Schilf gebunden, wie Jäger das mit ihrer Beute tun. Sie wurde fortgetragen aus ihrem Dorf, viele Tagesmärsche weit. Man gab ihr zu essen und zu trinken und band sie nachts los, damit sie schlafen konnte. Doch auch dann blieben ihre Hände und Füße gefesselt und zwei bewaffnete Krieger wachten neben ihrem Lager. Morgens schlug man sie wieder an das Gestell, das zwei Knechte schulterten und den Kriegern vorantrugen. Man bedeckte Asea mit einem Tuch, um sie vor der Sonne zu schützen und der Führer der Schar kümmerte sich selbst um ihr Wohlergehen. Niemandem außer ihm und den Bewaffneten war gestattet, sie bei den täglichen Verrichtungen des Fessels und Losbindens zu berühren und er selbst reichte ihr Wasser und Speise. Nie sprach er ein Wort zu ihr. Schweigend reichte er ihr Speise und Wasser und schweigend stand er dabei, wenn die Knechte sie morgens auf die Trage banden und abends wieder lösten. Einmal nur, noch in der Hütte des Vaters, als sie sich im groben Griff der Krieger gewunden, hatte er sie berührt, hatte das Amulett, das um den Hals hing, in seine Hände genommen, hatte es lange betrachtet und es ihr boshaft lächelnd wieder gelassen. Je länger sie wanderten, desto tiefer sank Asea in einen Strom ineinander verschlungener Gedanken und Ängste. Immer wieder erschien die Erinnerung an jene Stunde in ihr, als ein anderer ihr Amulett gefunden hatte. Eine liebende Berührung war es gewesen, die unsagbare Süße in ihrem Herzen aufgewühlt hatte, zartes Bangen, wie sie nie zuvor gespürt. Sie dachte an diesen Jungen, der mit dem blinden Erzähler in der Hütte gesessen war und sie schauderte noch immer bei dem Gedanken, dass er das gleiche Amulett um den Hals trug wie sie und dass sein Antlitz dem ihren gleich gewesen war, das sie manchmal, an windstillen Tagen, auf der glatten Fläche des Wassers erblickt. Wie oft hatte sie versucht, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, doch vergebens. Und nun war eben dieses Zeichen der Grund, warum sie noch am Leben war. Die Krieger waren gekommen, um ausgerechnet sie zu holen. Alle anderen im Dorf hatten sie erschlagen. Warum? Doch auch diese Gedanken führten nur in Leere und Ratlosigkeit. So kam es, dass sie teilnahmslos dahindämmerte in den Stunden, in denen sie auf die schwankende Trage gebunden lag, dass ihre sinnlosen Gedankenkreise sich mit Träumen und Erinnerungen mischten, dass sie mitunter sogar vergaß, in welcher Lage sie sich befand und zutiefst erschrak, wenn der schweigende Mann sie mit der Wasserschale anstieß und ihr Nahrung brachte. Stundenlang verlor sie sich in den bunt schimmernden Mustern, die das Sonnenlicht in den Schleier webte, der ihr Gesicht bedeckte. Und nachts, wenn der Schlaf nicht kommen wollte, starrte sie in den Sternenhimmel, der sich über ihr wölbte. Irgendwann aber verschwammen Tage und Nächte ineinander. Asea zählte sie nicht, doch sie horchte auf, als sie den Führer der Schar eines Morgens sagen hörte, dass man schon die nächste Nacht im Schutz des heimatlichen Fürstendorfes verbringen werde. Und wirklich, noch bevor die Sonne sank, erreichten sie ein großes, von starken Palisaden umgebenes Dorf, in dessen Mitte ein Haus aus Stein stand, so groß, wie Ala es noch nie gesehen. Ausgedehnte Gärten umgaben dieses Haus, abgeschirmt von hohen Mauern. Vielleicht waren es doch Götter, dachte Ala, als die Kühle der Gärten sie anwehte, grausame, blutrünstige Götter. Doch sie würde sich ihnen nicht beugen. Die Krieger banden sie los, stellten sie auf die Füße. Sie war nicht mehr gewöhnt zu stehen. Ihre Beine knickten ein, doch der Führer der Schar fing sie auf und stützte sie. An seiner Seite bewegte sie sich schwankend voran, wurde zum Haus gebracht, vor dem, im Schatten eines großen Schirms, ein dicker, fein gekleideter Herr saß, der gelangweilt zusah, wie das Mädchen zu seinem Sitz geführt wurde. Aufrecht und stolz stand sie vor ihm, mit herrischer Bewegung entzog sie sich den Händen des Mannes, der sie führte. Der Mann unter dem Schirm kniff die Brauen zusammen. So bewegte sich kein Bauernmädchen aus den Sümpfen. Er betrachtete die schöne junge Frau aufmerksam. Ihre Haut war von der Sonne gebräunt, doch sie hatte nicht die dunkle Färbung des alten Volkes. Er winkte den Führer der Schar zu sich und neigte den Kopf leicht zur Seite. Der Mann trat neben ihn und begann zu flüstern: »Wir haben sie in dem bezeichneten Dorf gefunden. Sie trägt ein Amulett mit dem Zeichen der Verfluchten um den Hals. Wir haben all diese Verräter, die ihr Unterschlupf boten, getötet. Mögen unerbittliche Dämonen sie in der Vernichtungsstätte martern«.
Der feine Herr hob den Kopf wieder und gab ein Zeichen, das Mädchen näher zu bringen. Widerspenstig ging Ala die wenigen Schritte voran, ungeduldig gestoßen von den Kriegern. Der Herr griff nach dem Lederband um ihren Hals und zog das Amulett hervor. Asea wollte sich wehren, doch der Anführer der Krieger packte ihre Handgelenke. Der Herr zog Ala an dem Lederband zu sich heran, dass Alas Nacken zu schmerzen begann, drehte das Amulett in seinen feisten Fingern, während er das Mädchen betrachtete, das vor seinem Sitz auf die Knie gefallen war. »Woher hast du das?« fragte er mit schriller Stimme.
»Ich hatte es immer, seit ich denken kann.«
»Weißt du, was es bedeutet?«
Asea schüttelte den Kopf. Der Mann ließ das Band los. Die junge Frau sank nach hinten.
»Behalte es. Ich will, dass der Herr dich so sieht, wie man dich zu mir gebracht hat. Er wird sehr zufrieden sein mit der Beute dieses Jagdausflugs.«
Er winkte. Die Krieger zerrten Ala hoch.
»Es darf ihr nicht das Geringste geschehen. Man behandle sie wie eine Tochter des Hauses. Sie bewege sich frei im Haus und den Gärten. Doch niemandem außer mir ist erlaubt, mit ihr zu sprechen. Unser Herr ist zum Allerhöchsten in die heilige Stadt gereist. Er wird bald zurück sein, um zu bestimmen, was mit ihr geschehen soll«.
Die Tage vergingen, ohne dass der Herr des Hauses zurückkehrte. Asea wohnte in einem mit feinen Kissen und Stoffen ausgestatteten Zimmer und verbrachte die heißen Stunden des Tages in den von Mauern umschlossenen und von Wasserläufen durchflossenen Gärten. Man brachte ihr Speisen, die sie nie zuvor gekostet und las ihr jeden Wunsch von den Lippen. Besonders liebte Asea eine verborgene Stelle im hinteren Teil des Gartens, wo in einem schattigen Hain eine Quelle entsprang und sich das Wasser seinen Weg durch eine Blumenwiese suchte. Dort hatten ihr die Diener des Hauses ein Ruhelager unter einem Baldachin errichtet. Manchmal ging sie schon in den Morgenstunden hinaus, um dort den Tag zu verbringen, um dem Murmeln der Quelle zu lauschen und aus den Blüten Kränze zu flechten. Manchmal schlief sie ein und ergab sich unter dem Baldachin ihren Träumen und Gedankenketten. Über der Verzweiflung in ihr begann eine zarte Haut von Hoffnung zu wachsen. Sie hatte niemals Böses getan in ihrem Leben. Auch der Gott dieses Hauses würde kein Fehl an ihr finden.
»Asea«, flüsterte eines Nachmittags eine Stimme in ihrem Traum und die Stimme, die ihren Namen nannte, schien ihr so süß wie die Musik der Quelle. Sie schlug die Augen auf und glaubte noch immer zu träumen, als sie den Jüngling erkannte, der neben ihr kauerte und ihr mit Gesten bedeutete, still zu bleiben. Sie erschrak bis in den Grund ihres Herzens, denn der Jüngling trug die Züge jenes Knaben, der einst mit dem blinden Erzähler in die Hütte ihres Vaters gekommen war. Als sie den Mund öffnete, um zu sprechen, legte sich seine Hand zart auf ihre Lippen, die andere Hand aber griff nach der ihren und führte sie zu dem metallenen Amulett, das er um den Hals trug. Stumm vor Schrecken und Freude starrte sie dem Jüngling in die Augen. Nechu versank in ihrem Blick und ihr heißer Atem, der stoßweise über seine Hand strich, entfachte ein Feuer in ihm, wie er es noch nie gefühlt. Er nahm die Hand von ihren Lippen, bewegte sie nun zart über ihre Wangen, ihre Stirn, ihr weiches Haar. Seine Lippen folgten der Hand. Asea ließ es geschehen. Sie spürte die Küsse dieses fremden Jünglings, der ihr vertrauter schien als das eigene Herz, wie die Erfüllung einer endlos lange gehegten Sehnsucht. Auch er fand das metallene Zeichen an ihrer Brust wie damals im Dunkel der Hütte, nun aber entflammte es nicht mehr Erschrecken und Staunen in ihm, sondern glühende Leidenschaft.
Die Dämmerung war schon hereingebrochen, als sie die ersten geflüsterten Worte wechselten, doch das Gesagte schien ihnen kümmerlich gegen die Sprache der Hände und Lippen, gegen die schweigende Sprache der Liebe. Beide waren nicht erfahren in der Kunst der Liebe und doch fanden sie sich in diesem Garten der murmelnden Bäche und vereinigten sich in einem von höchstem Glück berührten Augenblick wie ein göttliches Paar in den weiten Paradiesen des Himmels.
»Ich habe eine Möglichkeit gefunden, hierher zu kommen, mit Hilfe der Händler, die morgens Waren bringen«, flüsterte Nechu, während er Aseas Wangen streichelte. »Welch ein Glück, das sie dich nicht im Haus gefangen halten. Ist es dir möglich, morgen wieder um die Zeit der heißesten Stunde hier in diesem Garten zu sein?« »Ja«,, antwortete Asea zart.
Asea nickte lächelnd. Sie legte den Kopf an die Schulter des Geliebten und glaubte noch immer zu träumen. Es war nicht möglich, dass sie sich wiedergefunden hatten, gerade jetzt, in diesen dunkelsten Stunden der Verzweiflung. »Ich werde kommen und ich werde Seile bei mir haben, um die Mauer zu überwinden. Wir werden fliehen. Sie werden uns nicht finden in den Sümpfen. Ich finde mich dort zurecht wie kein zweiter. Doch nun muss ich fort. Die Wachen kennen mich. Ich war früher schon in diesem Haus, mit dem blinden Alten, den ich führte. Und ich habe ihnen Gold gegeben. Doch ich muss vor Einbruch der Dunkelheit durch das Tor hinaus, sonst schöpfen sie Verdacht«.
»Oh nein, komme nicht noch einmal in dieses Haus und diesen Garten«, flüsterte Asea voll Sorge. »Man wird dich töten, wenn man dich hier findet, so wie sie die Menschen meines Dorfes ermordeten«.
Nechu küsste Asea zärtlich. »Die Liebe ist stärker als der Tod«, flüsterte er und umarmte sie, bevor er lautlos zwischen den Büschen verschwand. Aseas Herz schlug bis zum Hals.
Auf einen knappen Wink ihres Anführers schwärmten die Krieger aus, die Schwerter gezückt. Siegesgewisses Lachen strahlte in ihren Gesichtern. Keine Mühe würde ihnen dieser hergelaufene Bursche bereiten. Kaum mehr als ein Schaf zu schlachten für das Abendbrot am Lagerfeuer war es, ihn zu töten, unwürdig für Krieger, die zu den besten des Landes zählten. Nechu wich zurück, erschrocken vor der jähen Gewalt des Hasses und der Verachtung, die aus den Augen der Männer sprühte, vor ihren Schwertern, die sich im knapper werdenden Halbkreis näherkamen. Sie würden ihn zurück an die Mauer treiben und dort niedermachen, so wie sie die Bauern und Fischer im Dorf getötet hatten. Es war zu spät, die Seile zu benutzen, die er um den Leib geschlungen trug. Im Zurückweichen stolperte er, knickte ein, fasste den sonnenheißen Boden mit einer Hand, die Augen nicht von den nahenden Kriegern wendend, durch die ein siegesgewisses Zucken ging angesichts seiner kurzen Schwäche, die schon vorstoßen wollten, um ihn zu stellen wie gestraucheltes Wild bei der Jagd, doch die in ihren Tritt zurückfanden, als er sich wieder erhob und weiter zurückwich, die Mauer schon spürend, an der er sterben würde. Im flüchtigen Berühren der Erde war plötzlich ein Stein in seiner Hand gewesen, den er an sich riss, um den seine Faust sich nun ballte. Durch die Reihe der Krieger sah Nechu seine Geliebte, die er gefunden hatte, um sie gleich wieder zu verlieren. Sie wand sich im Griff der Knechte, schrie nach ihm, sank unter den groben Händen der Männer auf die Knie, senkte das Gesicht zur Erde, wirbelte mit ihren Haaren, die sich gelöst hatten, eine feine Wolke Staub auf, in der sich das Sonnenlicht golden fing. Wütende Verzweiflung ergriff Nechu, als er Asea so sah und zugleich die Wärme der Mauer in seinem Rücken spürte. Er hielt inne in seiner Bewegung, duckte sich nach einer Seite und schleuderte den Stein. Noch während der Stein flog, so schien es, schnellte er ihm nach, sah im Sprung, wie der Stein einen Krieger zwischen die Augen traf, wie der massige Körper zuckte und zurücktaumelte, wie das Schwert seiner Hand entglitt und Nechu, noch bevor es zu Boden klirrte, es zu fassen bekam und in jäher Bewegung damit ausholte. Nie zuvor hatte er mit einer Waffe gekämpft, nie ein solches Schwert in der Hand gefühlt, eine in der Sonne blitzende, an der Spitze leicht gebogene Klinge aus Metall, wie das alte Volk es nicht zu schmieden vermochte. Unkundig war er der Kunst des Kampfes, und doch, als er den mit Leder umwundenen Schaft spürte, feucht und noch warm von der Hand des Kriegers, brach in diesem Augenblick tiefster Verzweiflung, als die anderen schon ihre Waffen hoben, um ihn zu erschlagen, etwas in ihm auf, das wie eine Erinnerung war, doch so klar und wirklich, dass sie alles andere in ihm verdrängte. Etwas in ihm schien sich zu öffnen und nach allen Seiten groß und weit zu werden in einem rauschhaften Wirbel, in dem die Zeit stillzustehen schien und den Raum zu einer Unendlichkeit dehnte, die angefüllt war mit Stille. Alles in diesem endlosen Raum lebte zugleich in seinem Gewahrsein. Er spürte die Überraschung der Krieger über die plötzliche Wendung dieses schon gewonnen geglaubten Kampfes und zugleich ihre Selbstgewissheit, dass auch dieser nun mit einem Schwert bewaffnete Bursche kein ernstzunehmender Gegner war. Die backofengleiche Wärme der Mauer in seinem Rücken und der Duft blühender Kräuter, die in den Ritzen der Wand wuchsen, durchdrangen seine Sinne, ebenso die Verzweiflung und Angst der Geliebten im Griff der Knechte. Aseas Gedanken, laut wie Schreie, hallten in seinem Kopf wider. Ebenso die Anspannung der Krieger, die wieder ihre Schwerter hoben und näherkamen. Ihr Rufen wandelte sich in der gedehnten Zeit zu dumpfem Gurgeln. Er, der nie mit einer Waffe gekämpft, der nie ein Schwert gehalten, führte die Klinge in diesem endlosen Raum, als hätte er nie etwas anderes getan. Ohne einen Gedanken zu denken, sprang er zur Seite und traf noch im Sprung zwei der Krieger tödlich. Sein Schwert schien als einziges befreit von der Lähmung, die diesen Augenblick durchdrungen hatte. Es zuckte mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Blitzes nach allen Seiten und fällte die erste Reihe der Garde. Nechu beachtete die vor ihm niederstürzenden Körper nicht, setzte mit Leichtigkeit über sie hinweg, rannte auf Asea zu. Ein Lachen klang nun in der weiten Ausdehnung seines Geistes, aber es war kein Siegestriumph, sondern Freude, die Geliebte zu retten. Schon mähte sein Schwert die zweite Reihe der Garde, die vorgeprescht war, um den Tod ihrer Kameraden zu rächen, mit knappem Befehl losgeschickt von ihrem Anführer, der starr wie eine Säule hinter den Reihen seiner Krieger verharrte, und schon glaubte Nechu, die Geliebte, die den Fäusten der Knechte entglitten war, mit den Spitzen seiner Finger berühren zu können, als ein vielstimmiges Sirren seine den ganzen Himmel umgreifende Bewusstheit erfüllte. Er wandte sich halb, als eine Wolke von Pfeilen ihn traf und taumeln ließ, als er spürte, wie ihm das Schwert entglitt, als er die Augen der Geliebten auf einmal ganz nahe sah, wie bei ihrer Umarmung im Garten. Diese Erinnerung machte ihn lächeln, obwohl glühender Schmerz zugleich in alle Fasern seines Körpers fuhr und die himmelweite Klarheit in ihm mit Dunkelheit füllte. Er fiel und glaubte doch zu schweben, bevor alle Empfindung in ihm verlöschte. Aseas verzweifelter Schrei, die Berührung ihrer Hand auf seiner Stirn war das letzte, das seine Sinne wahrnahmen, bevor sie im Nichts vergingen.
*
»Höchster Herr, Erhabener, Gesegneter, Licht der Erde, Sohn der Götter, ich bin noch einmal vor deinem Thron geeilt, um dir Kunde zu bringen, die Dein Herz erfreuen wird. Entsinne dich: Als deine Faust sich ballte, um das verfluchte Geschlecht jener auszutilgen, die das Auge des Tigers im Wappen führen, war ich die tätige Hand deines Wortes«.
»Ja, du hast mir gut gedient in jenen Tagen des Blutes und auch seither, da Friede im Land herrscht. Wohltaten und Reichtum hast du empfangen als Lohn für Deine Treue. Doch warum kommst du heute zu mir, um von jenen lange vergangenen Stunden grausamer Rache zu sprechen? Was ist geschehen, dass du mir nicht davon sprachst, als du zwei Wochen lang bei Hofe weiltest?«
»Niemand im Hause der Seef entging deinem Zorn, oh gottgleicher Herr. Mein Schwert und die Speere meiner Krieger brachten allen den Tod. Doch ich wusste, dass dem Haus der Seef ein Zwillingspaar geboren war, ein Sohn und eine Tochter, in denen das verdorbene Blut dieses verfluchten Geschlechts fortlebte und die einst sein Erbe antreten sollten. Wir durchsuchten das Haus und die Gärten genau, doch wir konnten diese Kinder nicht finden. Niemand vermochte uns Auskunft über sie geben und so sehr wir auch forschten und suchten, diese beiden Letzten ihres Geschlechts blieben verschwunden. Schamvoll verschwieg ich unsere vergebliche Suche und tröstete mich mit der Hoffnung, dass diese Kinder im Getümmel der Schlacht den Tod gefunden hatten. Doch all die Jahre peinigte mich der Gedanke, die Aufgabe für meinen Herrn und für den Geheimen, der sich brennend zu uns herabneigt und unsere Herzen erleuchtet, nur ungenügend ausgeführt zu haben, obwohl mir viel Ehre zuteil wurde seither. Nie habe ich aufgehört, wachsam zu horchen und Erkundungen einzuziehen und siehe, nach all diesen Jahren wurde meine Wachsamkeit belohnt. Ein Händler kam in mein Haus und prahlte bei meinen Untergebenen, er habe in einem Dorf in den Sümpfen ein Mädchen gesehen, schöner als der aufgehende Mond, von der hellen Farbe der Götter ihre Haut, obwohl sie doch beim alten Volk lebte. Er werde bald gehen, sie zu freien, schon habe er mit ihrem Vater, einem einfachen Fischer, über den Brautpreis verhandelt. Durch eine Fügung unseres göttlichen Schützers, dessen geheimen Namen ich preise, vernahm ich ein Wort dieser Prahlerei und ließ den Händler zu mir bringen, um ihn zu befragen. Sein Bericht weckte eine Ahnung in mir und sofort sandte ich Krieger nach jenem Dorf, um dieses Mädchen holen zu lassen. Ich gab ihnen den treuesten meiner Männer zum Führer, einen, der sich schon hervorgetan, als das Haus jener Frevler niedergebrannt und ihr verdorbenes Geschlecht ausgelöscht wurde. Ich gab Befehl, auch die Bewohner dieses Dorfes zu bestrafen, sollte es wirklich einem Mitglied des verworfenen Geschlechts als Versteck gedient haben. Als meine Männer auszogen, das Dorf in den Sümpfen zu suchen, das jener Händler genau zu beschreiben wusste, wurde ich zu Dir, oh hoher Herr, in die Stadt der Götter berufen, doch ich schwieg von dem, was ich gehört hatte, denn ich wollte sicher gehen und nicht das Ohr meines hohen Herrn mit Gerüchten und Kaufmannsgeschwätz behelligen. Als ich zurückkehrte in mein Haus, fand ich es in hellem Aufruhr. Ein Fremder war in die Gärten eingedrungen und hatte meine Krieger niedergemetzelt, die ihn stellen wollten. Als ich durch das Tor trat, lagen ihre Leichen noch dort und Blut tränkte den Sand der Wege. Ihre Weiber aber und das Gesinde hatten sich heulend und wehklagend um sie versammelt. Bitter ist es, oh höchster König, wenn einen das eigene Haus, das man wohlgeordnet hinterlassen, nach kurzer Reise als Stätte von Tod und Grauen empfängt. Der Führer meiner Krieger aber war am Leben geblieben und erstattete mir Bericht. Er sprach von ihrem Zug in die Sümpfe, von dem Mädchen, das sie in dem bezeichneten Dorf gefunden und das sie mit sich zurück in mein Haus gebracht. Dann aber sagte er: »Der Händler, der uns dieses Dorf bezeichnet hat und dem du, mein Herr, zum Dank das Privileg verliehen hast, uns Früchte und Öl zu liefern, kam zu mir und warnte mich. Ein kräftiger Jüngling habe sich in seine Dienste begeben als Träger, ein Jüngling aber, dessen Gesicht zu edel scheint für solch niedere Arbeit, ein Jüngling, der sich rasch mit den Wachen am Tor anfreundete, ihnen Leckerbissen zusteckte und einmal sogar Goldstücke, damit sie ihm erlaubten, in den Gärten ihres Herrn auszuruhen. Voll Misstrauen befragte ich den Händler über diesen Jüngling, doch er vermochte mir nichts weiter über ihn zu berichten, außer, dass er auf dem Gesicht des jungen Mannes manchmal das Antlitz jenes Mädchens in den Sümpfen zu erblicken glaubte, als sei er ihr Spiegelbild. Ich befahl den Wachen, mir sofort zu melden, wenn dieser Jüngling wieder das Tor unserer Gärten durchschritt. Schon am nächsten Tag um die Mittagsstunde machten sie mir Meldung. Ich nahm die besten unserer Krieger, um den Garten zu durchkämmen und wirklich, wir fanden den Jüngling in Umarmung mit dem Mädchen, dem unser edler Wesir gestattet hatte, in der Tageshitze im Schatten der Gärten zu ruhen. Der Jüngling aber war gekommen, um das Mädchen zu entführen. Er trug Seile um seinen Leib geschlungen, mit denen er und seine Geliebte heimlich über die Mauer klettern wollten, im hinteren Teil des Gartens, wo die Mauer an einer Stelle gebrochen und von geringerer Höhe ist. Wären wir nur wenig später gekommen, wäre ihnen die Flucht geglückt. Der Jüngling muss uns gefolgt sein vom Dorf des Mädchens. Vielleicht war er auf Jagd, als wir in das Dorf eindrangen und das Mädchen holten, ist dann unseren Spuren gefolgt und hat sich durch Betrug Zutritt verschafft zum Haus meines Herrn. Doch der Große Brennende war uns gnädig und wir konnten die Flucht der beiden verhindern. Der Jüngling aber schien von mächtigem Zauber erfüllt, denn er traf einen Krieger mit einem Stein, ergriff sein Schwert und kämpfte, wie ich noch nie jemanden habe kämpfen sehen. Er fällte die Reihen unserer besten Krieger wie ein rasender Dämon. Erst die Pfeile der Bogenschützen brachten ihn zur Strecke.« Dies also, oh höchster Herr, vernahm ich, als ich in mein Haus zurückkehrte. Ich ließ das Mädchen zu mir bringen und betrachtete mit eigenen Augen die pfeildurchbohrte Leiche des Jünglings. Da ergriff Freude mein Herz, denn nun wusste ich, dass ich meine Aufgabe, die mein König mir vor vielen Jahren gnädig anvertraut, endlich erfüllt hatte. Nun waren auch die letzten Sprösslinge dieses verderbten Geschlechts, dieses Zwillingspaar, in dem das verfluchte Blut fortlebte, in meiner Hand, das Mädchen lebendig, der Jüngling tot.«
»Was gibt dir die Sicherheit, dass du wirklich die Erben jener Verdorbenen gefasst hast«? fragte der König. »Es sind in jener Zeit, als sich die Hand des Brennenden zum letzten Schlag gegen all die Irrgläubigen erhob, die noch unter uns lebten, viele entflohen und haben Aufnahme gefunden bei diesen Tieren, die sich altes Volk nennen.«
»Oh höchster Herr«, rief der Fürst und beugte sein Haupt tief vor dem Thron des Königs, »niemals würde ich es wagen, Euer Ohr mit Gerüchten zu belästigen. Ich habe unangreifbaren Beweis für meine Worte. Nicht nur ihre Gesichter waren wie aus einem Stein geschnitten, wie ich mit eigenen Augen sah.« Er griff in sein Gewand und zog zwei goldene Amulette hervor, die an ledernen Bändern hingen. »Eines davon trug das Mädchen, das andere fanden wir an dem toten Jüngling.« Er reichte die Amulette dem König, der sie genau betrachtete. »Das Auge des Tigers. Das Zeichen der Verfluchten. Du hast wahr gesprochen und du wirst reichen Lohn erhalten für deine treuen Dienste. Doch sage mir, wo ist dieses Mädchen, das noch lebt, als einzige und letzte der Verfluchten«?
»Sie befindet sich sicher in deinem Palast, oh höchster Herr, treu bewacht vom Führer meiner Krieger und sie sei dir geschenkt als Ehrengabe deines Fürsten, der sich glücklich preist, deinen Auftrag nach so vielen Jahren endlich erfüllt zu haben«.