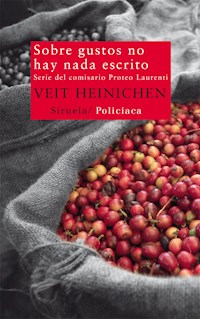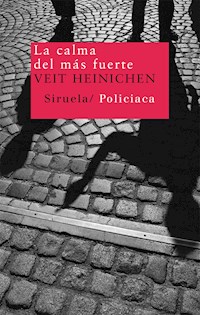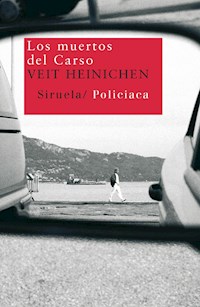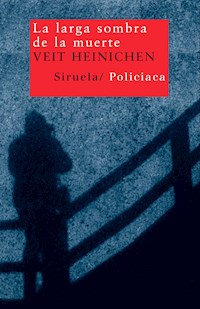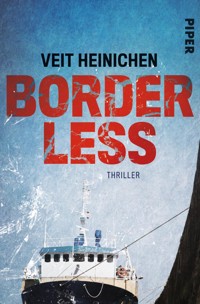10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was zieht Commissario Laurenti da aus dem Meer? Nahe der Segelyacht A, die seit den Sanktionen gegen Russland im Hafen von Triest festgesetzt ist, treibt ein tote Skipperin. In der Nacht hat es einen Anschlag auf das Schiff gegeben. Was hat die Leiche damit zu tun? Proteo Laurenti und sein Team stoßen auf ein Netz aus Gefälligkeiten, Eigeninteressen und Hinterzimmerdeals, in das die ganze Stadt verwickelt scheint. Offenbar auch ihr alter Bekannter Raffaele Raccaro. Aber ist er Strippenzieher oder nur ein kleiner Fisch? In jedem Fall ist er bereit, Opfer zu bringen, solange er davon profitiert… »Proteo Laurenti gehört zur Riege der großen Kommissare« Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Veit Heinichen 2024
((immer))
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: © Maciej Olszewski / Alamy Stock Foto
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Disclaimer
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Diebe privater Güter verbringen ihr Leben in Gefängnissen und Ketten, die Diebe öffentlicher Güter in Reichtum und Ehre.«
Marcus Porcius Cato, genannt Cato der Zensor
Dies ist ein Roman. Er entspringt ausschließlich der Vorstellungskraft seines Autors. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
Eins
Noch nie in seinem Leben hatte Proteo Laurenti eine derart barock anmutende Unterschrift geleistet. Das P und das L seines Namens bedeckten fast das halbe Blatt, und ihre Längen verflochten sich wie Schlange und Stab des Aesculap. Ihm war in diesem Moment, als hätte er eine bittere Arznei geschluckt, deren Wirkung ihm noch unbekannt war.
Mit dem Schreiben des Innenministeriums hatte er schon lange gerechnet, und doch war es etwas anderes, die eigene Pensionierung schwarz auf weiß angekündigt zu bekommen. Der hiesige Personalchef hatte das Kuvert selbst vorbeigebracht und um rasche Bearbeitung und Rückgabe gebeten. Laurenti, sagte er, sei der erste Kollege in seiner gesamten Laufbahn, den er dazu auffordern musste, dieser Aufgabe nachzukommen. Alle anderen hätten die bevorstehende Freiheit gar nicht erwarten können, doch Laurenti schien an den Ruhestand nicht einmal zu denken.
Der Commissario atmete tief durch, bevor er die beiliegende Bestätigung unterzeichnete. Die Kästchen für personenbezogene Daten ließ er leer. Wer, wenn nicht die Bürokraten aus der Personalabteilung, kannte seinen Dienstbeginn und die Anzahl der geleisteten Dienstjahre? Sollten doch sie den ganzen Kram für ihn ausfüllen. Mürrisch steckte er das Blatt in den Antwortumschlag, verklebte ihn und warf ihn in den Ausgangskorb auf dem Schreibtisch seiner Assistentin. Marietta schaute ihren Chef erstaunt an und vergaß für einen Augenblick sogar die qualmende Zigarette in ihrem Aschenbecher. In all den langen Jahren, die sie zusammenarbeiteten, hatte er sich noch nie selbst um seine Post gekümmert.
»Geht’s dir nicht gut?«, fragte sie ihn. »Du machst ein Gesicht, als hättest du gerade gekündigt.«
»Das war’s für heute«, knurrte Proteo Laurenti nur. »Ich bin höchstens noch im Notfall erreichbar. Ich habe jetzt erst mal Besseres zu tun.«
»Die Queen ist tot, Ratzinger ist tot und jetzt auch noch Berlusconi. Und wenn wir nicht gleich Nachschub bekommen, sehe ich für uns auch schwarz«, rief Lojze mit seinem unverwechselbaren Bariton.
»Kommt schon.« Silvano, der Winzer, von dessen Terrasse die beiden Seeleute auf Triest hinunterschauten, stellte eine große Karaffe Weißwein vor ihnen auf dem Tisch ab. Das Glas beschlug in der schwülen Hitze. Lojze schüttete so schwungvoll nach, dass sich auf dem Tisch eine Pfütze bildete.
»Eine Monarchin und zwei Päpste«, lachte Ottaviano. »Eine Epoche nach der anderen geht zu Ende. Nichts bleibt, wie es war, kein Stein auf dem anderen.«
»In den nächsten Wochen werden uns die Nachrichten und Zeitungen wieder mit dem hinterletzten Müll aus seinem Leben zuschütten, den wir schon hundertmal gehört haben. Als stünde deswegen der Rest der Welt still.«
»Immerhin war er ein brillanter Alleinunterhalter.«
»Du hast recht. Heute ist kein Politiker so beliebt, wie er es war. Vor allem keiner von den Linken. Selbst wenn sie dem Volk weismachen wollen, was es zu wollen habe. Berlusconi war glaubwürdig. Authentisch.« Lojze ließ seinen Blick über den Golf von Triest schweifen. Die beiden schwiegen für einen Augenblick. »Es wird ein Gewitter geben«, sagte er dann.
Der Wind war abgeflaut, die Sonne hatte ihren Zenit längst überschritten. Lojze Sedmak und Ottaviano del Re saßen bereits seit Stunden nebeneinander unter dem heiteren Himmel im Schatten eines alten Kirschbaums auf der Holzbank in der Osmizza hoch über der Stadt. Der Nachmittag neigte sich seinem Ende zu. Den Freunden waren weder Müdigkeit noch die Auswirkungen des konstanten Weinkonsums anzumerken. Vor ihnen auf dem Tisch lag ein leeres Servierbrett samt Brotkorb, dessen Inhalt sie zu hausgemachtem Schinken, Salami und Käse sowie eingelegten Oliven verdrückt hatten. Ein überquellender Aschenbecher und zwei leere Karaffen. Sie genossen Silvanos Wein, das unbeschwerte Geplauder und den freien Blick auf die Stadt, aufs Hafenbecken und das Kommen und Gehen der Schiffe auf dem offenen Meer, das weiter draußen in intensivem Blau leuchtete. Am Horizont verschmolzen Himmel und Wasser in diffusem Dunst. Wie immer, wenn die Verdunstung stark war.
Lojze und Ottaviano plauderten und scherzten, ohne sich um die Leute an den anderen Tischen zu scheren. Manchmal tauchte einer ihrer Bekannten auf, der eine neue Karaffe Wein auf den Tisch stellte und sich auf ein Glas zu ihnen gesellte, doch die verfügten über deutlich weniger Sitzfleisch als die beiden Freunde. Am Nachmittag war es dann Proteo Laurenti, der ihnen einen halben Liter spendierte. Die drei kannten sich seit Jahrzehnten aus verschiedenen Lokalen auf dem Karst. Nachdem Laurenti seine Pensionierung unterzeichnet hatte, war er heraufgefahren, um sich abzulenken. Außerdem wollte er ein paar Flaschen Wein für zu Hause einkaufen.
»Sag mal, Commissario«, fragte Lojze, »haben du und deine Kollegen eigentlich die Bewachung dieses Russenschiffs am Hals?«
»Damit haben wir glücklicherweise nichts zu tun, da walten höhere Mächte«, lachte Laurenti. »Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es jemand versenken würde.«
»Du gibst uns also deine Erlaubnis?«, feixte Ottaviano. »Wir können sofort loslegen.«
»Lasst euch noch ein paar Monate Zeit, damit sich jemand anderes damit rumschlagen muss. Und vor allem: Lasst euch nicht erwischen. Das würde bitter enden für euch«, antwortete er lachend.
Unweigerlich fiel sein Blick von der hoch gelegenen grünen Idylle auf den überdimensionalen grauen Dreimaster, der vor dem Hafenbecken ankerte und schon seit mehr als einem Jahr durch die Behörden blockiert war. Nur für Instandhaltungsarbeiten durfte er sich wegbewegen, und das auch nur für ein paar Seemeilen. Das Schiff war von eigenwilligem futuristischem Design, das den meisten seiner Betrachter aufstieß. Von einer deutschen Werft an der Ostsee nach den Entwürfen eines französischen Stardesigners mit Spezialmaterialien aus halb Europa gebaut. Eine halbe Milliarde sollte der Eigner der Sailing Yacht A dafür ausgegeben haben. Ein einundfünfzigjähriger Oligarch und, wie es hieß, siebtreichster Mann Russlands, mit offiziellem Wohnsitz in der Schweiz. Der Mann galt als Unterstützer des russischen Tyrannen, weshalb das Schiff samt anderer ihm zugerechneter Vermögensteile im Rahmen der internationalen Sanktionen gegen sein kriegsführendes Heimatland beschlagnahmt worden war. Der Oligarch hatte die Anwürfe wenig überzeugend zurückgewiesen und war mit seiner Familie umgehend von St. Moritz nach Dubai umgezogen.
»Dieser Mistkübel da unten gehört gesprengt, einfach versenkt«, schimpfte Ottavio del Re. Ein sehniger Kerl mit Bürstenschnitt, der Besitzer und Betreiber eines Zulieferboots war.
»Es war einfach Pech, dass das Ding gerade bei uns vor Anker lag, als der Krieg ausgebrochen ist. Sonst müssten jetzt andere dafür aufkommen.« Lojze Sedmak winkte ab. Er überragte seinen Freund um mehr als einen Kopf und hatte doppelt so breite Schultern. Seine muskulösen Arme waren voller Tätowierungen – keine politischen Motive, eher die klassischen Seemannsymbole, die gewisse Ambitionen zum Rockstar durchschimmern ließen.
Der ständige Anblick der weltgrößten Segelyacht erinnerte jeden in Triest täglich daran, dass ihre Instandhaltung samt der Versorgung der zwanzigköpfigen Besatzung vom Steuerzahler getragen wurde.
»Ich lass euch jetzt besser mal allein, bevor ihr in die Details geht«, sagte Proteo Laurenti, leerte sein Glas, holte bei Silvano ein paar Flaschen für daheim und ging davon.
»Nichts zu machen. Selbst wenn wir sie versenken könnten, würde sie sichtbar bleiben. Die Mastspitzen stehen hundert Meter über dem Wasserspiegel, dazu der Tiefgang des Kiels. Der Golf ist an der Stelle nur um die zwanzig Meter tief. Also rechne selbst nach.« Lojze schüttelte seinen Lockenkopf. Er selbst gehörte zur Besatzung eines Schleppers, der Containerschiffe oder Öltanker sicher zum Anleger manövrierte.
»So laut, wie ihr redet, werden die Ermittlungen hinterher nicht lange dauern«, mahnte Silvano. »Aber ihr würdet einiges an Beifall ernten, wenn dieser Schandfleck nicht mehr zu sehen wäre. Wusstet ihr eigentlich, dass hier schon einmal ein russisches Schiff Zuflucht gesucht hat? Ein Kriegsschiff.«
»Zuflucht, die Russen? Du spinnst, Silvano, das aufziehende Gewitter steigt dir wohl zu Kopf«, lachte Ottaviano auf, während er nachschenkte. »Wenn es erst mal geregnet hat, wirst du wieder klarere Gedanken haben.«
»Doch, doch. 1858 nach dem russisch-türkischen Krieg auf der Krim. Ich habe ein Buch darüber. Es gab damals einen Konflikt zwischen den Franzosen und den Russen um die heiligen Stätten in Palästina. Mit den Türken hatte der Westen sich schon geeinigt. Die Russen mussten vom Mittelmeer ferngehalten werden. Schon zu der Zeit gab es eine westliche Allianz, fast wie heute.«
»Aber das da unten ist kein Kriegsschiff, Silvano«, mischte sich Lojze ein. »Wir zahlen die Rechnung für einen größenwahnsinnigen Neureichen. In der Zeitung stand, dass es uns über neun Millionen im Jahr kostet. Aber sollten die Sanktionen irgendwann mal gelockert werden, bleiben wir auf dem Teil sitzen. Der Russe baut sich doch in der Zwischenzeit lieber ein neues Schiff, als darauf zu hoffen, es später irgendwann auszulösen. Oder er handelt die anfallenden Millionen auf einen Bruchteil herunter, nur damit wir ihn los sind. Du hast recht, Silvano: Würden wir den Kahn versenken, täten wir allen einen Gefallen.«
»Und wie willst du das anstellen?«, fragte Ottaviano. »Die haben ein perfektes Überwachungssystem an Bord.«
»So banal wie möglich.« Lojze schenkte erneut beiden nach. »Ein Taucher befestigt ein Päckchen TNT samt Zünder am Bug.«
»Keine Chance«, widersprach Ottaviano. »Als wäre so etwas nicht schon beim Bau berücksichtigt worden. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, als ich die Einkäufe der Besatzung abgeliefert habe. Die haben über vierzig Kameras am Schiff, über und unter Wasser.« Ottaviano dachte einen Moment nach und wischte sich den Mund ab, während er das leere Glas abstellte. »Auf der anderen Seite kann es mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht so weit her sein. Wenn ich Ware anliefern muss, melde ich es über Funk. Aber zum Kontrollieren ist bislang noch niemand gekommen.«
»Ich hoffe, ihr habt ein großes Waffenlager.« Silvano kam wieder zurück und stellte ein Brett mit hausgemachter Salami und eingelegtem Gemüse auf den Tisch. »Stellt euch vor, die im Rathaus bauen wirklich die Seilbahn bis zum Marianentempel hinauf. Ausgerechnet zu den Pfaffen. Nicht fürs Volk, schon gar nicht für die Einheimischen, die auch noch dafür bezahlen werden, selbst wenn es heißt, die Kohle für den Bau käme aus Brüssel.«
»Und wenn die Bora richtig pfeift, wird das Ding sowieso stillstehen. Sonst kotzen die Leute doch die Kabinen voll. Oder die darunterliegenden Gärten.« Lojze leerte sein Glas in einem Zug.
»Aber die Standseilbahn nach Opicina werden sie deshalb auch nicht wieder instand setzen. Auch wenn sie unter Denkmalschutz steht. Es verdienen einfach nicht die richtigen Leute daran.«
Seit einer Kollision vor sieben Jahren stand die über einhundertzwanzig Jahre alte Tram still, die sonst alle halbe Stunde Triest mit dem Karst verband. Es wimmelte inzwischen von einer Unzahl offener Baustellen, über die aus der Stadtverwaltung nicht einmal mehr voraussichtliche Fertigstellungstermine zu vernehmen waren.
»Irgendjemand kassiert da wahrscheinlich am Stillstand.« Lojze schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. Mit der Handkante wischte er über den Tisch. »Demokratie. Freiheit und Gerechtigkeit. Es braucht endlich wieder jemanden, der richtig durchgreift.«
Erst als die Sonne schon tief über dem Meer stand und kurz davor war, als glühend roter Feuerball zu versinken, erhoben sie sich endlich von ihrem Platz und verabschiedeten sich.
»Passt auf, dass ihr nicht erwischt werdet, so besoffen, wie ihr seid«, rief ihnen Silvano hinterher.
»Keine Sorge«, lachte Lojze. »Und bis morgen.«
Leicht schwankend stiegen die Männer in ihre grüne Ape mit der Ladepritsche, tuckerten mit knatterndem Motor davon und zogen eine blaugraue Abgasfahne den Anstieg zum Karst hinauf.
Am späten Nachmittag desselben Tages waren zwei schwarze Range Rover mit verdunkelten Scheiben und Schweizer Kennzeichen von Mailand in Richtung Osten gerast. Vierhundert Kilometer lagen vor ihnen. Sie wurden um 22 Uhr erwartet. Abrupt wechselten sie die Spuren und jagten, wenn nötig, sogar über den Standstreifen. Ohne Rücksicht auf Tempolimit und mögliche Radarkontrollen wirkten sie selbst bei den Überholmanövern wie aneinandergeklebt, obwohl sie sich ständig mit der Führung abwechselten.
Auf der Rückbank eines der beiden Fahrzeuge saß Fjodor Iljin, ein etwa fünfundvierzigjähriger sportlicher Mann mit Dreitagebart und mittellangem dunkelblondem Haar. Die beiden Männer auf den vorderen Sitzen trugen ihre Haare militärisch kurz, sie sprachen Russisch mit starkem serbischem Akzent. Genauso wie ihre drei Kumpane in dem anderen Fahrzeug, mit denen sie sich die gesamte Fahrt über in knappen ruhigen Worten per Funkgerät verständigten. Nur einmal fluchte sein Fahrer, als Iljin verlangte, an einer Raststätte bei Vicenza die Toilette aufzusuchen. Den Männern wäre es lieber gewesen, er hätte sich in die Hosen gemacht, doch sie wussten, wer sie bezahlte. Drei von ihnen begleiteten Iljin in den Autogrill, während die beiden Fahrer scheinbar beiläufig rauchend neben den Autos warteten und aufmerksam die Umgebung und den heranfahrenden Verkehr beobachteten.
Keinen Schritt hatte Fjodor Iljin in den letzten fünf Wochen vor die Tür der Mailänder Diplomatenwohnung in der Via Andegari gesetzt. Sie lag direkt hinter dem Opernhaus La Scala. Nach seiner Festnahme am Flughafen Malpensa hatte er nur ein paar Tage in einer Einzelzelle im Gefängnis San Vittore verbringen müssen, bis die Auslieferungshaft dank der massiven Intervention einer internationalen Anwaltskanzlei in einem Eilverfahren vorläufig in Hausarrest umgewandelt wurde. Iljin wurde dazu verpflichtet, eine elektronische Fußfessel zu tragen, die sofort Alarm schlug, würde er die Wohnung verlassen. Oder gewaltsam versuchen, sich von der Fessel zu befreien. Noch musste über den Antrag der Amerikaner auf Auslieferung des laut internationalen Haftbefehls verdächtigen Waffenhändlers Fjodor Iljin in einer höheren Instanz entschieden werden. Die Wohnung schien von den Russen für derlei Notfälle angemietet worden zu sein. Sein Kontakt zur Außenwelt war auf Anwaltsbesuche und die zwei täglichen Essenslieferungen beschränkt gewesen. Die einzigen zugänglichen Fernsehkanäle waren die der RAI, der staatlichen italienischen Medienanstalt.
Schon die Tatsache, dass er bis zu einer Entscheidung nicht in der Zelle einsitzen musste, sei bei der Brisanz des Falls außergewöhnlich, hatte sein Anwalt gesagt, der nach ein paar Tagen ernste Sorge über den Ausgang der Verhandlung äußerte, für die ein Termin in der folgenden Woche angesetzt war. In solchen Fällen vermuteten die Behörden gemeinhin akute Fluchtgefahr. Iljin lächelte undurchdringlich und nannte dem Mann daraufhin eine Telefonnummer mit zyprischer Vorwahl. Dort würde er weiterverbunden werden und neue Anweisungen erhalten. Fjodor Iljin musste nicht lange warten.
Kurz hinter der letzten Mautstelle wurden Iljins Begleiter plötzlich nervös. Blaulichter flackerten am Straßenrand. Doch es handelte sich nicht um eine Kontrolle, die Leuchtanzeigen meldeten lediglich, dass die Autobahn wegen eines schweren Unfalls gesperrt war. Der Verkehr wurde über die letzte Ausfahrt bei Sistiana auf die Landstraße umgelenkt, vor der sich bereits eine lange Schlange gebildet hatten. Die Fahrer der Range Rover sprachen sich kurz ab und verließen die Autobahn schon bei Duino. Schnöde drängelten sie sich in die schier endlose Fahrzeugschlange auf der Staatsstraße. Ein Lieferwagen für Sacher Wien Triest mit Wiener Kennzeichen machte mit wildem Hupen und hysterischen Lichtzeichen deutlich, was er von der Unverschämtheit der beiden schweren Luxusgeländewagen hielt. Hinter ihm war ein mächtiger Sattelschlepper aus Slowenien dicht aufgefahren, auf dessen Seitenwänden großflächig für ein Bordell in Kärnten geworben wurde.
Endlich kam Bewegung in den Stau, der Abstand zu den vorausfahrenden Wagen vergrößerte sich. Der wütende Lieferwagenfahrer setzte zu einem Überholversuch an. Der vorausfahrende Range Rover zog auf die linke Spur und bremste ihn harsch aus. Auch der Lkw raste heran. Sekundenbruchteile vor dem Aufprall auf den Lieferwagen beschleunigten die beiden schwarzen jäh. Aus dem Heckfenster sah Fjodor Iljin, wie sich der Lieferwagen überschlug und die konfektionierten zuckrigen Schokoladentorten sich über die Straße verteilten. Er hörte das dröhnende Hupen des Sattelschleppers.
»Gut gemacht«, sagte Iljin lächelnd. »Ist es noch weit?«
»Wir sind kurz vor der Grenze. Auf dem Landweg kommst du da nicht rüber. Nur übers Meer. Und das auch nur mit der nötigen Ablenkung, für die du selbst sorgen musst. Wir haben alles bis ins Detail geplant.«
Der Fahrer nickte zur Bestätigung, als er schließlich ins Industriegebiet von Monfalcone abbog und kurz darauf auf dem verwaisten Parkplatz eines Einkaufszentrums stoppte. Der andere Wagen war weitergefahren, doch nur einen Augenblick später hielt ein Jeep der Protezione Civile, des Zivilschutzes, neben ihnen. Am Steuer saß einer ihrer Leute.
»Hör jetzt genau zu. Dein Ziel ist der Leuchtturm dort drüben am Horizont. Auf kroatischer Seite. Du kannst ihn nicht verfehlen.« Der Beifahrer wies über das nachtschwarze Meer und erklärte Fjodor Iljin den Plan für die kommenden Stunden. Dann drückte er ihm zwei Päckchen in die Hand. »Wenn du alles genau so machst, wie ich es dir erklärt habe, bist du noch heute Nacht aus dem Land.«
Iljin stieg in das Fahrzeug des Zivilschutzes um, das, kaum hatte er die Tür hinter sich zugezogen, losfuhr und schon nach einem halben Kilometer an der Einfahrt zur Werft die Blaulichter aufflackern ließ. Es war 22:12 Uhr, als sich das elektrische Tor öffnete und sie in der Dunkelheit langsam zwischen hohen Yachtrümpfen bis zum Kanal vorfuhren, wo eine schmächtige Person sie erwartete, die ganz in Weiß gekleidet war, wie ein Seemann.
»Ist das etwa mein Skipper?«, wunderte sich Iljin, der in der Zwischenzeit ein kurzärmliges, viel zu großes Hemd mit dem Emblem des Zivilschutzes über sein T-Shirt gezogen hatte. Seelenruhig steckte er sich eine Glock 17 in den Hosenbund. Das noch ungeöffnete Päckchen behielt er in der Hand.
»Genau«, sagte sein Fahrer. »Er ist unbewaffnet. Er weiß wohin. Und er spricht Englisch.«
Der Skipper führte Iljin wortlos zu einem langen Schlauchboot aus festem Kunststoff mit zwei großvolumigen Motoren. Er schlug jede Hilfe aus und sprang an Bord.
»Ich heiße Maria«, sagte die weiß gekleidete Figur zu seinem Erstaunen, nachdem sie die Leinen losgemacht hatte und das Boot aus dem Kanal aufs offene Meer steuerte. Das anfängliche Flüstern der Motoren verwandelte sich in lautes Gebrüll, als sie beschleunigte.
Fjodor Iljin wurde in den Sitz gedrückt, der Bug des Boots hob sich vom Wasser ab. Erschrocken hielt er sich an einem Griff fest und schaute die Skipperin an. Maria, wiederholte er in Gedanken ihren Namen, er entdeckte keinerlei weibliche Merkmale an ihr.
»Fahr langsamer«, wies er sie in akzentfreiem Englisch an. »Und bleib nah an der Küste. Wir haben viel Zeit. Erst wenn ich es dir sage, kannst du mir zeigen, wie schnell das Boot wirklich ist. Verstanden?«
Maria nickte ihm zu und ließ das Boot ausgleiten. Mit wenig Abstand tuckerten sie unterhalb des Schlosses von Duino und den hohen grauen Felsen der Steilküste entlang Richtung Triest. Der Himmel war von einer durchgehenden Wolkendecke verhangen, immerhin hatte es zu regnen aufgehört, und so nah an der Küste war das Meer beinahe glatt, nur kleine Wellen kräuselten das Wasser. Kurz darauf erkannte Fjodor die Umrisse eines Urlaubsresorts. An wie vielen solcher, sich alle ähnelnden Orte rund um den Globus hatte er schon Geschäfte eingefädelt? Auf den Seychellen, den Bahamas und den British Virgin Islands, in Katar, Dubai oder am Westkap von Südafrika. Ihm knurrte der Magen, während sie an den Muschelzuchten vorbei gemächlich weiter in Richtung der funkelnden großen Stadt glitten. Bei diesem Tempo waren die Motoren kaum noch zu hören. Bald sah er die Lichter einer Trattoria direkt am Wasser, auf dem Landweg schien sie nicht erreichbar zu sein.
»Fahr da in den kleinen Hafen«, sagte Fjodor. »Und warte auf mich.«
Er sprang an Land und ging schnurstracks zum Tresen. Nur wenige Tische waren noch besetzt. Die anderen waren längst abgeräumt. Iljin fragte nach Essen. Man beschied ihm, die Küche sei geschlossen, höchstens ein belegtes Panino ließe sich noch machen. Er verlangte außerdem nach einem Bier und setzte sich. Als er mit seinem einfachen Abendmahl fertig war und feststellte, dass er kein Geld bei sich hatte, pfiff er Maria herbei. Sie schaute ihn zwar misstrauisch an, doch sie beglich seine Rechnung von weniger als zehn Euro. Befremdlich, dass der offizielle Eichmeister für Bordkompasse nichts als ein kleines Päckchen bei sich trug, nur Englisch sprach und so spät an Bord der A gebracht werden wollte. Und dann hatte er nicht einmal Geld in der Tasche.
»Ab morgen wird es wieder besser«, sagte er.
»Was wird besser?«
»Die Autobahn war blockiert, und der Zug von Rimini, dem Sitz der Zentrale, hat an jedem Misthaufen gehalten. Die Verspätung wurde immer länger. Bei meiner Arbeit ist es manchmal wichtig, außerhalb der gewöhnlichen Uhrzeiten zu kontrollieren. Der Kompass muss schließlich immer stimmen. Stell dir vor, das GPS fällt aus, dann steht die ganze Welt still.«
Als traute er den Bordinstrumenten nicht, warf Iljin einen Blick auf seine teure Armbanduhr. Sie tuckerten aus dem kleinen Hafen, in dem kaum fünfzehn Boote vertäut waren. Er bat Maria noch einmal, in Küstennähe zu bleiben, als sie schon aufs offene Meer zuhielt. »Ich möchte nicht, dass wir auf irgendwelchen Radarschirmen auftauchen, solange es nicht nötig ist. Und fahr so schön langsam wie vorher. Erst wenn wir in der Nähe der Yacht A sind, drehst du auf, sie sollen den Eindruck bekommen, wir hätten uns beeilt. Hast du verstanden?«
Maria bestätigte mit einem Kopfnicken, inzwischen war Wind aufgekommen, eine stark zunehmende Bora. Weiter draußen würde das Meer ruppiger werden. Schon jetzt ritten weiße Schaumkronen auf den Wellenkämmen. Doch ihr Auftrag war eindeutig, er lautete, ihn zu der beschlagnahmten Yacht zu bringen.
Sie brauchten eine gute halbe Stunde, bis sie am Segelhafen von Grignano waren, die Lichter von Schloss Miramare, dessen Fassade nachts beleuchtet war, waren schon zu sehen, und hinter der Landzunge verborgen leuchtete Triest.
»Dort drüben liegt die A«, sagte Maria und deutete in die Dunkelheit. Der Umriss des Schiffs war in der Dunkelheit kaum zu erkennen, nur die Positionslichter blinkten in die Nacht.
Fjodor Iljin erhob sich und schätzte die Entfernung ab. »Dann dreh auf, halt in direkter Linie auf sie zu und verlangsame erst im letzten Moment. Kannst du das?«
»Schnall dich an«, sagte Maria nur.
Schnell setzte er sich wieder und hielt sich fest, als die Motoren aufbrüllten und er ihre Kraft im ganzen Körper spürte. Wie geheißen legte er den Sicherheitsgurt an.
Schnurstracks hielt Maria auf die Sailing Yacht A zu. Das Tachometer auf dem Armaturenbrett zeigte fast fünfzig Knoten an. Über neunzig Stundenkilometer. Auf dem Wasser. Selbst die kleinsten Wellen führten zu harten Schlägen gegen den Rumpf. Immer wieder spürte Iljin, wie der Sicherheitsgurt in seinen Körper schnürte, wenn sie aufs Wasser aufschlugen. Auch, als sie schlagartig das Gas wegnahm. Nach kurzem Gleiten kamen sie unter der Bordwand zum Halten, Maria versuchte alles, um das Schiff nicht zu touchieren. An Deck war niemand zu sehen.
»Näher ran«, zischte Fjodor Iljin sie grob an und richtete den Lauf seiner Glock auf sie, während er in der anderen Hand einen würfelartigen Gegenstand hielt. »Planänderung.« Als er sich leicht zum Bug der A neigte und den Würfel in Sekundenschnelle an die Schiffswand heftete, versäumte Maria, die Motoren aufzudrehen und den Mann mit einer wilden Drehung über Bord zu schleudern.
»Fahr los!«, rief er, glitt auf seinen Sitz zurück und hielt die Pistole auf sie gerichtet. »Zum Leuchtturm dort drüben.«
Er zeigte auf die Spitze der istrischen Halbinsel, auf das Leuchtfeuer von Savudrija, die Punta Salvore. Sie lag nur knapp hinter der slowenisch-kroatischen Grenze, an der es seit ein paar Monaten keine Kontrollen mehr gab. Auch Kroatien war mit Jahresbeginn endlich Teil des Schengen-Gebiets geworden.
»Schneller«, befahl er unwirsch. »Zeig endlich, was die Mühle kann.«
»Das geht nicht. Du kennst die Gewalt der Bora nicht. Wohin willst du eigentlich?«
»Fahr so schnell, du kannst. Wir werden erwartet. Beim Leuchtturm ist ein kleiner Hafen. Dort fahren wir hin, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Du bist mich gleich los.«
Der dumpfe Donner einer Explosion übertönte das Brüllen der Motoren. Iljin warf einen flüchtigen Blick zurück nach Triest, das hinter ihnen rasch kleiner wurde. Es waren keine Flammen zu sehen, und doch glaubte er, in Stadtnähe Blaulichter auf dem Meer zu erkennen. Verdammt schnell, aber das hatten die Serben schon vorausgesagt. Sein Vorsprung, hatten sie außerdem gesagt, sei ausreichend.
Die Pistole in Fjodor Iljins Hand wippte bei jedem Wellenschlag. Der Wind ist ein wilder Geselle. Die Bora nahm rapide an Kraft zu, wie meistens nach schweren Unwettern, die große Wetterkämpfe auf dem Meer heraufbeschworen. Die Bora gewann immer. Weiße Wellenhunde stoben übers Meer, Maria hielt das Steuer mit beiden Händen fest.
Sie wusste, dass sie keine andere Möglichkeit hatte, als zu gehorchen. Selbst wenn sie kurz vor dem Hafen das Boot gegen einen der Felsen fahren würde, die dort aus dem Wasser ragten, würde auch sie es nicht heil überstehen. Vorher über Bord zu springen war undenkbar. Und der Neoprenanzug unter ihrer weißen Kleidung schützte sie nicht vor einer Kugel.
Am Fuße des Leuchtfeuers zog sich die Mole ins Meer, dahinter lag der Hafen. Das Signal des ältesten Leuchtturms Kroatiens blinkte im festen Rhythmus und war im ganzen nordadriatischen Golf zu sehen. Nun gab es Zeichen auch von der Marina. Die Lichthupe eines alten Fiats. Maria atmete auf, gleich würde sie ihren befremdlichen Fahrgast los sein. Sie fuhr im stilleren Gewässer des Hafenbeckens dicht unter den Anleger und warf dem Mann das Tau zu, damit er es festmachte, doch der rührte sich nicht vom Fleck. Flink kletterte Maria die Eisentreppe an der Kaimauer hinauf und zog das Boot heran.
Der Kerl löste sich von seinem Wagen und half Iljin auf die Mole.
»Dich kenn ich doch«, entfuhr es Maria, als das Scheinwerferlicht auf das Gesicht des Mannes fiel.
Zwei
Nach unendlich vielen Prozessen in zahllosen Instanzen, nach Befangenheitsanträgen, Gegengutachten zu medizinischen Attesten samt Prozessverschiebungen sowie drohenden Verjährungsfristen war die härteste Strafe für Raffaele Raccaro gewesen, dass seine Gefängnisstrafe zuerst in Sozialarbeit umgewandelt wurde, an die sich ein mehrjähriger Hausarrest anschloss. So hatte Lele, wie Raccaro von Freunden und geneigten Geschäftspartnern genannt wurde, sich mit seinen zweiundsiebzig Jahren täglich frühmorgens in einem seiner Wohnung nahe gelegenen städtischen Altersheim einzufinden. Achtzehn Monate lang musste der kleine drahtige Mann Gleichaltrigen Frühstück und Mittagessen servieren, er musste Demente und Bettlägerige füttern. Immerhin: Die Körperpflege mutete man ihm nicht zu. Was Raccaro aber am meisten wurmte, war, dass er jeden zweiten Tag auf dem Heimweg in der Questura seine Anwesenheit mit Unterschrift zu dokumentieren hatte. Und auch von seiner Wohnung in der obersten Etage, der vierzehnten, fiel sein Blick ausgerechnet auf das Polizeipräsidium. Wie er sich aufgrund der unzähligen Verhöre erinnern konnte, lag im dritten Stock des mächtigen Gebäudes das Büro des Commissario, der ihm das alles einst eingebrockt hatte. Proteo Laurenti. Er würde diesen Namen nie vergessen. Zusammen mit dem Vorzimmer waren es drei Fenster, an denen er die Präsenz des Polizisten ablesen konnte, sofern sie geöffnet waren oder dort Licht brannte. Allein aus diesem Grund hatte es Tage gegeben, an denen Raffaele Raccaro keine Lust verspürte, auf seine Terrasse hinauszutreten, um die ihn fast alle beneideten. Erst mit der Zeit war es ihm gleichgültig geworden, obgleich er davon überzeugt war, dass auch Commissario Laurenti ständig zu seiner Wohnung in dem ziegelroten Hochhaus hochstarrte. Es musste eine herbe Niederlage für ihn gewesen sein, dass Raccaro seine Strafe nicht im Knast hatte absitzen müssen.
Darin aber täuschte Lele sich. Laurenti hatte anderes zu tun, als an gelöste Fälle zu denken. Selbst wenn Gerichtsverfahren nicht zu eindeutigen Strafen geführt hatten.
Lele, auch in der Lokalpresse erschien Raffaele Raccaro mit seinem Spitznamen, hatte sich sogar ohne große Mühe mit dem Verlust seiner beiden unehelichen Söhne Aurelio und Giulio abgegeben – diese Nichtsnutze. Dem Commissario aber war er zuvorgekommen. La legge è uguale per tutti stand in jedem Gerichtssaal groß an der Wand: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Doch wer über ausreichende Mittel verfügte, konnte mithilfe von ausgefuchsten Experten versuchen, etwas am Urteil zu drehen – so viel wusste Raccaro. Dann war das Gesetz zwar für alle gleich, aber manche waren eben doch ein wenig gleicher.
Seit Lele wieder uneingeschränkt hingehen durfte, wo er wollte, und dem Commissario dabei gelegentlich auf der Straße begegnete, grüßten sie sich sogar, wenn auch distanziert mit einem Kopfnicken. Leles Radius hatte sich altersbedingt reduziert, zu Fuß war er nur noch in der näheren Umgebung unterwegs, am Corso Italia, in der Via San Nicolò oder auf der majestätischen, zum Meer hin geöffneten Piazza dell’Unità d’Italia, die an drei Seiten von den eleganten Palazzi der Macht umsäumt war, dem Rathaus, der Landesregierung und der Präfektur. Seine Limousine stand gleich nebenan auf ihrem festen Platz im unterirdischen Parkhaus unter dem Burghügel San Giusto. Chauffieren musste ihn, wenn er doch einmal das Auto benutzte, Antonia d’Antimi, eine androgyne Sechsunddreißigjährige mit schmalem Modigliani-Gesicht und dem Haarschnitt des jungen Alain Delon. Sie war Geschäftsführerin der Raccaro Development Studios und vertrat die Interessen ihres Chefs in allen Belangen der öffentlichen Hand. Manch einer vermutete verwandtschaftliche Bindungen zwischen ihm, Antonia und ihrer Zwillingsschwester Maria.
Von seiner Filmfirma im Palazzo Vianello hatte Raffaele Raccaro sich noch vor den Gerichtsverfahren getrennt, damit ihm deren schmutzige Finanzgeschäfte nicht angekreidet werden konnten. Nur die drei Supermärke zeugten noch von der früheren Größe seines Imperiums. Und eben seine Lobbyfirma unter der zuverlässigen Führung von Antonia d’Antimi. Die Büros der Development Studios besuchte Lele nur noch sporadisch, doch wenn es um die Zukunft der Stadt ging, zog er noch immer, wo es ging, die Fäden im Hintergrund. Nach langen Jahren der Stagnation und des Niedergangs hatten frische und von der Lokalpolitik unabhängige Kräfte Triest endlich wieder in eine Wachstumsphase geführt. Dass die Stadt neuen Auftrieb bekam, hatte kaum jemand vorausgeahnt, die bisherige Gemächlichkeit wurde allseits gelobt, doch inzwischen musste man die Plätze immer stärker gegen Touristen oder zugewanderte Unternehmer verteidigen. Über die Jahrzehnte des Stillstands hatte sich manch einer gefragt, ob es eine Riege der Verhinderer gab, die aus genau dieser verordneten Untätigkeit einen Vorteil zogen. Immerhin gab es nun ein Projekt aus einheimischen Reihen, das angeblich Fortschritt bedeutete: Der Bau der Seilbahn vom Meer bis hinauf auf den Karst – hinweg über Wohnhäuser samt Gärten, über Naturschutzgebiete und viel befahrene Straßen. Und altvertraute Hände führten wieder die Zügel.
Raffaele Raccaro war nicht allein, nur mithilfe seines Netzwerks war er zu Macht gekommen. Seine Loge, seine Clubs, die ihm geneigten Politiker oder Funktionäre in den Institutionen der öffentlichen Verwaltung. Und bei allem Miteinander hatte jeder von ihnen immer auch seine eigenen Interessen gepflegt und verfolgt. Der eine investierte mehr in Immobilien am Ort, der andere eher auswärts, und so hielten sie es auch mit Firmenbeteiligungen und kamen sich dabei kaum in die Quere. Ganz nach den eigenen Bedürfnissen, Visionen oder Illusionen. Aber immer im Einklang darüber, dass die Basis unter Kontrolle gehalten und in die gewünschte Richtung gelenkt werden musste. Selbst die Vertreter unterschiedlicher politischer Strömungen hatten sich höchstens öffentlich angefeindet, doch anstatt wirklich durchzugreifen, hielten sie ihre Wähler lieber mit Nebenschauplätzen beschäftigt.
Heute war Antonia schon früher bei ihm aufgetaucht als sonst. Sie wusste, das Lele immer früh auf den Beinen war. Und sie hatte ein beträchtliches Tagespensum zu erledigen.
»Du siehst müde aus, Antonia«, sagte Raccaro beim Kaffee. Sie saßen in seinem Wohnzimmer an dem ausladenden runden Marmortisch, an dem er früher die Abendessen mit seinen Vertrauten abgehalten hatte, wenn Dinge zu besprechen waren, die nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten. »Hast du schlecht geschlafen, oder ist es etwas anderes?«
»Ich war schon in aller Früh rudern, später wird es dafür zu heiß. Bei dem Dreckswetter der letzten Woche war an Training nicht zu denken, ich muss meine Kondition wieder aufbauen. Aber irgendetwas muss heute Nacht passiert sein, auf dem Wasser und an Land wimmelt es vor Sicherheitskräften.«
»Und ich dachte, du hättest dir die Nacht um die Ohren geschlagen, immerhin bist du noch jung.«
»Ich mache mir ernste Sorgen um Maria. Seit gestern Morgen habe ich nichts von ihr gehört. Auf meine Anrufe antwortet sie nicht. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht in das Unwetter gekommen ist. Sogar die großen Yachten sind gestern in Seenot geraten. Du weißt ja, Zwillinge spüren, wenn mit dem anderen etwas nicht stimmt.«
»Hast du bei der Werft und der Küstenwache nachgefragt?«
»Das mache ich erst, wenn ich bis zum Nachmittag nichts gehört habe. Maria genießt einen ausgezeichneten Ruf, ich will sie nicht in Verlegenheit bringen. Gestern hat sie gesagt, dass du sie angeheuert hättest, Lele. Was für Kunden sollte sie übernehmen?«
»Nur einen. Er ist sehr reich und spricht kein Italienisch. Sie hat das Geld vorab bekommen. Und es war nicht gerade wenig, das kann ich dir versichern.«
»Das ist mir egal. Wohin sollte sie ihn bringen?«
»Zuerst zur A. Den Rückweg wollte er spontan entscheiden. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Maria für Aufträge wie diesen angeheuert haben. Das weißt du. Sie sollte bald wieder zurück sein. Sie war mit einem schnellen Schlauchboot unterwegs.«
»Woher kennst du den Mann?«
»Eine meiner Verbindungen.«
»Legst du die Hand für ihn ins Feuer?«
»Das würde ich nicht einmal für dich tun, Toni.« Lele verzog das Gesicht zu etwas wie einem Grinsen.
»Ich mache mir auf jeden Fall große Sorgen. Das passt nicht zu ihr.«
Antonia d’Antimi kam meistens vormittags zu Lele, um über den Stand der Arbeiten und Geschäfte der Development Studios zu berichten. Sechs Mitarbeiterinnen wurden von der Sechsunddreißigjährigen geführt. Doch bei den Behörden sprach sie in wichtigen Dingen immer selbst vor.
»Heute wird die Ausschreibung für die Seilbahn nach Montegrisa geöffnet. Und ich möchte nicht, dass die Italiener den Zuschlag bekommen, Antonia«, sagte Lele. »Wir haben Anteile bei den Österreichern. Du weißt, was du zu tun hast. Mit dem Bürgermeister werde ich selbst sprechen.«
Abgesehen von seinem guten Draht ins Rathaus und zur Landesregierung hatte auch Leles Vertraute ihre Verbindungen zu Funktionären an strategisch wichtiger Stelle: Stefania Esposito war zuständig für Auftragsausschreibungen und Alfonso Guattari Stadtrat der Nationalkonservativen Partei. Er galt als öffentlicher Scharfmacher, sobald Themen sich nationalistisch umdeuten ließen. »Italien zuerst« war sein Lieblingsspruch. Und seine Kompromissfähigkeit zu erkaufen war teuer.
»Stefania sehe ich nachher auf einen Kaffee. Sie weiß, worum es geht, und bisher hat sie immer von unseren Plänen profitiert. Ihr ist bewusst, dass bei uns Gold zu finden ist.«
»Gold leider nicht mehr«, kommentierte Lele mit trockenem Mund. »Das war vielleicht mal so, bevor du eingestiegen bist. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Interessen vertreten. Mach der Esposito ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann, und liefere ihr die nötigen Argumente. Den Leuten in öffentlichen Ämtern mangelt es häufig an Fantasie. Wie ich gehört habe, haben sich die Anwohner, über deren Grundstücke die Seilbahn verlaufen soll, organisiert. Sie sind fortschrittsfeindlich und auch nicht besonders gewieft, finden aber Zuspruch bei den Linken, die eh gegen alles sind, was die Zukunft verspricht. Vergiss nicht, wie erfinderisch die Österreicher sind, wenn es um verdeckte Zahlungen geht. Dein Versprechen muss die Esposito beeindrucken, sie verdient gut in ihrer Position.«
»Dann hoffen wir, dass unser Angebot für sich spricht.«
»Im Zweifel muss sie ein Argument für eine Nachverhandlung finden. Und sei es ein formaler Fehler der Konkurrenz. Ich stehe im Wort, Antonia. Was liegt sonst noch an?«
»Die üblichen offenen Baustellen. Abriss und Neubau des therapeutischen Schwimmbads, der Tunnel von Montebello, die Tram von Opicina, die Umgestaltung des Porto Vecchio, drei Schulgebäude und das Aquarium. Wenigstens stellen die zuständigen Referenten inzwischen keine neuen Termine für die Fertigstellung mehr in Aussicht, sondern haben einfach auf ungewiss verschoben. Ich werde mit jedem Einzelnen von ihnen sprechen und Nachbesserungen fordern, wo nötig. Mehr als die üblichen Leserbriefe haben wir an dieser Stelle nicht zu befürchten. Auf die Straße geht doch niemand mehr. Und der Opposition fehlen Strategie und taugliche Vertreter. Die wollen auch nicht mehr arbeiten als die anderen, außerdem sind sie untereinander zerstritten. Typisch Triest. Ich habe bei der Renovierung meiner Wohnung gut daran getan, Handwerker aus Friaul und dem Veneto zu beauftragen. Die sind billiger und vor allem zuverlässig.«
»Dann mach dich an die Arbeit, Toni. Niemand soll wegen ein paar EU-Zuschüssen übereifrig werden. Die Stadt hat genug Geld. Es reicht, dass wir beim Antrag pünktlich waren. Der Rest ergibt sich von allein. Da lassen sich viele Gründe finden. Wir müssen unbedingt die Struktur im Griff behalten, sonst entgleitet uns alles. Die neue Hafenbehörde hat schon für genügend Unruhe gesorgt.« Lele warf einen Blick auf die Uhr. »In einer Stunde habe ich den Termin mit dem Bürgermeister.«
Antonia d’Antimi hatte Raffaele Raccaro vor einigen Jahren kennengelernt, als der Staat seinen historischen Zweimaster aus den Dreißigern zur Versteigerung brachte. Die Greta Garbo, auf der ein Mord geschehen war und die nachweislich zur Korruption von Politikern und Vertretern öffentlicher Institutionen eingesetzt worden war, war in der Marina von Ravenna festgehalten worden, bis das letztinstanzliche Urteil die Beschlagnahmung bestätigte. Lele hatte seine Strafe in der Zwischenzeit längst verbüßt und vergebens versucht, das Schiff zurückzubekommen. Antonia d’Antimi hatte damals auf der Bieterseite gestanden und den Kontakt zu ihm gesucht, um die Risiken abwägen zu können.
Die androgyne junge Frau gefiel Raccaro von der ersten Minute an. Das toughe Auftreten und ihre intelligente Tatkraft ließen ihn ihr schließlich das Angebot unterbreiten, seine Stellvertreterin zu werden. Und Antonia hatte nach kurzem Zögern angenommen. Sie entstammte einer mittelständischen Kaufmannsfamilie aus der Emilia, die ihr das Studium an der angesehenen Scuola degli interpreti ermöglichte, dem hiesigen Dolmetscher-Institut der Universität. Ihren Abschluss machte sie mit Auszeichnung in den Fächern Englisch und Russisch. Einen interessanten Job hätte sie problemlos gefunden, doch während ihres Studiums hatte sie die Vorzüge Triests und seine unschlagbare Lebensqualität kennengelernt. Im vorletzten Sommer hatte sie den fünfzigjährigen Bernardino geheiratet, der Chefarzt an der Triester Universitätsklinik und darüber hinaus ein besessener Segler war. Außerdem hatte sie auch ihre Zwillingsschwester zum Umzug nach Triest bewegt. Maria hatte rasch bei einer renommierten Werft in Monfalcone angedockt, für die sie nicht nur noble Yachten verkaufte, sondern sich selbst als Kapitänin für Probefahrten vercharterte. Oft genug erwuchs daraus ein lukrativer Kaufvertrag.
Trotz all seiner Beziehungen fühlte Raffaele Raccaro sich manchmal einsam. Melancholisch betrachtete er das Bild an der Wand, in einer Auktion würde es einen Spitzenpreis erzielen, das wusste er. Er sah aber darin nicht mehr die gleiche Wichtigkeit, die ihn vor vielen Jahren zum Kauf bewogen hatte. Eine erotisch interpretierte Landschaft um die seit der Antike mythenumwobene Mündung des unterirdischen Flusses Timavo bei Duino, die der Künstler angeblich einem berühmten späteren Werk vorausgeschickt hatte, L’Origine du monde.
Es war nicht das Alter, es war die Summe seines Lebens, bei dem er viel gewonnen und genauso viel verloren hatte. Aurelio, sein jüngerer Sohn, würde noch mindestens zehn Jahre im Gefängnis schmoren, zweifacher Mordversuch und Erpressung mit diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen Italien und Großbritannien. Zudem war er auch im Knast gewalttätig geworden. Und der ältere, Giulio, hatte in aller Heimlichkeit seine Wohnung und das Geschäft in Udine verkauft und war seitdem spurlos verschwunden. Das Einzige, was Raffaele Raccaro nach Ablauf seiner Strafe wiederbeleben konnte, waren seine alten Verbindungen. Fast alle seine Partner hatten nach 1992 juristische Probleme bekommen, die meisten wegen Bestechung, Korruption, verbotener Devisenausfuhr, Steuerhinterziehung und schwarzen Kassen oder Bildung krimineller Vereinigungen. Es hätte ein Aufbruch für das Land werden können, doch die meisten von ihnen fanden rasch zurück auf die Füße. Lele nannte sie Freunde, und wer von ihnen noch lebte, pflegte wieder Druck auszuüben bei Entscheidungen, die Triest und das Umland betrafen. Es war wie eine Sucht, von der sie nicht lassen konnten.