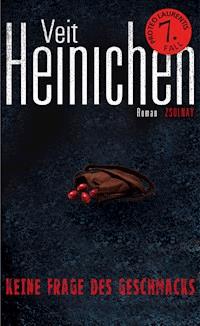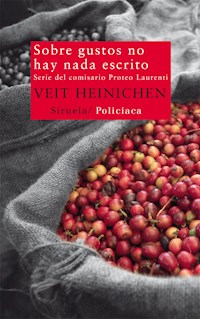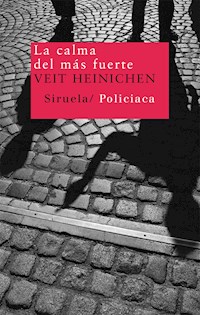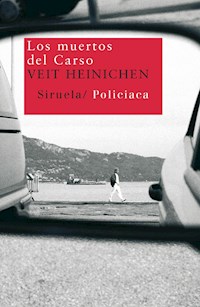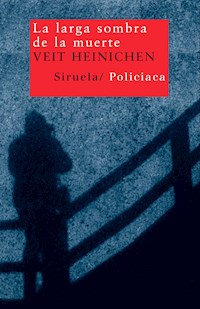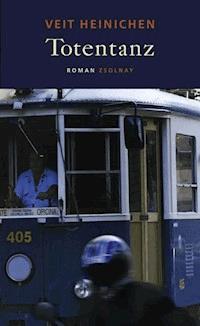
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Veit Heinichens fünftem Kriminalroman mit dem Triestiner Commissario Proteo Laurenti hat dieser einen Sack voll privater Probleme zu lösen. Darüber hinaus beschäftigt ihn die internationale Müll-Mafia, hinter der alte Bekannte stecken, die ihm an den Kragen wollen. Was Laurenti jedoch nicht ahnt: Die Verbrecher besitzen ein einzigartiges Präzisionsgewehr, auf das sogar die Amerikaner scharf sind, da es unliebsame Schnüffler aus größter Distanz erledigen kann. Ein typisch europäischer Fall, bei dem, wie im richtigen Leben, alles ganz anders läuft, als die Protagonisten es geplant haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Veit Heinichen
Totentanz
Roman
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05624-4
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2007/2012
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
»Lebe im verborgenen.«
Epikur
Ȇberall herrscht Zufall.
Laß deine Angel nur hängen;
wo du’s am wenigsten glaubst,
sitzt im Strudel der Fisch.«
Ovid
»Der Mensch ist etwas Komisches.«
Kenneth Patchen
Gute Freunde
Es war das Jahr, in dem die Deutschen einen Papst nach Rom schickten, um sich an den Italienern für Trapattoni zu rächen. Bayer gegen Fußballtrainer. Trotz seiner Nervosität prustete Proteo Laurenti vor Lachen, als er im Autoradio hörte, wie der oberste Rockträger mahnte, daß die katholische Kirche keine aufgewärmte Gemüsesuppe sei. Wenigstens stimmte die Grammatik.
Laurenti drehte den Ton leiser und passierte mit dem brandneuen Wagen seiner Frau, einem blauen Fiat Punto, den kleinen Grenzübergang bei Prebenico unterhalb der Burg Socerb, dessen Schlagbäume offenstanden. Kein Zöllner war weit und breit zu sehen, er hätte also auch seinen Dienstwagen nehmen können und Laura keine faule Ausrede servieren müssen, damit sie ihm ihr Auto lieh. In einer Viertelstunde würde er sich mit Živa Ravno treffen, der kroatischen Staatsanwältin aus Pula. Fast vier Jahre dauerte ihre Affäre inzwischen, Laurenti überschlug die Zeit und wurde immer nervöser. Die über fünfzehn Jahre jüngere Frau hatte sich seit Monaten rar gemacht und endlich, nachdem er sie erst lange am Telefon hatte becircen müssen, einen Treffpunkt in einem kleinen Tal auf der slowenischen Seite vorgeschlagen, wo der graue Kalkstein des Karsts in fruchtbaren Boden überging und Obstbäume wie Rebstöcke üppig wuchsen.
»Die kleine Wehrkirche von Hrastovlje«, hatte sie gesagt, »ich will, daß wir uns dort treffen.« Laurenti wiederholte ihre Worte, während er den Fiat über die kleine kurvige Straße prügelte. Bei aller Rationalität, die Živa in ihrem Beruf auszeichnete, hatte sie durchaus Sinn für theatralische Gesten. »Diese Kirche ist die Bibel des einfachen, leseunkundigen Volkes. Unglaublich schöne Fresken aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die das Alte und das Neue Testament darstellen. Und einen Totentanz, der ans Herz geht. Du solltest dich schämen, daß du noch nie dort warst in den dreißig Jahren, die du in Triest lebst! Es liegt direkt hinter der Grenze.«
»Und warum ausgerechnet dort?« hatte Laurenti gefragt. »Warum treffen wir uns nicht wie früher einfach in einem Hotel an der Küste?«
Živas Lachen, bevor sie antwortete, klang unecht. »Mir ist nicht danach. Hrastovlje paßt besser zu dem, was ich dir zu sagen habe.« Bevor Laurenti nachfragen konnte, hatte sie das Gespräch unter dem Vorwand, einen dringenden Termin zu haben, beendet.
Während der Küstenstreifen unter der Sonne glitzerte, waren über den Hügeln des istrischen Hinterlands schwere Gewitterwolken aufgezogen. Den Glockenturm mit dem Pyramidendach, der über die starken Festungsmauern mit den Resten der mächtigen Wehrtürme hinausragte, sah Laurenti schon aus der Ferne. Obgleich er zehn Minuten zu spät war, stand kein anderer Wagen auf dem Parkplatz am Fuß des Hügels, auf dem das Kirchlein thronte. Laurenti schloß den Fiat ab und schaute sich um. Živa war im Gegensatz zu ihm bislang stets pünktlich. Laurenti wählte auf seinem Mobiltelefon das slowenische Netz und ging widerstrebend den kleinen Weg hinauf. Ratlos stand er vor dem schweren schmiedeeisernen Tor, das mit einem riesigen Vorhängeschloß versperrt war. Unter dem Symbol eines mit einem dicken roten Balken durchgestrichenen Fotoapparats hing ein kleines zweisprachiges Schild mit der Telefonnummer des Kirchenwärters. Erste schwere Tropfen fielen vom Himmel, und Laurenti beschloß, nicht auf Živa zu warten. Eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung sagte, sie sei in fünf Minuten da, um ihn einzulassen. Er überlegte kurz, ob er besser in der Gostilna, die er weiter unten gesehen hatte, warten sollte, drückte sich dann aber eng an die Tür, um unter dem steinernen Torbogen wenigstens ein bißchen Schutz vor dem Gewitterschauer zu finden.
Wie lange hatten sie sich nicht gesehen? Laurenti versuchte, sich an das Datum ihres letzten Treffens zu erinnern. Es lag genau zwei Monate und vier Tage zurück, und sie hatten nicht einmal miteinander geschlafen. Živa war nervös gewesen und schien mit den Gedanken woanders, ihre Hand hatte sie immer wieder zurückgezogen, wenn er sie fassen wollte. Sie hatten sich, nach einem Termin Živas mit dem Oberstaatsanwalt von Triest, für die Mittagszeit in Koper verabredet. Jahrzehntelang war die kleine Nachbarstadt auf der anderen Seite der Grenze ein fester Anlaufpunkt jener aufmerksamen Familienväter gewesen, die für zwei Stunden über Mittag auch ihre Sekretärinnen nicht vernachlässigen wollten. Laurenti hatte sich immer gefragt, wie sie es anstellten, nicht ständig all den anderen über den Weg zu laufen, doch mit der längst problemlos zu überschreitenden Grenze hatten sich auch ihre Ziele verstreut. So hatte er arglos in Koper ein Hotelzimmer bestellt, doch Živa bestand darauf, im Caffè »Loggia« unter den alten Arkaden einen Apéritif zu nehmen. Offenbar wollte sie nichts von trauter Zweisamkeit wissen. Seinen Fragen wich sie aus und erzählte von einem aktuellen Fall, der sie angeblich sehr in Atem hielt. Es handelte sich um den Bankrott der Ferienresidenz »Skipper« hoch über den Salinen von Sečovlje. Vor Jahren bereits hatte dort eine Allianz aus Angehörigen exponierter Saubermänner der scharfmacherischen Lega Nord, Kärntner Hochfinanz und alter kroatischer Nomenklatura mitten im Naturschutzgebiet und mit unverbaubarem Blick auf den Golf von Piran einen enormen Betonkomplex in Angriff genommen, von dem gemunkelt wurde, er solle unter dem Spitznamen »Il Paradiso di Bossi« zur Feriensiedlung der Internationalen der Fremdenfeinde werden. Inzwischen ermittelten die Staatsanwälte wegen betrügerischen Bankrotts, bei dem vor allem Anhänger der Lega Nord über den Tisch gezogen worden waren. Bei Staatsanwältin Živa Ravno liefen die Ermittlungen bezüglich verdächtiger Schmiergeldzahlungen zur Erlangung der Baugenehmigung zusammen, während ein italienischer Kollege in Sachen versteckter Parteifinanzierung tätig war. Und Živa hatte ihm noch von einem anderen Verdacht berichtet. Ein Erzfeind Laurentis war vermutlich in die Sache verstrickt, der sich inzwischen gesellschaftlich etabliert hatte und in den höchsten Kreisen verkehrte. Auch wenn es sich um die üblichen alten Bekannten drehte, die ihm oft genug Probleme machten, hatte Laurenti seiner Geliebten nur mit einem halben Ohr zugehört.
Er vernahm Motorengeräusche, und kurz darauf stieg eine Frau in seinem Alter mit einem mächtigen Schlüsselbund in der Hand aus einem klapprigen roten Renault4 und begrüßte ihn. Wenn Živa nicht kam, dann wollte Laurenti sich das Kirchlein rasch alleine ansehen und schließlich, ohne sie anzurufen, verärgert nach Triest zurückfahren. Das hätte sie dann davon. Er ahnte nicht, daß seine Besichtigung länger dauern würde, als er von draußen vermutete. So klein die Ausmaße des romanischen Gemäuers waren, um so prächtiger waren dafür die Fresken. Er traute seinen Augen kaum. Kein Quadratzentimeter, der nicht bemalt war. Die Angst vor der Leere mußte im Mittelalter noch extremer gewesen sein. Aufmerksam hörte er der Frau zu, die ganz allein für ihn ihr Wissen heraussprudelte und ihn auf die vielen Details aufmerksam machte, die das Mittelschiff mit dem Tonnengewölbe sowie die beiden engen Seitenschiffe zierten: Altes und Neues Testament, Schöpfungsgeschichte und Passion, die Vertreibung aus dem Paradies, Kain und Abel und zwei frühe Stilleben, Tische mit Brot, Käse und Wein, Teller, Flasche und Krug. »Damals waren die Menschen mehr am Überirdischen interessiert als an der Wirklichkeit. Deshalb gab es dieses Genre vorher nicht«, sagte die Dame, als er einen Windstoß im Rücken fühlte, den das Knarren der Kirchentür begleitete. Die Führerin lenkte seinen Blick auf die dünnen Scheidewände zwischen den Apsiden und zeigte ihm die als Diakone dargestellten Heiligen Stephan und Laurentius. Er mußte lächeln, als er seinen Nachnamen hörte, und spürte im gleichen Moment eine regennasse Hand in der seinen und kurz darauf Živas warmen Atem an seinem Ohr.
»Entschuldige«, flüsterte sie, »ein Unfall auf der Autobahn.«
Die Führerin ließ sich nicht von ihr unterbrechen und ging zu einem Fresko im Südschiff hinüber. »Eine Besonderheit in der christlichen Ikonographie und ganz sicher das Motiv für die meisten Touristen, zu uns zu kommen, ist der Totentanz. Sehen Sie genau hin, der Grundgedanke ist die Gleichheit aller Menschen vor dem Tode, der als einziger gegen alle gerecht ist und dem niemand entfliehen kann. Alle müssen ihm folgen, allen grinst er gleichermaßen unverschämt ins Gesicht, während er sie zur frisch ausgehobenen Grube führt. Er duldet keine Ausnahme. Sehen Sie: Papst, König, Königin, Kardinal, Bischof, armes Mönchlein, reicher Kaufmann, hinfälliger Bettler, Kind. Er läßt sich von niemandem bestechen, auch wenn, wie Sie sehen, alle es versuchen, jeder auf seine Art.«
Laurenti legte seinen Arm um Živas Schulter und schmiegte sich an sie. Die Führerin lenkte über zu der Darstellung der Monate in den Deckengewölben. »Du hast recht gehabt«, flüsterte er, »höchste Zeit, daß mir dies jemand zeigt.«
»Und hier, die Inschrift in glagolitisch, dem kirchenslawischen Alphabet, die Gott sei Dank erhalten geblieben ist: ›Bemalung abgeschlossen am 13.7.1490 – Meister Johannes aus Kastar.‹ Ein Künstler aus der Nähe von Rijeka. Die Fresken wurden irgendwann übertüncht und erst Jahrhunderte später, 1949, wiederentdeckt und freigelegt.«
Laurenti bedankte sich und kaufte noch ein paar Postkarten, auf denen die Kunstwerke abgebildet waren – er mußte sie unbedingt seiner Frau zeigen und sie demnächst selbst zu diesem wunderbaren Ort bringen. Als sie aus dem Kirchlein traten, hatten die Gewitterwolken sich verzogen, und zarter Sonnenschein lag über der üppig grünen Landschaft.
»Gehen wir in das Gasthaus dort unten?« fragte Laurenti.
Živa nickte und hakte sich bei ihm ein. »Sie ist wunderbar, diese Kirche. Spätgotische istrische Malerei in einem Bauwerk, das vermutlich dreihundert Jahre älter ist. Die Wehrmauer wurde erst später gegen die Türkenbelagerungen errichtet.«
»Besonders tragisch ist der erste Schöpfungsfehler, die Vertreibung aus dem Paradies.« Laurenti faßte sie an den Schultern. »Ein grausamer Gott. Damit begann der Fluch der Arbeit.«
»Und der Totentanz, der Versuch, dem Tod das Leben abzukaufen? Das erinnert allzusehr an unsere Klientel«, sagte Živa.
Er hielt ihr die Tür zur Gostilna »Švab« auf. Ein niedriger langer Raum, der im vorderen Teil vom Tresen dominiert wurde, an den sich der Speisesaal anschloß. Unter der Woche war das Lokal über Mittag kaum frequentiert. Zwei Bauern, die ein Glas Wein an der Theke tranken, waren außer ihnen die einzigen Gäste. Die Speisekarte verzeichnete die üblichen deftigen Gerichte der istrischen Küche, die vom rohen Schinken der hauseigenen Schweine und dicker Maissuppe über des Bauern Lieblingshuhn bis zum Kalbsbraten reicht. Laurenti atmete auf, als er die frische Forelle entdeckte. Alles andere wäre ihm zu schwer gewesen, denn die reservierte Art Živas, die lediglich Gemüse vom Grill und als Hauptgang gedämpfte Brennesseln bestellte, verschloß ihm den Magen. Und ganz gegen ihre Art begnügten sie sich mit einem halben Liter Malvasia vom Faß.
»Du hast dich verdammt rar gemacht«, sagte Laurenti und legte sein Kinn in die Hände, die Ellbogen auf den Tisch gestützt. »Du fehlst mir sehr, wenn du so unerreichbar bist. Kaum Telefonate, meist bin ich es, der dich anruft, während du dich nur noch meldest, wenn es sich um Fachliches handelt. Manchmal habe ich den Eindruck, daß du mich gar nicht mehr liebst.«
Und wie so oft fühlte er sich im Nachteil, als der Wirt den Wein brachte und Živa damit eine direkte Antwort ersparte. Sie wartete, bis sie wieder alleine waren. Sie lächelte ihn milde an, fast mitleidig, und nahm einen kleinen Schluck von ihrem Glas, ohne Proteo zuzuprosten.
Als Laurenti nun schwieg, faßte sie seine Hand und schaute ihm in die Augen. »Das Leben geht weiter, mein Lieber. Es verändert sich jeden Tag. Wir leben in einer Zeit der unaufhaltbaren Beschleunigung. Nichts ist morgen mehr so wie heute. Die Arbeit wird von Minute zu Minute mehr, atemlos haschen wir nach Ruhe, die nur noch als Ahnung existiert, wie die Erinnerung an den Duft von frischem Heu, den wir aus der Kindheit kennen. Unsere Kunden sind innovativ und mit einem Tatendrang erfüllt, der dem Rest der Gesellschaft fehlt. Es lärmt überall, die Telefone stehen nicht mehr still, und selbst die Schreibtische scheinen zu stöhnen unter der Last der Aktenberge, die täglich auf ihnen gelagert werden. Du hast keine Vorstellung, vor welche organisatorischen Probleme mich allein unser Treffen gestellt hat. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, Proteo.«
Wieder wurden sie unterbrochen, diesmal brachte der Wirt das Gedeck.
»Was man an Zeit gewinnt, geht an Bewußtsein verloren, Živa.«
»Von wem ist der Satz?«
Laurenti druckste herum. Er war wirklich nicht seine Erfindung. »Ein französischer Autor, längst tot. Stand auf einem Kalender.«
»Ändere es, wenn du kannst«, sagte sie nur.
Er schnaubte durch die Nase. »Im November werden es vier Jahre, falls wir es tatsächlich bis dahin schaffen.«
»Vier Jahre was?« Živas Stimme klang nicht mehr sanft, eher so, als ginge ihr seine sentimentale Klage auf die Nerven.
Diesmal kam die Unterbrechung zu Laurentis Vorteil. Von der Küche her hörten sie ein Glöckchen bimmeln und dann sogleich die Schritte des Wirts, der die Gerichte servierte. Für Živa hatte er die Brennesseln nun doch zusammen mit dem anderen Gemüse gebracht, vor Laurenti standen ein Teller mit dampfenden Kartoffeln und eine Platte mit einer Forelle darauf, deren Schwanzflosse steil nach oben gekrümmt war.
»Vier Jahre.« Živa tippte mit ihrem Messer gegen den Fischschwanz. »Vier Jahre Heimlichtuerei, obwohl es alle um uns herum längst begriffen haben. Kein einziger gemeinsamer Sonntagsausflug, keine gemeinsame Reise, nicht einmal ein gemeinsames Frühstück, keine Ferien und kein Alltag, kein Streit und keine Versöhnung.«
Laurenti schaute sie erschrocken an. In der Tat war dies die erste gemeinsame Besichtigung einer Kirche, solange sie sich kannten, doch weshalb beklagte sie sich? »Wir hatten es so ausgemacht. Und was heißt eigentlich, daß alle davon wissen?« Er filettierte verstimmt und unkonzentriert den Fisch auf seinem Teller.
»Eine, wie soll ich sagen, fruchtbare Zusammenarbeit ist es, die wir bisher gelebt haben, sonst nichts. Und das ist nicht genug, finde ich.«
»Guten Appetit, Živa.«
»Lenk nicht ab, Proteo.« Živa hatte ihre Brennesseln bis jetzt noch nicht einmal angesehen. »Nenn mir nur einen einzigen Grund, weshalb wir mit dieser Beziehung fortfahren sollten!«
»Du hast immer auf deiner Freiheit bestanden, Živa. Ich habe dich nie danach gefragt, in welchen Verhältnissen du lebst, du hingegen kennst jeden einzelnen meiner Schritte.«
Seine Stimme hallte zu laut durch den leeren Raum. Proteo sah, wie der Wirt eine gewichtige Geste gegenüber den beiden Männern am Tresen machte und sie mit einem Augenwink in Richtung der beiden Essensgäste begleitete.
»Ebendarum geht es.« Živa, die endlich den ersten Bissen zu sich genommen hatte, legte hörbar ihr Besteck zurück auf den Teller. »Wir hatten vier schöne Jahre zusammen, oder sagen wir eher: zwei. Solange nämlich waren wir uns wirklich nahe, lachten und scherzten gemeinsam, machten Liebe, wie es uns gefiel. Die zweite Hälfte unserer Beziehung, Proteo, lief nicht mehr so. Und ich habe beschlossen, damit Schluß zu machen.«
Jetzt knallte Laurenti sein Besteck auf den Teller. Die drei Männer am Tresen schauten erschrocken zu ihnen herüber, ihre Ehen kannten derartige Ausbrüche schon lange nicht mehr.
»Laß uns gute Freunde bleiben und uns an die schönen Momente erinnern, die wir zusammen verbracht haben«, fuhr Živa fort, bevor er ihr widersprechen konnte. »Aber nichts anderes. Ich will frei sein. Und mit dir bin ich es nicht mehr.«
»Wenn dir jemand alle Freiheit gelassen hat, dann war ich das, Živa.« Er tastete sein Jackett nach Zigaretten ab, obwohl er seit zwei Jahren keine mehr kaufte und lediglich von denen der anderen profitierte, wenn er aufgeregt war.
»Rauch jetzt nicht«, sagte Živa. »Du hast noch nicht einmal die Hälfte von deinem Fisch gegessen.«
»Meeresfische sind besser als diese Tümpelforellen. Und schau gefälligst auf deinen Teller.« Aufgebracht wies er mit dem Finger auf das fast unberührte Gemüse und stieß dabei sein Glas um. »Verdammt noch mal.« Wie ein Tölpel tupfte er mit der Serviette auf dem Tischtuch herum. »Was willst du eigentlich, Živa?«
»Meine Freiheit, Proteo. Ich hab es schon gesagt.«
»Hast du einen anderen?«
Živa lächelte. »Nein. Aber es könnte irgendwann einmal passieren. Man weiß nie.«
»Wie heißt er?«
Wieder war es der Wirt, der sie unterbrach. Er hatte gesehen, daß sie ihr Essen nicht mehr anrührten, und trug mürrisch und kommentarlos ab. Laurenti bestellte die Rechnung, ohne Živa zu fragen, ob sie noch einen Nachtisch wünschte. Sie erhoben sich gleichzeitig und gingen an den grinsenden Männern vorbei ins Freie.
»Na denn«, sagte Laurenti auf dem Weg zum Parkplatz. Sein Leiden war Wut geworden. »Vielleicht überlegst du dir’s. Meine Telefonnummer kennst du ja.«
Er stieg, ohne sie noch einmal anzusehen, in den Fiat und startete mit aufheulendem Motor. Im Rückwärtsgang stieß er so heftig gegen die kleine Begrenzungsmauer zur Straße, daß der Lack splitterte.
»Du fährst wie ein Triestiner«, rief Živa ihm lachend hinterher.
Alles hat seinen Preis
Jede zweite Woche hatten Damjan und Jožica Babič Spätdienst und kamen dann immer erst gegen Mitternacht nach Hause in das Dorf auf der anderen Seite der Grenze. Um 22.30 Uhr stiegen sie in ihren Škoda und verließen das Gelände des Technologieparks oberhalb der Stadt, doch bogen sie schon nach einem Kilometer wieder von der Stadtumgehung ab auf den Parkplatz, wo sich ein Grillrestaurant befand. Eine Blockhütte, die man, um keine Baugenehmigung einholen zu müssen, mittels einiger Zeltvordächer erweitert hatte. Nur wenige Autos standen hier, und fast alle mit fremden Kennzeichen. Ein Wagen gehörte zu einem der zahlreichen Konsulate in der Stadt. Tagsüber war der Platz stärker besucht, es kamen Triestiner, die sich von hier zu einem Spaziergang an der Abrißkante des Karsts aufmachten, während sich andere nach längerer Reise die Füße vertraten und eine Kleinigkeit aßen.
Ein Geländemotorrad fuhr eng an ihrem Wagen vorbei und hielt erst am äußersten Ende des Areals. Sie hörten, wie sein Motor auslief, dann wurden die Lichter ausgeschaltet. Nur noch ein schemenhafter Umriß war zu sehen, der sich vom leuchtenden Stadthimmel abhob. Damjan und Jožica gingen durch die Dunkelheit zu dem kleinen Restaurant, wo eine auffällig elegant gekleidete Enddreißigerin auf sie wartete, deren pechschwarz gefärbtes, schulterlanges Haar in krassem Widerspruch zum fahlen Teint ihrer Haut und den kirschrot geschminkten Lippen stand. Die Frau begrüßte sie sogleich in ihrer Muttersprache und wies das Ehepaar an einen der Tische vor dem Lokal.
»Warum wolltet ihr mich sehen?« fragte sie und stellte ihre Krokotasche auf die Bank. »Habt ihr darauf geachtet, daß euch niemand gefolgt ist?« Sie machte eine Kopfbewegung zu der Stelle, an der das Motorrad stehen mußte, von seinem Fahrer war nichts zu sehen.
»Keine Sorge, wir sind allein«, brummte Damjan.
Die Schwarzhaarige wimmelte auf italienisch die Kellnerin ab, die ihre Bestellung aufnehmen wollte. »Wir gehen gleich wieder, danke.« Dann wandte sie sich dem Ehepaar zu. »Also, was gibt’s? Probleme?«
Damjan Babič überließ seiner Frau das Wort, wie sie es zuvor verabredet hatten. Er schaute in die Ferne und atmete schwer. Lange hatten sie beraten, wie sie aus ihrer Tätigkeit für Petra Piskera mehr für sich herausholen könnten.
Der »AREA SciencePark« bei Padriciano, auf dem Hochplateau über der Stadt, war das größte Forschungszentrum des Landes, eines der Aushängeschilder Triests, Hoffnungsträger für eine Zukunft als Stadt der Wissenschaft, aber auch Spielball parteipolitischer Interessen. Mehrfach hatte man in den vergangenen Jahren um die Finanzierung der Einrichtung von internationalem Ansehen gezittert, je nachdem, ob die jeweilige Regierung in Rom für oder gegen diejenige in der Stadt war. Ein Wissenschaftspark, der Synergien schaffen sollte zwischen staatlichen Institutionen, Universität und Privatunternehmern, die sich hier privilegiert ansiedeln konnten, sofern sie entsprechende Forschungsprojekte und die dazugehörigen Busineß-Pläne vorweisen konnten. Über achtzehnhundert Menschen arbeiteten in dem ausgedehnten Areal. Damjan und Jožica gehörten schon lange dazu. Sie hatten seit zehn Jahren eine reguläre Arbeitsgenehmigung, galten als unscheinbar, aber zuverlässig und kamen mit den beiden Gehältern bestens zurecht, denn der Tariflohn hier lag deutlich über dem für sie erreichbaren Monatsgehalt in Slowenien. Jožica arbeitete je nach Bedarf in der Foresteria, dem Gästehaus der Anlage, in der Mensa oder im Kindergarten, der für den Forschernachwuchs vorgesehen war und sich »Cuccioli della Scienza« nannte, Welpen der Wissenschaft, als stammte der Nachwuchs aus der Retorte. Jožica machte ihre Arbeit Spaß, ihre eigenen Kinder waren längst erwachsen und arbeiteten in Österreich als Saisonniers in der Gastronomie. Damjan, gelernter Elektriker, war einer der Hausmeister und eigentlich Mädchen für alles, der sich bisher noch vor keiner Arbeit gescheut hatte. Oft half auch er, ohne danach gefragt zu werden, in der Mensa aus, von wo er täglich die Säcke voller Lebensmittelsreste mitnahm und zu Hause an die Schweine verfütterte, die er in dem kleinen Stall hinterm Haus hielt. Dank ihrer beider Einkommen hatten sie in den letzten Jahren auf dem Land, das zu ihrem alten Haus aus Familienbesitz gehörte, ein neues hochgezogen. Die Fassaden waren noch nicht verputzt, das konnte warten. Damjan und Jožica machten längst Pläne für später. Irgendwann wollten sie die Arbeit in Padriciano aufgeben und damit die tägliche Autofahrt von und nach Komen auf dem slowenischen Karst, um sich ausschließlich ihrer Landwirtschaft zu widmen. Bisher blieb dafür nur frühmorgens, am Feierabend und an den dienstfreien Wochenenden Zeit. Die Tiere waren zu versorgen, dazu der Gemüsegarten und ein dreiviertel Hektar Rebstöcke, der durchschnittlich neun Hektoliter Wein ergab.
Als die Konsulin sie vor knapp einem Jahr anwarb, tat sich endlich eine vernünftige Perspektive auf. Denn was die Dame namens Petra Piskera von ihnen erwartete, schien eine gutbezahlte Kleinigkeit. Problemlos konnte Damjan bei seinen abendlichen Rundgängen durch das Institut nach ihrer Vorgabe mit einer Digitalkamera an genau bezeichneten Stellen ein paar Fotos von Dokumenten und Plänen schießen und dann die Kamera in den Büroräumen der CreaTec Enterprises zurückzulassen, um eine andere mit leerem Speicher an sich zu nehmen. Sechstausend Euro im Vierteljahr waren bisher ein schönes Taschengeld gewesen, mit dem sie sich einiges mehr erlauben konnten. Sie sprachen sogar von einer langen Urlaubsreise, doch die kleine Landwirtschaft verlangte ihre ständige Präsenz. Hühner und Schweine erwarten auch an Feiertagen pünktliche Fütterung.
Seit ein paar Tagen hatte Damjan allerdings das Gefühl, beobachtet zu werden, und sich nach einigem Zögern entschlossen, seiner Frau von diesem Verdacht zu erzählen. Es gab keine konkreten Anhaltspunkte, aber irgend etwas hatte sich verändert. Er wußte nicht, ob es mit den Artikeln in der reaktionären Presse zusammenhing, die von einer permanenten Gefahr sprach, die angeblich von allen Forschungszentren in der Stadt ausging, vor allem vom »ICTP« und dem »Abdus Salam« beim Park von Miramare, den Instituten für theoretische Physik, wo viele Forscher aus der dritten Welt ausgebildet wurden. Einmal stand in einem der Blätter, daß die islamische Atombombe in Triest geplant würde. Schwachsinn, das wußte sogar Damjan. Die Institute hatten bisher mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht, und der Neid gegen jede Form von Erfolg war überall gleich. Als Jožica beunruhigt von ihm verlangte, sich an jedes Detail der letzten Tage zu erinnern, stammelte er etwas von einer rothaarigen jungen Frau, trotz des Sommers mit einer schweren Lederjacke bekleidet, die er mehrfach auf dem Gelände gesehen hatte, ohne daß er sie aus einer der Firmen kannte. Sie war ihm aufgefallen, weil sie stets eine Kamera um den Hals und eine schwere Tasche mit technischem Gerät in der Hand trug. Vielleicht sah er Gespenster, doch eine innere Stimme riet ihm, auf diesen Nebenverdienst zu verzichten.
Jožica hatte Petra Piskera unter der ausländischen Telefonnummer angerufen, die sie ihnen als Kontakt gegeben hatte, und um das Treffen gebeten. Im gleichen Gespräch hatte er konkrete Anweisungen für die nächsten zwei Tage erhalten. Mit solchem Nachdruck hatte die Dame bisher nie auf die Erledigung einer Aufgabe bestanden. Jožica und Damjan hatten lange über das Telefonat gesprochen und sich schließlich darauf geeinigt, mit List das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Und Jožica sollte die Verhandlungen führen.
»Unsere Arbeit ist schwieriger geworden. Wir wollen mehr Geld, Frau Konsulin«, sagte sie entschieden.
»Was hat sich verändert? Für die paar Fotos seid ihr schon verdammt gut bezahlt.« Die Schwarzhaarige steckte sich hastig eine Zigarette an.
»Wir haben in der Zeitung gelesen, daß die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden sollen. Terrorismusvorbeugung, sagt man. Verschärfte Ein- und Ausgangskontrollen auch für das Personal.«
»Das betrifft euch doch nicht. Ihr nehmt doch nichts mit. Ihr macht lediglich die Fotos, Herr Babič stellt bei seinem letzten Durchgang den Apparat auf die Ladestation in den Räumen der CreaTec Enterprises und nimmt dafür die andere Kamera mit dem leeren Speicher an sich. Kein Kontrolleur kann etwas finden. Also, was soll das?« Grob drückte sie die nicht einmal halb gerauchte Zigarette in den Aschenbecher und kümmerte sich nicht darum, daß sie weiterqualmte.
»Wir brauchen mehr Geld«, beharrte Jožica. »Nur eine einmalige Prämie von fünfzigtausend Euro, dann geht alles weiter wie bisher. Für Sie ist das doch eine Kleinigkeit.«
Ihre Auftraggeberin verzog keine Miene. »Ihr habt gestern und heute kein Material geliefert. Warum?«
»Ebendarum.« Damjan Babič war ein stattlicher Mann von einem Meter neunzig mit den Händen eines Nebenerwerbslandwirts, der sich nun zu voller Größe aufrichtete, um seinen Worten mehr Bedeutung zu geben. »Sie sollen sehen, daß es uns ernst ist.«
Die Konsulin zeigte sich unbeeindruckt. »Sag deinem Mann, er soll sich setzen und die Klappe halten«, herrschte sie Jožica an, die sich nicht rührte.
Damjan trat ganz dicht vor die schwarzhaarige Dame und hob seine mächtigen Hände. »Was ist schwierig daran, unser Anliegen zu verstehen? Alles hat seinen Preis. Und unseren haben wir gerade genannt. Also, Sie akzeptieren oder Sie lassen es sein. Auf jeden Fall machen wir so nicht weiter.«
»Ihr bekommt dieses Mal das Doppelte. Aber nur dieses eine Mal. Verstanden.«
Damjan setzte sich wieder.
»Wir wissen längst, daß unsere Arbeit für Sie viel mehr wert ist, als Sie bezahlen, Frau Konsulin«, sagte Jožica. »Wir wollen nur das, was uns zusteht. Fünfzigtausend.«
Bevor Petra Piskera antworten konnte, fügte Damjan hinzu: »Und wenn Ihnen das zuviel ist, dann suchen Sie sich jemand anderen, der für Sie herumspioniert. So nennt man das doch! Verkaufen Sie uns nicht für dumm.« Damjan stand auf und faßte seine Frau am Ellbogen. »Komm jetzt, Jožica. Ich glaube, sie hat verstanden.«
»Warten Sie.« Sie hatten noch keine fünf Schritte gemacht, als die Konsulin sie mit eisiger Stimme aufhielt. »Liefern Sie die Fotos bis übermorgen, dann läßt sich etwas machen. Aber ich brauche sie übermorgen.«
»Ab übermorgen haben wir Frühschicht«, sagte Damjan über die Schulter, ohne seine Geschäftspartnerin anzusehen. »Warten Sie um fünfzehn Uhr auf uns im zweiten Parkdeck des Einkaufszentrums ›Torri d’Europa‹. Und vergessen Sie nicht das Geld. Wir machen keine Scherze.«
Sie ließen die Konsulin stehen und gingen zum Škoda hinüber. Damjan steckte sich eine Zigarette an und wartete mit dem Einsteigen, bis die Rücklichter des Wagens der schwarzen Dame nicht mehr zu sehen waren. Im Anfahren mußte er scharf abbremsen, um den Motorradfahrer vorbeizulassen, der es offensichtlich eilig hatte.
*
Alba Guerra war vierunddreißig Jahre alt und stammte aus Treviso. Drei Jahre hatte die Journalistin als Pressesprecherin des Cowboy-Bürgermeisters gearbeitet, der in der Stadt die Parkbänke abmontieren ließ, damit keine Penner mehr darauf übernachten konnten. Er hatte durch seine Äußerungen wiederholt für Aufsehen gesorgt, insbesondere als er die Meinung vertrat, daß man auf afrikanische Einwanderer wie auf Hasen schießen sollte, um sie zur Heimkehr zu bewegen. Als der Mann, der sich tatsächlich als Wildwest-Sheriff hatte ablichten lassen, mit Ende der zweiten Amtszeit nicht noch einmal antreten durfte, verabschiedete sich auch die »Rote Alba«, wie sie von ihren rechten Kameraden wegen ihrer Haarfarbe gerufen wurde, aus der Politik und ging zurück in den Journalismus. Sie arbeitete für eine überregionale Tageszeitung, die sich schon in der Vergangenheit auf die Forschungseinrichtungen in Triest eingeschossen hatte, sowie auf die vielen klugen Köpfe aus der dritten Welt, die dort tätig waren. Die Sprache ihrer Artikel war schneidend polemisch und politisch drastisch vorgestrig. Mehrfach hatte sie deshalb vor dem Richter gestanden, konnte aber stets, dank des Beistands einschlägig bekannter Rechtsanwälte, den Kopf aus der Schlinge ziehen. Für die Rechten war es Mode geworden, sich auf das demokratisch verbriefte Recht der Meinungsfreiheit zu berufen, wenn sie für ihre revanchistischen und hetzerischen Äußerungen am Pranger standen.
Alba Guerra war von ihrem Mailänder Chefredakteur zum erstenmal anläßlich des EU-Beitritts Sloweniens nach Triest geschickt worden. Eine Handvoll Neofaschisten hatte mit einem Sitzstreik vor dem Konsulat des Nachbarlandes protestiert, worüber kaum jemand berichtete – außer ihr. Sie hatte schnell Gefallen an der Stadt am Meer gefunden. Und innerhalb der Splittergruppe der Unverbesserlichen war sie, dank ihrer scharfmacherischen Artikel gegen die Nachbarn jenseits der Grenze, bald beliebt. Eine geschlossene Gesellschaft, die sich die Realität nach Gutdünken zurechtbog und das Recht auf ihrer Seite glaubte, auch wenn sich kaum jemand um sie scherte. Rechtsextreme Gewalt gab es in der Vielvölkerstadt Triest seit Jahrzehnten nicht. Und die vereinzelten Schmierereien auf Hauswänden mußte man nicht ernst nehmen. Wen scherte diese Polemik heute noch, mit der sich keine politischen Mehrheiten mehr schaffen ließen? Und außerdem badeten Faschisten wie Kommunisten alle im gleichen warmen Wasser der Adria.
Dank guter Kontakte hatte Alba eine Proforma-Anstellung und damit Einlaß in das Forschungszentrum gefunden. Rasch hatte sie die Fährte des Hausmeisters Damjan Babič aufgenommen, dessen Generalschlüssel am schweren Bund es ihr angetan hatte. Viel schneller als erhofft war sie fündig geworden. Der Mann gab sich keine große Mühe, sein Vorgehen zu verschleiern. Er hatte Zugang zu allen Räumen, und alle wußten dies. Glühbirnen wechseln, Schalter reparieren, Leitungen überprüfen – er war überall gern gesehen, und oft genug erhielt er ein Trinkgeld oder eine Tasse Kaffee. Aber dann hatte die Rote Alba ihn erwischt, als er in den Räumen des Instituts für Solartechnik, »ISOL«, die Pläne fotografierte, die an den Wänden hingen. Ein paar Tage später hatte ihn die Journalistin dabei fotografiert, wie er Akten aus einem Schrank nahm und ablichtete. Doch was ließ sich eigentlich in einem solchen Unternehmen stehlen? Weder Raumfahrt- noch Rüstungstechnik und schon gar kein radioaktives Material, das zum Bau einer schmutzigen Bombe getaugt hätte, wovon einige ihrer politischen Freunde munkelten. Alba Guerra hatte keine andere Wahl, als an Babičs Spuren zu kleben und darauf zu hoffen, daß er irgendwann weitere Hinweise lieferte. Heute abend war es endlich soweit. Aus der Dunkelheit heraus konnte sie ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen Fotos von dem Treffen mit der schwarzen Dame machen und das Gespräch in großen Teilen mit dem Richtmikrofon aufzeichnen. Und endlich hatte sie die Gewißheit, daß Babič krumme Sachen drehte, und er hatte ihr seine Auftraggeberin auch noch auf dem Tablett serviert. Die Angehörige eines osteuropäischen Konsulats! Das war ein gefundenes Fressen. Doch Industriespionage in Sachen alternativer Energiegewinnung? Das hatte es bisher noch nicht gegeben, und sie konnte sich leicht eine blutige Nase holen und sich der Lächerlichkeit aussetzen, wenn sie keine handfesten Beweise lieferte. Alba Guerra mußte unbedingt dieser schwarzhaarigen Frau folgen.
Bombenstimmung
»In Triest verschläft die Polizei sogar einen Bombenanschlag.« Die Spötter hatten leider recht, und es blieb nichts anderes übrig, als ihre Kommentare so souverän wie möglich zu übergehen und statt dessen von Spuren und Ermittlungen zu sprechen, selbst wenn man einiges hinzudichten mußte. Auch Proteo Laurenti hatte den Knall gehört, eineinhalb Stunden nach Mitternacht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!