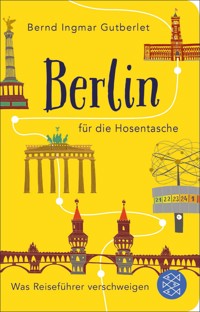
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
***Das kleinste Buch über die größte Stadt Deutschlands***Was gehört alles in Hoppelpoppel? Welche Berliner waren gar keine? Und wo findet man die wahren Oasen und Idyllen? Alles über die größte deutsche Stadt und ihre Bewohner: Historisches, Skurriles, Wissenswertes, Komisches, Bemerkenswertes, Interessantes, Vergessenes, Staatstragendes, Aktuelles, Abwegiges, Triviales, Aufregendes, Ärgerliches, Rührendes, Eigenwilliges, Vergnügliches – kurz: Berlinerisches – für Berlin-Touristen, Alt- und Neuberliner und alle, die mitreden wollen über die Stadt, die in aller Munde ist. Verfasst von einem, der Berlin kennt wie seine Hosentasche, dem Historiker und Stadtführer Bernd Ingmar Gutberlet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernd Ingmar Gutberlet
Berlin für die Hosentasche
Was Reiseführer verschweigen
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke | Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de
Covergestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, München
Coverabbildung: Shutterstock / Lavandaart
Abbildungen Innenteil: Shutterstock / Lavandaart
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403743-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Die Stadt vorab
Berlin und der Rest der Welt
Die geräumige Stadt: Berlins Topographie
Die grüne und blaue Stadt: Natur
Die gebaute Stadt: Architektur
Die gelebte Stadt: Bevölkerung
Die verlebte Stadt: Geschichte
Die belebte Stadt: Kultur
Die beliebte Stadt: Szene
Die hungrige Stadt: Kulinarisches
Die verwaltete Stadt: Politik und Verwaltung
Die geschäftige Stadt: Wirtschaft und Wissenschaft
Die bewegte Stadt: Verkehr
Die zukünftige Stadt
Einleitung
Es ist im Moment eine der prominentesten europäischen Hauptstädte.
Waleri Gostomski, polnischer Historiker, 1904
Europe’s Capital of Cool.
Time Magazine, 2009
Dynamik! Vielfalt! Freiheit!
Berlin ist in aller Munde. Die Bundeshauptstadt ist ein Renner nicht nur bei Touristen, ob aus Deutschland oder von anderswoher, die Jahr für Jahr in größerer Zahl zu Besuch kommen, sondern ebenso bei Zuzüglern aus Deutschland und aller Welt, die hierher umziehen und die Einwohnerzahl beständig wachsen lassen – um rund 40000 pro Jahr. Fast zwei Millionen Menschen sollen seit 1990 hergezogen sein, wenn auch häufig nur für einige Zeit. Ob Politik, Medien oder Kultur, ob national oder international, an Berlin kommt man nicht vorbei, und das hat die Aufmerksamkeit für die Stadt in den letzten Jahren enorm gesteigert.
Das führt dazu, dass fast jeder, der nach Berlin kommt, Erwartungen oder bereits eine Meinung über die Stadt im Reisegepäck mitbringt. Und diese Meinungen sind so facettenreich wie Berlin selbst. Ein bisschen ist Berlin wie ein alter Reisekoffer, übersät mit Etiketten: manche alt, ausgeblichen und zu Teilen überklebt von neueren, glänzenderen. In ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit halten sie das ramponierte Ganze zusammen. Diese Vielfalt der Meinungen entspricht der Vielfalt der Stadt. Natürlich: Manches Etikett ist so unübersehbar oder schrill oder kommt so häufig vor, dass es weithin geläufig ist – aber das muss natürlich nicht bedeuten, dass der Gehalt auch zutrifft. Und doch: Wer mit Vorschusslorbeeren oder Vorurteilen, mit konkreten Erwartungen oder bereits gefasstem Urteil die Stadt besucht, kann das Mitgebrachte meist auch bestätigt finden. Nur sollte man sich auf die Stadt einlassen und nicht nur nach dem Erwarteten suchen, sondern bereit sein, mehr als das zu sehen und die Vielfalt kennenzulernen, die Berlin auszeichnet. Denn Mitte-Hipster mit Jules-Verne-Bart gehören ebenso dazu wie verschlumpfte Kreuzberger Altlinke, die Helikoptermami auf dem Pankower Spielplatz ebenso wie bulgarische Mütter, die ihrem Nachwuchs das Betteln beibringen. Teil des Stadtbilds sind südeuropäische Touristengruppen auf Fahrrädern, die Autofahrer zur Verzweiflung bringen, aber auch herbe Ostfrauen jenseits der fünfzig mit schrill gefärbter Kurzhaarfrisur – oder russische Obdachlose, schnieke Kudamm-Bummler und Randberliner mit Provinzflair und Potenzgehabe am Lenkrad. Längst gehören dazu auch die schwarzen Limousinen der Politiker, Diplomaten und Lobbyisten, und immer noch die Westberliner gute Gesellschaft, die sich am Samstag in der Feinschmeckeretage des KaDeWe den Schampus schmecken lässt. Und die Vorurteile, die aus diesen Etikettierungen sprechen, gehören auch schon wieder dazu, denn um sich in der fordernden Großstadt sowohl einen Überblick als auch einen mentalen Schutzraum zu verschaffen, arbeitet selbst der Berliner mit Vorbehalten und Vorurteilen zur Abgrenzung.
Die Vielfalt der Stadt sowie der Ansichten und Meinungen über sie macht das Unterfangen, einen Berlin-Führer zu verfassen, so komplex wie aussichtslos. Andererseits ist jeder Zugang zu einer Stadt am Ende ein persönlicher, also subjektiv. Und beim Kennenlernen macht stets den entscheidenden Unterschied aus, wenn ein lokaler Lotse bereitsteht, der die unbekannte Stadt individuell vermittelt. Werden wir also persönlich.
Hollywood war es, das mich nach Berlin brachte. Und es geschah in Paris. Als Anfang-zwanzig-Jähriger saß ich in den achtziger Jahren irgendwo nahe Odeon allein in einem ziemlich abgetakelten Kino und sah »Cabaret«. Liza Minelli als Sally Bowles, die unter der S-Bahn-Brücke der Bleibtreustraße kreischend das Zuggetöse übertönt. Der Berliner Tanz auf dem Vulkan, beendet vom Marsch strammer brauner Stiefel. Sein Ende angekündigt vom süßlichen Volkslied, dessen Darbietung von harmloser Folklore zu dumpfer Volkstümelei und schließlich zur Bedrohung wird. Michael York, der mit naiv-fasziniertem Staunen das mondän-dekadente Treiben betrachtet. Die Huldigung Berlins, das zur Drehzeit des Films, Anfang der siebziger Jahre, einen ziemlich jammervollen Eindruck machte: abgewrackt, abgelebt, versehrt und noch dazu in zwei Hälften geteilt. An diesem Abend habe ich mich in die Stadt verliebt, ohne je zuvor dort gewesen zu sein. Nach der Vorstellung rauchte ich auf dem Pont Alexandre über der Seine eine Zigarette und beschloss, von Film und Tabak enthusiasmiert, nach Berlin zu gehen.
Seither hat mich die Stadt nicht mehr losgelassen. Ein paar Mauerjahre habe ich noch erlebt, roch den morbiden Charme Westberlins und erlitt neben einem Kohleofen die berüchtigten stumpfgrauen Berliner Winter, fuhr nach Ostberlin und lernte dort Freunde kennen – und verpasste schließlich, direkt an der Mauer und betrunken, wie die Grenze sich öffnete. Seither erlebe ich, wie diese Stadt wieder zu sich kommt, mögen das manche Berliner merkwürdigerweise auch ganz anders sehen. Auf beiden Seiten der einstigen Mauer gibt es nämlich bis heute Sehnsucht nach den klaren Verhältnissen von damals, mitunter mit staunenswerter Einseitigkeit und voller Gedächtnislücken vorgebracht. Ein Berliner Paradoxon besteht zudem darin, dass alteingesessene Berliner zwar in einer vielbeachteten Weltstadt wohnen, aber die damit notwendig verbundenen Beschwerlichkeiten einer Metropole nicht so recht akzeptieren wollen. Noch kurioser der Stolz der Berliner auf ihre Stadt, den die Welt teilen soll – der sich aber nicht darin äußern möge, dass immer mehr Touristen ihren Stolz in Augenschein nehmen.
Und doch ist Berlin irgendwie ein Phoenix, der strahlend aus der Asche emporsteigt. Angesichts ungezählter Kameras, die sich auf ihn richten, ordnet er immer wieder eitel sein Gefieder, und all diejenigen, die früher verächtlich in eine andere Richtung schauten, lässt er nun großzügig oder herablassend unter seinen breiten Schwingen Platz finden. Und dieser Phoenix hält durchaus etwas auf die Tatsache, dass sich noch einiges an Asche im Gefieder finden lässt.
Berlin ist wieder zur Weltstadt aufgestiegen, was sie einerseits zu einer unter vielen macht, die sich mit anderen Weltstädten messen lassen muss, andererseits kann sie ihr Potential endlich wieder entfalten. Selten kann man einer Stadt bei einer solchen Häutung zusehen, die noch dazu in wenigen Jahrzehnten vonstattengeht. Das ist überaus aufregend und faszinierend, hat aber natürlich seine Schattenseiten. Man muss beklagen, dass Kreuzberg seinen spezifischen Charakter verliert, weil die Mauer in diesem Fall schützend gewirkt hatte. Trotzdem muss man konstatieren, dass die künstliche Situation auf beiden Seiten der Mauer, so besonders und faszinierend sie das Leben in Berlin auch machte, Ende der achtziger Jahre bereits begann, sich zu überleben. Man muss bedauern, dass das vielbeschworene Unfertige verschwindet, was aber großstädtische Dynamik mit sich bringt, wenn die Käseglocke zerbricht. Man muss kritisieren, dass die Politik viel zu wenig tut, um den Begehrlichkeiten von Investoren Grenzen oder verbindliche Gestaltungsrahmen zu setzen, um Charakter und Vielfalt der Stadt zu erhalten und die weitere Stadtentwicklung zu gestalten, statt ihr bloß zuzusehen. Man möchte, wenn man es aufmerksam verfolgt, manchmal schier verzweifeln an der selbstgefälligen Einfallslosigkeit vieler verantwortlicher Stadtplaner, wenn die wieder einmal auf alte Rezepte setzen, die anderswo längst krachend gescheitert sind. Ein Zukunftslabor soll die Stadt sein, aber viele Versuchsanordnungen sind schon reichlich angestaubt.
An Berlin kann man sich reiben und muss es auch. Meine Liebe zur Stadt ist ebenso aufregend wie anstrengend, und je länger man hier lebt, desto mehr setzt sich die Einsicht durch, dass es Berlin nicht nur einmal gibt. Es gibt diese Stadt nicht allzu viel weniger mal, als Berlin Einwohner hat. Deshalb können die Berliner auch leidenschaftlich über ihre Stadt streiten. Wer seine Stadt beschreibt, erntet schnell Widerspruch. Das wird mir auch mit diesem kleinen Berlin-Buch passieren, aber so muss es auch sein. Trotzdem aber gilt: Ein guter Berlin-Führer muss ein subjektiver sein – nur rechthaberisch darf er nicht werden. Kommen Sie mit mir durch meine Stadt, um anschließend Ihr Berlin zu entdecken!
Die Stadt vorab
Berlin ist eben keine Stadt, sondern ein trauriger Notbehelf, Berlin ist ein Conglomerat von Kalamitäten.
Frank Wedekind, 1908
Den Neuankömmling kann Berlin schon mal überfordern: sooo groß, sooo hektisch, sooo unübersichtlich. Na, Großstadt eben! Aber eben auch keine beliebige Großstadt, sondern eine mit spezifischen Eigenarten. Wer die vorab kennt, dem fällt das eigentliche Kennenlernen leichter. Daher kurz beantwortet: sieben erste Fragen von Berlin-Erstlingen.
Städte haben ein Zentrum. Normalerweise. Zumindest darf man erwarten, dass eine überzeugende Mehrheit der Bewohner einer Stadt bei dieser Frage auf denselben Punkt des Stadtplans zeigt. In Berlin ist die Frage eher schlecht gestellt, denn die Stadt hat mehr als ein Zentrum. Zwar gibt es einen Bezirk namens Mitte – aber den würde wohl nicht jeder Berliner als Berlins Zentrum angeben. Und wenn doch, wo in Mitte, das ja schon Großstadtgröße hat, liegt dann das Zentrum? Am Brandenburger Tor, dem wichtigsten Wahrzeichen? Am Schloss, das lange der Bezugspunkt nicht nur der Politik, sondern der Stadtentwicklung war? Am Alex, wo täglich Hunderttausende Berliner umsteigen und der Fernsehturm in die Höhe ragt? An der Nikolaikirche, wo Berlin mal begann?
Und wenn Mitte, was ist dann mit der City West und dem Bahnhof Zoo, als Menschenumschlagplatz dem Alex ebenbürtig? Ebenjene beiden, Zoo und Alex, könnten mit einiger Berechtigung so genannt werden, zumal Ost und West durchaus noch Kategorien sind und es auch schon vor dem Bau der Mauer waren. Und Berlins »neue Mitte« am Potsdamer Platz – ein zentraler Platz, der nach dem Krieg zur Riesenbrache wurde, weil die Mauer mittendurch ging? Nicht ausgeschlossen ist außerdem, dass ein in seinem Kiez verwurzelter Berliner aus Überzeugung, Ichbezogenheit oder reinem Trotz sein unmittelbares Wohnumfeld als Zentrum nennt. Die Frage ist also nicht nur kompliziert, sondern auch aufgeladen, und viele Berliner beantworten sie eh mit Abwinken. Noch am ehesten kann man sich darauf verständigen, dass Berlins Zentrum von Zoo bis Alex reicht – dann aber zum einen reichlich groß ist, zum anderen nicht durchgängig so verdichtet, wie es sich für das Zentrum einer Großstadt eigentlich geziemt. Genau besehen ist Berlin sowieso polyzentral, denn zu den genannten kommen noch andere Zentren, etwa die Altstädte von Köpenick oder Spandau.
891 Quadratkilometer, das ist schon ’ne Menge, 45 Kilometer vom einen Ende zum anderen ist auch kein Pappenstiel. Der Grund ist derselbe wie der für die polyzentrische Stadtstruktur: 1920 wurden Berlin sieben umliegende Städte sowie Dutzende Dörfer, Gemeinden und Gutsbezirke dazwischen und rundherum einverleibt. Flächenmäßig machte das aus Berlin über Nacht die zweitgrößte Stadt der Welt, nur Los Angeles hatte ein noch größeres Stadtgebiet. Stadt- und Dorfkerne haben sich als Zentren behauptet, darunter die heutige City West, einst Zentrum der unabhängigen Stadt Charlottenburg. Paris beispielsweise wurde nie mit seinem Umland vereinigt, deshalb passt, an Stadtgrenzen gemessen, die französische Hauptstadt in die deutsche fast achteinhalbmal hinein – aber das ist natürlich eine ungehörige Milchmädchenrechnung.
Es lebe die Statistik. Eine besagt allen Ernstes, Berlin sei die ärmste Hauptstadt der Welt, wegen der krassen Diskrepanz zwischen dem Reichtum Deutschlands im Ganzen und seiner wirtschaftlich schwachbrüstigen Hauptstadt. Deutschlandweit lautet ein sehr beliebter Vorwurf, Berlin hänge am Tropf des ganzen Landes. In der Tat ist das Bundesland Berlin Hauptnutznießer des Länderfinanzausgleichs und hat mit Geld nicht immer ein glückliches Händchen. Der Stadt ihre Wirtschaftsschwäche vorzuwerfen ist trotzdem ungerecht. Denn Berlins Stellung als Hauptstadt und wichtigste Industriestadt Deutschlands war mit Kriegsende 1945 zu Ende und die Stadt weitgehend zerstört. Von der alten Wirtschaftskraft hat sich nur sehr wenig wieder gebildet, denn die politischen Verhältnisse ließen das nicht zu. Kritiker zumal aus München oder Frankfurt am Main müssen sich schon sagen lassen, dass sie davon kräftig profitierten: Früher waren zum Beispiel die Deutsche Börse und viele Bankenzentralen in Berlin ansässig; wichtige Firmen stammen aus Berlin, sind aber abgewandert. Zur Wahrheit gehört außerdem, dass Berlin schon seit Jahren auf einem sehr guten wirtschaftlichen Weg ist: Bei stark wachsender Einwohnerzahl sinkt die Arbeitslosenquote nirgendwo so rasch wie hier, durch einen strammen Sparkurs seit den 90ern werden die Schulden abgebaut. Ganz abgesehen davon, dass Stadtstaaten gegenüber Flächenländern strukturell bedingte Nachteile haben. Trotzdem schimpfen bis heute Leitartikler überall in Deutschland, die Stadt lebe über ihre Verhältnisse und ihre Verwaltung sei aufgebläht. Auch das stimmt längst nicht mehr, der öffentliche Dienst der Stadt wurde auf die Hälfte zusammengestrichen, was inzwischen zu problematischen Engpässen führt.
Vor mehr als einem Vierteljahrhundert fiel die Mauer, heute sind nur an wenigen Stellen in der Stadt substantielle Reste übrig. An anderen Orten wurden Mauerstücke erneut aufgestellt, aber insgesamt ist von einst 160 Kilometer Grenze verschwindend wenig erhalten. Kein Wunder eigentlich, wenn man den Hass auf dieses Bauwerk und die Freude über sein Ende bedenkt. Die Berliner sahen damals mit größter Befriedigung dabei zu, wie es Stück für Stück verschwand. Heute erinnert eine Linie auf dem Asphalt an den Verlauf der »Schandmauer« (West) oder des »antifasch-/imperialistischen Schutzwalls« (Ost), wie das Monstrum genannt wurde. Selbst diese Markierung war in der Stadt zunächst schwer vermittelbar, wurde aber notwendig, weil in Vergessenheit geriet, wo genau die Mauer mal verlief. Inzwischen ist die Teilung so lange her, dass die Berliner entspannter damit umgehen.
Hartnäckig hält sich die Ansicht, der Stadtname Berlin ließe sich vom Wappentier Bär herleiten, zumal der Askanier Albrecht der Bär die Mark Brandenburg gründete. Mit einiger Wahrscheinlichkeit aber verhält es sich umgekehrt: Historiker gehen davon aus, dass der Name aus dem Slawischen stammt – schließlich war die Gegend bis Mitte des 13. Jahrhunderts slawisches Herrschaftsgebiet. Vermutlich bezieht er sich auf den morastigen Untergrund. Weil diese Namensherkunft aber in Vergessenheit geriet, je mehr das Slawische verdrängt wurde, suchte man eine andere Ableitung und bemühte noch im 13. Jahrhundert den Bären (Berlin wäre dann niederdeutsch für »kleiner Bär«) und setzte ihn später ins Stadtwappen.
Berlin wächst, und überall in der Stadt wird gebaut, was das Zeug hält. Ständig kommt man an großen, oberirdisch erkennbar provisorisch installierten Rohren vorbei, mal blau, mal rosa, mal lila. Sie dienen dem Abpumpen von Grundwasser, das wegen des hochstehenden Grundwasserspiegels Baulöcher füllt. Berlin hat nicht nur viele Flüsse, Seen und Kanäle, sondern auch im Untergrund viel Wasser, das bei Bauarbeiten immer wieder Probleme macht. Die Bauten der Museumsinsel stehen zum Beispiel auf vielen tausend Holzpfählen, und Neubauten müssen, je nach Lage, im Untergrund gut verankert und vor eindringendem Grundwasser geschützt werden. Wasser hat Berlin also reichlich, trotzdem sind die Trinkwasserpreise hoch. Weil daher die Berliner sparsamer als früher mit dem Wasser umgehen, steigt der Grundwasserpegel sogar.
Auch das hat mit Berlins chronisch nassem Untergrund zu tun, der dem Tiefbau Schwierigkeiten macht, und ebenso mit der Verteilung von Arm und Reich in der Stadt. Als beispielsweise die 1902 eröffnete erste U-Bahn gebaut wurde, leistete sich das reiche Charlottenburg den teuren Tunnel, während der Arbeiter- und Soldatenwohnbezirk Kreuzberg mit einer Hochbahnstrecke vorliebnehmen musste. Einige Nachkriegslinien fahren zwar tief, aber ungedeckelt – man sah später einfach keine Notwendigkeit mehr für eine Abdeckung. Für die neue U-Bahn-Strecke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor wurde übrigens wegen des heiklen Baugrunds einiger Aufwand betrieben, unter anderem wurde teilweise Erdreich eingefroren, um besser bauen zu können. Dafür machte das Wasser dann nach Fertigstellung des Rohbaus an einigen Stellen Schwierigkeiten, als es in die Tunnelröhre eindrang.
Da hätten wir vorab schon ein paar Fragen geklärt, die meist sehr rasch aufkommen. Gleich hinterher noch sieben stadtspezifische Begriffe, die Neuankömmlingen nicht unbedingt geläufig sind.
Schrippe: Okay, nicht allein in Berlin, aber doch vor allem hier heißt, was anderswo Semmel, Brötchen oder Rundstück genannt wird: Schrippe. Das Wort kommt von »schripfen«, also mit einem Messer einritzen. Eine Schrippe zeichnet sich denn auch durch die Kerbe aus, an der man sie halbieren kann. Eigentlich ist die Schrippe eine besonders preiswerte Brötchenart, aber das scheinen gerade die Bäckereiketten irgendwie vergessen zu haben.
Kiez: Weil Berlin wieder so populär wurde, ist der Begriff überregional sehr viel bekannter als früher. Nicht zuletzt hippe US-Berliner beschwören gern, wie sehr sie in ihrem Kiez schon verwurzelt sind. Der Berliner bezeichnet so das, was der Pariser »mon quartier« nennt: die unmittelbare Wohnumgebung, den eigenen städtischen Lebensmittelpunkt. Der ostelbische Begriff Kiez bezeichnete ursprünglich eine slawische Dienstsiedlung; noch heute gibt es im Brandenburgischen Dörfer namens Kiez oder Kietz.
Berliner Zimmer: Eine Eigenheit des Berliner Wohnungsbaus: Alte Mietshäuser, die aus Vorderhaus und Seitenflügel bestehen, haben in größeren Wohnungen einen Raum, der den repräsentativeren Vorderhausteil mit dem Teil im Seitenflügel verbindet. Dieses sogenannte Berliner Zimmer ist meist sehr groß und eher dunkel, da es nur ein Eckfenster hat.
Molle: Eine Molle ist ein Bierglas oder auch ein Glas Bier. In echten Kiezkneipen, die längst unter Hipstern als angesagt gehandelt werden, kann man den Eingeborenen mimen, in dem man lässig eine Molle ordert. Man muss allerdings damit rechnen, dafür belächelt zu werden. Mollenfriedhof ist eine Berliner Bezeichnung für den Bierbauch, die sogar der Duden kennt.
Späti: In Ostberlin gab es zu DDR-Zeiten Spätkaufs, denn das (begrenzte) Warenangebot sollte auch Spätschichtlern zugänglich sein. Viele Spätkaufs retteten sich ins Gesamtdeutsche, neue kamen stadtweit hinzu und sind nicht selten Kult bei den Anwohnern, die auf ihren Späti nichts kommen lassen – schon weil das unverzichtbare Straßenbier dort zwar teurer als im Supermarkt, aber eben stets zu haben ist. Andere überfordert schlicht die Tatsache, dass ein Supermarkt auch mal zuhat, und das Nötigste gibt’s beim Späti auch: Bier und Zigaretten, Chips und Tiefkühlpizza. Allerdings entspricht die späte Öffnung nicht dem deutschen Ladenöffnungsgesetz. Immer wieder führt das Ordnungsamt Razzien durch und schließt ungesetzlich geöffnete Spätis, während Petitionen zu ihrem Schutz bislang erfolglos blieben. Trotzdem halten sich die Spätis in ihrer prekären Existenz hartnäckig.
Pfannkuchen: Man gehe in eine Berliner Bäckerei und verlange einen Berliner. Wenn schon nicht die Verkäuferin schnoddrig wird, dann gibt es sicher in der Schlange einen älteren Berliner, der sich scherzhaft oder gar altherrenwitzig anbietet. Denn was anderswo Berliner heißt, ist an seinem namensgebenden Ort ein Pfannkuchen. Und der wiederum heißt in Berlin Eierkuchen.
Sechser: Einer der schönen Begriffe, die immer weniger gebräuchlich sind. Ein Sechser ist ein Fünfpfennigstück, heute eben ein Fünfcentstück. Die Bezeichnung kommt wohl daher, dass es in Preußen eine Halbgroschenmünze gab, das entsprach sechs Pfennigen. Die Bezeichnung ging später über auf das Fünfpfennigstück.
Und dann sind da noch einige Berliner Besonderheiten, die zu kennen von Vorteil sein kann, bevor man die Stadt besucht. Unzählige Touristen und Neuberliner kamen schon ins Schwitzen auf der Suche nach einer Hausnummer. Denn gemeinerweise ist die Hauszählung der Berliner Straßen uneinheitlich. Zwar zählen sie ihre Häuser mehrheitlich wie anderswo auch, also mit geraden Nummern auf der einen, den ungeraden auf der anderen Seite. Viele Straßen zählen aber fortlaufend, beginnen also am einen Ende der Straße und wechseln am anderen Ende auf die andere Seite und zählen zurück weiter. Im Fall der Schönhauser Allee etwa stehen sich Ecke Torstraße Nr. 5 und Nr. 188 gegenüber, am anderen, Pankower Ende springt mit der Nummer 97 die Zählung auf die andere Seite und geht wieder stadteinwärts. Auch der Kurfürstendamm zählt so und hat noch dazu die irritierende Eigenheit, Nummern auszulassen: 1 bis 9 sowie 238 bis 264, weil Berlins Einkaufsmeile heute an der Gedächtniskirche beginnt, bis 1925 aber bereits am Landwehrkanal; außerdem fehlen durch bauliche Veränderungen die Nummern 10, 221–223 sowie 77–89.
Man könnte Berliner Taxifahrern unterstellen, sie hofften stets auf Neuankömmlinge, die am Flughafen oder Hauptbahnhof atemlos einsteigen und in die Berliner Straße gebracht werden wollen. Davon gibt es nämlich viele, und besagte pfiffig-skrupellose Taxifahrer würden den Gast vermutlich in die am weitesten entfernte fahren, um dort mit einem Achselzucken die Vorwürfe abzutun, man habe diese Berliner Straße doch gar nicht gemeint. Und auf Entrichtung des stolzen Betrags auf dem Taxameter bestehen. Weil Berlin aus Dutzenden ehemaliger Städte und Dörfer besteht, die meist auch eine Straße besaßen, die nach Berlin führte, zeichnet die Stadt aus, besonders viele nach ihr benannte Straßen zu besitzen. Mit Selbstverliebtheit hat das nichts zu tun.
Auch wer nach Berlin zieht und den Touri-Rummel gar nicht erst mitmacht – an den Ausprägungen des Fremdenverkehrs kommt man nicht vorbei. Dazu gehören Rollkoffer der ohrenbetäubenden Sorte, orts- und verkehrsregelunkundige Fahrradhasardeure auswärtiger Zunge, chronisch schleichende Sightseeingbusse – und die unvermeidlichen Trabitouren. Die gibt es zwar auch in einigen anderen Städten, aber bei Berlin-Touristen sind sie besonders beliebt. Sie sind auch eine gleichzeitig spaßige und authentische Weise, Berlin kennenzulernen, zumal mancher Anbieter nicht Klamauk, sondern Niveau bietet (www.trabisafari.de). Wer mitfährt, wird so oft fotografiert wie selten zuvor, denn das DDR-Auto ist eine Sehenswürdigkeit auf Rädern. Den Berlinern sind sie ein steter Dorn im Auge – der Geruch, die Hupe, Verkehrshindernis und ästhetischer Affront etc. Also wirklich.
Während sich die Berliner mit ihrer Ablehnung der Trabitouren mehrheitlich einig scheinen, streiten sie über andere stadtspezifische Angelegenheiten gerne kontrovers. Wo, zum Beispiel, gibt es die beste Currywurst? Oft läuft es auf eine Ost-West-Spitze hinaus: »Curry 36« (Mehringdamm, Bhf. Zoo) und Konnopke (Schönhauser Allee). Ebenso wird über den besten Döner und die besten Burger diskutiert. Mit Leidenschaft verteidigen Berliner oft ihren persönlichen Kiez als den tollsten der Stadt, das ist mitunter eine Frage des Prinzips. Umstritten sind auch die Bezirke insgesamt: Jeder hat Vorlieben und Vorurteile, und die müssen sich nicht einmal unbedingt auf eigene Anschauung gründen. Denn wer kennt schon jeden Bezirk dieser großen Stadt gut genug? Und dann gibt es da noch die ausgemachten Zankäpfel, die nicht ansprechen sollte, wer harmoniebedürftig ist oder in Eile:
Das Schloss
Tempelhofer Freiheit
Potsdamer Platz
Verkehr
Hunde
Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses als Humboldtforum wurde von Anfang an kontrovers diskutiert und spaltet die Berliner weiterhin. Der Sitz der Hohenzollern war nach seiner Sprengung auf Befehl der DDR-Regierung 1950 in Vergessenheit geraten, ebenso seine architektonische und städtebauliche Bedeutung. Eine Bürgerinitiative holte es in den 1990ern wieder ins Gedächtnis und arbeitete beharrlich für eine Wiedererrichtung, die der Bundestag schließlich beschloss und weitgehend finanziert. Für und Wider bleiben Thema: Hätte nicht der DDR-Protzbau Palast der Republik erhalten werden müssen? Macht es Sinn, ein Barockschloss modern wieder aufzubauen? Andere finden, so werde der Stadt ihr Herz zurückgegeben und das historische Vierer-Ensemble aus Schloss, Dom, Altem Museum und Zeughaus wiederhergestellt. Und mit den einziehenden Museen erhalte die Museumsinsel eine kongeniale Erweiterung mit Blick auf die ganze Welt.
2008 wurde der Altflughafen Tempelhof geschlossen. 2010 wurde das Gelände zugänglich gemacht, und seither ist der neugewonnene Stadtraum eine Lieblingspiste der Berliner. Der Senat plante, das Areal an den Rändern zu bebauen, wogegen ein Volksentscheid angestrengt wurde, der 2014 stattfand: Fast mit Zweidrittelmehrheit beschlossen die Berliner, das Gelände nicht zu bebauen, sondern so zu erhalten, wie es ist. Das war eine harsche Abfuhr für den Senat und freute viele Berliner. Vor allem wegen des großen Wohnungsbedarfs der Stadt finden aber viele, eine Randbebauung müsse sein. Andere finden die Brache zu hässlich, um im derzeitigen Zustand erhaltenswert zu sein.
Der Potsdamer Platz als erstes Großprojekt der Stadt nach ihrer Wiedervereinigung ist längst Stadtinventar. Streiten lässt sich darüber aber immer noch, wie das seit den ersten Neuplanungen der Fall ist. Damals stellten die Gegner in Frage, dass die Stadt einen Wiederaufbau des vor dem Krieg wichtigen und quirligen Viertels brauche, auch die architektonischen Entwürfe wurden angezweifelt. Zwingend künstlich geraten müsse ein solches Vorhaben, Urbanität aus der Retorte wiedererstehen zu lassen. Heute ist dort wieder ein betriebsames Stück Berlin zu besichtigen, aber viele Berliner fahren allenfalls naserümpfend dran vorbei.
Berlin wächst – und damit das Verkehrsaufkommen, obwohl prozentual der Anteil des Autoverkehrs sinkt. Die Straßen werden voller und die verschiedenen Verkehrsarten belauern und bekriegen sich. Autofahrer echauffieren sich über die Regelignoranz der Radler, die deren Rücksichtslosigkeit beklagen; Fußgänger fühlen sich weder von Zwei- noch von Vierrädern respektiert. Selbst das gutausgebaute Nahverkehrsnetz stößt an Kapazitätsgrenzen. Außerdem muss vieles modernisiert werden, was zu oft langen Streckensperrungen und aufwendigen Umfahrungen führt. Die neue Landesregierung will umsteuern: weniger Autoverkehr, mehr Platz für die immer zahlreicher werdenden Radfahrer, Vorfahrt für die Öffentlichen. Im Vergleich zur bisherigen Verkehrspolitik ein veritabler Paradigmenwechsel. Symbol dafür ist die für 2019 geplante Sperrung der Linden für Autos.
Ein paar hunderttausend Hunde leben in der Stadt, deren vieles Grün eigentlich ideal ist. Die genaue Zahl ist schwer abschätzbar, da nicht jeder Hund steuerlich verbucht ist. Aber die Stadt scheint sich in Hundeliebhaber und Hundehasser zu teilen, die einander unversöhnlich gegenüberstehen. Das stimmt so natürlich nicht, im Großen und Ganzen mögen Berliner Hunde durchaus. Aber jeder Hundebesitzer macht seine Erfahrungen mit keifenden Tierfeinden, und jeder, der einfach nur Angst vor Hunden hat, kann von Hundehaltern berichten, die den lächerlichen Angsthasen zum Problem erklären, nicht die eigene Missachtung des Leinenzwangs. Zwei Unduldsame beider Hundefronten können aus einer entspannten Party eine ideologische Schauveranstaltung machen.
Und der neue Flughafen?, werden Sie jetzt fragen. Das ist kein Streitpunkt in Berlin, alle sind sich seit der Absage der Eröffnung 2012 einig, dass die Peinlichkeit grenzenlos ist. Wir kommen aber später noch darauf zurück.
Solche Streitfälle offenbaren einen Aspekt, mit dem andere Großstädte ebenso zu kämpfen haben und der sich in Berlin auf vielfältige Weise äußert: Das Wesen der Stadt als verdichtetes Zusammenleben, das nur durch gegenseitige Toleranz und Rücksichtnahme funktioniert, kollidiert immer häufiger mit einer selbstsüchtigen Haltung des modernen Hyper-Individualismus: Klar brauchen wir Wohnungen, aber doch nicht gleich gegenüber, wo es mir die Sicht versperrt! Super, dass Berlin international so angesagt ist, aber diese Touris überall! Natürlich muss das Verkehrsnetz ausgebaut werden, aber doch nicht vor meiner Haustür! Klar muss man im Stadtverkehr Rücksicht üben, aber ich hab’s gerade soo eilig. Selbstredend ist Respekt ein unverzichtbares Schmiermittel im Großstadtmiteinander, aber ich bin halt grad echt schlecht drauf!
Und da wären wir bei der Gelegenheit, als leidenschaftlicher, aber durchaus kritischer Berliner das Thema Berlin-Bashing anzuschneiden. Zuvörderst muss man da konstatieren, dass Hauptstädte und exponierte Metropolen sowieso immer im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, zumal im Land, zu dem sie gehören. Davon kann man in Paris ebenso ein Lied singen wie in Moskau oder New York. Da nehmen auswärtig Wohnende der Stadt übel, wie oft über sie berichtet wird, wie viel Geld der Staat (angeblich) dort reinschießt, wie undankbar diese Stadt sich verhält, dass sie alles Talent von anderswo abzieht und verschwenderisch mit all dem Geld umgeht. Der Neidfaktor ist also durchaus mit im Spiel. Anderen machen Großstädte Angst, und sie finden sie zutiefst suspekt. Dann kommt hinzu, dass sich durch den steilen Aufstieg Berlins in der nationalen wie internationalen Wahrnehmung andere Städte zurückgesetzt fühlen.
Klar, der Berlin-Hype zieht anderswo Aufmerksamkeit ab, aber wie wäre es mit ein bisschen Stolz auf eine tolle Hauptstadt? Alte Ressentiments kommen dazu, seien es landsmannschaftliche Empfindlichkeiten oder historisch-politische Vorurteile. Natürlich lastete Preußens Dominanz schwer auf der deutschen Geschichte – aber Berlin ist nicht mehr die Hauptstadt des mächtigsten und großmäuligsten deutschen Staates, denn den gibt es nicht mehr. Die Alliierten haben ihn nach dem Zweiten Weltkrieg ganz offiziell aufgelöst.
Aber Negativklischees halten sich nun mal hartnäckig, selbst wenn sie gar keine Grundlage mehr haben. Noch immer wird Berlin in den Medien und an den Stammtischen gerne vorgehalten, über seine Verhältnisse zu leben und anderer Leute Geld mit beiden Händen auszugeben. Vom harten Sparkurs seit den 1990ern und der Schrumpfung des öffentlichen Dienstes auf die Hälfte ist selten die Rede. Selbst als sehr zu Recht ganz Deutschland sich darüber echauffierte, wie die Hauptstadt 2015 vom Flüchtlingszustrom monatelang komplett überfordert war, wurde einer der Hauptgründe selten genannt: die fehlenden Stellen in der Verwaltung, deren Personalausstattung man inzwischen nicht mal mehr als auf Kante genäht bezeichnen kann. Besonders ungerecht und unzutreffend am beliebten und sooo gerne medial aufgebauschten Eindreschen auf Berlin ist, wenn die Stadt als Prügelknabe für Entwicklungen dient, die gar nicht berlinspezifisch sind: Sozial- und Kultur-, Architektur- und Systemkritik mag angebracht sein, und Auswüchse unserer Zeit treten in einer Großstadt nun mal früher und vor allem stärker zutage. Aber Berlin hat weder die schlechten Manieren erfunden noch das moderne Credo, stets in Eile und dabei immer sehr bedeutend zu sein. Dasselbe gilt für Rücksichtslosigkeit im Verkehr oder grundloses Anpöbeln anderer, Sauforgien auf öffentlichen Plätzen oder gesichtslose Investorenarchitektur.
Zwei Klagen seien noch erwähnt, die doch sehr kurz gedacht sind: Berlin sei hässlich, lautet die eine. Das geht von einem merkwürdigen Maßstab aus, denn Großstädte sind nie nur schön. Prag ist im Zentrum mehr Puppenstube als Stadt und drumherum reichlich hässlich, wie auch das schöne Budapest viele scheußliche Ecken hat. Die vielgepriesene Schönheit von Paris kann man zwar schwerlich bestreiten, grenzt aber in vielen quartiers an Monotonie. In Berlin ist es nur eben so, dass Schönes und Hässliches sich recht ungeordnet abwechseln. Weder gibt es ein schönes Schmuckkastenzentrum, noch wurde das Hässliche an den Stadtrand verdrängt. Und die Vielfalt Berlins gibt sich auch in der Vielfalt ihrer schönen Ecken zu erkennen. Abgesehen davon: Keine andere deutsche Stadt hat im Zweiten Weltkrieg so viele Bomben abbekommen wie Berlin – und die Scheußlichkeit vieler Nachkriegsbauten und -ideen ist kein Berliner Phänomen.
Die andere Klage bezieht sich auf die Nachwende-Architektur: Da sehe ja fast alles gleich aus, wie schrecklich. Der Vorwurf ist zwar nicht ganz falsch, lässt aber die Tatsache außer Acht, dass nun einmal seit der Wiedervereinigung enorm viel gebaut wird, worunter sich unvermeidlicherweise viel Mittelmaß findet. Zudem lässt sich so viel Neues in einer Stadt nicht ausschließlich mit schmucken Solitärbauten bestücken, die sich gewissermaßen gegenseitig anschreien. Am einfallslosen Bauen sind neben der Politik, die zu viel durchgehen lässt, vor allem die Investoren schuld, weil sie meistens rein renditeorientiert planen lassen, anstatt der Stadt markante Architektur zu schenken – wie in Stuttgart oder Frankfurt am Main auch. Und doch: Wer Architekturführer über Berliner Bauten der letzten 20 Jahre in die Hand nimmt, wird beeindruckt sein, wie viel tolle Architektur gebaut wurde. Wer mit offenen Augen durch die Stadt fährt, ebenso. Für Architektur gilt wie für anderes: Man nimmt gerne wahr, was die vorgefasste Meinung bestätigt.
Zum schlechten Bild von Berlin, das zu zeichnen höchst beliebt zu sein scheint, gehört die Klage von der kriminellen Stadt, in der man an jeder Straßenecke dreimal erschossen und zehnmal ausgeraubt wird. Dabei ist Berlin im Vergleich übrigens keine sonderlich gefährliche Stadt, auch wenn man es als Tourist Taschendieben, Pöblern, Gewaltbereiten und Falschspielern deshalb nicht übermäßig einfach machen sollte. Die Frage ist, womit man die Berliner Kriminalitätsrate vergleicht – mit Eichstätt oder Mexiko-Stadt? Wie auch immer, die Berliner Polizei identifiziert Jahr für Jahr sogenannte KBO – kriminalitätsbelastete Orte. Veröffentlicht werden sie eigentlich nicht, aber in den Medien wird trotzdem darüber berichtet.
Hier zehn Orte, an denen man Wertsachen sicher verwahrt haben, Glücksspieler meiden und auf Provokationen eher nicht eingehen sollte:
Kottbusser Tor
Die Gegend rund um Bahnhof Zoo, Gedächtniskirche sowie Joachimsthaler Straße
Alexanderplatz
Warschauer Brücke/Revaler Straße (Friedrichshain)
Görlitzer Park
Hermannplatz und -straße
Volkspark Hasenheide
Leopoldstraße
U-Bahn-Linien 8 und 9
Altstadt Spandau
Bleibt für ein erstes Kapitel eine kleine Liste selbstredend subjektiver Vorschläge, was man in Berlin auf jeden Fall machen sollte, um ein bisschen von der Vielseitigkeit der Stadt mitzunehmen:
Durchs Brandenburger Tor laufen.
Auf der Stadtbahnstrecke quer durch Berlin fahren, von Westkreuz bis Ostkreuz, wahlweise auch eine ganze Umfahrt mit der Ringbahn (1 Stunde).
Übers Tempelhofer Feld laufen.
Wahlweise Currywurst/Döner/Burger versuchen.
Mindestens drei verschiedene Wohnbezirke abseits der Sehenswürdigkeiten durchstromern.
Auf Oberbaum-, Modersohn- oder Admiralsbrücke den Sonnenuntergang anschauen.
Für Autofahrer: auf der AVUS und der Stadtautobahn rumkurven, vorzugsweise spätabends.
Den Park am Gleisdreieck besuchen.
Ein Stück Berliner Mauer suchen und anfassen.
Am Kudamm bummeln und die Seitenstraßen nicht vergessen.
Mindestens drei verschiedene U-Bahn-Linien fahren und beobachten, worin sie sich unterscheiden.
In’t Jrüne fahren: Lübars, Friedrichshagen oder Kladow besuchen.
Im Sommer: Im Strandbad Wannsee einen Strandkorb mieten und auf Ostsee machen.
Berlin und der Rest der Welt
Berlin ist ganz neu, die neueste Stadt, die mir je vorgekommen ist. Sogar Chicago würde altersgrau daneben aussehen.
Mark Twain, um 1880
Im Vergleich zu Berlin ist Paris ein Stall, London eine Kloake und New York ein Schweinekoben.
Charles Huard, 1907
Berlin darf sich, je nach Perspektive, seit über hundert oder gut zehn Jahren als Metropole ansehen. Dass das für die Jahrhundertwende 1900 oder die 20er Jahre zutrifft, steht außer Frage, ebenso, dass die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg dem gründlich den Garaus gemacht haben. Wann Berlin wieder zur Metropole im Weltmaßstab wurde, können Berliner heiß diskutieren, am Ende aber einigt man sich meist darauf, dass Mauerfall, Wiedervereinigung und Regierungsumzug unentbehrliche Impulse lieferten und dass spätestens mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 der Boom in Gang kam. Da sich aber im Berliner der deutsche Zweifler und notorisch Unzufriedene mit einem lokalspezifischen Nörglergeist und einer latenten Unsicherheit vermischen, ist die Sache mit der Weltmetropole immer so eine Sache. Das können noch so viele Touristen rundheraus bestätigen oder Medien von Weltrang schwarz auf weiß als gesichert hinausposaunen – dem Berliner wird ein bisschen mulmig, wenn man ihn als Bewohner einer bewunderten Weltmetropole anspricht. Aber wehe, die internationale Gunst wird entzogen, wie es als Kontrapunkt zum Lob über den grünen Klee in Form von Berlin-Bashing notgedrungen auch vorkommen muss. Dann ist der Berliner schwer beleidigt und zeigt plötzlich eine Eigenschaft, die ihm schon in früheren Jahrhunderten attestiert wurde: ein raubeiniges Sensibelchen zu sein.
Was bleibt also übrig, als Berlin mit anderen, unangefochtenen Weltmetropolen zu vergleichen? Und das am besten auf ganz unterschiedlichem Gebiet, anhand ganz unterschiedlicher Daten, Merkmale und Eigenschaften.
Berlin: 891,68 qkm; Moskau: 2520 qkm; Paris: 105,40 qkm; Peking: 16807,8 qkm; Hamburg: 755,22 qkm; Hongkong: 1104 qkm
Einwohnerzahl:Berlin: 3,6 Mio.; Peking: 21,5 Mio.; München: 1,4 Mio.; Budapest: 1,8 Mio.; Sydney: 4,8 Mio.
Einwohnerdichte:Berlin: 3891 pro qkm; Paris: 21258; Hongkong: 6429; New York: 10800; Mexiko-Stadt: 6000; Köln 2600
Anteil Wasser (Prozent der Stadtfläche):Berlin 7; Frankfurt/Main 2,1; Hamburg 8; Venedig 61
Anteil Grün (Prozent der Stadtfläche):Berlin 35; New York 14; Toronto 12,5; München 20; Singapur 3; Dubai 5
Recyclingquote (Prozent):Berlin 40,4; München 43; Hamburg 25,4; Köln 36,7; Leipzig 81,3
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (USD):Berlin: 36000; Hamburg: 50000; Lima: 16500; London 57000; Moskau: 46000; New York: 70000; Zürich: 57000; Peking: 23000
Wirtschaftskraft (Global Cities Index 2015, Rang):Berlin: 17; New York: 1; Paris: 3; Tokio: 4; Amsterdam: 25; Wien: 18; Peking: 9
Studienkosten (internat. Studenten, USD):Berlin 1100; Boston 5500; San Francisco 5000; London 3900; Amsterdam 2200; Madrid 1800; München 1300
Anteil Ausländer (Prozent):Berlin 13,2; Frankfurt/Main 28,7; München 21; Dresden 4,7; Genf 48; Moskau 16; Singapur 40; Luxemburg 64; Warschau 0,6; Budapest 3,3
Mordrate (Morde pro 100000 Einwohner):Berlin: 3,85/131 Morde (2014); Hamburg: 3,8/67 Morde (2014); New York: 3,86/328 Morde (2014); Caracas: 116 (2014); Reykjavik 0 (2012); Kapstadt: 60 (2014)
Touristen (Übernachtungen, 2015):Berlin: 30,3 Mio.; München: 14,0; London 58,8; Kopenhagen 7,5; Dresden: 4,3; Frankfurt/Main 8,7
Hotelbetten:Berlin: 137000; Hamburg: 57000; Singapur: 1226000
Anzahl Messen und Kongresse (2013):Berlin 178; Paris 204; Madrid 182; Brüssel 111; Peking 101; Rom 99; London 166
U-Bahn-Kilometer:Berlin: 146 km; London: 402; Budapest: 38,3; New York 1355; München 103,1; Tokio: 201,1
Radwege (pro qkm):Berlin 1,58; München 3,87; Hamburg 2,25; Leipzig 1; Köln 2,01; Frankfurt/M. 1,01
U-Bahn-Ticket (Tageskarte, Euro):Berlin: 7; München: 6,40; Paris: 11,15; Budapest: 5; Hongkong: 7,40; Chicago: 9
Bierkonsum (Liter/Kopf und Jahr):Berlin: 107; Prag 144; Warschau: 127; München: 107; Kiew: 104
Bierpreis Kneipe (2016, in Euro, 0,33 l):Berlin: 4,90 €; München 4,10; Paris: 8,98; Athen: 8; Hongkong 9,87; Bratislava: 2,49
Sowieso gibt es Berlin ja nicht nur an der Spree, sondern weltweit. Die Technische Universität Berlin zählte mal ganz genau und kam auf insgesamt 118 Berlins – mal Städte, mal Dörfer, mal winzige Kleckernester. Einige davon müssen hier gewürdigt werden:
Berlin, Argentinien: 4500 m über N.N., drei Lehmhütten
Berlinchen, Nordbrandenburg: fast 750 Jahre alt, 288 Einwohner
Berlingo, Breschia, Italien: ca. 2000 Einwohner
Berlintsy, Briceni District, Moldawien





























