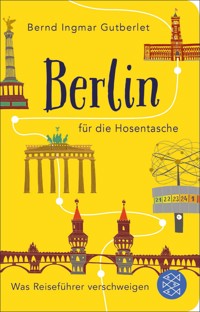Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band seiner Reihe über historische Irrtümer verschiedenster Art wendet sich Bernd Ingmar Gutberlet den Legenden, Lebenslügen und vermeintlichen Helden der Geschichte zu. Denn nicht jede lieb gewonnene Anekdote ist verbürgt, auch wenn wir sie für authentisch halten. Nicht jeder Nationalheld ist so makellos, wie Geschichtslehrer glauben machen. Und so manche verbreitete Ansicht über historische Entwicklungen und Ereignisse entpuppt sich als kollektive Lebenslüge, die der Tagespolitik dienen mag, aber falsch ist. Historische Irrtümer können sehr hartnäckig sein, oft gehören sie zur nationalen Folklore oder sind ein wichtiger Teil der kollektiven Selbstwahrnehmung. Mal wurden vermeintliche Helden über die Jahrhunderte immer weiter idealisiert, mal wurde Historisches aus politischen Gründen verfälscht. Die Geschichte ist sehr viel mehr Teil unserer Gegenwart, als wir gemeinhin annehmen. Ihre Legenden zu entlarven, unsere Lebenslügen zu enttarnen und vergötterte Helden zu stürzen ist unterhaltsam und lehrreich zugleich. Die Beschäftigung damit macht wachsamer in einer Zeit, in der Geschichte für politische Zwecke verfälscht und missbraucht wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERND INGMARGUTBERLET
»Der Staat bin ich!«
Legenden, Lebenslügenundgestürzte Helden der Geschichte
Inhalt
Wo die Vergangenheit irrlichtert
Legenden
Unermesslich reich an Abbildern
Kräftemessen auf Schlachtfeld und Sportplatz
Orientalisch ausgeschmückt
Showdown vorm Burgtor
Genagelt – verschickt – umstritten
Das unvollendete Weltwunder
Säckeweise schwarzes Gold
Der Satz der Sonne
Anekdotisch überhöht
Die verhasste Festung
Das Märchen vom Kini
Nordamerika und seine Deutschen
Ehrgeiz und Eisberg
Respekt per Verbrechen
Die kleine Dilettantenspionin
Zarentochter aus dem Pommerschen
Tanz auf dem Vulkan
Wo sie abgeblieben sind
Lebenslügen
Stammbaum der Demokraten
Demos und Despot
Nullpunkt der Geschichte
Ritterlich auf den Vorteil bedacht
Noch einmal davongekommen
Gott blies und zerstreute
Von Puritanern und Sklaven
Parlament mit Heiligenschein
»Umsiedlung« mit Todesfolge
Nichts gewusst, nichts getan, beste Absichten
Phönix aus der Asche
Die bessere Hälfte
Das Volk steht auf
Wo ich bin, ist vorn
Gestürzte Helden
Strumpfbehost heldenhaft
Roadmovie des Mittelalters
Nationalhelden unter der Lupe
Der Westen im Osten
Ökologische Ahnenforschung
Literatur
Der Autor
Wo die Vergangenheit irrlichtert
Sehr viel mehr, als wir gemeinhin denken, begleitet die Geschichte unsere Gegenwart. Ob Straßenschilder, TV-Serien oder in Redewendungen – die Vergangenheit ist im Alltag stets präsent. Meist gehen wir wie selbstverständlich mit historischen Figuren, mit fernen Ereignissen und jahrhundertealten Entwicklungen um, weil wir zu wissen glauben, wie es einstmals gewesen ist. Doch in unserem historischen Gedächtnis tummeln sich zahlreiche Irrtümer. Mal sind sie harmlos, weil es sich um liebenswerte Legenden oder Histörchen ohne größere Bedeutung handelt. Sie können aber auch folgenreicher sein, wenn sich beispielsweise ganze Gesellschaften auf vermeintlich Gesichertes stützen, das sich als Lebenslüge entpuppt. Dann führen sie uns noch in der Gegenwart in die Irre, weil wir von falschen historischen Voraussetzungen ausgehen.
Historische Irrtümer können sehr hartnäckig sein. Wenn sie zur nationalen Folklore gehören, sind sie wichtiger Teil der kollektiven Selbstwahrnehmung. Wurden vermeintliche Helden über die Jahrhunderte immer weiter idealisiert, verleiht ihnen die beständige Wiederholung unbewiesener Geschichten einen trügerischen Wahrheitscharakter. Oder Historisches wird aus politischen oder strategischen Gründen verfälscht und geht nach und nach ins kollektive Gedächtnis ein. Dann wieder lernen Schüler, was Historiker längst als falsch entlarvt haben – doch die neuen Erkenntnisse schaffen es nicht in die Schulbücher, nicht in die Medien, nicht ins Allgemeinwissen.
Dieser zweite Band der Reihe über historische Irrtümer verschiedenster Art beschäftigt sich mit den Legenden, Lebenslügen und vermeintlichen Helden der Geschichte. Denn nicht jede lieb gewonnene Anekdote ist verbürgt, auch wenn wir sie für authentisch halten. Nicht jeder Nationalheld ist so makellos, wie Geschichtslehrer glauben machen. Und so manche verbreitete Ansicht über historische Entwicklungen und Ereignisse entpuppt sich als kollektive Lebenslüge, die der Tagespolitik dienen mag, aber unhistorisch ist.
Die Legenden der Geschichte zu entlarven, unsere Lebenslügen zu enttarnen und vergötterte Helden zu stürzen ist nicht nur unterhaltsam, sondern ebenso lehrreich. Die Beschäftigung damit macht wachsamer in einer Zeit, in der Geschichte für politische Zwecke verfälscht und missbraucht wird. Gleichzeitig erweist sich, wie überaus lebendig und kurzweilig die Vergangenheit ist, denn immer wieder gibt es neue Erkenntnisse und immer wieder muss vermeintlich Wahres revidiert werden.
Legenden
Unermesslich reich an Abbildern
Reich wie Krösus – das ist noch heute ein sprichwörtlicher Ausdruck für Geld im Überfluss, für sagenhaften Reichtum. Zweieinhalb Jahrtausende nach dem Leben und Wirken des Mannes, auf den der Vergleich zurückgeht, weiß noch immer jeder, was damit gemeint ist, denn in vielen Sprachen hat es der antike König ins Vokabular geschafft. Aber schon bei der Zuordnung des Namens hapert es, denn mehr als das Etikett, der reichste Mann seiner Zeit gewesen zu sein, ist selten bekannt. Und war Kroisos, der lydische König des 6. vorchristlichen Jahrhunderts, wirklich reicher als alle anderen?
Die historische Landschaft Lydien liegt in Kleinasien am östlichen Mittelmeer, im Westen der heutigen Türkei. Während der kurzen Zeit seiner größten Ausdehnung reichte das lydische Imperium von der Ägäis bis an die Westgrenze des Perserreiches (östlich von Ankara), von Marmara- und Schwarzem Meer im Norden bis zur Mittelmeerküste im Süden beim heutigen Antalya. Vermutlich war die Entwicklung ähnlich der in Griechenland: Kleinere Herrschaftszentren bildeten sich heraus, aus denen die Siedlung Sardes (östlich des heutigen Izmir) hervorstach und eine Vormachtstellung in Lydien errang. Mit dem lydischen König Gyges im 7. Jahrhundert v. Chr. gehen vage Geschichten und Legenden ins Handfestere, weil Nachweisbare über. Gyges errang den Thron mit gewaltsamen Methoden, deren genauere Natur nicht ganz klar ist, und regierte mehrere Jahrzehnte lang. Er begründete die dritte und letzte lydische Herrscherdynastie der Mermnaden, die ihr Land zwischen der griechischen Welt im Westen sowie Assyrern und Persern im Osten zu positionieren suchten. Zahlreiche Erwähnungen der Geschichtsquellen umliegender Regionen belegen, wie die Mermnaden durch diplomatische und militärische Aktionen von sich reden machten.
Seine Blüte erlebte das Königreich Lydien unter König Alyattes II. (ca. 610–560 v. Chr.) und seinem Sohn Kroisos (ca. 560–541 v. Chr.), die sich als Herren über das westliche Kleinasien durchsetzten. Verbunden damit war eine Ausdehnung des Reiches, das nun ungefähr sechsmal größer war als Attika, das Herrschaftsgebiet des Stadtstaates Athen. Sardes scheint in dieser Zeit einen Zustrom von Menschen erlebt zu haben, die Hauptstadt wurde befestigt, der internationale Handel florierte wie nie zuvor. Lydien profitierte dabei nicht zuletzt von seiner günstigen Lage an wichtigen Handelsrouten und vom natürlichen Goldreichtum des Landes. Berühmt und bei gegnerischen Heeren ungeheuer gefürchtet war die lydische Kavallerie. Auch die Kunst erlebte einen Aufschwung, aus ihr spricht der rege kulturelle Austausch eines kosmopolitischen Reiches mit Griechenland, Ägypten oder den Assyrern. Insbesondere bei den Griechen waren die Lyder für Musik und Tanz beliebt und geschätzt. Ihre große Zeit endete jedoch bereits mit Kroisos, der wie so viele erfolgsverwöhnte Eroberer der Weltgeschichte den Bogen überspannte und an seinem Übermut kläglich scheiterte. Zunächst gelang ihm jedoch, was seine Vorgänger mit Ausnahme seines Vaters Alyattes nicht vermocht hatten: Er zwang die griechischen Städte der kleinasiatischen Mittelmeerküste dauerhaft zu Tributzahlungen.
Dass Kroisos es aber bis ins 21. Jahrhundert zum Status des sprichwörtlich reichsten Mannes überhaupt gebracht hat, verdient jedoch genauere Betrachtung. Wie andere antike Herrscher war der Lyder durchaus sehr reich, zumal er davon profitierte, dass sein Land viel Gold aus Flüssen (vor allem aus dem Paktolos, heute Sart Çayı) und in Bergwerken förderte. Auch die Siege über die kleinasiatischen Griechenstädte und die daraus erwachsenden Tributzahlungen und Steuerleistungen sowie erfolgreiche Feldzüge nach Osten zur Ausdehnung des Reiches bis zur Grenze des Perserreiches am Fluss Halys (heute Kızılırmak) vermehrten sein Einkommen. Der Vater der Geschichtsschreibung Herodot berichtet in seinen in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. verfassten Historien von einem Besuch des Atheners Solon am Hofe des Kroisos, der sich wegen seines Reichtums für den glücklichsten aller Menschen hielt. Doch Solon, einer der sieben Weisen Griechenlands, fuhr dem stolzen König mächtig in die Parade, als er ihm auf die Frage, wieso er ihm darin nicht zustimme, antwortete: »Ich sehe wohl, dass du sehr reich und ein großer König bist. Deine Frage aber kann ich nicht beantworten, bevor ich nicht weiß, ob dein Leben bis zu Ende glücklich gewesen ist. Der Reichste ist nicht glücklicher als der Arme, der nichts hat als sein tägliches Brot, wenn es ihm nicht vergönnt ist, seinen Reichtum bis an sein Lebensende zu genießen. […] Vor seinem Ende aber dürfte man nie sagen, dass einer glücklich wäre, sondern höchstens, dass es ihm gut ginge.«
Dass es aber gleichwohl Kroisos war, der es als Inbegriff von Reichtum bis in den modernen Sprachgebrauch schaffte, hat nach aller Wahrscheinlichkeit einen ganz anderen Grund: Lydien führte als erstes Land das Münzgeld ein, also geprägte Geldstücke, die wegen ihrer Gold-Silber-Legierung nach dem griechischen Wort für Bernstein auch Elektronmünzen genannt werden. Und schon mit ihrem Namen »Kroiseiden« verweisen sie auf den berühmten König. Lydische Münzen verbreiteten sich durch den Handel weit in der antiken Welt, sie waren als verlässliches Zahlungsmittel geschätzt. Auf ihnen prangte neben Stier und Löwe das Siegel des Kroisos. Seine Münzen trugen also die Kunde vom lydischen Reichtum in die Welt und machten den vermeintlich unermesslich reichen König sprichwörtlich. Der reichste Mann seiner Zeit aber ist Kroisos nicht gewesen, und sowieso war er gemessen am Reichtum anderer Herrscherkollegen ein vergleichsweise kleiner Fisch. Besonders die persischen Könige, die über ein ungleich größeres Reich geboten und auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen konnten, übertrafen ihn um ein Vielfaches.
Übrigens erwies sich auch, dass sein Leben trotz der erfolgreichen Jahre alles andere als glücklich ausging: Als habe sich Solons doch eher philosophische Mahnung in bare Münze verwandelt, verlor Kroisos nicht nur durch einen schicksalhaften Vorfall seinen Sohn Atys, obwohl ihm das im Traum geweissagt worden war und er alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen zu seinem Schutz ergriffen hatte. Auch seinen politischen Untergang und das Ende seines Reiches musste er erleben, denn unglücklicherweise legte er es darauf an, das mächtige Perserreich niederzuzwingen. Ob ihn allein Eroberungsdrang dazu bewog oder familiäre Bindungen zum benachbarten medischen König, der sein Schwager war und gegen den Perserkönig Kyros II. eine Niederlage erlitten hatte, ist nicht ganz klar. Wie auch immer: Bevor er das Wagnis einging, befragte er immerhin diverse Orakel der Mittelmeerwelt nach seinen Erfolgsaussichten. Zwei ähnlich lautende Weissagungen, nämlich wenn er den Grenzfluss Halys überschreite, werde er ein großes Reich zerstören, legte er in seinem Sinne aus. Die Weissagung sollte sich bewahrheiten, aber Kroisos versetzte nicht etwa dem Persischen Reich den Todesstoß, sondern seinem eigenen. Nicht einmal seine bewährten Reitertruppen kamen richtig zum Einsatz, denn Kyros ließ seinen Soldaten Kamele vorausreiten, die die lydischen Pferde in Panik versetzten. Mitte der 540er-Jahre v. Chr. ging die Hauptstadt Sardes unter – der lydische König war nach Vorstößen nach Persien für den Winter dorthin zurückgekehrt und hatte seine Söldner zum größten Teil entlassen. Kyros aber stellte ihm nach, bezwang mühelos die dezimierten lydischen Streitkräfte und obsiegte. Ob Kroisos die vernichtende Niederlage überlebte, ist nicht ganz klar. Die einen schreiben, er sei vom siegreichen Perserkönig hingerichtet worden, die anderen berichten von einer Begnadigung. So oder so: Das Glück hatte Kroisos ebenso verlassen, wie er seines Reichtums verlustig gegangen war.
Kräftemessen auf Schlachtfeld und Sportplatz
Unter der Herrschaft der Perser erlebte Lydien trotz der Abhängigkeit von der Dynastie der Achämeniden zunächst ruhige und gute Zeiten, wenn auch Unabhängigkeit und Einfluss verloren waren. Dann aber wirkte sich das epochale Kräftemessen zwischen Griechen und Persern seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. auf Lydien massiv aus. Zwischen den Machtblöcken eingeklemmt, erlitt man, als die friedlichen Zeiten vorbei waren, das Schicksal einer Pufferzone im Fokus von unterschiedlichen Interessen und kriegerischer Machtpolitik.
Große Wendepunkte der Menschheitsgeschichte bieten den Anlass zu fragen, wie es der Welt wohl ergangen wäre, wäre ein zentrales Ereignis anders ausgegangen. Zu solchen Schicksalsereignissen gehören naturgemäß solche, in denen eine Bedrohung endgültig abgewehrt werden konnte, etwa durch das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg, durch den napoleonischen Expansionsdrang zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder durch die Türken Ende des 17. Jahrhunderts – oder eben viel früher das Perserreich, das im 5. vorchristlichen Jahrhundert versuchte, die griechische Welt im östlichen Mittelmeerraum zu unterwerfen. Weil der klassische Gegensatz zwischen dem Wir und den Anderen die eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit prägt, fließt er mit ein in die konjunktivische Einschätzung – über die Jahrhunderte wurde die Abwehr der persischen Invasoren als grundlegend für die weitere Entwicklung betrachtet, bis hin zur Errettung der westlichen Zivilisation, die ansonsten der »persischen Despotie« zum Opfer gefallen wäre. Abgesehen davon, dass den Griechen vermutlich der sich anschließende verheerende Bürgerkrieg erspart geblieben wäre, ist aber keineswegs zwingend, dass »der Westen« aufgehört hätte zu existieren, ehe sein Siegeszug so richtig Schwung hätte aufnehmen können. Die berühmtesten Kernereignisse der Perserkriege sind zwei griechische Triumphe über die Invasoren: Die Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. und die Seeschlacht vor der Insel Salamis bei Athen zehn Jahre darauf. Diese Siege über die Perser gingen nach der Neugründung Griechenlands 1830 (bis dahin war es Teil des Osmanischen Reiches) in den Bestand der Nationalmythen des Mittelmeerstaates ein.
Das riesige Herrschaftsgebiet der Perser, einer der am weitesten entwickelten Kulturen der Alten Welt, bildete das bis dahin größte Reich überhaupt. Es reichte von Ägypten bis Indien, vom südlichen Russland bis zum Indischen Ozean. Im östlichen Mittelmeerraum waren die griechischen Städte an der Küste Kleinasiens und die vorgelagerten Inseln zu Vasallen der Perserkönige geworden. Das stellte nicht unbedingt einen Nachteil dar, denn die unterworfenen Völker genossen weitgehende Freiheiten, kulturell und religiös, und ihre Fürsten besaßen einige Entscheidungsfreiheit. Auch profitierten sie von der bemerkenswerten Infrastruktur des Großreiches, das beispielsweise als Erstes überhaupt ein Postwesen einführte. Gleichwohl beschworen griechische Autoren einen Gegensatz von griechischer Freiheit und persischem Despotismus, dies war ideologischer Bestandteil der Auseinandersetzung und hält sich wirkmächtig bis heute. Doch mehr als um Freiheit ging es um Vorherrschaft.
Als der Herrscher der griechischen Stadt Milet (im heute türkischen Kleinasien, südlich von Izmir) sich von den Persern lossagte, begann damit 500 v. Chr. der Ionische Aufstand, den die Athener unterstützten. Zunächst erfolgreich, mussten sich die aufständischen Städte schließlich doch den Persern geschlagen geben; die Kulturmetropole Milet wurde als Aufrührerin 494 v. Chr. völlig zerstört. In einer Vergeltungsaktion schickte sich der persische König Dareios I. an, die Herrschaftsverhältnisse im östlichen Mittelmeerraum ein für alle Mal zu persischen Gunsten zu klären. 490 v. Chr. zog ein Heer bis nach Attika, konnte aber bei Marathon geschlagen werden – überraschend für alle Seiten, zumal die stärkste Militärmacht Griechenlands, Sparta, an der Schlacht gar nicht beteiligt war. Die Spartaner trafen nämlich zu spät ein – wegen des Vollmondes, bei dem sie nicht ins Feld ziehen durften.
Marathon liegt nordöstlich der griechischen Hauptstadt, und hier sah sich im Jahr 490 v. Chr. die Republik Athen unter Miltiades einer Übermacht der Perser gegenüber. Die 10 000 Soldaten der Athener wurden von einer Tausendschaft befreundeter Platäer unterstützt. Gegen alle Wahrscheinlichkeit siegten die Griechen, was ihr Selbstbewusstsein stärkte und ihren Willen, sich weiter gegen die mächtigen Perser zu behaupten. Noch heute kann man in Marathon den Grabhügel für die 192 gefallenen Soldaten der Athener sehen. Marathon besitzt aber auch eine Gedenkstätte für den berühmten Marathonlauf, an der bei den Olympischen Spielen 2004 die Läufer zum Wettkampf antraten.
Als nämlich der Sieg der Athener gesichert war, soll ein Bote namens Pheidippides (bei anderen Autoren Thersippos oder Eukles) in voller Rüstung mitsamt Speer und in Sandalen die gut 42 Kilometer nach Athen gerannt sein, um auf dem Marktplatz den Landsleuten die frohe Kunde zu überbringen. Dort rief er nach der Erzählung des Geschichtsschreibers Plutarch aus: »Freut euch, wir haben gesiegt!«, brach gleich darauf jedoch vor Erschöpfung tot zusammen.
Aus dieser Legende ging die moderne olympische Disziplin des Marathonlaufes hervor, die seit den ersten Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, ausgetragen wird: Ein Langstreckenlauf von zunächst 40 Kilometern, was der Distanz zwischen Marathon und dem Zentrum von Athen entspricht. Die heutige Wettkampflänge von 42,195 km wurde erst 1924 festgelegt. Seither laufen die Leichtathleten eine Strecke, die der Entfernung zwischen Windsor Castle und dem White-City-Stadion entspricht und auf die Spiele in London 1908 zurückgeht. Den ersten olympischen Marathonlauf 1896 gewann ein griechischer Schafhirte namens Spyridon Louis in knapp drei Stunden, ganz überraschend als Außenseiter der 25 Teilnehmer. Er wurde prompt als Volksheld gefeiert. Da tat es wenig zur Sache, dass der Mann im Team der Vereinigten Staaten angetreten war, weil die griechische Sportwelt ihn nicht ernst genommen hatte. Nationalheld ist Spyridon Louis in Griechenland bis heute, und das Athener Olympiastadion der Spiele von 2004 wurde auf seinen Namen getauft.
Der Schafhirte war aber nicht nur der Sieger des ersten olympischen, sondern des ersten Marathonlaufes überhaupt, denn die Legende vom Boten nach der Schlacht besitzt keine historische Grundlage, da sind sich die Fachleute ziemlich einig. Mehrere Umstände lassen die Geschichte höchst unwahrscheinlich erscheinen: Zum einen gibt es einen Hauptinformanten über die Schlacht, nämlich den berühmten Geschichtsschreiber Herodot. Der aber erwähnt den Boten der Siegesnachricht mit keinem Wort. Das ist ausgesprochen verdächtig, denn sein Bericht verklärt die Großtat der Griechen gegen die übermächtigen Perser, wo es nur geht – da hätte er sich den Verweis auf den tapferen Soldaten, der sein Leben opfert, um die Nachricht vom Sieg nach Athen zu bringen, ganz bestimmt nicht entgehen lassen. Viel später erst haben Autoren den Marathonläufer in ihre Schlachtbeschreibung eingebaut, nachgewiesen zuerst im 2. Jahrhundert n. Chr., also mehr als ein halbes Jahrtausend später. Der Geschichtsschreiber Plutarch immerhin verweist in seinem Bericht auf eine sehr viel ältere Schilderung, die aber nicht überliefert ist. Des Weiteren ist die Geschichte vom Schlachtboten, der gerade noch seine Nachricht übermitteln kann und dann tot zusammenbricht, ein häufig bemühter Topos im antiken Griechenland. Und schließlich wäre da noch ein eher banaler, aber deshalb nicht weniger überzeugender Umstand: Es gab gar keine Notwendigkeit, einen Boten zu Fuß nach Athen zu schicken. Zur damaligen Zeit hatten die Griechen längst die Übermittlung von Nachrichten per Signalgebung eingeführt. Und so dürften sie ihre Mitbürger auch sehr viel schneller und ohne den Tod eines weiteren Soldaten über den Sieg informiert haben.
Nach der Schmach des Jahres 490 zog sich Persien zunächst aus Griechenland zurück, rüstete jedoch sogleich wieder auf. Aber erst als 486 v. Chr. Dareios I. gestorben und sein Sohn Xerxes I. König geworden war, wurde ein abermaliger Griechenlandfeldzug in Angriff genommen. Xerxes hatte nichts weniger im Sinn, als das gesamte Griechenland seinem riesigen Reich einzuverleiben, und ging die Sache planvoll und methodisch an. Zum Beispiel ließ er eigens für den Truppentransport auf der Halbinsel Chalkidike einen Kanal bauen. Im Sommer 480 v. Chr. überschritt sein Heer auf Pontonbrücken die Dardanellen, die damals Hellespont hießen; seine Flotte folgte entlang der ägäischen Nordküste. Bei den Thermopylen nördlich von Delphi siegte Anfang August in mehrtägiger Schlacht das persische Heer, die gleichzeitige Seeschlacht am Kap Artemision an der Nordwestküste Euböas ging unentschieden aus. Die griechische Flotte entging ihrem Untergang gerade so.
Jetzt stand die Sache Spitz auf Knopf. Mehr als zwei Dutzend griechische Stadtstaaten inklusive der Militärmacht Sparta taten sich zusammen, um den Entscheidungskampf zu bestreiten. Bei aller Entschlossenheit dürfte so mancher es mit der Angst zu tun bekommen haben, denn die Truppen des Xerxes schienen den alliierten griechischen Streitkräften um ein Vielfaches überlegen. Das Perserreich befand sich auf der Höhe seiner Macht; alle Verbündeten, darunter die weiterhin botmäßigen der unterworfenen kleinasiatischen Griechenstädte, steuerten Kontingente bei: Außer Persern dienten in Heer und Flotte Phönikier, Ionier, Karer, Kaspier, Äthiopier, Inder, Araber, Meder und viele andere mehr. Auch die befragten Orakel vermochten keine rechte Zuversicht bei den griechischen Alliierten aufkommen zu lassen – den Athenern riet ein Spruch, ans Ende der Welt zu fliehen.
Das alles verhieß nichts Gutes. Unvermeidlich, dass der nun folgende Schicksalskampf vielfachen Niederschlag bei griechischen Historikern und Dramatikern fand – und die Legende hervorbrachte, die Griechen hätten über eine eigentlich unüberwindbare persische Übermacht gesiegt. Damit wurde aus einem als epochal verstandenen Ereignis ein besonders heroisches, errungen gegen alle Wahrscheinlichkeit. Nach antiker Darstellung lag der persische Sieg eigentlich auf der Hand, denn sensationelle 1,7 Millionen Soldaten umfasste das Heer des Xerxes, berichtet Herodot. Um die unüberschaubare Menge, die Xerxes an dem Fluss Strymon (heute Strymonas bzw. Struma) östlich der Chalkidike einer Musterung unterzog, überhaupt zählen zu können, drängte man zehntausend Mann eng zusammen, markierte den Raum und berechnete die Gesamtzahl, indem man nach und nach alle Soldaten hindurchschickte. Dazu kamen außerdem 80 000 Reiter und weitere 20 000 Soldaten mit Kamelen bzw. Streitwagen. Eine gigantische Zahl, die spätere Schreiber auf 700 000 oder 800 000 Mann korrigierten. Selbst diese Zahl ist enorm.
Wegen der persischen Bedrohung war Athen spätestens Anfang September evakuiert worden. Ende des Monats befand sich die Akropolis in feindlicher Hand, wurde geplündert und in Brand gesetzt. Der Kriegsrat der Griechen sprach sich für eine Seeschlacht in der Meerenge von Korinth aus, änderte dann aber auf Betreiben des Themistokles die Pläne und beließ die Kriegsflotte in Salamis. Die felsige, karge Insel liegt westlich vor Athen, getrennt vom Festland nur durch einen schmalen Streifen Wasser, keine zwei Kilometer breit, und in diesen Verhältnissen und durch umsichtiges Handeln vermochten die Griechen die persische Übermacht zu besiegen. Als schlachtentscheidend wird allerdings die Tatsache angesehen, dass die Griechen um ihre Freiheit und gegen Versklavung kämpften, dass also der wichtigste Vorteil ein psychologischer war. Wie auch immer, den Perserkönig, der auf einem eigens gebauten Thron auf dem Berg Egaleo (heute ein Stadtteil Athens) sitzend das Geschehen verfolgte, verließ die anfängliche Euphorie, als sich die Größe seiner Flotte immer mehr als Nachteil erwies. Als die Schlacht für ihn verloren war, zog er gen Norden zu den Dardanellen, ohne sein Ziel aufgegeben zu haben – er verfügte ja noch über seine Streitmacht zu Lande. Aber auch zwei letzte Schlachten – zu Lande 479 v. Chr. am Nordhang des Kithairon-Gebirges bei Platäa, wo die Spartaner und ihr überragender Feldherr Pausanias sich überaus eindrucksvoll bewährten und die Sache entschieden, und zur See bei Mykale vor der Ostküste von Samos – verloren die Perser vernichtend, die Auseinandersetzungen gingen allerdings noch einige Zeit weiter.
Je grandioser der Sieg beschrieben wurde, desto heldenhafter nahm sich der heroische Freiheitskampf aus. Folglich frisierten Herodot und seine Nachfolger die Zahlen der gegnerischen Truppenstärke massiv – zu allen Zeiten beeindrucken Rechenvergleiche mit hohem Gefälle. Damit lassen sich die verschiedenen Niederlagen im Ionischen Aufstand oder in den Perserkriegen selbst mühelos entschuldigen, die Siege aber werden zu übermenschlicher Größe erhöht. Mögen die Griechen auch alle inneren Kräfte mobilisiert haben, weil es um alles oder nichts ging – militärisch waren sie den Persern durchaus einigermaßen gewachsen. Ganz abgesehen davon, dass die Griechen keine Gelegenheit hatten, die feindliche Truppenstärke durch Nachzählen zu bestimmen, und Herodot auch keine verlässlichen Gewährsmänner dafür zur Verfügung standen, sind die Zahlen nicht einmal als Schätzungen brauchbar. Nüchterne Forschungen haben ergeben, dass das persische Heer vermutlich 50 000, allenfalls 100 000 Mann umfasste – eine größere Zahl wäre bei üblichem Gefolge mitsamt Tieren auf dem Weg durch Kleinasien und entlang der Nordküste der Ägäis gar nicht zu verpflegen gewesen. Auf dem Weg von der Stadt Sardes in Kleinasien, wo Xerxes seinen Feldzug begann, bis nach Athen auf geschätzten 170 Tagen wären für die Versorgung eines Heeres der behaupteten Größe Getreide, Tierfutter und Trinkwasser in ungeheuren Mengen nötig gewesen, ein Vielfaches dessen, was logistisch möglich war. Auch der Umfang der Flotte muss weitaus kleiner gewesen sein, als die griechischen Schreiber angeben. Herodot spricht von 600 Schiffen, die der Perserkönig vielleicht theoretisch hätte aufbieten können, aber das hätte die Handelsflotte des Perserreiches so sehr beansprucht, dass Handel und Versorgung arg gelitten hätten – ganz abgesehen davon, dass die Zahl der Soldaten und Besatzungen bei Weitem übersteigt, was sich beim zu vermutenden Umfang der damaligen Bevölkerung hätte rekrutieren lassen, selbst wenn man auswärtige Söldner einberechnet. Die Forschung geht daher mehrheitlich davon aus, dass die Truppen der Perser den Griechen an Zahl zwar überlegen waren, aber in einem Maß, das den griechischen Sieg bemerkenswert, aber eben nicht übermenschlich machte.
Die Geschichte der Kriege schreiben die Sieger, und die griechischen Geschichtsschreiber machten ihre Sache, politisch gesehen, vortrefflich. In diesem Fall aber fehlt noch eine persische Version des Geschehens als Gegendarstellung. Das griechische Bild der Perserkriege aber, vom demokratischen Kampf gegen Tyrannei, in dem der Freiheitsdrang eines Kulturvolkes gegen eine dekadente Despotie aufbegehrt und obsiegt, herrscht in der westlichen Welt bis heute vor. Vor allem die Schlachten von Marathon und Salamis wurden, bei aller welthistorischen Bedeutung, mythisch überhöht, die Sieger vergöttlicht und die Gräber ihrer Gefallenen zu Altären erklärt. Platon bezeichnete die Helden von Marathon als »Väter der Freiheit, unserer und insgesamt aller auf diesem Festland«, und Plutarch geht sehr viel später so weit, die errungene Freiheit sei von den Griechen an die gesamte Menschheit weitergegeben worden. Überall in Griechenland erinnerten Denkmäler und Trophäen, Gedenktage und Feste an die ruhmreichen Siege, landauf, landab war ein Kriterium in der Einschätzung von Landsleuten, wie es ihre jeweilige Polis wohl mit den Persern gehalten habe: standhaft oder korrumpiert? Vielleicht auch, um diese gespaltene Vergangenheit zu überdecken, definierten sich die Griechen seither als einig Gegenbild zu den Persern, die nunmehr als die Barbaren schlechthin galten – was aber nicht verhinderte, dass wenige Generationen nach den Perserkriegen das Orientalisch-Persische zur Modeerscheinung wurde. Der vereinte Kraftakt wurde politisch instrumentalisiert, als im Peloponnesischen Krieg Griechenland einen schrecklichen Bürgerkrieg erlebte, um im Kampf gegen ausländische Invasoren auf die nunmehr verlorene Einheit von Hellas einzuschwören.
Diese vereinfachende Sichtweise übernahmen Alexander der Große, als er das Perserreich erklärtermaßen als Revanche für die Kriege des frühen 5. Jahrhunderts niederrang, und später die Römer, die sich ohnehin als Erben der Griechen und Makedonier verstanden – eben auch in der Verteidigung des Westens gegen alles Barbarische. Im 19. und 20. Jahrhundert griffen europäische Historiker diese ideologische Sichtweise auf und verankerten sie im Weltbild des Westens. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel befand 1837 gar: »Denn es sind welthistorische Siege: Sie haben die Bildung und die geistige Macht gerettet und dem asiatischen Prinzipe alle Kraft entzogen.«
Kommen wir noch einmal auf die Olympischen Spiele zurück, das berühmteste Erbe der griechischen Antike. Wenn heute alle vier Jahre irgendwo in der Welt die Spiele stattfinden, kann man mitunter in der Zeitung lesen, welche Länder eigentlich besser nicht teilnehmen sollten oder gar ausgeschlossen wurden – weil sie gerade Krieg führen. Zur Zeit des Kalten Krieges, als sich NATO und Warschauer Pakt argwöhnisch gegenüberstanden, hat es mehrere politisch motivierte Boykotte gegeben, beispielsweise 1980. Damals nahm ein großer Teil der westlichen Länder nicht an den Spielen in Moskau teil, weil die Rote Armee im Jahr zuvor in Afghanistan einmarschiert war. Auch 1936, als das nationalsozialistische Deutschland in Berlin strahlende Spiele feierte und der Welt ebenso gekonnt wie erfolgreich vorgaukelte, ein entspanntes, weltoffenes und liebenswertes Land zu sein, war im Vorfeld vor allem in den Vereinigten Staaten gefordert worden, nicht daran teilzunehmen. Weitere Boykotte gab es 1956, 1972 sowie 1976. Und 1984, als nach der Sowjetunion die USA mit Los Angeles als Gastgeber an der Reihe waren, verpassten die Staaten des Warschauer Paktes unter Federführung des Kreml dem Westen einen Denkzettel, indem sie ihrerseits die Teilnahme aussetzten. Und schließlich 2014: Als der russische Präsident Putin die ukrainische Krim besetzen ließ und annektierte, erschien dieser Bruch des Völkerrechts direkt nach Abschluss der Winterspiele in Sotschi besonders perfide. Zwietracht in der olympischen Familie wird jedes Mal heftig beklagt, denn die Olympischen Spiele der Neuzeit verstehen sich als friedensstiftende Unternehmung. In der Nachfolge der im antiken Olympia abgehaltenen Spiele betrachten sie das als ein ehrenvolles Erbe. Der Begründer der modernen olympischen Bewegung, Pierre de Coubertin, nannte als ein Argument für seine Bemühungen, die Spiele nach mehr als zwei Jahrtausenden wiederzubeleben: »Die Olympischen Spiele feiern heißt, sich auf die Geschichte berufen. Sie ist es, die am besten den Frieden sichern kann.«
Was die Gründung dieses Ideals in Form von sportlicher Betätigung betrifft, greift man weit zurück. Angeblich existierte bereits im 8. vorchristlichen Jahrhundert ein Vertrag, den das Orakel von Delphi verlangt hatte: Danach sollte während der Spiele Olympischer Friede herrschen. Die griechische Antike kannte als Beweisstück sogar einen beschrifteten Diskus, den der berühmte Aristoteles höchstselbst in Augenschein genommen haben soll. Allerdings ist schon nicht klar, wann überhaupt die ersten Olympischen Spiele der Antike ausgetragen wurden, denn die vorliegenden Berichte darüber sind äußerst unzuverlässig.
Der allmähliche Aufstieg Olympias vollzog sich im Laufe des 7. Jahrhunderts: Aus einem unter vielen Heiligtümern wurde eines der wichtigsten Griechenlands mit immer populäreren sportlichen Wettkämpfen in drückender Augusthitze. Um 700 v. Chr. wurden Kult- und Sportstätten erheblich vergrößert, weil die Besucherzahlen immer weiter stiegen. Der erwähnte Vertrag ist zwar nicht mit Sicherheit belegt, aber spätere antike Autoren verweisen auf eine solche Vereinbarung – sie mag also späteren Datums sein, aber sie hat zweifelsfrei existiert und ist seit 476 v. Chr. historisch belegt. Es liegt ja auch auf der Hand: Angesichts chronischer Auseinandersetzungen zwischen den Stadtstaaten der antiken Welt wäre ein einvernehmlicher Wettstreit ihrer Athleten anders überhaupt nicht zu bewerkstelligen gewesen. Schon die Anreise aus allen Ecken Griechenlands nach Olympia hätte für alle Beteiligten größte Probleme bedeutet. Unter den Schutz des Zeus gestellt, wurde das gastgebende Elis zur entmilitarisierten Zone: Niemand durfte es mit Waffen betreten, auch durchziehende Truppen mussten dies unbewaffnet tun. Und um Teilnehmern wie Zuschauern eine gefahrlose An- und Abreise zu gewährleisten, verständigte man sich auf Sicherheiten. Der hehre Gedanke eines »Olympischen Friedens« aber, während dessen Dauer die Welt den Waffen entsagt und ihre Jugend versammelt, auf dass diese sich friedlich im sportlichen Wettkampf messe, hat mit der Wirklichkeit der antiken Spiele wenig zu tun. Das ist den Althistorikern seit Langem bewusst, aber in der Öffentlichkeit herrscht die idealistische Vorstellung bis heute vor, wenn es um die Geschichte des großen Sportereignisses geht.
Aber was hat es nun mit dem Irrtum auf sich? Wie so oft liegt die Erklärung im Detail, in diesem Fall in der Übersetzung. Die griechischen Quellen sprechen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen und ihrem ideellen Rahmen keineswegs von Frieden (griech. eirene), sondern von Waffenruhe (griech. ekecheiria). Wörtlich meint der Begriff das Zurückhalten der Hände. Es ging also nicht darum, einen Friedenszustand herzustellen, bevor an Wettkämpfe zu denken war, sondern um eine Kriegspause, die unter den Schutz des Olympischen Zeus gestellt wurde. Alle vier Jahre wurde in Olympia zum Zwecke der Spiele eine Waffenruhe proklamiert, sodann schwärmten Boten in die griechischen Städte aus, um sie zu verkünden. Die Olympischen Spiele genossen schon in der Antike ein derartiges Prestige, dass jeder Stadtstaat der Aufforderung nachkam und in den folgenden drei bis vier Monaten die Sicherheit aller Sportler, Zuschauer und offiziellen Delegationen gewährleistete, ob sie nun aus Naxos oder Sizilien kamen. Mehr bedeutete dieser Waffenstillstand nicht – also keineswegs, dass überall in der antiken Welt Kämpfe und Konflikte eingestellt oder vertagt worden wären. Da es allein um den Schutz der Spiele und ihrer Teilnehmer ging, konnten in gebührlicher Entfernung durchaus Kriege wüten. Das ist auch nicht wirklich verwunderlich: Zum einen gehörten kriegerische Auseinandersetzungen quasi zum Alltag, zum anderen kämpfte man stets in den Sommermonaten, und da fanden ja auch die Spiele statt.
Allerdings gab es tatsächlich einen Versuch, innergriechische Streitereien künftig prinzipiell friedlich beizulegen. Hintergrund waren besagte Perserkriege des frühen 5. Jahrhunderts, die das griechische Festland fast seine Unabhängigkeit gekostet hätten. Die griechische Zwietracht hätte die vereinte Anstrengung, die zum Sieg über die Perser nötig war, fast vereitelt, und um es nicht noch einmal so weit kommen zu lassen, sondern die Einheit zu bewahren, wollte man in Olympia ein innergriechisches Schiedsgericht etablieren. Diese Praxis währte aber nur sehr kurz, weil die Interessen der verschiedenen griechischen Städte schon bald wieder auseinanderdrifteten. Das Ideal dahinter blieb jedoch präsent – und ist es in anderer Form bis heute.
Das Neutralitätsgebot und die Waffenruhe wurden bis zum Peloponnesischen Krieg (431–404 v. Chr.) bis auf eine Ausnahme eingehalten. In diesem Bürgerkrieg aber wurde es schwierig, wie bisher kriegerische und sportliche Dinge gleichzeitig zu trennen und zu vereinbaren. Im Zuge dieses großen Krieges gab Elis im Nordwesten der Peloponnes, wo die Spiele stattfanden, seine Neutralität auf und schlug sich gegen Sparta auf die Seite Athens. Der ersten Regelverletzung folgte die zweite auf dem Fuße: Sparta rückte in Elis ein. Zu diesem Zeitpunkt war zwar der olympische Waffenstillstand längst ausgesprochen, aber die Spartaner flüchteten sich in das Argument, diese Nachricht sei in Sparta noch gar nicht angekommen. Nach dieser Version wären die olympischen Friedensboten und die spartanischen Truppen zwischen Sparta und Elis aneinander vorbeigelaufen, was eine ziemlich lahme Ausrede war. In den Augen ihrer Feinde hatten die Spartaner allen heiligen Gepflogenheiten krass zuwidergehandelt, weshalb sie, die auch nicht einlenken wollten, von den 90. Olympischen Spielen 420 v. Chr. ausgeschlossen werden sollten. Es war ein ziemliches Geschachere unter allen Beteiligten, auch die Eleer nutzten skrupellos das Prestige der Spiele und des Heiligtums Olympia, um den Spartanern zu schaden. Der Krieg von bislang ungekannten Ausmaßen, der ganz Griechenland in Atem hielt, hatte zu einer schändlichen Missachtung der Olympischen Spiele geführt, die immerhin unter dem Schutz des höchsten Gottes standen. Wenige Jahrzehnte zuvor noch hatte man ein panhellenisches Schiedsgericht in Olympia eingerichtet, nun versagte man dem Heiligtum jeden Respekt. Die Kontrahenten zeigten kein Einsehen, am Ende musste Sparta zähneknirschend auf die Teilnahme an den Spielen verzichten. Als der Krieg mit dem Triumph Spartas und der Niederlage Athens geendet hatte, zogen die Sieger unter König Agis abermals nach Elis und rächten sich für die Schmach: Die Eleer mussten öffentlich bekunden, seinerzeit im Unrecht gewesen zu sein, und den Spartanern für alle Zeiten die Teilnahme an den Spielen zusichern.
Noch einmal wurde das olympische Waffenstillstandsgebot in der Antike spektakulär gebrochen: 364 v. Chr. hielten die Arkadier, Spartas nördliche Nachbarn, Olympia besetzt und rissen die Leitung der Spiele an sich, wogegen sich die Eleer militärisch wehrten. Ausgerechnet die heiligen Spielstätten wurden zum Schauplatz eines blutigen Kampfes – angeblich, während auf den Rängen Zuschauer sportlichen Wettstreit erwarteten. Nach der militärischen Entscheidung wurde um die sportlichen Siege wie gewohnt gerungen, als wäre nichts geschehen. Diese 104. Olympischen Spiele wurden erst im Nachhinein für ungültig erklärt, als selbst den siegreichen Besatzern Olympias mulmig geworden war und sie mit Recht um ihr Ansehen fürchteten. Und doch erweist sich daran, dass die Griechen es mit der Unantastbarkeit eines Olympischen Friedens oder Waffenstillstands nicht allzu ernst nahmen, wenn Pragmatismus oder Eigennutz im Spiel waren. Insofern unterscheidet sich die Antike von der Moderne gar nicht so sehr.
Aber auch wenn die Vorstellung, die Völker der Welt sollten wenigstens für die Zeit der Spiele in Frieden miteinander leben, nicht den antiken Rückhalt besitzt, der bis heute gern unterstellt wird, ist das Ideal des Olympischen Friedens natürlich kein bisschen weniger wertvoll. Es ist aber auch gar nicht unbedingt notwendig, sich deswegen auf die antiken Vorläufer unserer Spiele berufen zu können, denn der Friede ist stets erstrebenswert und ein Wert an sich. Der olympische Gedanke der Neuzeit tut also gut daran, sich dieses moderne Ideal zu bewahren und es anzustreben.
Orientalisch ausgeschmückt
Dass es im Märchen nicht um die akkurate Darstellung von Geschichte geht, weiß eigentlich jedes Kind. Das hindert uns jedoch nicht daran, in manchem Fall die märchenhafte Darstellung einer historischen Persönlichkeit in unser Geschichtsbild zu übernehmen – durchaus ähnlich der Wirkmächtigkeit ihrer Darstellung im Film, man denke nur an den unvergesslichen Peter Ustinov als Kaiser Nero in Quo vadis? oder Daniel Day-Lewis als Abraham Lincoln. So geht es auch mit dem berühmten Kalifen Harun ar-Raschid, der uns vor allem als märchenhafte Gestalt aus Tausendundeine Nacht geläufig ist, aber tatsächlich gelebt hat. Allerdings haben die beiden Figuren, historisch und literarisch, nicht allzu viel miteinander gemein. Und obwohl die westliche Welt Harun ar-Raschid, Kalif von Bagdad, als Vertreter eines goldenen Zeitalters kennt, er der bekannteste Vertreter seiner Dynastie ist und den Beinamen »der Rechtgeleitete« erhielt, wird er in der islamischen Welt bedeutend weniger geschätzt. Aus gutem Grund.
Während heute mancher Muslim aus dem Orient den Lockungen des Westens verfällt – oder sie im Gegenteil als verwerflich verteufelt –, war es in früheren Jahrhunderten der Orient, der die Fantasie der Menschen im Abendland beschäftigte. Alles Morgenländische schien märchenhaft: die fremde Religion des Islam, die prächtigen Höfe der Sultane, die exotischen Speisen und verwunschenen Basare, die Kleidung und die so ganz anderen Sitten. Gekonnt ausgeschmückte Reiseberichte und andere literarische Zeugnisse waren es, die dem Abendland die Kultur des Orients vermittelten. Der französische Schriftsteller Paul Valéry nannte jenes Orientbild, das auf Hörensagen, Träumerei und literarischer Fantasie beruht, »l’orient de l’esprit«. Und nichts hat in Dauer und Breitenwirkung mehr Einfluss entwickelt als die berühmte Märchensammlung Tausendundeine Nacht.
Bei diesen Märchen handelt es sich um eine umfängliche Erzählsammlung, in die Geschichten aus verschiedenen östlichen Kulturräumen Eingang fanden: Persische, indische, ägyptische und arabische Erzähltraditionen kommen zusammen, um nur einige zu nennen. Die heute in der westlichen Welt geläufige Version wurde vermutlich im 16. oder 17. Jahrhundert in Ägypten zusammengestellt. Die erste französische Ausgabe von Tausendundeine Nacht vom Anfang des 18. Jahrhunderts spielte bei der Verbreitung in Europa eine Schlüsselrolle, rasch gefolgt von Ausgaben in anderen europäischen Sprachen und einer ganzen Welle davon inspirierter orientalischer Romane. Knapp 200 Jahre später schrieb der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal in der Einleitung zu einer Ausgabe von Tausendundeine Nacht: »Hier ist Buntheit und Tiefsinn, Überschwang der Phantasie und schneidende Weltweisheit; hier sind unendliche Begebenheiten, Träume, Weisheitsreden, Schwänke, Unanständigkeiten, Mysterien; hier ist die kühnste Geistigkeit und die vollkommenste Sinnlichkeit in eins verwoben.«
Eine ganze Welt also eröffnen die Erzählungen, aber eben eine märchenhafte. Kalif Harun ar-Raschid taucht in gleich mehreren Märchen der Sammlung auf und gewann mit ihnen eine solche Popularität, dass er in Kunst und Literatur seit dem 18. Jahrhundert zur festen Größe wurde. Er gilt in der westlichen Welt bis heute als gerechter Herrscher, großzügig und gewitzt – und natürlich bei prachtvoller Hofhaltung all den Glanz und die Exotik verkörpernd, die das Orientbild verlangt. Berühmt sind seine angeblichen Inkognito-Gänge durch Bagdad, von denen er sich bei »beklommener Brust« Abhilfe versprach. Auf ihnen spürte er, als Kaufmann verkleidet, neugierig, aber fürsorglich seinem Volk hinterher, stellte die eigene Bodenständigkeit unter Beweis und ließ sich schon mal von Kinderweisheit zum Nachdenken und Handeln anregen. Eine Anekdote weiß zu berichten, der Kalif habe, als man ihm ein überaus kostbares Gericht nur aus Fischzungen (in ihrer Masse hübsch zur Fischform angerichtet) servierte, eine gleichwertige Summe Geldes an die Armen verteilen lassen. Ein Salomon unter den Feinschmeckern also, aber vor allem eben ein Ausbund an Gerechtigkeitssinn, Weisheit und Tugend.
Zur Zeit Karls des Großen, um das Jahr 800, war Harun ar-Raschid, Kalif von Bagdad, der mächtigste Herrscher der arabischen Welt. Kaiser und Kalif hatten Berührungspunkte, weil beide eine religiös fundierte Reichsidee verkörperten. Während die römische Kirche dabei auf antike Strukturen zurückgreifen konnte, sprengte der islamische Expansionsdrang alles Bisherige: Von der Arabischen Halbinsel bis zum Schwarzen und Kaspischen Meer im Norden, bis zum Indus im Osten, über Ägypten und Nordafrika bis nach Spanien im Westen verlief der Siegeszug der islamischen Eroberer. In der Schlacht bei Tours und Poitiers 732 stießen die beiden Reiche und Weltreligionen schließlich aufeinander, als das Frankenreich dem islamischen Eroberungsdrang zumindest in Europa eine Grenze setzte. Im Unterschied zum Christentum legte der Islam zwar keinen umfassenden Missionseifer, aber dafür einen ausgeprägten Machtdrang an den Tag. Zur persönlichen Begegnung Haruns mit seinem Herrscherkollegen Karl kam es nie, wohl aber zum Austausch von Gesandten, die Berichten zufolge im Jahr 802 dem Kaiser neben einer Masse weiterer kostbarer Präsente ein besonders sensationelles Geschenk überbrachten: einen weißen Elefanten namens Abul Abbas, den ersten seiner Spezies, der nördlich der Alpen auftauchte.
Harun war der fünfte Kalif in der Reihe der Abbasidenherrscher und regierte in Bagdad von 786 bis 809. Schon sein Weg an die Macht entspricht nicht gerade dem Bild des Märchens: Zunächst ließ der 22-Jährige seinem Bruder den Vortritt, übernahm aber schon bald die Herrschaft des Reiches, als der Bruder aus ungeklärten Gründen früh verstarb. Harun wurde mit dem plötzlichen Tod in Verbindung gebracht, seine Mutter stand im Verdacht, für ihren Sohn Gift zur Anwendung gebracht zu haben. Die Abbasiden, die sich auf ihre Abstammung von einem Onkel des Propheten Mohammed berufen konnten, waren Mitte des 8. Jahrhunderts aus innerarabischen Machtkämpfen siegreich hervorgegangen und lösten die ein Jahrhundert währende Herrschaft der Omaijaden ab. Sie führten Verwaltungs- und Steuerrecht sowie ein Justizsystem mit Kadis in allen größeren Städten ein, wodurch sie die Grundlagen für eine islamische Staatlichkeit schufen. Zunehmend entrückt und beim Gewähren von Audienzen hinter einem Vorhang verborgen, ließen die Kalifen das Land von Wesiren regieren. Unter Harun am zunächst einflussreichsten war die afghanischstämmige Adelsfamilie der Barmakiden, denen er viel verdankte. Und doch entledigte sich Harun ihrer Dienste im Jahr 803 mit brutaler Härte, selbst seine eigenen Lehrer und engste Vertraute kamen dabei zu Tode.
Die Herrschaft über das Abbasidenkalifat übernahm Harun zu dessen Glanzzeit, als es von Marokko bis nach Indien reichte. Seine Hauptstadt Bagdad, 762 gegründet und Nachfolgerin von Damaskus, ließ er zu einer prächtigen Residenz ausbauen. Die glanzvolle Metropole war mit bis zu einer Million Einwohnern die damals größte Stadt der Welt. Harun ar-Raschid verbreitete Glanz und Pomp, schuf hingegen nichts von Dauer, denn der Glanz war überschattet von politischer Instabilität und Spannungen. Sein größter militärischer Triumph gelang ihm, bevor er Kalif wurde, als er bis zum Bosporus vorrückte und mit reicher Beute zurückkam. Doch das Erreichte war letztlich vergeblich, denn das Reich war so groß, wie es schwer regierbar war, und innenpolitisch erwies sich Harun als nicht übermäßig erfolgreich. An den vielen Enden des Reiches kam es immer wieder zu Machtkämpfen und Aufständen, gegen die die schwache Zentralgewalt mehrmals einzuschreiten versuchte. Das Problem hatte Harun von seinen Vorgängern geerbt, aber auch er vermochte es nicht zu lösen. Im weitläufigen, schwer zu kontrollierenden Reich agierten die Provinzen zunehmend unabhängig, mal mit, häufiger ohne den Segen des Kalifen. Noch dazu war die Hauptstadt Bagdad beherrscht von Intrigen und Machtkämpfen zwischen Parteiungen, denen jeweils ein Sohn des Kalifen angehörte: Nummer eins und Nummer zwei der Thronfolge. Eine faktische Reichsteilung noch zu Haruns Lebzeiten führte nach seinem plötzlichen Tod während einer Rebellion in Samarkand alsbald zu Bürgerkrieg und Wirtschaftskrisen, zur Verwüstung Bagdads und schließlich zur allmählichen Auflösung des Großreiches der Abbasiden.
Die historische Person des Harun ar-Raschid entspricht also keineswegs dem Bild, das in Tausendundeine Nacht von ihm gezeichnet wird. Er war alles andere als ein weiser und sanfter Herrscher, sondern wie andere Kalifen ein brutaler Despot – und selbst darin nicht so meisterhaft, dass er dem allmählichen Niedergang seines Reiches erfolgreich entgegengewirkt hätte. Er setzte auf Gewalt und Mord als Mittel, um seine Herrschaft auszuüben und zu festigen, nahm es dagegen mit Ehrenwort und Versprechen nicht so genau, wie der edle Fürst aus den Märchen vermuten ließe, die auch sein notorisches Misstrauen und seine Überheblichkeit unerwähnt lassen. Für die Pracht seines Hofes in Bagdad und später in seiner Residenzstadt ar-Raqqa sowie die Förderung von Kunst und Wissenschaft ist er nicht zu Unrecht berühmt – aber der Preis dafür waren Zugeständnisse an die Provinzen, die sich der Kalif mit Tributzahlungen vergüten ließ.
Dass er so prominent in Tausendundeine Nacht auftritt und damit berühmt wurde, hat aber seinen Grund: Harun ar-Raschids Herrschaft steht für eine goldene Zeit, die verloren schien, als die Märchen entstanden: die kulturell glanzvolle Epoche der Abbasiden, der »gesegneten Dynastie«, als die islamische Welt im Kalifen von Bagdad noch den einen, einenden Herrscher besaß, Gott und dem Propheten zur Ehre gereichend. Diese alsbald verklärte Blütezeit endete mit Haruns Tod und den nachfolgenden Machtwirren, die den Abstieg des Abbasidenreiches beschleunigten.