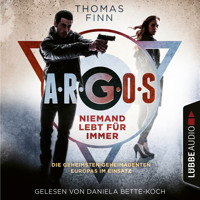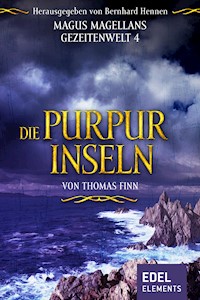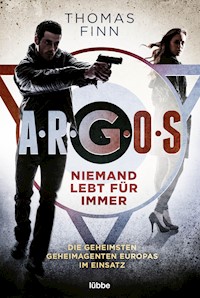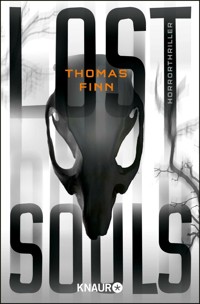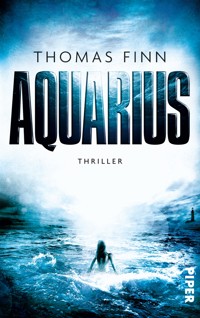12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Gruppe Schiffbrüchiger – eine unheimliche Insel im Bermuda-Dreieck – ein gnadenlos spannender Horror-Thriller! Nur knapp überleben der Biologe und Rucksackreisende Alex Kirchner und die Umweltaktivistin Itzil Pérez den Untergang ihres Kreuzfahrtschiffes, das mitten im Bermuda-Dreieck in einen unheimlichen Hurrikan gerät. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Überlebender werden Alex und Itzil am Strand einer Vulkan-Insel angespült, doch die vermeintliche Rettung erweist sich schnell als tödliche Falle: Auf der Insel funktionieren weder Handys noch Kompasse; das Treibgut, aus dem die Überlebenden sich notdürftig ein Lager am Strand errichten, ist am nächsten Morgen fast vollständig verschwunden, Nahrungsmittel verrotten über Nacht bis zur Unkenntlichkeit. Während Alex eine Bergungsmission zum Wrack des Kreuzfahrtschiffes unternimmt und seinen Augen nicht traut, als er feststellt, dass das Wrack komplett verrostet ist, als läge es seit Dekaden im Wasser, entdeckt Itzil auf der Insel Spuren eines geheimnisvollen indianischen Heiligtums. Kurz darauf stellt die Gruppe fest, dass einer von ihnen fehlt – dafür führen breite Schleifspuren direkt in den Mangrovendschungel … Eine unheimliche Macht dezimiert gnadenlos die Überlebenden eines Schiffsunglücks im Bermuda-Dreieck: Der Horror-Thriller von Thomas Finn wird nicht nur Fans der Mystery-Serie »Lost« begeistern. Der in den USA geborene und mittlerweile in Hamburg lebende Autor hat bereits mit den Horror-Thrillern »Dark Wood« und »Lost Souls« gezeigt, wie man bekannte Mythen und Legenden in Nervenkitzel voll unerwarteter Wendungen verwandelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Finn
BERMUDA
Horrorthriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nur knapp überleben der Biologe Alex Kirchner und die Umweltaktivistin Itzil Pérez ein Schiffsunglück mitten im Bermuda-Dreieck. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Überlebender werden sie am Strand einer Vulkaninsel angespült. Doch die vermeintliche Rettung erweist sich schnell als tödliche Falle: Auf der Insel funktionieren weder Handys noch Kompasse, Nahrungsmittel verrotten über Nacht auf geheimnisvolle Weise, und schon am ersten Morgen ist ein Mitglied der Gruppe unauffindbar – dafür führen breite Schleifspuren direkt in den Mangrovendschungel. Und das ist erst der Anfang …
Inhaltsübersicht
Widmung
Dank
Motti
Anno 1533
Atlantischer Ozean
Der Hurrikan
Gestrandet
Die Insel
Rätsel der Toten
Sand & Knochen
Terra incognita
Nicht allein
Die Visionsschlange
Unsichtbare Grenzen
Zeuge alter Zeiten
chʼį́įdiitah
Rost & Stahl
Die Grotte
Portugiesische Galeeren
Signalfeuer
Hunger
Blanker Zorn
Kontakt
Der Mondregenbogen
Auge in Auge
Der Turm
Grabmal der Götter
Ah Mucen Cab
Alles oder nichts
Sichere Gestade
Für Sophia, Michi und Alex.
Ich vermisse euch.
Mit Dank an:
Tanja, Wiebke, Flow und Kayla für akribisches Testlesen, dramaturgische Hinweise, technische Beratung und Übersetzungen ins Philippinische, als ich selbst im Bermudadreieck zu verschwinden drohte.
»Das Bermuda- oder Teufelsdreieck ist ein imaginäres Gebiet in der Nähe der südöstlichen Atlantikküste der Vereinigten Staaten, das wegen der hohen Zahl ungeklärter Verluste von Schiffen, kleinen Booten und Flugzeugen bekannt ist. Die Eckpunkte des Dreiecks sollen, wie allgemein angenommen wird, die Bermudainseln, Miami in Florida und San Juan in Puerto Rico sein.«
Küstenwache der Vereinigten Staaten, Formularbrief (Akte 5720 des Siebenten Küstenwachendistrikts
»… allwo du einst um Mitternacht mich aufriefst,
Tau zu holen vor den beängstigenden Bermudas …«
Shakespeare, Der Sturm
»Wir hatten mit Gegenströmung zu kämpfen. Zu Beginn dieser Nacht wichen die Kompassnadeln nach Nordwesten ab, morgens zeigten sie mehr nach Nordosten.«
Logbuch des Christoph Kolumbus, 1492, nordöstliches Bermudadreieck
»Gefahr wie ein Dolch … Kommt schnell! … Wir können nicht fliehen …«
Hilferuf des verschollenen japanischen Frachters Raifuku Maru, 1921, nördliches Bermudadreieck
»Die Nadel des Erdanzeigers flatterte hin und her. Das Ziffernblatt des Flüssigkompasses rotierte, ohne innezuhalten. Konnte keine Sterne durch den dichten Dunst erkennen …«
Bordbuch von Charles Lindbergh, Flug der Spirit of St. Louis, 1928, westliches Bermudadreieck
»Wir können nicht sagen, wo wir sind. … Wir denken, wir sind 225 nordöstlich der Basis … Es scheint, als ob wir in weißes Wasser kommen … Wir sind komplett verloren …«
Letzter Funkspruch des verschollenen Flugs 19, 1945, Bermudadreieck
»Den Nebel, den wir durchfuhren, konnte anfangs nicht einmal das grelle Licht der Karbonlampen durchdringen. Im Maschinenraum begann der Dampfdruck zu sinken, als steuerbords schemenhaft die Küstenlinie einer Insel auszumachen war. Die Männer vom Wachdienst überprüften sofort die Instrumente. Sie schienen zu funktionieren. Nur gibt es in diesen Breiten keine Inseln … Gerade als der Kapitän den Befehl gab beizudrehen, durchbrach das Schiff die Nebelwand, und zwar wenige Hundert Meter von der Stelle entfernt, an der wir in diesen hineingefahren waren. Als es hell wurde, war der seltsame Dunst verschwunden …«
Matrose des Kabelverlegungsschiffes Yamacraw,1956, Bermudadreieck
»Die Passagiermaschine der National Airline, eine Boeing 727, verschwand für gut zehn Minuten spurlos vom Radarschirm – tauchte dann aber wieder auf. Auch der Funkkontakt riss in dieser Zeit ab. Zum Glück landete sie dann aber ohne weitere Zwischenfälle. Die Flugbesatzung verglich später alle Uhren und Zeitmesser an Bord und fand heraus, dass sie alle um genau zehn Minuten nachgingen. Es war, als hätten sie in dieser Zeit einfach nicht existiert …«
Mitglied der Kontrollstation in Miami, 1969, westliches Bermudadreieck
»Mit dem schnell näher kommenden Nebel, dem wir gerade noch ausweichen konnten, drang aus dem Funkgerät ein undefinierbares Surren und Flüstern. Wie ich inzwischen erfahren habe, gibt es zahlreiche Aufnahmen dieser ›Stimmen‹, bei denen es sich nicht etwa um atmosphärische Störungen handelt. Immer, wenn diese Laute hörbar werden, fällt der komplette Erdfunkverkehr aus. Keine Verständigung mit anderen Schiffen oder Flugzeugen, einem Heimat- oder Seehafen oder Flugplatz-Tower ist möglich …«
Pilot eines Sportflugzeugs, Mitte der 80er-Jahre, Bermudadreieck
Anno 1533
Ein auf- und abschwellendes Dröhnen drang an Miguels Bewusstsein, dem ein Prasseln wie von knackenden Feuerscheiten folgte. Aufgeregte Stimmen mischten sich in den unheimlichen Laut, und der Untergrund senkte sich unentwegt auf und nieder. War das Seewind, der über seine klamme Kleidung strich? Es roch nach Salz und Tang. Ihn fröstelte.
Nur … konnte er sich kaum bewegen.
Er war gefesselt.
Miguels Kopf ruckte endgültig hoch, und er spürte mit der Bewegung einen pochenden Schmerz an seinem rechten Bein. Stöhnend öffnete er die Augen. Seine wollene Kniehose war auf Höhe des rechten Oberschenkels aufgerissen und gab den Blick auf blutverkrustete Wickel frei, unter denen grüne Blätter hervorlugten. Mehr als die Wunde selbst erschreckte ihn jedoch das mehr als ein Dutzend halb nackter Männer in Lendenschurzen, die in einer langen Reihe quer vor ihm hockten und auf unbestimmte Art aufgeregt wirkten. Ihr Hautton glich dem der Menschen auf den Kanarischen Inseln. Allerdings war ihr schwarzes Haar dicht und struppig, wobei sie es über der Stirn kurz trugen, während es zum Rücken hin Pferdeschweifen ähnelte.
Indios. Eindeutig.
Ihre Oberkörper waren mit grauer Farbe bemalt, die Augenpartien hingegen auf gefährlich wirkende Weise weiß und rot markiert. Keiner von ihnen schien älter als dreißig Jahre zu sein, und das Sonnenlicht, das hin und wieder den Himmel durchbrach, enthüllte das Schattenspiel ihrer kräftigen Muskeln. Stark mussten sie auch sein, denn sie stachen in einem rhythmischen Takt mit Rudern, die ihn an Ofenschaufeln erinnerten, in die Wellen. Jenseits der Schiffsbegrenzungen erkannte er nichts als Wasser. Viel Wasser. Sie befanden sich irgendwo auf dem Meer.
Miguel war nur ein einfacher Matrose, hatte jedoch bereits die Hälfte seines jungen Lebens auf See verbracht und war mit seinen vierundzwanzig Lebensjahren weit herumgekommen. Auf den zurückliegenden Fahrten in die Neue Welt hatte er genug mit den hiesigen Bewohnern zu tun gehabt, um Händler von Kriegern unterscheiden zu können. Die Indios vor ihm waren Krieger – und das war alles andere als ein gutes Omen.
Die Zeiten, in denen seine Landsleute bei den Einheimischen ein paar Glasperlen gegen Schmuck, Perlen, Gewürze und seltene Vögel hatten eintauschen können, waren lange vorbei. Die Indios hatten längst verstanden, dass Spanier und Portugiesen sich ein brutales Wettrennen um die kostbaren Goldschätze ihrer Heimat lieferten. Auch der Dschungel, die tödlichen Tiere oder das mörderische Klima der Neuen Welt konnten die Konquistadoren nicht davon abhalten, das neu entdeckte Land für die jeweilige Krone in Besitz zu nehmen. Viele der Indios setzten sich daher längst gegen die brutale Landnahme zur Wehr, nur hatten sie gegen die Feuerwaffen der Abenteurer kaum eine Chance. Gerüchten zufolge war inzwischen sogar ein ehemaliger Schweinehirt namens Pizarro mit einigen Söldnern ausgerückt, um ein Reich südlich Neuspaniens zu erobern. Wenn das stimmte, dachte Miguel, dann konnte jeder in der Neuen Welt zu Ruhm und Wohlstand gelangen.
Jeder … bis auf ihn.
Denn beim Anblick der vielen Ruderer beschlich Miguel das unangenehme Gefühl, dass ihn sein Glück verlassen hatte, noch ehe er es überhaupt in die Waagschale hatte werfen können.
»Na, ist unser Bürschchen aufgewacht?«, erklang hinter ihm eine dunkle Stimme in vertrautem Spanisch.
Miguel drehte mühsam den Kopf, und seine Vermutung bewahrheitete sich. Er saß mit klammer Kleidung auf der Mitte eines überraschend großen Floßes, das sich auffallend von den aus Baumstämmen gefertigten Kanus unterschied, mit denen die Einheimischen üblicherweise zwischen den Inseln unterwegs waren. Auch auf der gegenüberliegenden Floßseite hockten in einer langen Reihe Indios, die mit ihren Rudern in gleichförmigem Takt ins Wasser stachen. Was ihn jedoch am meisten beunruhigte, war, dass feste Stricke seinen Körper umschlangen. Außerdem waren ihm die Hände auf den Rücken gefesselt worden. Man hatte ihn Rücken an Rücken mit zwei Unbekannten zusammengebunden, von denen er gerade so viel erkennen konnte, dass der Sprecher deutlich älter als er war, einen struppigen grauen Vollbart trug und in einem verschmutzten braungelben Wams steckte. Ein Konquistador.
»Wo bin ich hier?«, presste Miguel hervor, während dicht an seinem rechten Ohr ein Summen ertönte. Eine Biene. Eine Biene? Verärgert schüttelte er den Kopf, um sie zu vertreiben.
»Na, wo wohl? Weit draußen auf dem Meer.« Der zweite Kerl hinter ihm schnaubte freudlos. Miguel warf einen Blick über seine andere Schulter und sah, dass auch der zweite Mann nicht mehr der Jüngste war. Im Gegensatz zu dem des Konquistadors war sein Haar allerdings noch immer schwarz, und das Gesicht zierte ein mächtiger Schnauzbart. Auch die Wangen schienen schon längere Zeit nicht mehr geschabt worden zu sein. Dem Hemd und der knielangen Wollhose nach war er ebenso ein Seemann wie Miguel selbst. Vermutlich ein Segelmacher, dachte er, als er nach einem Blick über die Schulter den leeren Schultergurt seines Mitgefangenen erspähte, in dem üblicherweise Werkzeuge wie Pricker, Splisshorn oder Markpfriem steckten.
»Ich bin Miguel Fernandez«, stellte er sich vor und versuchte zugleich, seine unbequeme Sitzposition etwas zu verlagern, was sofort Schmerzen in seinem Bein verursachte. »Wer seid ihr?«
»Antonio de Ovando, Ritter vom Calatrava-Orden.« Der Konquistador beäugte misstrauisch die Indios um sie herum, die das Floß weiterhin kraftvoll durch die Wellen steuerten. »Unser Kamerad hinter uns hört auf den Namen Diego Vazquez.«
»Und wie bin ich hierhergelangt?«
»Das solltest du eigentlich selbst am besten wissen«, knurrte Diego Vazquez. Der Segelmacher ruckte heftig an den Seilen, mit denen sie zusammengebunden waren, da die Biene nun ihn umschwirrte. Wo kam das lästige Insekt überhaupt her? »Die verdammten Heiden haben dich vor einigen Stunden samt einem Treibstück aus dem Meer gefischt. Ich schätze, die haben dich zunächst für tot gehalten. Und nicht nur die … Der Don und ich hingegen sind ihnen vor drei Wochen bei einer, na ja, sagen wir mal missglückten Bestrafungsexpedition in die Falle getappt. In La Florida.«
Miguel, der von diesem La Florida noch nie gehört hatte, runzelte die Stirn. »Ist das weit weg?«
Der Konquistador lachte abfällig. »Inzwischen schon. Die Heiden haben uns anfangs zwar unter Drogen gesetzt, aber wenn ich richtig mitgezählt habe, sind wir jetzt schon drei Tagen unterwegs. Und es geht seitdem immer weiter gen Osten.«
Miguel musterte erst die Rudernden und dann sein schmerzendes Bein. »Haben die Indios meine Wunde versorgt?«
»Ja, der Kazike da vorn.« Antonio de Ovando bedeutete ihm mit dem Kopf, zum Bug des Floßes zu schauen, wo neben einem Berg aus Kalebassen, die wohl Wasser und Nahrungsmittel enthielten, auch die erbeuteten Besitztümer seiner Leidensgenossen aufgehäuft waren. Darunter Stiefel, Umhängetaschen, ein abgetragener Mantel sowie de Ovandos ausgebeulter Halbharnisch, sein Glockenhelm und das Waffengehänge samt Rapier. Daneben war hochkant ein Baumstamm verzurrt, um den zu Miguels Verwunderung ein halbes Dutzend Bienen schwirrte. Unweit von ihm stand ein auffallend groß gewachsener und prächtig gekleideter Indio mit buntem Federschmuck im Haar, der – von den Insekten scheinbar unbeeindruckt – auf das Meer hinausblickte. Über seinen Schultern lag ein braun gefleckter Umhang aus dem Fell eines Pumas, links trug er ein goldenes Ohrgehänge. Außerdem konnte Miguel Ketten am Hals des Indios ausmachen, an denen vermutlich Perlen und Muscheln aufgefädelt waren.
»Ist das nicht im Zweifel ein gutes Zeichen?«, wandte sich Miguel hoffnungsfroh an seine Schicksalsgenossen. »Also, dass sie sich um mich gekümmert haben?«
»Darauf würde ich besser nicht wetten.« Antonio de Ovandos Stimme klang resigniert. »Das sind Taíno. Die gelten zwar als friedfertiger als die Menschenfresser weiter unten im Süden, aber es erklärt nicht, warum sie uns mit auf See genommen haben.«
»Sag schon, Junge«, machte der Segelmacher wieder auf sich aufmerksam. »Woher kommst du? Offensichtlich bist du ein Schiffbrüchiger.«
Miguel versuchte verzweifelt, sich zu erinnern. Sein Kopf war zwar noch immer wie in Bausch gepackt, doch vor seinem geistigen Auge stiegen allmählich Bilder empor. Unangenehme Bilder.
»Wir befanden uns auf dem Rückweg nach Spanien«, stöhnte er, während er mit den Erinnerungen kämpfte. »Am fünften Tag sind wir in einen Sturm mit vielen Gewitterschlägen geraten, der unseren ohnedies bereits angeschlagenen Segeln schwer zugesetzt hat. Irgendwann war der Wind so stürmisch, dass unsere Karavelle derart tief tauchte, dass wir schon glaubten, sie wolle in Grund und Boden versinken. Wir haben wegen der schweren Ladung vor Top und Takel gelenzt. So ging es zwei Tage, danach erst flaute der Wind wieder ab. Nur … hatte das Ruder bereits drei Fingerlinge verloren. Und dann hieß es, dass der Kompass verrücktspiele. Wir gerieten … in ein seltsames Meeresgebiet. Da war plötzlich dieses weiße Wasser. Überall auf den Wellenbergen. Bevor ich über Bord gespült wurde, befahl Kapitän de Padilla noch …«
»Wer bitte?«, unterbrach ihn der Konquistador brüsk.
»Kapitän Alonso de Padilla.«
»Du sprichst vom Kapitän der Isabella?«
»Ihr kennt die Karavelle? Ich befürchte …«
»Willst du uns verarschen?«
Miguel sah eingeschüchtert zu einem der Ruderer auf, der angesichts ihrer Unterhaltung missbilligend mit der Zunge schnalzte.
»Ich verstehe nicht«, entgegnete er leise.
»Wann soll das gewesen sein?«, zischte der Konquistador.
»Na ja … ich wurde von einer Welle über Bord gespült. Wie lange ich dann im Wasser trieb, kann ich nicht sagen. Da sich mein Durst in Grenzen hält, würde ich schätzen … vor ein, höchstens zwei Tagen.«
»Die Isabella gilt als verschollen. Und zwar seit ihrem Auslaufen im Oktober.«
»Als verschollen? Jetzt schon?« Miguel runzelte die Stirn. »Wir sind doch erst am Neunundzwanzigsten des Monats in Santiago de Cuba ausgelaufen. Unterwegs waren wir eine knappe Woche, seit …«
»Letztes Jahr, du Idiot. Ihr seid letztes Jahr ausgelaufen! Wir haben inzwischen Mitte August!«
Miguel ruckte zu dem Adligen herum, und sein Bein schmerzte wieder. »Aber … das ist unmöglich. Das wäre dann ja acht Monate her!? Ich schwöre: Wir sind erst vor gut einer Woche ausgelaufen.«
»Mein verschissener Stiefbruder hat als Offizier unter Kapitän Alonso de Padilla gedient«, knurrte Antonio de Ovando. »Die Karavelle ist nie in Spanien angekommen. Also erzähl mir keinen Mist. Woher stammst du wirklich?«
»Ich schwöre es Euch, Don. Ich …«
Der Seewind trug einen hallenden, unangenehm reißenden Laut heran, wie Miguel ihn vorhin bereits vernommen hatte. Seine Nackenhaare stellten sich bei dem undefinierbaren Geräusch auf, und er spürte, dass sich auch seine beiden Mitgefangenen versteiften. Der Kazike rief einige Kommandos, und der Taktschlag der Ruderblätter um sie herum erhöhte sich.
»Was zum Teufel ist das?«, ächzte Diego Vazquez hinter ihnen.
Miguel und Antonio blieben ihm die Antwort schuldig. Stattdessen versuchten sie einen Blick voraus zu erhaschen, dorthin, wo der Kazike stand. Dieser erhob seine Stimme nun zu einem melodischen Singsang. Er löste an dem Baumstamm eine Art Klappe, und Miguel begriff, dass der Stamm ausgehöhlt war, denn unvermittelt brach aus diesem ein großer, brummender Bienenschwarm hervor, der sich in einer dichten Traube über dem Bug des Floßes sammelte. Dann bewegte er sich – einer schwirrenden und summenden Rauchfahne gleich – weiter über das Meer.
Unter den Ruderern ertönten Rufe, und die Indios erweckten nun den Eindruck, als würden sie den Kurs des Floßes korrigieren. Miguel sah den Tieren ratlos nach, versuchte, an den Kalebassen vorbei einen Blick in Fahrtrichtung zu erhaschen – und schluckte. Am Horizont waren unbemerkt von ihnen dunkle Sturmwolken aufgestiegen, die in kurzen Abständen von gelblichen und grünlichen Blitzen entflammt wurden. Das unheimliche Geschehen spielte sich in seltsamer Lautlosigkeit ab – nicht ein Grollen begleitete das bizarre Wetterleuchten. Über den Wellen jedoch … wogte ein gespenstischer Nebel, der rasch näher rückte.
Und das auf breiter Front.
Im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden war Miguel in der imposanten Bergwelt der Sierra Nevada aufgewachsen, deren Steilhänge teils bis ans Mittelmeer heranreichten. Die gewaltige graue Wand, die über das Meer hinweg auf sie zurollte, erinnerte ihn daher fatal an eine abgehende Schneelawine, die sie unter sich zu begraben drohte.
»Scheiße, was ist das?«, zischte der Konquistador beunruhigt.
Miguel folgte dem Blick des Adligen, der statt auf den Horizont auf seine aufgehäuften Besitztümer gerichtet war – und sah es nun ebenfalls. An de Ovandos Mantel, der quer über dem Brustharnisch lag, hing eine schlichte Halskette mit eisernem Kruzifix. Während die unheimliche Nebelwand mit hoher Geschwindigkeit auf sie zurollte, ruckte das Glaubenssymbol Stück für Stück über den Stoff, straffte die lederne Kette und hing plötzlich wie von Geisterhänden getragen quer in der Luft.
Teufelswerk!
Miguel japste erschrocken und hätte sich am liebsten bekreuzigt. Doch die Fesseln hinderten ihn daran.
Unvermittelt beugten sich zwei der Indios über sie und legten ihnen Augenbinden an. Diego Vazquez versuchte sich zu wehren, doch mit kräftigen Schlägen brachen ihre Peiniger seinen Widerstand. Er und Antonio de Ovando fügten sich daher in ihr Schicksal, und auch Miguel ließ zu, dass die Welt um sie her in Dunkelheit versank.
Mit schmerzendem Bein saß er da und lauschte verzweifelt auf seine übrigen Sinne. Was hatten die Taíno nur mit ihnen vor? Erstmals fragte er sich, was die Indios überhaupt hier draußen auf dem Meer zu suchen hatten.
Schlagartig wurde es kühler, und er fröstelte – in seiner klammen Kleidung, aber auch wegen der aufsteigenden Furcht, die ihm die Kehle eng werden ließ. Die Stimmen ihrer Entführer klangen nun gedämpfter. Offenbar hatte sie der eigentümliche Nebel erreicht. Unvermittelt hob ein größerer Wellenberg das Floß an, energische Rufe hallten über das Deck, Spritzwasser schlug ihm ins Gesicht – und all das, obwohl der beständige Seewind Miguels Eindruck nach um keinen Deut stärker geworden war. Diego Vazquez griff nach seiner Hand, und noch immer war weiter vorn das leise Summen der Bienen zu hören, während die Indios auf beiden Seiten des Floßes hörbar schwer daran arbeiteten, das schwankende Gefährt über die bewegte See voranzutreiben. Der Konquistador wollte etwas sagen, doch einer der Indios fiel ihm wütend ins Wort, und ein kräftiger Schlag ließ den Adligen verstummen.
Miguel betete still, während ihm erneut die verstörenden Umstände seiner Rettung durch den Kopf gingen. Was hatten Vazquez und Ovando ihm gerade erzählt? Die Isabelle galt bereits seit acht Monaten als verschollen? Aber er konnte doch unmöglich all die Zeit auf See getrieben sein!
Miguel wusste nicht, wie viel Zeit er mit Grübeln verbracht hatte, als unvermittelt Sonnenlicht seinen Körper traf und ihn wärmte. Auch die Luft roch jetzt anders. Nach … Blüten.
Hilflos versuchte er, trotz der Augenbinde etwas zu erkennen, doch das Mistding machte ihn noch immer blind. Die Rufe der Indios um sie herum hatten sich verändert. In seinen Ohren klangen sie … aufgeregt. Und aus der Ferne mischten sich weitere Geräusche unter die Stimmen: Brandungsrauschen, über dem ein dumpfes Grollen lag. Fast wie ein Gewitter und doch mit nichts vergleichbar, das Miguel je zuvor vernommen hatte. Als schließlich ein Ruck durch das Floß ging, hörte und spürte er, wie die Indios rings um sie herum ins Wasser sprangen, um … ja … um ihr Gefährt unter lauten Kommandos irgendwo … an Land zu ziehen.
Land.
Ohne Zweifel.
Schritte näherten sich ihm und seinen zwei Schicksalsgenossen, und die Indios befreiten sie von den Stricken, mit denen Ovando, Vazquez und er selbst zusammengebunden waren. Kräftige Hände packten ihn, richteten ihn mitleidlos auf und zwangen ihn so dazu, sein verletztes Bein zu belasten. Gequält stöhnte er, und es tröstete ihn wenig, dass seine Gefährten nicht weniger grob behandelt wurden. Jemand stieß ihn brüsk vorwärts. Er stolperte unter Schmerzen voran, trat kurz darauf ins Leere und kippte schreiend vornüber. Doch statt im Wasser landete er … auf einem weichen und warmen Untergrund.
Die Indios lachten spöttisch, wurden jedoch von einer befehlsgewohnten Stimme zur Ordnung gerufen. Der Kazike.
Zwischen Miguels Zähnen knirschte es, sein Bein brannte inzwischen wie Feuer, und mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen wälzte er sich herum, wobei seine Binde etwas verrutschte und kurz den Blick auf einen weißgelben Sandstrand mit hohen schwarzen Felsen freigab, die von rotem Abendlicht beschienen wurden.
Abendlicht?
Vorhin war es doch noch mitten am Tag gewesen. Miguel vermochte es nicht, dem Gedanken weiter zu folgen, denn schon schoben sich die nackten Beine ihrer Häscher in sein Sichtfeld, gefolgt von der grünen Wand eines Dschungels mit Palmen und anderem Grünzeug.
Abermals erfüllte ein dumpfes Grollen die Luft, wie von einem nahenden Gewitter.
Gleichzeitig richtete einer der Indios ihn wieder auf und drängte ihn dazu, weiter voranzuhumpeln. Miguel ächzte schmerzerfüllt, während Antonio de Ovando und Diego Vazquez sich schräg hinter ihm laut und empört über die unsanfte Behandlung durch die Indios beschwerten. Diese jedoch schien das nicht weiter zu kümmern, denn sie trieben ihre Gefangenen unerbittlich den Strand hinauf, bis sie die Ausläufer des Dschungels erreichten. Die Meeresbrandung wurde hier allmählich leiser; Miguels Kopfschmerzen hingegen schwollen an, während er weiter vorangestoßen wurde. Mittlerweile fiel der Schatten tropischer Bäume und Gewächse auf sie, die Luft roch jetzt schwer nach Hibiskus und Orchideen, und aus dem Wald drangen exotische Rufe, hinter denen Miguel Vögel vermutete. Die Indios hielten kurz inne und senkten ihre Stimmen. Ehrfürchtig. Fast ängstlich.
Unsanft zogen seine Häscher ihn und die anderen einige minutenlang durch die stickige Blätterwelt, dann gebot der Kazike dem Trupp, innezuhalten.
Schwer atmend blieb Miguel stehen und versuchte, die Schmerzen in seinem Bein zu ignorieren. Es gelang ihm nicht. Stattdessen vernahm er hinter sich den gedämpften Fluch Antonio de Ovandos. Offenbar hatte sich sein Landsmann während des Marsches den Knöchel verstaucht.
Abermals packten die Indios sie, und diesmal wurden sie auf eine verschattete Lichtung geführt, auf der sich – soweit Miguel das unter der Binde erkennen konnte – vier schlanke Holzpfähle befanden, in die Indiomuster eingeschnitzt waren. Die Einheimischen führten sie jeweils zu einem von ihnen und banden sie dort abermals mit Stricken. Miguel, der auf seinem verletzten Bein kaum mehr stehen konnte, war fast froh um die kräftige Wickelung.
»Was habt ihr mit uns vor, ihr dreckigen Heiden?« Diegos Stimme bebte vor Wut, und Miguel konnte hören, wie der Segelmacher, den die Indios rechts von ihm an einen der Pfähle gebunden hatten, erfolglos an seinen Fesseln zerrte, während Antonio de Ovando links von ihm sich mit nur mühsam bewahrter Beherrschung an den Kaziken wandte. »Komm schon – sag, was du willst. Meine Familie ist reich. Wenn ihr mich verschont, wird sie mich auslösen.«
Der Kazike antwortete nicht, und die übrigen Indios, die Miguel hinter den Pfählen im Rücken ihrer drei Gefangenen wähnte, verstummten. Stille fiel wie ein schweres Tuch über die Lichtung und ließ nur das leichte Rauschen des Windes in den Zweigen und Blättern und das Stöhnen Antonio de Ovandos zurück, der seine Versuche, die Indios zur Zusammenarbeit zu bewegen, aufgegeben zu haben schien. Vorsichtig hob Miguel den Kopf, um mehr zu erkennen, und entdeckte im Licht der untergehenden Sonne den Kaziken einige Schritte voraus. Dieser kniete mit erhobenen Händen vor einem imposanten Felsen mit fremdartigen Steinritzungen, der düster vor der ihnen gegenüberliegenden Dschungelwand aufragte. Dabei murmelte er feierliche Worte in der Sprache seines Volkes. Dann legte er sich vor dem Koloss auf den Bauch, demütig und mit weit abgespreizten Armen, und die Indios hinter ihnen stimmten ein mehrkehliges Summen an.
Miguels Gedanken rasten. Was auch immer ihre Peiniger da trieben, es gefiel ihm nicht. Ganz und gar nicht. Er hatte von Völkern in der Neuen Welt gehört, die ihren Gefangenen in grässlichen heidnischen Ritualen und bei lebendigem Leib das Herz aus der Brust rissen. Angstschweiß trat ihm auf die Stirn, während er verzweifelt und erfolglos zu erfassen versuchte, was ihre Entführer für sie vorgesehen hatten.
Plötzlich kehrte wieder jenes lang gezogene Grollen zurück, das er noch immer nicht zuordnen konnte, und diesmal glaubte er sogar, den Laut körperlich spüren zu können. So, als würden kleine Wellen durch den Boden laufen.
Als habe der Kazike nur darauf gewartet, erhob er sich, und einige der Indios traten hervor, um die Habseligkeiten von Miguels Begleitern auf die Lichtung zu werfen. Es schepperte, als Antonio de Ovandos Konquistadoren-Helm auf den Brustharnisch traf. Dann zogen sich ihre Peiniger zurück, und selbst der Kazike verschwand, soweit Miguel das anhand der Geräusche beurteilen konnte, ohne ein weiteres Wort hinter ihnen im Dickicht. Gehölz knackte, und Blattwerk raschelte, als der Trupp sich einen Weg durch das Unterholz bahnte. Dann waren die Taíno verschwunden.
»Sind sie weg?«, fragte Diego leise.
»Ja, ich glaube schon«, wisperte Miguel, den das Verschwinden ihrer Häscher alles andere als beruhigte. Ganz im Gegenteil. Hinzu kam, dass es allmählich dunkel wurde.
»Könnt ihr euch irgendwie losmachen?«, wollte Antonio de Ovando wissen.
»Könnte ich es, würde ich hier garantiert nicht mehr herumhängen«, blaffte Diego zurück. »Außerdem wäre ich schon froh, wenn ich wüsste, wo zum Teufel diese Heiden uns überhaupt hingeschleppt haben.«
Miguel, der offenbar als Einziger durch seine verrutschte Augenbinde hatte sehen können, erklärte den beiden, was er wusste.
»Die haben sogar mein Rapier zurückgelassen?«, fragte der Konquistador ungläubig.
»Ja, soweit ich das erkennen kann, schon«, antwortete Miguel. »Keine Ahnung, warum. Ich meine, die haben uns doch nicht ...«
Unvermittelt hielt er inne und brauchte einige Augenblicke, bis er verstand, was sich verändert hatte: Das schwere Tuch schien sich erneut über die Lichtung gelegt zu haben. Der Dschungel war verstummt. Selbst die Vögel schwiegen. Miguel spürte seinen Herzschlag, dann drang aus dem Blätterdickicht vor ihnen ein Rascheln.
»Habt ihr das auch gehört?«, zischte Diego.
Angespannt lauschten sie, dann vernahmen sie das Rascheln abermals. Diesmal deutlich weiter rechts, gefolgt von einer Art … Zirpen.
Miguels Nackenhaare stellten sich bei dem befremdlichen Laut auf, während er sich verzweifelt damit abmühte, unter seiner Binde etwas zu erkennen.
Doch sein Sichtfeld war noch immer deutlich eingeschränkt, die Schatten wurden immer länger, und wohin er auch zu blicken vermochte, entdeckte er um sie herum nur Bäume, Blätter und Farne.
Da vernahm er unvermittelt ein metallisches Kratzen. Er ruckte herum und versuchte den Platz genauer einzusehen, an dem die Indios die Besitztümer des Konquistadors zurückgelassen hatten. Helm und Harnisch waren fort! Stattdessen bewegten sich im nahen Dschungel einige Pflanzen, und Miguel hielt unwillkürlich die Luft an, als ihm bewusst wurde, dass jemand … oder etwas sie beobachtete.
»Eure Rüstung ist weg«, keuchte er mit zittriger Stimme. »Da ist irgendetwas im Dschungel … das … hat sie geholt.« Miguel hörte selbst, wie panisch seine Stimme klang.
Antonio de Ovando bewegte sich am Pfahl neben ihm, als das unheimliche Zirpen oder Schnattern abermals die Lichtung erfüllte. Plötzlich brach etwas schräg hinter ihnen aus dem Urwald. Miguel hörte dort, wo Diego Vazquez angebunden war, das Reißen und Platzen von Fasern, dann dessen erschrockene Stimme. »Was, zum Teufel …?!«
Miguel sah unter der Augenbinde, wie der Körper des Segelmachers, befreit von den Stricken, auf die Lichtung kippte. Der Mann versuchte sich noch zu wehren, doch etwas schien ihn am Bein zu packen, denn kurz darauf wurde Vazquez mit einem Ruck aus Miguels Blickfeld gerissen. Das Zirpen, das über die Lichtung gellte, klang nun triumphierend.
»Nein! Neiiiiiiiiinnn …« Im Dschungel hinter sich hörte Miguel das brutale Geräusch brechender Knochen und rücksichtslose Schleiflaute, die sich rasch entfernten. Mit ihnen entfernten sich auch die panischen Schreie des Segelmachers, wurden leiser – und verstummten schließlich endgültig.
»Scheiße. Was ist das?«, keuchte Antonio de Ovando.
Ein weiteres Mal kreischte das grauenvolle Zirpen über die Lichtung, und diesmal schien es sich von links zu nähern.
Schon gellte der Schrei des Konquistadors an Miguels Ohren, und er konnte hören, wie etwas den Mann packte und diesen ebenfalls mit rasender Geschwindigkeit ins Unterholz riss. Das panische Brüllen de Ovandos hallte noch in Miguels Ohren, als der Mann schon längst verstummt war.
Den Schmerz an seinem eigenen Bein spürte Miguel längst nicht mehr. Zitternd vor Angst, hing er am Pfahl, lauschte in den Dschungel und nahm nur am Rande wahr, wie er sich unkontrolliert in seine Beinkleider erleichterte.
Und dann spürte er es: Die Aufmerksamkeit der fremdartigen Präsenz war nun auf ihn gerichtet. Irgendetwas baute sich unmittelbar vor ihm auf und stieß einen Laut aus, der ihn an ein lauerndes Schnattern erinnerte.
»Bitte!«, schluchzte Miguel verzweifelt und schloss die Augen, als könne er damit sein Schicksal abwenden. Aber die Würfel waren längst gefallen, und er wusste es.
Er hob nun doch den Kopf, starrte in riesige schwarze Augen – und begann unkontrolliert zu schreien.
Atlantischer Ozean
Der Hurrikan
»Dieser Trip war die beschissenste Idee, die wir je hatten!«
Draußen heulte der Sturm, die Sea Quest sackte ab, und Alex drohte abermals, den Halt zu verlieren. Aber diesmal war er darauf vorbereitet und schaffte es gerade noch rechtzeitig, sich am Bett festzuhalten, als die nächste Welle gegen das verstärkte Glas ihrer Kabine brandete. Und das auf Deck 6! Für einen Moment erschien es ihm, als blicke er auf ein Aquarium. Nur dass dort draußen die Fische fehlten. Dann richtete sich das Kreuzfahrtschiff wieder auf, und die Scheibe war übersät von ablaufenden Schlieren und Wasserrinnen, die ihm gnädigerweise den Blick auf die wild bewegte See unmöglich machten.
»Ich hoffe, du gibst jetzt nicht mir die Schuld für den Sturm!«, kommentierte Jochen seinen Balanceakt. Alex’ Kumpel saß trotz des schwankenden Untergrunds lässig auf dem Nachbarbett ihrer geräumigen Zwei-Personen-Kabine, zückte entspannt sein Smartphone und richtete es auf die Scheibe, die abermals unter einer blaugrauen Woge versank. Jochen grinste, während er das Spektakel filmte. »Immerhin haben wir jetzt etwas zu erzählen, wenn wir wieder zurück in Deutschland sind.«
»Wir haben auch so genug zu erzählen.« Alex, der gegen den Freiheitsdrang seiner Vormittagsbouillon ankämpfte, verfluchte sich längst dafür, ausgerechnet auf einem Schiff wie diesem eingecheckt zu haben. Die MS Sea Quest zählte mit ihren knapp zweihundert Metern Länge zu den eher kleinen Kreuzfahrtschiffen und hatte auf ihren sechs Passagierdecks gerade mal Platz für etwas mehr als dreihundertfünfzig Gäste. In puncto Komfort hielt die Sea Quest zwar, was der Reiseprospekt versprochen hatte, aber die echten Kreuzfahrtriesen lagen bei Sturm bestimmt stabiler im Wasser. Ganz davon abgesehen, dass Alex jede andere Reisemethode deutlich bevorzugt hätte.
»Wir könnten auf den Bahamas längst gemütlich einen Cocktail schlürfen«, murrte er, »wenn du nicht so eine verdammte Flugangst hättest.«
»Ach, komm schon.« Jochen strich sich das halblange dunkle Haar aus der Stirn, musste sich jedoch ebenfalls festhalten, da das Schiff erneut in ein Wellental geriet. »Schließlich haben wir extra einen Termin außerhalb der Hurrikan-Saison gebucht. Wir haben einfach Pech.« Er steckte das Smartphone zurück in seine Tasche. »Dass wir schon wieder in so einen Orkan wie damals auf der Polarstern geraten würden, war ja nun wirklich nicht abzusehen.«
Alex erinnerte sich nur zu gut an die stürmische Arktisexpedition, auf der Jochen und er sich vor einigen Jahren kennengelernt hatten. Als angehende Biologen hatten sie auf dem deutschen Forschungsschiff Polarstern Praxiserfahrung gesammelt. Doch während Jochen sich durch die Expedition in seiner Spezialisierung auf Meeresbiologie bestätigt gefühlt hatte, war Alex die halbe Expedition über seekrank gewesen. Dieser Ausblick auf seine zukünftigen Arbeitsbedingungen hatte ihn von Hamburg nach Berlin und anschließend nach Rostock umziehen lassen, wo er seinen Studienschwerpunkt neu ausgerichtet hatte. Inzwischen stand er kurz vor seiner Promotion in Zoologie, während Jochen all die Jahre über in Hamburg geblieben war, wo er sich mehr recht als schlecht mit Hiwi-Jobs durchschlug.
Offiziell arbeitete sein Freund ebenfalls an einer Doktorarbeit, aber dass ihn die häufig wechselnden Studentinnen in seinem Bett mehr interessierten als das Näherrücken seines akademischen Grades, war ein offenes Geheimnis. Jochen war eben das, was man für gewöhnlich als einen Hingucker bezeichnete: Groß, athletisch und mit halblangem dunklem Haar ähnelte er den Surfer-Typen, denen sie vor zwei Wochen in Kalifornien begegnet waren. Dass er da einen Schlag bei Frauen hatte, war nicht weiter verwunderlich.
Auch Alex selbst war nicht unsportlich, aber ihm fehlte die Leichtigkeit, mit der es Jochen gelang, das andere Geschlecht für sich einzunehmen. Außerdem hatte er bis vor einem halben Jahr in einer festen Beziehung gelebt – und täte das sicherlich noch immer, wenn Svenja ihn nicht ausgerechnet an seinem dreißigsten Geburtstag und nach fünf gemeinsamen Jahren für einen ehemaligen Schulfreund verlassen hätte. Wie sich herausgestellt hatte, war der Kerl ihre heimliche Jugendliebe gewesen und war, wie Alex leicht durch einen Check seiner Social-Media-Accounts hatte feststellen können, ebenso blond und sportlich wie er selbst, teilte seine Leidenschaft fürs Bergsteigen und schätzte sogar die gleichen Bücher und Filme. Der Unterschied zwischen ihnen war, dass der Typ eine kleine Fullservice-IT-Agentur besaß, die so viel abwarf, dass er sich mühelos einen Sportwagen leisten konnte. Die Erkenntnis, dass er all die Jahre über bloß als billige Kopie eines anderen hatte herhalten dürfen, schmerzte Alex noch immer.
Unabhängig von seiner Übelkeit war er Jochen deshalb mehr als dankbar, dass dieser ihn zu dem mehrwöchigen USA-Trip überredet hatte. Die Reise hatte ihm tatsächlich gutgetan und ihn auf andere Gedanken gebracht. Von New York aus hatten sie schließlich ihre zehntägige Karibikrundfahrt angetreten, die sie über Bermuda, die Bahamas und von dort über Orlando und Norfolk zurück nach NYC führen würde und den grandiosen Abschluss ihrer Reise bilden sollte. Bermuda hatten sie bereits hinter sich gelassen, und trotz seiner Abneigung gegen Schiffsreisen hatte sich Alex auf den Tag auf See sogar gefreut – wäre da nicht dieser sonderbare Sturm gewesen. Der Orkan, der das Kreuzfahrtschiff gerade erneut in ein tiefes Wellental jagen ließ, hatte sich kurz nach Mittag völlig ohne Vorwarnung und – Alex warf einen Blick auf seine Funkarmbanduhr, die ihm Svenja zu ihrem letzten gemeinsam verbrachten Weihnachtsfest geschenkt hatte – in nicht einmal vierzig Minuten über dem Meer zusammengebraut. Grelle Blitze zuckten nun über den östlichen Horizont und offenbarten über den Wellenbergen einen Himmel in beängstigendem Schwarzgrün.
Draußen war es inzwischen so dunkel, als sei die Sonne bereits untergegangen. Selbst damals auf der Polarstern hatte er einen solchen Sturm nicht erlebt.
Eine weitere hohe Welle traf das Schiff, die Sea Quest begann, schwer zu rollen, und die Kabinenlichter flackerten. Im gleichen Moment schwang die Tür zum Bad auf, und Deo, Zahnpasta und Tabletten kollerten in den Schlafbereich.
Diesmal richtete sich auch Jochen auf.
»Alter Schwede!« Er lachte. »Vielleicht hätten wir vor unserer Abfahrt doch ein Opfer an Poseidon bringen müssen.«
»Ja, dich …«, murrte Alex.
Sein Freund grinste.
Alex hob seufzend ein Röhrchen mit Tabletten gegen Seekrankheit auf, als über einen Lautsprecher in der Raumdecke die Stimme des Kapitäns der Sea Quest zu hören war. Er forderte die Passagiere auf, in ihren Kabinen zu bleiben. Doch dann brach die Stimme unvermittelt ab, und die Kabinenlichter flackerten wieder.
Alex entnahm seiner Jacke sein Handy und deaktivierte den Flugmodus, den er aus Kostengründen eingeschaltet hatte. Zu seinem Befremden gelang es dem Gerät nicht, sich in das Bord-Mobilfunknetz einzuwählen. Es wurde nicht einmal angezeigt.
»Findest du es nicht auch komisch, dass es heute keinerlei Unwetterwarnung gab?« Beunruhigt blickte Alex im fernen Wetterleuchten auf das aufgewühlte Meer. Sogleich nahm ihm eine weitere Welle die Sicht auf die sturmgepeitschte See, brandete bis hoch gegen das Fenster und schnitt sie erneut von dem Zwielicht der Außenwelt ab.
»Jetzt mach dir nicht ins Hemd«, versuchte Jochen ihn zu beruhigen und erhob sich trotz des schwankenden Untergrunds. »Bei einem Sturm wie diesem ist es draußen auf dem Meer sogar am sichersten. Immerhin können wir hier nirgendwo auflaufen. Außerdem sind die modernen Kreuzfahrtschiffe so gebaut, dass ihnen selbst ein Hurrikan nichts anhaben kann.«
»Ja, verdammt, ich weiß«, knurrte Alex. »Aber sag das mal meinem Magen.«
Ein heftiger Stoß ließ das Schiff erzittern, und die Welt hinter dem Kabinenfenster versank abermals in blaugrauer Dunkelheit. Das Deckenlicht im Raum erlosch, während auf dem Gang vor der Kabine heftiges Gepolter zu hören war, dem ein Schrei folgte.
Alex und Jochen warfen einander besorgte Blicke zu. Obwohl das Schiff noch immer schwer auf der Seite lag, mühte sich Alex zur Tür, öffnete diese und spähte nach draußen. Der lange Gang, von dem zahlreiche weitere Kabinen abzweigten, empfing ihn im düsteren Schein der Notbeleuchtung, und die einzige natürliche Lichtquelle war eine Glastür etwas weiter den Gang hinunter zu seiner Rechten. Dort ging es zum Heck des Schiffes mit der Rezeption, dem Fahrstuhl und den Miniboutiquen. Linker Hand jedoch, keine drei Schritte von ihrer Kabine entfernt, war ein herrenloser Servierwagen mit großer Kraft gegen eine Kabinentür auf der gegenüberliegenden Gangseite gedonnert und hatte in diese eine faustgroße Delle geschlagen. Neben dem Wagen lag eine junge Frau mit sommerlich weißer Wickelhose und am Bauch zusammengeknotetem Top am Boden. Eine amerikanische Touristin, soweit sich Alex erinnerte, da ihn Jochen bereits bei der Abreise in New York auf die Blondine aufmerksam gemacht hatte. Die junge Frau blutete an der Stirn, hielt sich den rechten Oberarm und versuchte soeben, sich aufzurappeln.
»Oh, Shit!« Das Schiff richtete sich wieder auf, und Alex setzte sich in Bewegung, um der blonden Amerikanerin zu Hilfe zu eilen. Doch er kam nicht weit, denn schon zog Jochen an ihm vorbei und half ihr auf die Beine.
»Alles in Ordnung?«, sprach sein Kumpel sie besorgt auf Englisch an.
Die Gestürzte verzog das Gesicht und lächelte zaghaft, als sie sah, wer ihr aufhalf. »Danke. Geht so ... Eigentlich wollte ich bloß zurück auf mein Quartier – und dann krachte mir plötzlich dieser Wagen in die Seite.«
»Warten Sie, ich hole rasch ein Pflaster«, bot sich Alex an und lief zurück in die Kabine. Dabei fiel ihm auf, wie kühl es mit einem Mal geworden war. Als wäre mit dem Licht auch die Wärme aus dem Schiffsleib gewichen. Schnell griff er nach seiner Sommerjacke und suchte dann im Bad erfolglos nach Verbandsmaterial. Also lief er zurück in den Flur, doch da sackte das Schiff bereits wieder ab, und sie alle rangen abermals mit dem Gleichgewicht. Jochen stützte die Amerikanerin – natürlich tat er das –, während Alex den Servierwagen zu packen versuchte, der im Gang herrenlos in Richtung Schiffsheck sauste. Erfolg hatte er erst vor einer der Türen kurz vor der Rezeption. Eine Stewardkabine. Sie stand eine Handbreit auf, und jemand hielt sie von innen fest. Während Jochen weiter hinten im Korridor den Frauenflüsterer mimte, drangen auch aus dem Türspalt der Kabine Stimmen.
»… hatten auf der Brücke schon Ärger mit dem Kompass«, erklärte eine verärgerte Männerstimme auf Englisch. »Und jetzt scheint die Elektrik ausgefallen zu sein.«
»Und was bedeutet das?«, fragte eine aufgeregte Frauenstimme mit lateinamerikanischem Akzent. »Jetzt, bei diesem seltsamen Sturm?«
»Was weiß ich? Ich erreiche oben niemanden«, knurrte der Mann. »Die arbeiten sicher schon daran.«
Alex klopfte, und im Türspalt erschien eine hübsche Frau mit dunkelbraunen Augen, dunklem Teint und schulterlangen schwarzen Haaren, deren ausgeprägte Wangenknochen ihn unwillkürlich an alte Maya-Abbildungen erinnerten. Die Südamerikanerin war einen halben Kopf kleiner als er und dem Äußeren nach Ende zwanzig. Ihr uniformierter Dress – blau-weißes Hemd, Schulterklappen, knielanger weißer Rock – offenbarte, dass sie dem Servicepersonal der Sea Quest angehörte. Itzil Pérez, las Alex auf ihrem Namensschild. Kaum dass sie sah, dass sie einen Passagier vor sich hatte, knipste sie ein unverbindliches Lächeln an. »Was kann ich für Sie tun?«
»Entschuldigen Sie, aber wir benötigen Verbandsmaterial«, erklärte Alex, der sich nun seine Jacke überstreifte. »Der Wagen hier hat gerade eben jemanden umgerissen.«
»Oh.« Die Kreuzfahrtmitarbeiterin reagierte sichtlich bestürzt. »Das ist meine Schuld. Ich habe ihn … einen Moment.«
Unter dem Protest eines etwa vierzigjährigen Mannes in ebenfalls blau-weißer Stewarduniform zog sie den Servierwagen kurzerhand in die Kabine, trat anschließend an Alex’ Seite und warf einen Blick hinüber zu der Amerikanerin, der Jochen längst mit einem Taschentuch aushalf.
Die Südamerikanerin seufzte. »Warten Sie bitte.«
Abermals gerieten sie wegen der Schlingerbewegungen des Schiffes aus dem Tritt, doch da Jochen stumm signalisierte, die Sache im Griff zu haben – was genau genommen sehr wörtlich zu verstehen war –, folgte Alex ihr durch die Glastür in den Rezeptionsbereich. Auch dort hatte der Sturm seine Spuren hinterlassen: Werbezettel, Stifte und sogar eine Vase mit Blumen lagen am Boden, und hinter den Scheiben der Miniboutique war ein Kleiderständer umgestürzt. Unglücklicherweise war mit dem Licht auch der Fahrstuhl zu den übrigen Decks der Sea Quest ausgefallen. Weiter unten lag seines Wissens das Hospital des Schiffes. Und war damit vermutlich derzeit unerreichbar für sie. Sicherlich gab es irgendwo einen Treppenbereich, aber der war vermutlich nur dem Personal zugängig.
Alex’ Begleiterin kämpfte sich über den schwankenden Untergrund zur Rezeption vor, sodass Alex Zeit fand für einen Blick auf die große Fensterfront auf der Backbordseite. Erneut setzten grelle Blitze den Himmel über der bewegten See in Flammen. Ihr Lichtschein beleuchtete heftig flatternde, rot-weiße Absperrbänder nahe der Außenreling, die den Weg zu den Außentreppen versperrten. Aber wer sich jetzt noch dort draußen aufhielt, musste ohnedies verrückt sein.
Die Südamerikanerin sprach derweil auf Spanisch mit der Rezeptionistin, an deren Tresen sich ein Italiener festklammerte, den Jochen und er gestern beim Abendessen kennengelernt hatten. Der Mann nickte ihm unglücklich zu. Die Rezeptionistin kramte in einem Schrank und schüttelte bedauernd den Kopf.
Der komplette Bereich wurde wieder kurz in grelles Licht getaucht, dann rollte vom Meer her ein dumpfes Krachen an ihre Ohren. Alex konnte sich nicht helfen, aber der Sturm da draußen wurde ihm zunehmend unheimlich.
Er wollte sich gerade abwenden, da glaubte er, etwas auf den Wellenbergen auszumachen.
Was war das?
Alex trat näher an die Scheiben heran. Auf den gewaltigen Wasserbergen … tanzte ein Schiff. Eine schnittige, überaus modern wirkende rot-weiße Jacht mit eigenwilligen … technisch anmutenden Aufbauten.
Spritzwasser prasselte von außen gegen die Glasfront des Kreuzfahrtschiffs, und er trat respektvoll zurück. Als das Wasser abgeflossen war, war von der Jacht nichts mehr zu sehen. Alex kniff die Augen zusammen, dann schüttelte er den Kopf. Er hatte sich das Schiff garantiert nicht bloß eingebildet.
Itzil Pérez trat an seine Seite.
»Tut mir leid«, erklärte sie, und er hörte ehrliche Enttäuschung in ihrer Stimme, »aber es sieht so aus, als müssten wir rüber ins Restaurant. Dort sollten wir in jedem Fall einen Erste-Hilfe-Kasten für Ihre Freundin finden.«
»Ich kenne die junge Frau gar nicht persönlich.« Alex schloss die Knöpfe seiner Jacke. »Mein Freund und ich sind ihr …«
Eine riesige Welle donnerte gegen die Außenscheiben und ließ das Schiff erzittern. Er geriet aus dem Gleichgewicht, ruderte mit den Armen und spürte plötzlich Hände, die ihn stützten. Die Südamerikanerin lächelte schief, und er richtete sich wieder auf.
»Danke.«
»Gern geschehen. Möchten Sie mir folgen?«
Trotz des beständigen Aufs und Abs der Sea Quest kämpften sie sich an Miniboutique und Internetcenter vorbei Richtung Heck und auf die dort gelegene Restauranttür zu. Dabei bemerkte Alex, dass seine Begleitung seine Besorgnis bezüglich des Sturmes zu teilen schien.
»Habe ich das richtig verstanden, dass wir gerade größere Probleme haben?«, sprach er sie an.
»Sie haben das Gespräch vorhin in der Kabine mitangehört?« Die Südamerikanerin sah unglücklich auf. »Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beunruhigen. Die werden das schon bald in den Griff bekommen. Aber wenn ich ehrlich bin … es gab nicht einmal eine Unwetterwarnung. Außerdem …« Sie sah nach vorn und wirkte mit einem Mal verärgert. »Das darf doch nicht wahr sein«, schimpfte sie. »Hier sollte eigentlich längst niemand mehr sein!«
Durch die Glastür zum Restaurant sah nun auch Alex das halbe Dutzend Passagiere, das dort trotz der Anweisung des Kapitäns, die Kabinen nicht zu verlassen, noch immer ausharrte. Das Schiff begann abermals zu krängen. Alarmiert beobachtete Alex, wie im Saal Tische und weitere Servierwagen verrutschten, während ein gewaltiger Brecher gegen die gläserne Panoramafront des Restaurants schlug. Das Schiff sackte ab, weitere Möbelstücke kippten um, und diesmal lösten sich unter der Wucht des Aufpralls sogar zwei Deckenpaneele und stürzten zu Boden. Verängstigte Schreie gellten ihnen entgegen.
»Meine Fresse!«, entfuhr es Alex auf Deutsch.
Hastig zogen sie die Türen auf, und mit den mittäglichen Essensdüften drang nun auch ein unangenehmer Geruch nach Erbrochenem an ihre Nasen. Grelle Blitze über dem Meer erhellten das Bordrestaurant, und Alex entdeckte in dem Licht einen Mann, der sich krampfhaft an einer Sitzgruppe festhielt und sich übergab, während unweit von ihm eine Frau verzweifelt den Inhalt ihrer zu Boden gefallenen Handtasche aufzusammeln versuchte. Im hinteren Teil des Restaurants gelang es einem dicken Asiaten trotz der Unterstützung der Mitarbeiter des Restaurants nur mit Mühe, das Gleichgewicht zu wahren.
Alex folgte der Südamerikanerin hinüber zum Tresenbereich samt Grill und Bordküchen-Durchreiche. Dort sperrte sie eine Tür zu einem schmalen Raum mit Regalen auf, auf denen mindestens drei Dutzend roter Rettungswesten aufgestapelt waren. Während sie einen Erste-Hilfe-Koffer von der Wand löste, zwängte Alex sich, ohne weiter nachzudenken, an ihr vorbei, griff nach einer der Rettungswesten und legte sie sich gemäß der Notfallübung zu Beginn der Reise an. Dann drückte er seiner Begleiterin kurz entschlossen ebenfalls eine der Westen in die Hand. »Besser, Sie tragen auch eine. Und vielleicht nehmen wir auch gleich ein paar von denen mit nach hinten?«
Die Kreuzfahrtmitarbeiterin wirkte unschlüssig. »Eigentlich bedarf es dafür einer Weisung von der Brücke.«
»Wie denn, bei ausgefallener Bordkommunikation?«
Die junge Frau nickte und schlüpfte ihrerseits in die Weste – als sie beide ein befremdlicher Laut innehalten ließ. Ein dumpfes Dröhnen, dem ein eigentümliches Prasseln folgte.
Nein … es klang mehr wie reißendes Papier … oder das durchdringende Knattern einer Plane. Der Laut drang ihm bis ins Mark.
Was war das?
Alex lauschte angestrengt und war sich mit einem Mal sicher, dass das unangenehme Geräusch nicht vom Schiff selbst, sondern von irgendwoher weit draußen auf dem Meer stammte.
Um sich zu orientieren, eilte er aus dem Kabuff, als jäh die Türen und Schubladen des Küchenbereichs aufsprangen. Teller, Tassen, Gläser und Geschirr krachten lawinenartig auf den Boden. Messer, Gabeln und Löffel hingegen hingen für einen irrwitzigen Augenblick in der Luft, nur um dann quer durch den Saal auf das Panoramafenster des Restaurants zuzujagen. Ihnen folgten der Rost des großen Grills, einige Fleischermesser und Suppenlöffel aus der Bordküche sowie ein riesiger Kochtopf, der lautstark mit den Türen der Durchreiche kollidierte, bevor auch er wie eine Kanonenkugel an Alex vorbeischoss, um auf der gegenüberliegenden Seite des Raums gegen die Fensterfronten zu krachen.
Alex starrte das Phänomen ungläubig an. Eines der Messer steckte sogar im Glas, während die übrigen Besteckteile wie wütend ruckelnde Rieseninsekten an den Fenstern klebten.
Nur am Rande nahm Alex die Schmerzensschreie jener im Raum wahr, die von dem metallenen Geschosshagel getroffen worden waren, denn das Bild, das sich ihm draußen auf See bot, war ungleich entsetzlicher: Die beschädigte Fensterfront gewährte ihm einen Blick auf die Querachse des Schiffes. Und dort war jetzt ein tiefes Wellental auszumachen, hinter dem sich eine gewaltige schwarze Wasserwand aufgetürmt hatte. Rasend und schäumend näherte sie sich der Sea Quest. Eine Freak-Wave. Eine Monsterwelle!
Sicher dreißig Meter hoch.
Alex fuhr zu seiner Begleiterin herum, die soeben aus dem Kabuff trat und erschrocken auf die heranrollende Riesenwelle starrte. Hektisch schloss er die Verschlüsse ihrer Rettungsweste. »Beeilen Sie sich. Wenn uns das Ding trifft, dann …«
Das Kreuzfahrtschiff kippte auf die Backbordseite, sie beide stürzten, dann brach die riesige Wasserwand über die Sea Quest herein. Die Fensterfront knackste lautstark, das Glas überzog sich mit Rissen, und unter ohrenbetäubendem Getöse barsten die Scheiben.
Meerwasser flutete den Saal.
Alex spürte, wie ihn eine titanische Kraft emporriss, anhob und herumwirbelte.
Dann wurde es schwarz um ihn.
Gestrandet
Sonnenstrahlen kitzelten Itzils Augenlider, und Wellen schwappten über ihre Beine.
Sie lag unbequem auf der Seite, während die Rettungsweste ihr gegen die Rippen drückte. Aus der Ferne drang das Geräusch von Brandung an ihre Ohren, ihr Mund schmeckte nach Salzwasser, und es roch nach Strand, Muscheln und … Öl.
Verzweifelt kämpfte sie um ihr Bewusstsein, öffnete die Augen – und starrte in die glanzlosen Augäpfel eines korpulenten Mannes um die vierzig, der ein buntes Hawaiihemd trug und dessen rotes Haar mit Tang bedeckt war.
Der Mann war tot!
Itzil keuchte entsetzt auf und kämpfte sich mühsam in die Höhe. Sie war auf einem warmen Sandstrand mit hohen schwarzen Basaltfelsen zu sich gekommen. Hinter dem Toten war Treibgut angespült worden, darunter ein Koffer und Kleidungsstücke, herrenlose Rettungswesten und sogar ein kompletter Sonnenschirm samt Teilen einer Liege. Und doch hatte sie nur Augen für den Toten, der keine zwei Schritte von ihr entfernt lag und sie vorwurfsvoll anstarrte.
Itzil wich panisch vor der Leiche zurück, kippte, weil der Anblick Übelkeit in ihr aufsteigen ließ, zurück auf alle viere, übergab sich krampfhaft und glaubte, dem Geschmack nach vor allem Meerwasser auszuspeien. Dann, endlich, schaffte sie es wieder hoch und taumelte auf einen grünen Dschungel zu, der sich in fünfzehn oder zwanzig Schritten Entfernung abzeichnete: eine üppige grüne Wand aus Mangroven, Kletterpflanzen und prächtigen Palmen. Bereits auf halber Strecke ließ sie sich erschöpft erneut auf die Knie fallen und sah sich abermals entsetzt um.
Sie hatte keine Ahnung, wo sie hier gelandet war, aber zumindest das Warum war offensichtlich. Allerdings hatte sie an das Schiffsunglück selbst nur noch wenige Erinnerungen und konnte sich lediglich an diese Monsterwelle erinnern, die auf das Kreuzfahrtschiff zugerollt war. Alles danach war in dunkle Schleier gehüllt.
Um einen erneuten Blick auf den Toten zu vermeiden, starrte sie krampfhaft an Basaltfelsen und Treibgut über eine Bucht hinweg aufs Meer hinaus, wo am fernen Horizont noch immer auf ganzer Breite schwarze Sturmwolken den Himmel verfinsterten, in denen hin und wieder grelle Blitze zuckten. Irritiert schüttelte sie den Kopf, denn hier auf der Insel schien die Sonne warm auf sie herab und brachte das türkisfarbene Wasser über weite Strecken zum Glitzern. Nur dass der Sonnenball jenseits der treibenden Schäfchenwolken von einer Korona aus eigenartigen Lichtreflexen umgeben war, die sich in weißlichen Kreisen und Bogen manifestierten. Solche Haloeffekte kannte sie nur von Fotos.
Während sie stirnrunzelnd die Sturmwolken in der Ferne betrachtete, wehte ihr ein angenehm warmer Seewind ins Gesicht, über ihr kreisten Möwen am Himmel, und die Wellen brandeten in gleichmäßigem Takt gegen den Strand. Ganz so, wie an einem lauschigen Urlaubstag in der Südsee – wären da nicht überall die schrecklichen Zeugnisse der Schiffskatastrophe gewesen.
Ein Grummeln wie bei einem Gewitter drang an ihre Ohren, doch sie war sich nicht sicher, ob das Geräusch wirklich von dem fernen Unwetter herrührte.
Itzil atmete tief ein und sah sich aufmerksam um. Die Flut hatte sie am Küstenstreifen einer halbmondförmig geschwungenen Bucht an Land geschwemmt. Neben den dunklen Basaltfelsen, die unregelmäßig über den sandigen Küstenabschnitt verteilt waren, konnte sie linker Hand, in etwa zweihundert Metern Sichtlinie, eine vielleicht vier oder fünf Meter hohe Anhöhe aus dunklem Felsgestein ausmachen, die den Strand wie ein zerklüfteter Wall begrenzte. Rechter Hand hingegen zog sich der breite Sandstreifen weitere sechshundert oder siebenhundert Meter in die Länge, um schließlich an einer dicht von Mangroven bewachsenen Halbinsel auszulaufen, die ein gutes Stück weit auf das Meer hinausragte. Itzil folgte der Landzunge mit ihren Blicken bis zur Spitze – und verlor schlagartig auch den letzten Rest an Hoffnung.
Da draußen auf dem Meer konnte sie die Sea Quest ausmachen, auf der sie gute zwei Monate gearbeitet hatte.
Zumindest das, was von ihr übrig war.
Denn das Bild, das das havarierte Kreuzfahrtschiff bot, war niederschmetternd.
Ähnlich wie beim Unglück des italienischen Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vor acht Jahren, das die gesamte Kreuzfahrtbranche aufgerüttelt hatte, lag das einstmals so stolze Schiff schwer auf der Seite und wurde quer über zahlreiche Decks hinweg vom Meer umspült. Ein gutes Drittel des Schiffes lag unterhalb der Wasserlinie. Wie eine Speersitze ragten der Schornstein und die Aufbauten der Bugsektionen schräg aus dem Wasser.
Die komplette Szenerie erschien ihr so unwirklich.
Aufgewühlt kramte sie nach ihrem Handy, doch es war fort. Alles, was sie fand, war ihr Bund mit Schlüsseln für Schränke, Spinde und Schiffskabinen, eine durchnässte Packung Taschentücher, einige Münzen und ein Lippenstift.
Ihr Blick glitt kurz hinüber zu der Leiche, dann suchte sie auch den Rest des Strandes mit Blicken ab. Sie entdeckte einen weiteren Toten in einer Stewarduniform. Die See hatte ihn mit den Füßen voran angespült, während sein Oberkörper im Wasser lag und gelegentlich auf und ab schwappte. Itzil erhob sich mit zusammengepressten Lippen und ging im Geiste die Namen ihrer Kollegen und Freunde durch, die ihr etwas bedeuteten: Joziah, Livi, Roman, Tom und natürlich Valery, die sich damals gemeinsam mit ihr beworben hatte.
Wieder schaute sie zu der halb versunkenen Sea Quest – und jäh beschlich sie ein schlimmer Verdacht.
Waren sie und ihre Freunde vielleicht für die Havarie verantwortlich?
Nein. Unmöglich. Oder doch?
Verzweifelt biss sie sich auf die Lippen und ging den Plan noch einmal durch. Nein. Es sei denn, Roman hatte Mist gebaut. Oder Livi. Doch ehrlich gesagt, kannte sie niemanden, der verlässlicher war als Livi. Andererseits war niemand gegen Fehler gefeit …
Die Hand vor den Mund gepresst, stand sie da und konnte sich nicht aufraffen, um nachzusehen, wer der Tote in der Stewarduniform war. Ihre Hand zitterte leicht, und am liebsten wäre sie auf der Stelle in Tränen ausgebrochen. Doch Itzil widerstand dem Impuls, sich gehen zu lassen. Natürlich, sie stand unter Schock, aber im Moment war allein entscheidend, ob auch andere das Unglück überlebt hatten. Die Sea Quest hatte diesmal 321 Passagiere befördert. Hinzu kamen noch einmal fast 210 Crewmitglieder. Sie konnte nicht die einzige Überlebende sein.
Sie durfte nicht die Einzige sein.
Unschlüssig machte sie einige Schritte auf das Meer zu – als sie rechter Hand, hinter einem der hohen Basaltfelsen, eine menschliche Regung bemerkte. Gute vierzig Meter von ihr entfernt.
»Hey!« Sie winkte aufgeregt, schnallte sich endlich die Rettungsweste ab, nahm sie in die Hand und lief, so schnell es ging, über den Strand auf die Gestalt zu. Es handelte sich um eine Frau um die siebzig mit durchfeuchtetem, beigefarbenem Sommerkleid und aufgelösten graubraunen Haaren.
»Hier ist ja doch jemand!«, rief ihr die alte Dame entgegen. Offenkundig eine US-amerikanische Passagierin. Etwa hundert Meter hinter ihr konnte sie eine rote, in sich zusammengefallene Rettungsinsel im Wasser ausmachen, deren Reste träge auf den Fluten schwappten.
Erst jetzt sah Itzil, dass hinter einem der wuchtigen Basaltfelsen – nur wenige Meter von der Frau entfernt – ein ebenfalls etwa Siebzigjähriger mit lichtem Haarkranz, braunen Shorts und verschmutztem Kakihemd im Sand kniete und einem blonden jungen Mann mit Jeans und Rettungsweste mit Mund-zu-Mund-Beatmung zu helfen versuchte. Itzil riss überrascht die Augen auf, denn sie erkannte den Beatmeten sofort wieder. Das war der Deutsche, der im Restaurant dafür gesorgt hatte, dass auch sie die rettende Schwimmweste angelegt hatte.
Der junge Mann würgte, der Amerikaner drehte ihn auf die Seite, und sie sah mit an, wie der Deutsche einen Schwall Wasser erbrach, hustete, schließlich tief einatmete und verwirrt aufsah.
Itzil eilte an der Frau, die sie zuerst entdeckt hatte, vorbei und auf den jungen Deutschen und seinen Retter zu.
»Wo sind wir hier?«, krächzte der junge Mann irgendwann mit rauer Stimme.
»Keine Ahnung«, seufzte der Rentner. Er erhob sich mit knackenden Gliedern, schulterte eine kleine Segeltuchtasche mit wenigen Habseligkeiten, nickte Itzil erleichtert zu und wandte sich zum Mangrovendschungel um. »Das gilt es noch herauszufinden.«
Der Deutsche fasste nun sie ins Auge, und auch er erkannte sie wieder. Itzil schenkte ihm ein knappes Lächeln, wartete, bis er sich erholt hatte, und half ihm dann gemeinsam mit dem Amerikaner auf die Beine. Schockiert sah sich der junge Mann am Strand um, dann erblickte auch er die Überreste des Kreuzfahrtschiffes in weiter Ferne. »Oh, mein Gott.«
Nun wandte er sich direkt an sie. »Sie haben nicht zufällig meinen Kumpel gesehen? Der … mit der verletzten Amerikanerin?«
»Nein, tut mir leid.« Itzil schüttelte betreten den Kopf, und wieder überkam sie das schlechte Gewissen. Verzweifelt kämpfte sie es nieder. »Sie hier sind die Ersten, denen ich begegnet bin. Weiter hinten liegen zwei Tote. Aber …«, am liebsten hätte sie sich für die Unbedachtheit auf die Zunge gebissen, » … nicht Ihr Freund.«
Der Deutsche sah niedergeschlagen in die Richtung, in die sie gedeutet hatte, und dann wieder hinaus aufs Meer, an dessen Horizont sich noch immer die Nachwehen des Sturms austobten. Sie ahnte, was in ihm vor sich ging.
»Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen bedanken.«
»Wofür?« Ihr Gegenüber sah nachdenklich zum Himmel und dann auf seine Armbanduhr, die er schüttelte, wie um sie wieder zum Leben zu erwecken.
»Für die Rettungsweste.« Müde hob sie die Linke, mit der sie das Ding noch immer umklammerte. »Ich vermute, Sie haben mir damit das Leben gerettet.«
»Bislang die einzige gute Nachricht heute.« Der Deutsche hustete, kramte dann in seiner Jacke und zog ein Handy hervor. Das Display war schwarz. »Scheiße. Hat von Ihnen jemand ein Mobiltelefon?«
»Nein. Bei den Preisen an Bord habe ich es in der Kabine gelassen.« Der Amerikaner fuhr sich niedergeschlagen über seinen Haarkranz und sah Itzil fragend an, die lediglich den Kopf schüttelte.
»Was machen wir jetzt?«, wollte der Deutsche wissen.
»Ich denke, wir sollten erst mal nach weiteren Überlebenden Ausschau halten«, schlug der Rentner vor. »Vielleicht …« Er unterbrach sich, da seine ältere Begleiterin soeben dabei war, den Strand hinauf zum Dschungel zu marschieren. »Liebling, was machst du da? Bleib hier.«
Rasch eilte er ihr nach, und trotz seines Alters wirkte er auf Itzil erstaunlich fit.
Dabei glitt ihr Blick an dem älteren Pärchen vorbei zu der grünen Wand aus Palmen, Mangroven und Schlingpflanzen – und erstmals über die Baumkronen hinweg. Ihre Augen weiteten sich in Erstaunen, denn jenseits der Dschungelgrenze hob sich das unbekannte Land zunächst sanft, dann immer steiler werdend an. Die Pflanzendecke spannte sich bis hinüber zu einem gerippten Bergrücken in einigen Kilometern Entfernung, dessen markantester Punkt eine kegelförmige Erhebung war, die inmitten des allgegenwärtigen Grüns hoch zum Himmel aufragte. Über dem Kegel lag eine leichte Rauchfahne, und es grollte wie bei einem Gewitter.
»Ein Vulkan!« Auch der Deutsche starrte den rauchenden Berg überrascht an.
»Sieh doch, Schatz!«, rief nun die alte Dame und deutete erfreut auf den Dschungel. »Das sieht aus wie im Katalog! Wenn wir suchen, finden wir vielleicht unser Appartement.«
»Nein, Liebling, ich befürchte, nicht.« Ihr Mann nahm sie behutsam am Arm, und Itzil musterte die Frau. Dass die beiden verheiratet waren, hatte sie bereits vermutet. Allerdings schien die Frau etwas neben sich zu stehen. Der Amerikaner drehte sich entschuldigend zu ihnen um, bedeutete seiner Begleiterin zu warten und kehrte wieder zu ihnen zurück.
»Alles in Ordnung mit Ihrer Frau?«, fragte Itzil.
»Ja. Und nein.« Der Rentner rückte seufzend seine Segeltuchtasche zurecht. »Meine Frau leidet unter Demenz. Das hier sollte unsere letzte große Reise sein, bevor … na ja. Tut mir leid. Sie hat hin und wieder Aussetzer. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie sie ebenfalls etwas im Blick behalten würden.«
»Natürlich«, antwortete der Deutsche und kam Itzil damit zuvor. Er blickte in die Runde, während er sich nun ebenfalls die Rettungsweste löste: »Vielleicht sollten wir uns einander kurz vorstellen? Alexander Kirchner. Freunde sagen Alex zu mir. Ich stamme aus Deutschland.«
»Ihr Akzent verrät es.« Der Amerikaner schürzte knapp die Lippen, ehe er ihnen steif die Hand reichte. »Oliver Scott. Und meine Frau – Sophia.«
»Itzil Pérez«, stellte sich Itzil vor, der plötzlich bewusst wurde, dass das eigentlich nicht nötig war, da sie noch immer ihr Namensschild am Revers trug. Sie löste es und steckte es weg. »Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte«, sie sah hinauf zur Spitze des Basaltfelsens neben ihnen, der etwa drei bis vier Meter über den Strand aufragte. »Von da oben haben wir vermutlich einen besseren Überblick auf den Küstenabschnitt. Vielleicht finden wir so weitere Überlebende – und vielleicht auch … Wasser? Die Frage ist, ob wir da raufkommen.«
»Die Idee hat etwas.« Alex Kirchner wischte sich eine Strähne seines blonden Haars aus der Stirn und taxierte den Felsen. »Ich glaube, das schaffe ich.«
»Sicher?« Oliver Scott blieb skeptisch. »Gar nicht lange her, dass Sie noch bewusstlos waren.«
Der Deutsche winkte ab. »Es geht mir gut. Außer einigen Prellungen bin ich nicht verletzt und in meiner Freizeit Sportkletterer. Zwar nicht Free Climber, aber das hier sind auch nicht gerade die Alpen.«
Er trat an den Felsen heran, überprüfte seine Schuhe und spuckte in die Hände. Sogar Sophia Scott kehrte wieder zu ihnen zurück. Gespannt sah Itzil mit den älteren Herrschaften an ihrer Seite Alex Kirchner dabei zu, wie er sich erstaunlich behände an dem schwarzen Felsbrocken in die Höhe zog. Tatsächlich besaß der Fels genügend Spalten und Risse, sodass Itzil allmählich den Eindruck gewann, ebenfalls den Aufstieg schaffen zu können. Schließlich erreichte der Deutsche die Spitze und richtete sich über ihnen auf.
»Und?«, rief ihm Itzil zu.
Ihr Schicksalsgefährte spähte in die Ferne, dann winkte er nach unten und deutete in Richtung der Klippen. »Ich glaube, dahinten ist jemand. Hey! Hallo!«
Er schwenkte beide Arme. Schließlich machte er sich wieder an den Abstieg.
»Eine Frau, soweit ich das erkennen konnte«, erklärte er, kaum dass er den Fuß wieder in den Sand setzte. »Nur reagiert sie nicht. Und … ich glaube, dahinten sind noch weitere Tote.«
Itzil seufzte. Noch mehr Tote – natürlich. Egal, um die Sache mit dem Wasser würden sie sich später kümmern müssen.
»Gehen wir zu ihr«, schlug Oliver Scott vor.
Schweigend und vorbei an zahllosen weiteren Trümmerteilen – darunter vereinzelte Flipflops, leere Plastikflaschen und sogar Kleidungsstücke – mühten sie sich durch den Sand in Richtung des Klippmassivs, vorbei an dem Toten im Hawaiihemd und der Leiche ihres Kollegen, die sich noch immer mit der Brandung bewegte. Diesmal ahnte Itzil, wer er war. Sie kannte ihn nicht persönlich, aber soweit sie sich erinnerte, hatte er oben auf dem Sonnendeck gearbeitet. Sophia Scott schien inzwischen ebenfalls zu begreifen, in welche Lage sie geraten waren, denn sie klammerte sich am Arm ihres Mannes fest, und in ihrem Gesicht spiegelte sich das gleiche Entsetzen wie bei allen anderen.