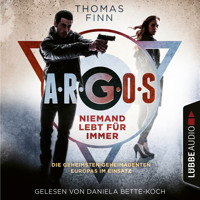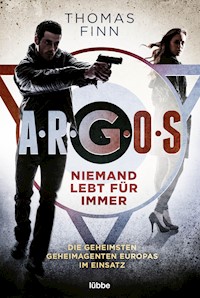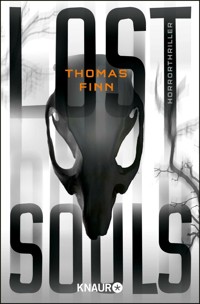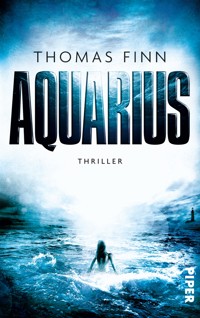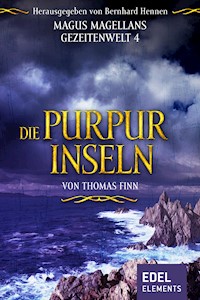
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gezeitenwelt
- Sprache: Deutsch
Magus Magellans Gezeitenwelt – "Das größte deutsche Fantasy-Epos, das jemals geschrieben wurde." Wolfgang Hohlbein Ein unheilvoller Schleier liegt über der Gezeitenwelt, und im Zwielicht des rätselhaften neuen Zeitalters nehmen alptraumhafte Wesen Gestalt an. Einzig das ferne Reich Eulykien verspricht Hoffnung. Denn dort erwartet das leibhaftige Orakel all jene, die verzweifelt genug sind, ihre erste und letzte Frage zu stellen. Auch Surjadora, die Kapitänin des Schiffs Stern von Andhakleia, erhofft sich von der Sphinx Hinweise auf das Grab des Leomedes, jenes Erfinders des geheimnisumwobenen Weltennetzes, dessen Macht sich von Küste zu Küste erstreckte. Und so führt sie die Suche dorthin, wo sie einst begann: auf die Purpurinseln … "Fantasy als opulente Schöpfungsgeschichte." Kai Meyer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Magus Magellans Gezeitenwelt – "Das größte deutsche Fantasy-Epos, das jemals geschrieben wurde." Wolfgang Hohlbein
Ein unheilvoller Schleier liegt über der Gezeitenwelt, und im Zwielicht des rätselhaften neuen Zeitalters nehmen alptraumhafte Wesen Gestalt an. Einzig das ferne Reich Eulykien verspricht Hoffnung. Denn dort erwartet das leibhaftige Orakel all jene, die verzweifelt genug sind, ihre erste und letzte Frage zu stellen. Auch Surjadora, die Kapitänin des Schiffs Stern von Andhakleia, erhofft sich von der Sphinx Hinweise auf das Grab des Leomedes, jenes Erfinders des geheimnisumwobenen Weltennetzes, dessen Macht sich von Küste zu Küste erstreckte. Und so führt sie die Suche dorthin, wo sie einst begann: auf die Purpurinseln …
"Fantasy als opulente Schöpfungsgeschichte." Kai Meyer
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2004 by Thomas Finn
Copyright © Idee, Konzeption und Herausgeberschaft: Bernhard Hennen
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Designomicon.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-703-5
facebook.com/edel.ebooks
Du siehst Dinge, und du sagt: Warum? Aber ich träume von Dingen, die es nie gegeben hat, und ich sage: Warum nicht?
GEORGE BERNARD SHAW
Gestrandet
Meer des Schlafes, auf einem Eiland nahe der Küste, am 9. Tag des Grünen Erntemondes zur Mittagszeit, im 459. Jahr der Abwesenheit Gottes
Gleich dem Atem eines lauernden Jägers schwebte das Geräusch über dem Wasser; es klang fremd und auf eigentümliche Weise bedrohlich. Nukulahi hielt in seiner Arbeit inne und blickte sich aufmerksam um. Doch ebenso unerwartet, wie der Laut an seine Ohren gedrungen war, ebbte er wieder ab.
Der Küstenstreifen, auf dem der coleopäische Prinz stand, war, soweit das Auge reichte, mit schwefeligem Sand, ölig glänzenden Steinen und Büscheln vertrockneten Grases bedeckt. Wie meist um diese Tageszeit hatte der Seewind aufgefrischt und trug einen schwachen Geruch nach verfaulten Eiern heran.
Doch was mochte das Geräusch verursacht haben? Nukulahi ermahnte sich, wachsam zu bleiben.
Schiffsführerin Surjadora hatte ihm das Kommando über ein gutes Dutzend Seeleute anvertraut, mit denen er mehrmals in der Woche mit dem Beiboot der Stern von Andhakleia und zwei Flößen, die aus Resten des zerstörten Vorderkastells ihrer Karavelle gefertigt waren, vom hiesigen Eiland aus zum nahen Festland übersetzte. Die mühsame Plackerei war notwendig, um möglichst unbemerkt von etwaigen Feinden die Reparatur an der schwer beschädigten Karavelle ausführen zu können, mit der sie vor so langer Zeit erst in den Osten und schließlich in den Süden Ajunas aufgebrochen waren. Der Prinz erinnerte sich noch gut an jenen unheilvollen Tag, da sie in Sadi einen Lotsen an Bord genommen hatten, der sie unversehrt durch das Meer des Schlafes hätte führen sollen. Doch statt seinen Auftrag zu erfüllen, hatte der Fremde sie in ein gefährliches Blasenmeer gelockt, dessen giftigem Odem die halbe Mannschaft erlegen war. Kurz darauf hatten Piraten versucht, das Schiff zu entern. Allein dem Schmaläugigen Gijao war es zu verdanken, daß sie diese Begegnung überlebt hatten. Dennoch waren zwölf Besatzungsmitglieder an der verpesteten Atemluft über dem Meer zugrunde gegangen. Die Überlebenden hatten noch Tage darauf unter Schwächeanfällen gelitten.
Das Eiland, das die Besatzung der Karavelle seitdem zum Versteck gewählt hatte, war unbewohnt, und die wenigen Pflanzen, die hier wuchsen, sahen braun und kränklich aus, waren sie doch von den Ausdünstungen der nahen See gezeichnet. Und so schaffte er mit den Seeleuten seit nunmehr fünf Monden Bauholz, Nahrungsmittel und Trinkwasser mühsam vom Festland herbei.
Hilfe von fremden Schiffen wagten sie nicht in Anspruch zu nehmen. Am fernen Horizont waren zwar immer wieder die Umrisse fremder Segler auszumachen, doch da nicht zu unterscheiden war, ob es sich dabei um friedliche Handelsschiffe oder weitere Piraten handelte, hatte Schiffsführerin Surjadora den Befehl erteilt, sich bis zum Ende der Reparaturen bedeckt zu halten.
Auch die Expeditionen zum Festland hatten sich als gefährlich erwiesen. Schon bei ihrer ersten Erkundungsmission hatte der Seemann Parvateo in den Wäldern des unbekannten Landstrichs drei halbverweste Leichen entdeckt, die kopfüber von einem Baum gehangen hatten. Wer sie dort aufgeknüpft hatte oder warum die Unbekannten dieses Schicksal hatten erleiden müssen, ließ sich nicht sagen. Doch die Toten hatten den Männern Angst eingejagt.
Einen Mond später hatte sich der übergesetzte Holzfällertrupp vor einer Schar kriegerisch anmutender Fremder auf Pferden verstecken müssen, die von dem dumpfen Schlag der Äxte angelockt worden waren. Als sie später Steuermann Lakshapheus von der Begegnung berichtet hatten, hatte dieser vermutet, daß es sich bei den Fremden um Angehörige eines der Reitervölker von Huarama gehandelt habe. Aus unbekannten Gründen war er überzeugt davon gewesen, daß Nukulahi und die seinen gut daran getan hatten, ihnen aus dem Weg zu gehen.
Auf diese Weise war Mond um Mond verstrichen, während die schwer beschädigte Stern von Andhakleia Stück um Stück instand gesetzt wurde ...
Erst eine halbe Stunde zuvor waren der Prinz und seine Männer mit neuer Festlandsbeute auf die kleine Insel zurückgekehrt. Nukulahi stand neben einem schwarzen Felsen und half einigen Seeleuten dabei, einen Baumstamm an Land zu hieven, der schon am Vortag in drei Teile zersägt worden war. Nicht weit von ihm entfernt dümpelten das Beiboot der Karavelle und ihre beiden großen Flöße in der Brandung. Die übrigen Seeleute waren damit beschäftigt, Fässer mit Frischwasser aus einer kleinen Quelle, die sie drüben auf dem Festland entdeckt hatten, zu einem einfachen Holzschlitten zu rollen. Mittels seiner Hilfe würden sie das kostbare Naß zu der Bucht schaffen, in der die Arbeiten am Schiff vonstatten gingen.
Direkt vor dem Schlitten aber stand erwartungsvoll Tvashi, ihr Schiffsjunge. Dem Knaben waren die Strapazen der letzten Wochen am wenigsten anzumerken. Für ihn schien die ganze Unternehmung ein einziges großes Abenteuer darzustellen. Der Wind spielte mit seinem zerzausten Haar, und das schmutzige Hemd hing ihm wie zerrissenes Segeltuch aus der Pluderhose – eine Gewohnheit, die dem Schiffsjungen regelmäßig eine Standpauke von Schiffsführerin Surjadora eintrug, die auch in dieser Lage Wert auf Disziplin und Ordnung unter den Mitgliedern ihrer Mannschaft legte. Nukulahi hingegen brachte Tvashis Anblick jedesmal aufs neue zum Schmunzeln.
Während er sich anschickte, dem Jungen eine scherzhafte Bemerkung zuzurufen, erklang der eigentümliche Laut aufs neue.
Es hörte sich an, als zerplatzten Schaumblasen. Das Geräusch jedoch hatte nichts mit jenem wohligen Knistern gemein, mit dem Gischt an Land zerstiebt, sondern ähnelte eher einer leisen, schnellen Abfolge heimtückischer Schnalzlaute. Nukulahis Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, und das Lachen und Schwatzen der Männer um ihn herum war nicht mehr als ein Summen in seinen Ohren.
Bei Eomes, was war das?
Der Coleopäer sah sich um und musterte jenen Bereich, wo Land und Meer aufeinanderstießen. Sein Blick heftete sich auf einen langgezogenen Gürtel verfaulenden Tangs, der ihn an einen glitschigen Wall gemahnte, errichtet von den Gezeiten, um den braunschillernden Schaumkronen Einhalt zu gebieten, die mit jeder Brandungswelle an die Küste des Eilands schwappten.
Da nahm er aus den Augenwinkeln heraus eine Bewegung wahr, keine vier Schritt von dem Jungen entfernt. Vor Schreck stellten sich seine Nackenhaare auf.
»Tvashi, paß auf! Neben dir ...« Sein Warnruf war noch nicht verhallt, als er auch schon den Baumstamm fallenließ, den er gepackt hatte, und zum nahen Boot hetzte, wo sein Speer quer über einer der Sitzbänke lag.
Der Schiffsjunge fuhr erschrocken hoch. Auch die übrigen Seeleute hatten den Ruf vernommen; verwundert hielten sie in ihrer Arbeit inne und wandten sich dem Prinzen und dem Jungen zu. Doch niemand verstand den Grund für Nukulahis eigentümliches Gebaren. Am trüben Himmel über ihnen kreiste einsam ein Federschnabel. Das Meer zwischen der Insel und dem Festland lag verlassen da. Hier war nichts, was auf eine Gefahr hindeutete.
Nukulahi wußte es besser.
»Was ist denn, Nukulahi? Hier ist doch ...«
Schon fuhr der Prinz Tvashi ins Wort. »Verdammt, Tvashi. Weg von dem Schlitten. Sofort!« Meerwasser umspülte die Waden des Prinzen, und die bronzenen Schuppen seiner Kriegsschürze klimperten gefährlich, als er in einer fließenden Bewegung nach seinem Speer griff und mit der Waffe in der Hand herumfuhr. Keinen Herzschlag lang hatte er den Strand aus den Augen gelassen. Der Knabe wollte seiner Aufforderung soeben nachkommen, als einer der Männer entsetzt aufbrüllte und auf das Wasser zeigte.
Dort, wo sich Tang und Meerschaum zu einem widerwärtigen Gemisch vereinten, erhob sich ein zuckendes schwarzes Etwas aus den Fluten – ein gewaltiger schwarzer Brocken mit gezackten Kanten, der zudem über ein Paar gestielter Augen verfügte, mit denen er heimtückisch die Umgebung musterte. Die eigentümlich tickenden Schnalzlaute waren jetzt unüberhörbar und verdrängten die aufgeregten Rufe der Männer, die panisch vor dem unbekannten Schrecken Reißaus nahmen. Bevor Nukulahi eingreifen konnte, hatte sich die monströse Krabbe auch schon auf ihren acht Schreitbeinen aus dem Schlamm gewühlt und jagte seitwärts auf den Schiffsjungen zu. Die beiden großen Scheren des Meeresungetüms klickten gefährlich.
Tvashi schrie vor Furcht, wirbelte herum und versuchte verzweifelt hinauf auf den Schlitten zu springen. Doch seine Füße fanden im Sand keinen Halt, und er strauchelte.
Während das Ungetüm näher kam, wurde Nukulahi bewußt, wie gewaltig es war. Die Krabbe wies Größe und Umfang eines Wagenrades auf, wie er sie in den Städten am Rand der Welt kennengelernt hatte. Mehr noch: Sie reichte ihm und den Männern fast bis zu den Oberschenkeln. Kalkablagerungen bedeckten ihren mächtigen schwarzen Panzer, und die ehrfurchtgebietenden Beine wiesen jeweils den Umfang dicker Holzscheite auf. Doch all dies war nichts im Vergleich zu den kürbisgroßen Scheren, die erregt auf und zu klappten.
Nukulahi stürmte nach vorn, holte weit aus und schleuderte in einer kraftvollen Bewegung den Speer, den ihm Schiffsführerin Surjadora damals bei der Abfahrt aus Andhakleia geschenkt hatte. In der jetzigen Lage war er froh darüber, daß seine alte Waffe mit der Spitze aus coleopäischer Bronze bei dem Zwischenfall in der andhakleischen Himmelswarte zu Bruch gegangen war. Eisen, wie es die Völker am Rand der Welt zu schmieden vermochten, war sicher das einzige Mittel, mit dem man einem Wesen wie diesem zu Leibe rücken konnte.
Der Speer beschrieb eine gerade Linie, hieb mit großer Wucht gegen den Panzer des Ungetüms – und prallte an dem Schild ab. Verzweifelt ballte der Coleopäer die Fäuste. Immerhin, der Angriff hatte das Ungetüm in der Bewegung innehalten lassen. Schon sah es sich nach seinem neuen Gegner um.
Tvashi richtete sich flink wieder auf und setzte in einem gewaltigen Sprung über den Schlitten hinweg. Erst als er gute zehn Schritte zwischen sich und das Meerungeheuer gebracht hatte, drehte er sich um und beobachtete bang die Anstrengungen der Seeleute, der Riesenkrabbe beizukommen. Die waren indes nicht untätig geblieben. Vier Männer unter Führung von Krishphos, die sich schon bei der Rettung der Schiffbrüchigen auf den Sireneninseln mit ihrem Mut hervorgetan hatten, hielten Äxte und Entermesser in den Händen. Gemeinsam kreisten sie das furchterregende Geschöpf ein. Auch die anderen Männer griffen jetzt zu den Waffen.
»Bei der Knute des heiligen Chrysantho, ist das Vieh riesig!« ächzte einer der Männer. »Schaut euch bloß die verdammten Scheren an!«
»Ihr wolltet mir ja nicht glauben«, fiel ihm Krishphos ins Wort. »Dieser Kerl in der sadischen Hafenschenke hatte mir doch erzählt, daß es im Meer des Schlafes von solchen Biestern nur so wimmelt. Jetzt habt ihr den Beweis.«
Der Seemann spuckte verächtlich aus und behielt die Krabbe mißtrauisch im Blick.
Die Stielaugen des Ungetüms pendelten indes aufgeregt hin und her. Ein penetranter Gestank nach totem Fisch schwängerte die Luft und ließ die Männer den schwefeligen Geruch des Meeres vergessen.
Das Geschöpf wirkte wie auf dem Sprung.
»Hat er dir auch erzählt, wie man dem Ungetüm beikommt?« wollte einer der Umstehenden mit banger Stimme wissen. Krishphos schüttelte unwillig den Kopf.
Nukulahi, der seinen Speer längst wieder an sich genommen hatte, reihte sich in den Kreis der Männer ein. Beiläufig strich er sich das lange Haar zurück und grübelte nach. Einen Augenblick lang hatte er das unheimliche Gefühl, als musterte ihn die Krabbe besonders eingehend, doch er mochte sich täuschen. Mit Sicherheit war dieses Ungetüm das größte Wesen seiner Art, das er je zu Gesicht bekommen hatte, viel größer als die roten, handtellergroßen Schwemmkrabben auf Pilu’huata und Lolo’tuma. Ja, das Geschöpf vor ihm war sogar größer als die seltenen Lahabehi-Krabben, die nicht nur den Fischern im Reich der Tausend Inseln, sondern auch deren Netzen gefährlich werden konnten. Lahabehi-Krabben erreichten immerhin die Größe eines Arms.
»Wir müssen es umwerfen.« Die Stimme des Prinzen war nicht mehr als ein Flüstern. Inzwischen hatten sich ihnen drei weitere Bewaffnete angeschlossen, die einander furchtsame Blicke zuwarfen. »Dieses Ding dürfte auf der Bauchseite weniger gepanzert sein als auf dem Rücken«, fuhr Nukulahi fort. »Oder wir warten, bis sich unser Freund von selbst wieder zurückzieht.«
»Ein guter Einfall«, meinte Krishphos und winkte zweien der Männer zu, die dem Tier den Rückweg zum Meer abschnitten. »Wenn wir eine Gasse bilden, dann ...«
Weiter kam er nicht. Plötzlich klickten die Scheren des Ungeheuers, und das Tier gab ein zischendes Geräusch von sich. Sand stob auf, und von einem Augenblick zum anderen jagte die Riesenkrabbe auf Nukulahi zu.
Speer in Brandung!
Nur seiner Behendigkeit hatte er es zu verdanken, den Speer gerade noch rechtzeitig zwischen sich und das riesige Geschöpf zu bringen. Mit einem häßlichen Kratzen schrammte die eiserne Spitze über den Panzer der Krabbe und verkeilte sich nahe dem Bruststück. Der Prinz stemmte sich in den Sand, woraufhin das Ungetüm ruckartig zum Stehen kam.
»Schnell, macht schon!« preßte der Prinz zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Die Waffe in seinen Händen zitterte unter der Belastung, und er mußte seine ganze Kraft einsetzen, um den fürchterlichen Gegner auf Abstand zu halten. Die Ausgeburt des Meeres führte derweil vor ihm auf dem Strand einen merkwürdigen Tanz auf. Unversehens spritzte Nukulahi Sand ins Gesicht, und er war einen Augenblick lang wie geblendet. Dann vernahm er ein häßliches Knacken, und er ahnte mehr, als daß er es sah, daß die Riesenkrabbe den hölzernen Schaft des Speeres mit den Scheren zertrümmert hatte.
Immer noch ohne jede Orientierung taumelte der Coleopäer nach vorn und fürchtete schon, in die Zangen des Ungetüms zu geraten. Doch im nächsten Augenblick brandete wütender Kampflärm um ihn herum auf. Mit dem Mut der Verzweiflung und von allen Seiten zugleich droschen die Seeleute jetzt mit ihren Äxten, Beilen und Entermessern auf das Meeresungeheuer ein. Splitter vom Panzer flogen durch die Luft, und ein lautes, schrilles Fiepen gellte über den Strand. Krishphos gelang es, der Krabbe mit einem gut gezielten Hieb seiner Holzfälleraxt eines der Beine abzuschlagen. Giftigrot spritzte es über den Strand. Wütend versuchte das Ungeheuer mit seinen Scheren nach dem Bein des Matrosen zu schnappen.
Inzwischen hatte sich Nukulahi den Sand aus den Augen gewischt und setzte mit dem verbliebenen Rest seines Speerschafts zu einem weiteren gutgezielten Hieb an. Mit Wucht sauste das Holz auf die wütende Krabbe nieder. Kurz darauf zeugte nur mehr eine blutende Wunde davon, wo sich soeben noch eines der Stielaugen befunden hatte.
»Aus dem Weg!«
Lautstark verschafften sich hinter ihnen fünf Seeleute Gehör. Die Männer wuchteten unter lauten »Hei-Ho!«-Rufen einen der großen Baumstämme heran und warfen ihn mit wütendem Gebrüll auf den Rücken des Ungeheuers. Die monströse Krabbe knickte unter der Wucht des Aufpralls ein und gab erneut eine Folge schriller Pfeiftöne von sich. Doch diesmal war sich der Prinz sicher, daß die Laute von der Todesangst des Tieres herrührten.
Schon bald hatten die Männer dem unter dem Stamm eingeklemmten Ungeheuer bis auf ein Bein sämtliche Glieder abgehackt. Schließlich rollten sie das schwere Holz beiseite und warfen das Geschöpf auf den Rücken. Anschließend hieben sie mit ihren Äxten so lange auf die weiche Unterseite ein, bis die auch letzten Zuckungen des Tieres erstarben.
Stille senkte sich über den Küstenabschnitt, die nur von dem Säuseln des Windes und den angestrengten Atemzügen der Seemänner durchbrochen wurde. Fassungslos beäugten die Matrosen das vor ihnen liegende Geschöpf. Niemand von ihnen hatte ein solches Monstrum je zuvor gesehen.
»Wenn ich wieder in Andhakleia bin, wird mir niemand von meinen Freunden glauben, daß ich mal mit so einem Ungetüm gekämpft habe.« Überrascht drehten sich die Männer zu Tvashi um, der sich unbemerkt in den Kreis der Umstehenden geschoben hatte. Noch immer war der Junge vor Schreck aschfahl im Gesicht, aber sein Blick funkelte vor ehrlich empfundener Genugtuung.
Krishphos musterte den Jungen, dann lachte er schallend. Auch die anderen Seeleute stimmten in das Gelächter ein, und selbst Nukulahi konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Wieso, was habt ihr denn?« wandte sich Tvashi empört an die Umstehenden. Doch zu Nukulahis Erleichterung blieben sie ihm die Antwort schuldig, denn in diesem Augenblick tauchten hinter einer hohen Düne zwei vertraute Gestalten auf.
Die eine war schon von weitem durch ihr langes, sonnenhelles Haar zu erkennen: Kallyê, die bildhübsche Leiterin des eulykischen Handelskontors in Andhakleia, die sie vor vielen Monden unter den Schiffbrüchigen auf den Sireneninseln aufgelesen hatten. Sie war in ihr enganliegendes grünes Gewand gekleidet, das ihre weibliche Figur betonte. Sowohl die silberne Kette, die sie um den Hals trug, als auch der lange Dolch, der in einer kostbaren, mit Mondsteinen verzierten Silberscheide in ihrem Gürtel steckte, erinnerten an ihre vornehme Herkunft.
Der coleopäische Prinz wußte als einer der wenigen an Bord, daß Schiffsführerin Surjadora tief in der Schuld der Eulykierin stand. Die geplante Reise nach Thalliopê, zugleich die Heimat Kallyês, war immerhin mit dem Gold der Kontorsleiterin bezahlt worden.
Wie jedesmal, wenn Kallyê in Erscheinung trat, verstummten die Männer und zwinkerten einander bedeutungsvoll zu. Nukulahi mußte sich wie schon oft während ihrer langen Reise eingestehen, daß ihm die zweideutigen Blicke der Matrosen insgeheim einen Stich versetzten. Ihm war klar, woran die Seeleute dachten.
Und woran dachte er, wenn er Kallyê sah?
Manchesmal kam es ihm so vor, als legte sie es darauf an, die Männer herauszufordern. Oder galten diese Versuche allein ihm? Er hatte nicht vergessen, daß Kallyê in Sadi versucht hatte, ihn zu verführen. Eomes sei Dank hatte er dieser Versuchung widerstehen können und sich beherrscht, um sich seine Jungfernschaft zu bewahren, ganz wie es die coleopäische Tradition vorsah.
Natürlich hatten sie einander seitdem nicht aus dem Weg gehen können. Doch in all den Monden, die sie zusammen verbracht hatten, hatten sie es vermieden, über jenen Abend in Sadi zu sprechen. Längst war zwischen ihnen eine Art Freundschaft erwachsen, auch wenn Schiffsführerin Surjadora ihn beständig ermahnte, nicht allzu vertrauensselig gegenüber der Kontorsleiterin zu sein.
Manche Nacht aber lag er insgeheim wach und dachte an jenen Abend in Sadi zurück, und seine Gedanken kreisten nicht mehr allein um jenes harmlose Lied vom Silbergarten, das Kallyê ihm damals vorgesungen hatte. Selbst seine Versuche, in solchen Momenten das Bild seiner coleopäischen Braut Tuilaepe heraufzubeschwören, die fern im Reich der Tausend Inseln auf ihn wartete, konnte ihn nicht davor bewahren, von der schönen Eulykierin zu träumen. Dafür verabscheute er sich selbst, denn in diesen Augenblicken war es nicht viel besser um ihn bestellt als um den verräterischen Thronräuber Tongaro, den zu stürzen er bei Eomes’ Namen geschworen hatte.
Der einzige Mann an Bord, den Kallyês Anblick scheinbar unbeeindruckt ließ, befand sich an ihrer Seite: Garuleos, der Schiffskoch der Stern von Andhakleia. Man mußte nur einen Blick auf seinen ausladenden Bauch werfen, um zu wissen, daß seine Leidenschaft anderen Genüssen galt. Schweren Schrittes stapfte der dicke Seemann neben der Eulykierin durch den Sand und machte durch heftiges Winken auf sich aufmerksam. Als er und Kallyê bei ihnen angekommen waren, griff er japsend nach einem Tuch und wischte sich über die schweißbedeckte Stirn.
»So weit ist es von der Bucht zwar nicht«, stöhnte er auf. »Aber bei den pöbelnden Götzen vom Ende der Welt, ich schwöre, bei diesem verdammten Sand hier kommt es mir jedesmal so vor, als müßte ich einen halben Tagesmarsch hinter mich bringen.«
Zwei der Männer lachten schadenfroh, und Nukulahi legte dem Schiffskoch verschmitzt die Linke auf die Schulter, schon um dem eindringlichen Blick zu entgehen, den Kallyê ihm zuwarf. »Wenn Ihr wünscht, übe ich mit Euch einige Laufschritte, die mir einst mein alter Lehrmeister Buralofa beigebracht hat.«
»Prinz, haltet Ihr mich für verrückt?« Garuleos tippte sich empört gegen die glänzende Stirn. »Ich habe einen Ruf zu verlieren. Zeigt mir lieber, was Ihr diesmal von Eurem Festlandsausflug mitgebracht habt.«
Tvashi drängelte sich nach vorn und deutete aufgeregt auf die tote Riesenkrabbe. »Schau doch, Garuleos. Dort!«
Nur zu gern gaben die Seeleute die Sicht auf das Meerungeheuer frei, das hinter ihnen am Strand lag. Nukulahi hörte, wie Kallyê beim Anblick der toten Bestie überrascht die Luft anhielt. Der Schiffskoch hingegen lächelte verzückt.
»Donnerwetter! Und auch schon in handliche Stücke zerlegt. Daraus läßt sich doch mal ein leckeres Süppchen zaubern. Wo habt Ihr die denn gefunden?« Garuleos bückte sich und strich mit der Rechten furchtlos über die scharfen Scheren. »Ich wette, daß das Fleisch zart und saftig ist. Das wird vielleicht ein Gaumenschmaus! Kapitänin Surjadora wird sich freuen. Aber hättet Ihr davon nicht noch drei oder vier weitere Exemplare mitbringen können?«
»Noch so ein Spruch, und wir stecken Euch selbst in den Kochtopf!« Innerhalb von Augenblicken war der Schiffskoch von aufgebrachten Matrosen umringt, die ihm wild gestikulierend den Kampf mit der Riesenkrabbe schilderten.
Kallyê lachte leise und wandte sich Nukulahi zu. »Ich freue mich, daß du bereits heute zurückgekommen bist.«
Der Prinz atmete tief ein und nahm den betörenden Geruch wahr, der von Kallyê ausging. Er wußte nicht, welche Öle sie aufgelegt hatte, aber hier an diesem Ort waren sie ein Labsal für seine Sinne. Erneut gewahrte er, wie schön die Eulykierin war. Unwillkürlich tastete er nach Tuilaepes Tuch, das er wie immer eng am Leib trug; es kam ihm wie ein Rettungsanker vor. Vielleicht wäre es gut, wenn er Kallyê irgendwann von seiner Braut erzählte? Vorsichtshalber.
»Ja, ich bin auch froh, daß wir wieder zurück sind. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, ausgerechnet hier auf einen solchen Gegner zu stoßen.« Seine Antwort war schroffer ausgefallen, als er es vorgehabt hatte. Nukulahi warf den zertrümmerten Speerschaft grimmig auf den nahen Schlitten. Vielleicht wußte Zimmermann Tarjixes noch etwas mit den Holzrest anzufangen. »Aber was meinst du mit ›bereits heute‹?«
»Nun, nach Aussage von Kapitänin Surjadora wird sich heute entscheiden, ob wir mit der Stern von Andhakleia wieder in See stechen können – oder ob wir das Schiff für immer aufgeben müssen.«
Betroffen starrte der Prinz sie an. »Was soll das heißen?«
Kallyê zog sorgenvoll die Stirn in Falten und strich sich eine widerspenstige Haarsträhne aus dem Gesicht. Selbst diese Geste wirkte bei ihr bezaubernd.
»Ich schlage vor, du sagst den Männern, daß sie sich beeilen sollen. Ihr seht euch das besser selbst an.«
Myrianders Segen
Meer des Schlafes, auf einem Eiland nahe der Küste, ein wenig später
»Die Männer sind bald soweit, Kapitänin.« Vor dem Zelt erklang gedämpft die Stimme von Steuermann Lakshapheus. Surjadora schaute gedankenverloren von ihrem Logbuch auf, das aufgeschlagen vor ihr auf der Seekiste lag. Die Pergamentseiten waren dicht mit der sorgfältigen, ihr eigentümlichen Handschrift gefüllt, die keinen Raum für verspielte Schnörkel ließ.
Ursprünglich hatte sie nur vorgehabt, die Eintragungen vom Vortag zu überprüfen, doch in einem für sie seltenen Anflug von Rührseligkeit hatte sie weiter zurückgeblättert, bis sie bei jenen Aufzeichnungen angelangt war, die Zeugnis von ihrer spektakulären Expedition in den Ozean des Morgens gaben. Im Namen Mahatargos’ III., des Maharadschas ihrer kurjamäischen Heimat, war es ihre Aufgabe gewesen, mit Hilfe einer alten Seekarte die sagenumwobenen Purpurinseln zu finden, jene geheimnisvolle Quelle des katauekischen Purpurreichtums, die sie für Kurjameos hatte erschließen sollen.
Doch es war anders gekommen, als sie geplant hatten. Zwar waren sie vom König der neuentdeckten Inselwelt auf die Hochzeit seines Sohnes Nukulahi und einer Inselschönheit namens Tuilaepe eingeladen worden, doch schon wenige Stunden später waren sie in eine entsetzliche Verschwörung verstrickt worden. Und als wäre all dies noch nicht genug der Schrecken gewesen, war zur selben Zeit eine unvorstellbare Katastrophe über die Welt hereingebrochen, ein himmlischer Schrecken, der all ihre sorgfältig ausgetüftelten Pläne umgestoßen und ihrer Flottille beinahe den Untergang beschert hatte .. .
»Kapitänin?«
Surjadora atmete tief ein, strich hastig den blauen Stoff ihres marinefarbenen Saris glatt und setzte ihre Maske des unerschütterlichen Gleichmuts auf. Keinen Augenblick zu spät, denn schon schlug ihr Steuermann die Zeltbahn am Eingang zurück und lugte besorgt durch den Spalt. Die Kapitänin schaute ihm geradewegs in die dunklen Augen.
»Ja, ich habe Euch gehört, Lakshapheus. Geht ruhig schon vor, ich bin sogleich bei Euch.«
Der Mann musterte sie aufmerksam, strich sich nachdenklich über den Wickelbart und nickte dann. Kurz darauf war er wieder verschwunden.
Surjadora atmete wieder aus. Lakshapheus war ein guter Mann, der beste Steuermann, den sie je in Dienst gestellt hatte. Seit jenem fernen Tag, da sie ihn auf dem Sklavenmarkt von Markomassa freigekauft hatte, teilten sie die Freuden und Entbehrungen, die ihnen ihre Fahrten auf See bescherten. Aber manchmal führte Lakshapheus sich ihr gegenüber wie eine Glucke auf.
Surjadora wußte selbst, daß sie ihrem treuen Steuermann gegenüber ungerecht war. Aber heute war eben einer jener Tage, an denen es ihr niemand recht machen konnte. Genau genommen handelte es sich um den 148. Tag, an dem sie schon morgens so gereizt war, daß sie am liebsten mit einem Belegnagel auf irgend jemanden losgegangen wäre, vorzugsweise auf diesen Kataueken Gijao näng Singua, der ihre halbe Ladung über Bord hatte kippen lassen. Denn so lange war es her, daß ihre stolze Karavelle von diesem elenden sadischen Lotsen in die Falle der Piraten gelockt worden war.
Zugegeben, ohne Gijaos Maßnahme würden sie heute vielleicht allesamt das Schicksal ihrer toten Kameraden teilen. Aber irgendein unberechenbarer Teil ihrer selbst wollte diesem durchtriebenen Kataueken die Schuld an der ganzen Misere geben.
Mürrisch klappte Surjadora den Deckel der Truhe auf und warf das Logbuch hinein. Anschließend erhob sie sich von dem mit Perlen bestickten Sitzkissen, das sie vor acht Jahren auf dem großen Markt in Elephantinos erworben hatte, und streckte ihre knackenden Glieder. Sie hatte das gute Stück für nur fünf Silberdubokinen erstanden. Doch selbst die Erinnerung daran, daß es ihr damals gelungen war, diesen eitlen elephantinischen Händler um ganze zwei Silberdubokinen herunterzuhandeln, verschaffte ihr heute keine rechte Freude. Es wurde verdammt noch einmal Zeit, daß sie wieder Planken unter den Füßen spürte.
Wie so oft in den letzten Wochen stieß Surjadora mit dem Turban gegen das schräg gespannte Tuch ihres Zeltes und bedachte es mit finsterem Blick. Wütend rückte sie ihre Kopfbedeckung zurecht, fegte mit einem leisen Fluch auf den Lippen das Segeltuch im Eingangsbereich zur Seite und trat ins Freie.
Die herzförmige Bucht, die sich nun vor ihren Augen ausbreitete, wurde von zwei Dutzend weiteren Notquartieren gesäumt. Seit Monden schon dienten sie als Unterkünfte für die Mannschaft.
Mit einem Blick auf zwei Hemden, die inmitten des Lagers an einer gespannten Wäscheleine hingen, stellte sie fest, daß der Wind beständig aus Nord-Nordwest wehte. Mit sich brachte er wie immer den fauligen Geruch vom Meer des Schlafes.
Dem Gefühl auf ihrer Wange nach mußte die Brise im Vergleich zum Morgen um einen Strich oder zwei aufgefrischt haben. Bestes Segelwetter. Hoffentlich war das ein gutes Omen.
Nicht weit von dem Zeltplatz entfernt, im Süden der Bucht, befand sich das Lager mit all den verbliebenen Gütern, die sie aus dem Bauch der schwer beschädigten Karavelle geborgen hatten, darunter gebogene Stoßzähne aus kurjamäischem Elfenbein, große Fässer mit merkantilischem Wein, mehrere Teppiche aus Gautamar, die ihren Weg zu den Häfen der Halbinsel Gwanapur gefunden hatten, und vieles andere mehr. Doch bei alledem handelte es sich nur um einen Bruchteil jener Güter, mit denen der Stauraum ihres Schiffes gefüllt gewesen war, als sie Sadi verlassen hatten.
Dann, endlich, richtete sie ihr Augenmerk auf ihr Schiff: die Stern von Andhakleia. Wie eine stolze hölzerne Festung, die von einem breiten Wassergraben eingefaßt wurde, thronte die Karavelle inmitten der matt schimmernden Bucht. Da die Männer das Schiff weitgehend leergeräumt hatten, lag sie hoch auf dem Wasser. Zwei Flöße dümpelten neben einer der Außenbordwände, und Dutzende von Männern turnten an Deck herum. Leise waren die kehligen Rufe von Schiffszimmermann Tarjixes zu hören, der die Mannschaft energisch zur Arbeit antrieb.
Surjadora atmete tief ein. Der Geruch schmelzenden Pechs trieb über das gekräuselte Wasser, und dumpf dröhnte von drüben der Hammerschlag.
Es hatte lange gedauert, das Schiff wieder in diesen Zustand zu versetzen. Der Beschuß, dem die Stern von Andhakleia beim Angriff der Piraten ausgesetzt gewesen war, hatte große Schäden angerichtet. Unter anderem waren mehrere Löcher in die Bordwand gerissen worden, darunter zwei, die unterhalb der Wasserlinie lagen und die sie auf dem Meer nicht hatten reparieren können.
Sie selbst war damals wie zahlreiche andere Mitglieder ihrer Mannschaft ohne Bewußtsein gewesen. Brahthos, den sie wegen seines besonnenen Vorgehens vor vier Monden zum Oberbootsmann befördert hatte, hatte damals alle verfügbaren Männer zu den Pumpen beordert und ein Lecksegel ausbringen lassen, mit dem er den Untergang der Karavelle abgewendet hatte, bis sich vor dem Bug des Schiffes diese Insel aus dem Meeresdunst geschält hatte.
Das Eiland mochte auf den ersten Blick karg und trostlos erscheinen, doch sie hatten Glück im Unglück gehabt. Die Bodenproben am Talg des Bleilotes hatten ergeben, daß der Grund der Bucht aus Sand bestand. Man hatte die Karavelle dort also getrost aufsetzen können.
Anschließend hatten sie das Zeltdorf errichtet und die Waren und Vorräte zusammen mit dem Ersatzteillager der Karavelle aus dem Schiffsbauch geschafft. In den darauffolgenden Tagen war die beschädigte Karavelle unter Anleitung von Schiffszimmermann Tarjixes auf die Seite gelegt worden, damit dieser mit seinen Gesellen den Boden hatte bearbeiten können.
Die schwere Plackerei war letzten Endes von Erfolg gekrönt gewesen, denn inzwischen wirkte die Karavelle fast wieder wie neu – wäre da nicht der gebrochene Hauptmast, der noch immer wie ein häßlicher Stumpen zwischen den neuen Aufbauten hervorlugte. Diesen Makel zu beseitigen würde sich als der gefahrvollste Teil ihrer Arbeit erweisen – eine Aufgabe, die ihnen heute bevorstand und die über das Wohl der Männer entscheiden würde.
»Ah, da ist die Kapitänin. Dann können wir wohl beginnen.«
Erst jetzt bemerkte Surjadora, daß Steuermann Lakshapheus nicht weit von ihrem Zelt entfernt auf sie gewartet hatte. In seiner Begleitung befanden sich Oberbootsmann Brahthos und der Nautiker Gijao näng Singua.
Ausgerechnet der Kataueke.
Der Anflug der guten Stimmung, der Surjadora beim Anblick ihres Schiffes erfaßt hatte, verflog sogleich wieder. Der Mangalier war in die einfache Kleidung eines kurjamäischen Seemannes gehüllt, nur, daß er sein Hemd offen bis zu den Oberschenkeln trug. Das schwarze Haar lief am Rücken in einem dicken Zopf aus.
Als Gijao sie erblickte, verzogen sich seine Lippen zu einem feinen Lächeln. Höflich verneigte er sich.
Natürlich hatte Surjadora nicht im Sinn, sich noch einmal von ihm täuschen zu lassen. Lieber hätte sie es gesehen, wenn der Kerl zum Wergzupfen eingeteilt worden wäre. Die vorhandenen Vorräte waren ohnehin knapp genug bemessen.
Die Kapitänin erwiderte das Lächeln des Mandeläugigen mit falscher Freundlichkeit und verschränkte die Arme auf dem Rücken.
»Nun, meine Herren, wollen wir zur Tat schreiten. Ich gehe davon aus, daß alles so weit vorbereitet ist, daß wir die letzte Etappe der Reparaturen in Angriff nehmen können?«
»Jawoll, Kapitänin.« Oberbootsmann Brahthos leckte sich fahrig über die Lippen und nestelte einmal mehr an seinem kupfernen Aionarsstern, der ihm vor der Brust baumelte. Surjadora wußte, daß Lakshapheus den Mann verdächtigte, als Spitzel für einen gewissen pater Massimilio zu dienen, jenen Kirchenmann, der in Andhakleia die Aufsicht über das Waisenhaus führte, in dem ihr Schiffsjunge Tvashareo aufgewachsen war. Doch Brahthos’ Benehmen war stets tadellos gewesen. Surjadora neigte inzwischen dazu zu glauben, daß die Verdächtigungen unbegründet waren.
Der Oberbootsmann deutete zur Bucht. »Wie Ihr sehen könnt, Kapitänin, warten die Männer nur noch auf Euer Kommando.«
Surjadora folgte seinem Fingerzeig. Die Zufahrt zur Bucht wurde von einer hohen, schwefelgelb schimmernden Klippe gesäumt, die aus dem dunkelsandigen Untergrund der Insel wie der Reißzahn eines kurjamäischen Tigers ragte.
Surjadora hatte die beiden verbliebenen Elephantinen der Stern von Andhakleia sofort nach Anlaufen der Insel hinauf auf die Klippen schaffen lassen, um die Bucht mit den Torsionsgeschützen gegen feindliche Angriffe zu sichern. Doch seit dem Vortag thronte dort oben in schwindelerregender Höhe ein Kran, dessen beweglicher Arm weit über das Felsmassiv hinausragte. Die mit großem Aufwand errichtete Konstruktion war aus den Stämmen gefertigt worden, die Nukulahi vom nahen Festland aus herbeigeschafft hatte. Stück für Stück hatten ihre Männer die Einzelteile des Krans auf das Massiv geschafft und dort oben zusammengebaut – eine handwerkliche Meisterleistung, die sie ohne die sachkundige Anleitung ihres Zimmermanns niemals hätten vollbringen können. Jetzt blieb ihnen nur noch zu hoffen, daß der Kran hielt und die entscheidende Reparatur gelang.
Als stünde ihr die Sorge ins Gesicht geschrieben, meldete sich nun auch Gijao zu Wort.
»Ich bin sicher, stolzeste Blüte des Meeres, das alles gutgehen wird. Morgen oder übermorgen wird uns unser Weg weiter nach Süden führen.«
»Sicher wird er das«, giftete sie zurück. »Und anschließend werde ich Euch wieder nach Andhakleia bringen.«
Das siegesgewisse Lächeln des Kataueken verdüsterte sich, wie Surjadora mit Genugtuung feststellte. Sie sah sehr wohl, daß sich Lakshapheus und Brahthos vielsagende Blicke zuwarfen, doch sie hatte schließlich niemandem Rechenschaft abzulegen. Sie war hier die Kapitänin.
»Ah, und da hinten kommen auch der Prinz und seine Leute.« Lakshapheus räusperte sich. »Sie hätten zu keiner besseren Stunde zurückkehren können.«
Tatsächlich tauchten hinter einer Düne die Köpfe Nukulahis, Kallyês und Tvashareos auf. Der Junge stürmte mit ausgestreckten Armen voran und schlitterte den sandigen Hügel hinab. Über Surjadoras Gesicht flog ein scheues Lächeln.
Schließlich kam auch der Rest der Seeleute in Sicht, die an langen Seilen den Holzschlitten hinter sich herzogen, auf dem Fässer und weitere Baumstämme festgezurrt waren.
»Gut, meine Herren. Verlieren wir keine Zeit. Laßt uns herausfinden, ob uns der Abwesende auch weiterhin gewogen ist.« Die Kapitänin wandte sich vorn Anblick der Neuankömmlinge ab und eilte mit energischem Schritt zu einem der Flöße, während Gijao und ihre beiden Offiziere sich auf den Weg zurr Ende der Bucht machten. Sie würden über Hängeleitern und künstlich angelegte Treppen auf das Steilmassiv gelangen, um dort an Ort und Stelle die Arbeiten am Kran zu beaufsichtigen.
Surjadora wollte das Floß gerade betreten, als Nukulahi zu ihr geeilt kam. Nicht zum ersten Mal mußte sich die Kapitänin eingestehen, daß der Prinz ein überaus gutaussehender junger Mann war. Seine golden schimmernde Kriegsschürze hob sich angenehm von seiner dunklen Haut ab, und sein geschmeidiger Gang und das Spiel seiner Muskeln ließen niemanden darüber in Zweifel, daß der Coleopäer ein begnadeter Kämpfer war. Surjadora wußte noch immer nicht zu sagen, ob diese kokette eulykische Kontorsleiterin den Prinzen aus persönlichem Gefallen umgarnte oder ob es der Purpurreichtum seiner Heimat war, der sie schon seit Monden wie eine rollige Katze um ihn herumschleichen ließ. Bislang hatte sich der Coleopäer als charakterfest erwiesen. Sie hoffte, daß es auch weiterhin so blieb.
Beunruhigt strich sich Nukulahi das lange Haar zurück und musterte die Kapitänin mit ernster Eindringlichkeit.
»Schiffsführerin, Kontorsleiterin Kallyê berichtete mir, es gebe Schwierigkeiten bei der Reparatur des Schiffes ...«
Die Kapitänin hob gleichmütig eine Augenbraue und lud den Prinzen ein, mit ihr zusammen auf das Floß zu steigen. Anschließend gab sie den Männern Weisung, zum Schiff überzusetzen.
»Nein, noch haben wir keine Schwierigkeiten. Aber es könnte zu welchen kommen. Am besten, Ihr seht Euch die Arbeiten vor Ort an. Im Gegensatz zu mir könnt Ihr schließlich schwimmen. Womöglich erweist sich dies ein weiteres Mal als zweckdienlich ...«
Schweigend setzten sie zur Stern von Andhakleia über, wo ihre Leute bereits das Fallreep zu Wasser gelassen hatten. Kurz darauf standen sie an Deck der Karavelle, wo sie von Zimmermann Tarjixes in Empfang genommen wurden.
»Ich freue mich, Kapitänin, daß Ihr die Arbeiten selbst beaufsichtigen werdet.« Im struppigen Vollbart ihres Landsmannes hatten sich einige Sägespäne verfangen, und die Ringe unter seinen Augen ließen ahnen, daß er die Nacht über gearbeitet hatte.
»Natürlich, Tarjixes«, Surjadora gestattete sich ein knappes Lächeln und hoffte, daß ihre eigene Aufregung nicht zu offensichtlich war. »Habt Ihr gedacht, ich wollte dem Spektakel von Land aus zusehen?«
»Natürlich nicht, Kapitänin.«
»Gut, dann laßt uns anfangen!«
Tarjixes nickte, wandte sich ab und brüllte seine Kommandos über das Deck. Ein gutes Dutzend Seeleute enterte das Fallreep und besetzten die Flöße. Der Anker wurde eingeholt, und am Bug des Schiffes wurden lange Trossen zu Wasser gelassen. Gemeinsam mit Nukulahi eilte Surjadora hinauf zum Achterdeck, wo sich das Steuerrad der Karavelle befand.
»Nun sagt schon, Schiffsführerin: Warum seid Ihr so besorgt?« Der Coleopäer stemmte die Hände in die Hüften und beäugte sie eindringlich. Unvermittelt lief ein leichtes Zittern durch das Schiff. Die Trossen hatten sich gespannt, und die Ruderer vorn auf den beiden Flößen zogen die Karavelle Stück für Stück in tiefes Wasser, dorthin, wo sich der steil aufragende Felsen befand.
»Wir werden heute den Hauptmast ersetzen«, erwiderte Surjadora, ohne den Blick von dem mächtigen Felsriesen abzuwenden. Auch Nukulahi legte den Kopf in den Nacken, um einen Blick auf die weit über ihnen verankerte Konstruktion zu werfen. Langsam zogen die Männer das Schiff unter den Felsen, bis sich der zerstörte Kreuzmast genau unter dem Ausleger des Krans befand.
»Anker werfen!« gellte Surjadoras Befehl über Deck. Sogleich rumpelte die Ankerkette durch die eisenverstärkte Klüse und klatschte laut ins Wasser. Die Männer auf den Flößen holten die Ruder ein, die Trossen entspannten sich, und Zimmermann Tarjixes scheuchte den Rest der Mannschaft auf, um die Karavelle an Ort und Stelle zu verholen.
Surjadora eilte zur Bordwand, um die Handgriffe der Matrosen zu überwachen. Fehler konnten sie sich heute auf keinen Fall erlauben.
»Den gebrochenen Mast aus dem Schiff zu entfernen ist der leichteste Teil der Übung. Aber wenn wir den neuen Mast einsetzen, kann es Ärger geben. Uns stehen hier an diesem Ort leider nicht die Hilfsmittel einer Werft zur Verfügung.« Die Kapitänin schaute dem Prinzen in die dunklen Augen. »Der neue Mast ist gut und gern 20 Schritt lang.«
»Ich weiß ... Ich war dabei, als wir den langen Stamm auf die Insel gebracht haben.«
»Richtig. Entscheidend ist aber sein großes Gewicht. Wenn wir den Mast mittels des Krans einsetzen«, sie deutete in die Höhe, wo Lakshapheus und die anderen nach und nach eine lange Trosse herabließen, »und er sich dabei löst, so daß er nicht auf der Mastspur auf dem Kiel landet, sondern auf dem Schiffsboden aufschlägt, dann besteht die Gefahr, daß er die Bordwand durchschlägt. Unsere Hauptsorge ist die Trosse des Krans. Wir wissen nicht, ob sie stark genug ist, den neuen Mast zu halten. Aber wir haben keine andere, die lang genug ist. Sollte die Trosse reißen, dann können wir nichts mehr für das Schiff tun. Das Wasser ist an dieser Stelle acht Schritt tief. Der Mast wird die Karavelle durchstoßen und auf dem Meeresboden festnageln wie ein Holzspieß die Käfer, die Ihr uns damals bei Euren Hochzeitsfeierlichkeiten vorgesetzt habt. Anschließend können wir dabei zusehen, wie die Stern von Andhakleia Stück für Stück untergeht.« Surjadoras Stimme hatte einen äußerst mißmutigen Klang angenommen, und sie klopfte sich gegen den Turban. »Also wünscht uns Glück, Prinz. Ansonsten ...«
Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich ab und hastete hinunter zum Hauptdeck, wo die Männer schon dabei waren, die Verkeilungen des zerbrochenen Mastes loszuschlagen und die Trosse des Krans anzubringen. Endlich steckte sich Zimmermann Tarjixes die Finger in den Mund, legte den Kopf in den Nacken und stieß einen lauten Pfiff aus.
Kurz darauf spannte sich das schwere Seil, und der Maststumpf wurde wie ein kranker Zahn aus dem Schiff gezogen. Ächzend und knarrend schwenkte der ausladende Arm des Krans hoch über ihren Köpfen herum und setzte den alten Mast nahe der Klippen ab, wo ein halbes Dutzend weiterer Männer schon darauf wartete, die Last in Empfang zu nehmen. In ihrer Obhut befand sich auch der neue Mast. Sorgfältig verbanden sie ihn mit der Trosse.
»Betet zu Eurem Eomes, mein Lieber«, wandte sich die Kapitänin wieder an Nukulahi, der ihr gefolgt war und die Arbeiten ebenso atemlos verfolgte wie sie selbst.
Unter der Mannschaft war inzwischen jedes Gerede verstummt. Mit bangen Blicken sahen die Männer zu, wie der neue Mast Schritt für Schritt angehoben wurde, bis er frei in der Luft pendelte.
Der Kran hoch über ihnen knarrte und quietschte besorgniserregend, doch die Trosse hielt. Die Männer um sie jubelten; Mützen und Turbane wurden durch die Luft gewirbelt, und die Männer fielen sich in die Arme.
Surjadora mochte ihre Freude noch nicht so recht teilen. Langsam schwenkte der Arm des Krans wieder zum Schiff herum, bis der neue Mast wie ein riesiger Speer senkrecht über dem Schiff hing. Wieder quietschte und ächzte es über ihnen. Die Trosse war zum Zerreißen gespannt, aber sie hielt noch immer. Ganz langsam wurde der Mast weggefiert und zum Kiel des Schiffes geführt.
Zimmermann Tarjixes war mit seinen Männern längst im Schiffsbauch verschwunden, um den Mastfuß mit dem Spurzapfen der Mastspur zusammenzuführen.
»Noch gute zwei Schritt«, gellte sein Ruf dumpf zu ihnen hinauf. Surjadora wollte seine Anweisung gerade weitergehen, als ein lauter Knall über ihren Köpfen zu hören war. Holzsplitter und kleinere Felsbrocken regneten auf das Schiff herab, und ferne Schreie gellten aus der Höhe zu ihnen in die Tiefe. Nicht die Trosse war der Schwachpunkt ihres Plans – es war der Kran selbst!
Die hölzerne Plattform, auf der die Konstruktion stand, kippte unvermittelt in Richtung See und drohte mitsamt dem Aufbau von der Klippe zu rutschen.
Beim Buckligen! Dort oben mußten sich die Verankerungen gelöst haben, mit denen sie den Kran an das Felsgestein gekettet hatten. Mit einem Ruck senkte sich der Schlagbaum über ihnen, dann kam die schwere Konstruktion wieder zum Stillstand. Halb hing sie über der Felskante, halb wurde sie noch von irgendwelchen Seilen gehalten. Weitere Gesteinsbrocken fielen in die Tiefe und prasselten auf die Karavelle nieder.
»Weg hier!« tönte es von oben. Surjadora glaubte in dem panischen Schrei die Stimme ihres Steuermanns herausgehört zu haben.
»Verdammt, was ist denn los? Ich brauche sofort ein paar Männer hier unten. Schnell!« Auch die Stimme der Zimmermanns, der von der drohenden Katastrophe noch nichts mitbekommen hatte, klang im höchsten Maße beunruhigt. An Bord und auf dem Wasser brach unterdessen das Chaos aus. Schreiend versuchten sich die Seeleute auf den Flößen in Sicherheit zu bringen.
Laut brüllte Surjadora ihre Befehle, doch während sie noch hoffte, wieder Ordnung in die Reihen bringen zu können, wurde sie mit großer Wucht von einem Gesteinsbrocken an der Schulter getroffen. Stöhnend sackte sie auf die Planken.
Als sie sich benommen umsah, bemerkte sie, daß vier Männer ohne Rücksicht auf ihr Leben durch die Vorluk in die Tiefe des Schiffsbauchs sprangen, um Tarjixes zur Hand zu gehen. Sie mußten das Schiff in Sicherheit bringen!
Wieder knarrte es weit über ihren Köpfen, und der Schlagbaum des Krans ruckte ein weiteres Stück in die Tiefe. Die gesamte Konstruktion oben auf dem Felsen war nun endgültig in Schieflage geraten. Mit lautem Schrei stürzte plötzlich ein Mensch in die Tiefe. Wild schlug er in der Luft um sich, bevor er sich wie eine Kerze streckte und steuerbords inmitten einer großen Fontäne auf dem Wasser aufschlug. Der Zopf, das Hemd ... das mußte der umtriebige Kataueke gewesen sein!
Surjadora richtete sich auf und stürzte zur Reling, völlig die Gefahr außer acht lassend, die weit über ihr dräute. Doch von Gijao war nichts zu sehen. Der coleopäische Prinz aber kletterte flink wie ein Knurrsalamander an dem neuen Mast empor. Zwischen seinen Zähnen blitzte die Klinge eines Entermessers, das er einem der Seeleute abgenommen hatte. Was hatte Nukulahi vor? Natürlich! Surjadora bewunderte die schnelle Auffassungsgabe des Coleopäers. Wenn der Kran in die Tiefe stürzte, mußte jemand die Trosse kappen, wollten sie verhindern, daß der Mast ein weiteres Mal brach. Doch viel wahrscheinlicher war, daß der schwere Holzaufbau selbst auf dem Schiff aufschlug.
»Wir haben es!« schallte es dumpf aus dem Schiffsbauch. Offensichtlich war es Tarjixes und seinen Leuten gelungen, den Mastfuß zu verankern. Keinen Herzschlag zu spät. Polternd und dröhnend gaben die letzten Verankerungen nach, die den Kran auf dem Massiv gehalten hatten, und die schwere Holzkonstruktion neigte sich mit lautem Quietschen weiter hinab. Nukulahi hatte indes das Mastende erreicht und hackte mit wuchtigen Hieben auf die Trosse ein.
Ein letztes Rumpeln ertönte über ihren Köpfen, und ein schwerer schwarzer Schatten stürzte auf sie herab.
Surjadora schloß in stiller Erwartung die Augen, nun von Hunderten Klaftern Holz erschlagen zu werden. Doch statt dessen riß ein heftiger Luftzug an ihrer Kleidung, dem ein lautes Klatschen folgte. Von Kopf bis Fuß mit Spritzwasser eingedeckt, riß sie die Augen auf und sah, wie zwei Mannlängen neben der Karavelle der schwere hölzerne Kran in den Fluten versank. Wie gelähmt starrte sie dem Unheil nach, das ihr Schiff und auch sie nur um Haaresbreite verfehlt hatte.
Beim heiligen Myriander! Sie war davon überzeugt, allein mit diesem Erlebnis alle Gunst des Hochheiligen auf einen Schlag verbraucht zu haben.
Wie im Nebel drangen die Jubelrufe der Seeleute an ihre Ohren. Hoch über ihr, an der Spitze des Mastes, winkte ihr Nukulahi zu, bevor er sich wieder auf den Weg nach unten machte.
Dieser verdammte Heißsporn! Der Prinz hatte es doch tatsächlich geschafft, die Trosse zu kappen. Mit breitem Grinsen wischte Surjadora sich die Wassertropfen aus dem Gesicht.
»Ihr da! Bei den ungezählten Köpfen der Hydra ... hört mich denn niemand?«
Surjadora wirbelte herum. Das war doch die Stimme des Kataueken! Gijao war aus gut 25 Schritt Höhe in das Meer gestürzt. Sie hätte keine einzige Kupferdubokine mehr für sein Leben gegeben.
»Könnte mir bitte jemand an Bord helfen?« Gleich einer Korkboje hüpfte der Kopf des Nautikers auf dem Wasser; sein langes schwarzes Haar rahmte ihn ein wie ein Schleier aus Tinte. Mit ruhigen Schwimmzügen hielt er auf die Karavelle zu. Nichts wies darauf hin, daß ihm der Sturz Schaden zugefügt hatte.
Wie hätte es auch anders sein können? Dieser Kerl war einfach nicht kleinzukriegen.
Kopfschüttelnd griff Surjadora zu einem Seil, verknotete es an der Reling und warf es grinsend dem Nautiker zu.
»Donnerwetter, Gijao, Ihr konntet es wohl nicht abwarten, wieder zurück an Bord eines ajunäischen Schiffes zu kommen!«
Der Kataueke ergriff dankbar das Seilende und schaute gereizt zu ihr auf. »Aber nicht doch, stolzeste Blüte der steinigen Liga. Du bist es, zu der ich zurückwollte. Bis ich dir begegnet bin, war mein Leben öde und voller Langeweile.« Ächzend zog er sich am Seil in die Höhe. »Ich finde, du solltet dich geschmeichelt fühlen«, fuhr er fort, während er mit seinen Füßen Halt an der glitschigen Bordwand suchte. »Denn ich wette, daß dir noch nie ein Mann nachgesprungen ist. Schon gar nicht aus solch einer Höhe.« Der katauekische Nautiker grinste frech über das ganze Gesicht.
Surjadora bemerkte zu ihrem Ärger, daß einige ihrer Matrosen feixend dein Gespräch lauschten. Das Blut schoß ihr ins Gesicht. Mit einem Ruck löste sie den Seemannsknoten. Gijao, der sich schon halb aus dem Wasser gezogen hatte, klatschte zurück in die Fluten.
Mit einer gewissen Genugtuung drehte sie sich zu den acht Männern um, die sich an der Reling versammelt hatten. Unter ihnen befand sich inzwischen auch der coleopäische Prinz.
»Habt Ihr nichts zu tun?«
Sogleich zerstreuten sich die Seeleute, doch die Kapitänin hielt den bärtigen Segelmacher ihrer Karavelle zurück. »Parvateo, irgendwelche Verletzte?«
»Nein, Kapitänin. Wir haben wirklich Glück gehabt. Zwei oder drei Männer haben Schürfwunden. Aber nichts Schlimmes. Und so, wie es aussieht, haben sich auch der Steuermann, Oberbootsmann Brahthos und die anderen in Sicherheit bringen können.«
Surjadora warf einen Blick zur steilen Felswand hinauf, wo sie Lakshapheus und seine Leute beim Abstieg ausmachen konnte. Erleichtert atmete sie aus und betrachtete dann zufrieden den neuen Hauptmast.
»Gut. Gebt den Männern Bescheid, daß wir als nächstes die Ladung wieder aufnehmen werden.«
Unten im Wasser wurden die wütenden Rufe des katauekischen Nautikers laut. Surjadora drehte sich zufrieden zu Nukulahi um. »Mein Prinz, seid doch bitte so gut und helft Gijao aus dein Wasser. Nicht daß sich unser katauekischer Gast noch eine Erkältung holt ...«
Der lange Zwangsaufenthalt auf dem Eiland ging nunmehr langsam dem Ende entgegen. Mit Sicherheit kann gesagt werden, daß die Geschehnisse während der langen Reparaturarbeiten zu einem Gefühl der Verbundenheit unter den Schicksalsgefährten beitrugen, das spätere Entscheidungen und Ereignisse nachhaltig beeinflußte.
Gegen Ende des Grünen Erntemondes im 459. Jahr der Abwesenheit Gottes war dieSTERN VON ANDHAKLEIAso weit wiederhergestellt, daß man mit ihr den Gefahren des Meeres trotzen konnte. Die beiden Elephantinen wurden von der Klippe gehievt und vorn auf dem Bugkastell eingesetzt.
Surjadora bestimmte das Fest der Rückkehr des Lichts im Jahr 460 der Abwesenheit Gottes zum Tag ihres neuerlichen Aufbruchs.
Das Meer wurde stürmischer, je weiter die Karavelle ihren Kurs nach Süden fortsetzte.
Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand an Bord ahnen, daß sich am fernen Horizont bereits weitere Schicksalsschläge abzeichneten.
Nicht nur, daß sich die Kirche des Abwesenden Gottes anschickte, die Spur der Kapitänin aufzunehmen. Auch zwei katauekische Pfauenschiffe aus dem fernen Tschöng-Hau Leng an der Mangalischen Küste jagten zu ebendiesen Stunden über den Ozeans des Abends. Getrieben wurden sie von einem mehr als denkwürdigen Passagier, und auch sie hatten das Orakel von Thalliopê zum Ziel ...«
SCHWESTER DOLORES, CHRONIK EINER VERLORENEN, ZEIT, BD. 11, NIEDERGELEGT ZU CANTAMO
Kirchengeheimnisse
Castrum dei des princeps von Andhakleia, Goldschlägerviertel von Andhakleia, zur Mittagszeit am 8. Tag des Sturmmondes, im 460. Jahr der Abwesenheit Gottes
Pater Massimilio saß an einem Pult in der ihm zugewiesenen Amtsstube der Ordensburg des Kirchenfürsten von Andhakleia. Eifrig studierte er die Berichte der vergangenen Tage. Wieder kein Hinweis, der ihm bei seiner Suche weiterhalf!
Bereits vor zehn Monden war princeps Purusheos seinem Wunsch nachgekommen, ihn von seinen Verpflichtungen im Waisenhaus der Stadt zu entbinden. Seit dieser Zeit hatte er das kirchliche Spitzelnetz im Universitätsviertel mit einer Besessenheit ausgebaut, die ihn selbst erschreckte. Leider war es ihm noch immer nicht gelungen, einen der Philosophen für seine Sache zu gewinnen. Sicher, fünf Studenten arbeiteten ihm seit geraumer Zeit zu, und auch unter den Bediensteten des Universitätsgeländes besaß er Augen und Ohren. Doch den Verlust von Schwester Rawalpinda konnte niemand von ihnen ausgleichen.
Massimilio wandte sich gedankenverloren von den eng beschriebenen Pergamentbögen ab. Sein Blick glitt an den mit Dokumentenrollen gefüllten Regalen vorbei und erfaßte den kleinen Tisch neben der Tür. Auf ihm stand eine Karaffe aus jenem bunten Glas, für das dieses Königreich so berühmt war. Ein Geschenk Rawalpindas. Seine einzige Erinnerung an sie.
Noch immer empfand er leisen Schmerz, wenn er an seine einstige Geliebte dachte. Bis heute hatte er keinen Hinweis darauf finden können, welchem Schicksal sie anheimgefallen war. Weder hatte man in den vergangenen Monden ihren Leichnam entdeckt, noch war nach Aussage von princeps Purusheos eine Nachricht von Bord der Stern von Andhakleia eingetroffen. Es war zum Verzweifeln.
Er wußte, er fühlte, daß sie tot war. Indes blieb ein schwacher Rest an Hoffnung, daß man sie vielleicht doch auf das Schiff der Kapitänin gebracht und mit der Karavelle verschleppt hatte.
Ein Klopfen an der Tür schreckte ihn aus seinen Gedanken.
»Herein.« Pater Massimilio legte die Unterlagen zur Seite und blickte zur Tür, in der nun pater Bavaphios stand, der magister officiorum des Kirchenfürsten.
»Bruder«, die Stimme des Priesters hatte einen Unterton, der dem Merkantilier gar nicht gefiel, »du wirst erwartet. Ich soll dich in die kleine Kapelle führen.«
»Und wer wünscht mich dort zu sprechen?« wollte Massimilio stirnrunzelnd wissen.
Die kleine Kapelle befand sich in einem abgelegenen Teil im Westtrakt des castrum dei und wurde nur für kleinere Zeremonien oder vertrauliche Zusammenkünfte genutzt. Der Sekretär schluckte und schien unangenehm berührt. Offenbar wußte er nicht so recht, was er auf diese Frage antworten sollte.
»Mir wurde auf getragen, darüber zu schweigen.« Bavaphios betonte das letzte Wort auf eigentümliche Weise. Was sollte diese Geheimniskrämerei?
Massimilio schob die Berichte seiner Spitzel ungehalten in eine lederne Mappe und klappte sie zu. Dann erhob er sich, folgte dem Kirchensekretär nach draußen und schloß sorgfältig seine Stube ab. Bavaphios führte ihn durch die Gänge der Ordensburg hinunter zur Kapelle und schwieg auch weiterhin, was ungewöhnlich für ihn war. Massimilio fand für dieses Gebaren keine Erklärung. Hatte er sich vielleicht etwas zuschulden kommen lassen? Oder, schlimmer noch, hatte man gar einen Hinweis auf den Verbleib Rawalpindas gefunden? Sollte letzteres der Fall sein, ahnte er, wie er das Verhalten des Kirchensekretärs zu deuten hatte.
Kaum hatten sie die letzte Biegung des Ganges erreicht, der direkt zur Kapelle führte, als Massimilio wie vom Donner gerührt stehenblieb. Vor der Tür zur Kapelle hatte ein Ritter mit prachtvoller Rüstung Stellung bezogen. Der bronzene Muskelpanzer, die Arm- und Beinschienen, alles war ganz im Stil des Alten Imperiums gefertigt. Seine Rechte hielt eine Hellebarde umfaßt, und seine Linke ruhte auf dem Waffengurt mit der verzierten Schwertscheide. Der lange rote Umhang wurde auf der linken Schulter von einer goldenen Spange mit einem weißemaillierten Gottesstern gehalten. Zweifellos war es kein Angehöriger der Kirchentruppen, der vor ihm stand, sondern ein Ritter des ordo executionis silentii finiti, der bewaffnete Arm des Roten Ordens.
Jetzt wußte er, wer ihn zu sprechen wünschte: Priester des ordo silentii mysteriorum. Die Bewahrer der verbotenen Geheimnisse der Kirche.
Massimilio war nicht wohl zumute. Noch nie hatte er einem Mitglied dieses Ordens persönlich Rede und Anwort stehen müssen. Böse Zungen behaupteten, die Roten Priester und ihre Ritter hätten die rote Ordenstracht deswegen gewählt, weil soviel Blut an ihren Händen klebte, daß ihre Soutanen immer besudelt wären. Vermutlich war dieser Umstand mit ein Grund dafür, warum viele Priester die Brüder und Schwestern dieses Ordens so fürchteten. Einige von ihnen hielten den Roten Orden sogar für die treibende Kraft hinter dem Thron der primarchin. Ob an dem Gerücht etwas dran war, wußte Massimilio nicht zu sagen. Ganz sicher aber trug die Geheimniskrämerei des Ordens zu dieser Vermutung bei. Er selbst wußte nur, daß es stets einen wichtigen Anlaß gab, wenn sich dessen Priester in einer Stadt blicken ließen.
Pater Bavaphios, der neben ihm stehengeblieben war, warf ihm einen um Verständnis heischenden Blick zu, nickte fahrig und eilte schnellen Schrittes zurück in seine Amtsstube. Ein wenig ähnelte sein Abgang einer Flucht, doch Massimilio konnte seinen Glaubensbruder verstehen. Auch ihm war alles andere als wohl zumute. Tief atmete er ein und ging hoch erhobenen Hauptes auf den Ritter zu. Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Dennoch, das ungute Gefühl blieb.
Eigentlich hätte der Gerüstete unter dem Helm mit dem Busch aus rotgefärbtem Roßhaar und den tief herabgezogenen Wangenklappen unsäglich schwitzen müssen. Doch im Gegensatz zu ihm selbst war dem Mann keine Regung anzumerken. Der pater wußte, daß der Ritter vor ihm zu den zuverlässigsten Kämpfern der Kirche zählte. Sollten die Roten Priester dem Mann befehlen, ihn zu erschlagen, so täte er das, ohne zu zögern.
Er würde auch dann gehorchen, wenn die Priester verlangten, Hand an sich selbst zu legen.
Erst als Massimilio schon ganz nah vor ihm stand, öffnete er steif die Tür.
Im Innern der Kapelle war es etwas kühler als draußen auf dem Gang. Es roch angenehm nach Sandelholz. Die Wände waren weiß getüncht, und durch die bunten Bleiglasscheiben der beiden hohen, bogenförmigen Fenster zu seiner Rechten fiel warmes Licht auf die schlichten Sitzbänke, die sich in zwei Fünferreihen an den Wänden zu seiner Linken und Rechten erstreckten. Ein Gang in ihrer Mitte führte zur Stirnseite der Kapelle, wo Massimilio einen entzündeten Rauchkessel ausmachen konnte. Er stand zu Füßen der Marmorstatue des heiligen Chrysantho. Die kurjamäischen Bildhauer hatten den Schutzpatron der iudicatoren als bärtigen Mann mit gestrengem Gesichtsausdruck dargestellt. Sein kräftiger Leib wurde von einer wallenden Tunika bedeckt, und in seinen Händen hielt er Schwert und Feder, die Attribute eines Richters.
Gefaßt blickte Massimilio zu den vorderen Sitzreihen, auf denen sich drei Rote Priester niedergelassen hatten und ihm die Rücken zuwandten. Sie schienen ins Gebet vertieft. Links und rechts vom Eingang hatten zwei weitere Ordensritter Aufstellung bezogen. So unbewegt, wie sie mit ihren rotschimmernden Rüstungen und Unihängen dastanden, ähnelten sie Statuen aus geronnenem Blut.
Doch Massimilio war nicht der einzige Priester im Raum, der eine weiße Soutane trug. In der Sitzreihe unmittelbar vor den drei Ordensangehörigen, ganz in der Nähe des Rauchkessels, saß ein rothaariger Priester, der ihm ebenfalls den Rücken zugekehrt hatte. Seine weiße Tracht nahm sich zwischen dem Blutrot der Priestersoutanen wie ein fahler Knochensplitter aus.
Gleich neben ihm kauerte ein Fremder, der keinesfalls der Kirche angehörte, ein pausbäckiger Mann mittleren Alters mit Rahmenbart. Als einziger im Raum trug er einen Turban, der mit verdrehten Lederschnüren verziert war – so wie es das wandernde Handwerksvolk dieses Reiches tat. Immer wieder sah sich der Pausbäckige verstohlen zu den drei Priestern hinter ihm um. Mehr noch, der Fremde wirkte zutiefst eingeschüchtert.
Ein dumpfer Laut erklang hinter Massimilio und durchbrach das eisige Schweigen in der kleinen Kapelle. Die Tür war wieder ins Schloß gefallen. Das Geräusch hatte etwas Endgültiges.
Als ob die drei Roten Priester einem unbekannten Ritus folgten, schlugen sie gemeinsam ihre Kapuzen zurück und drehten ihm ihre Gesichter zu. Es waren eine Frau und zwei Männer.
Massimilio hatte gehofft, auf den Anblick vorbereitet zu sein. Doch wie schon damals, während seiner Novizenzeit in Grazzianda, als er das erste Mal in seinem Leben Mitgliedern des Roten Ordens begegnet war, stellten sich ihm die Nackenhaare auf. Die Gesichter der Priester waren blaß, so als hätten sie schon seit Jahren die Sonne nicht mehr gesehen. Am unheimlichsten aber war der Anblick ihrer Münder, denn ihre Lippen waren mit Golddraht vernäht. Das Gesicht der Priesterin wurde überdies durch eine wulstige Narbe entstellt, die von ihrem Haaransatz bis hinunter zum Kinn verlief Doch nicht nur das. Massimilio gewahrte, daß ihnen allen die Hände fehlten. Ihn schauderte.
Über welches geheime Wissen geboten die Mitglieder des Roten Ordens? Aus welchem Grund waren sie so verzweifelt darum bemüht, sich selbst davor zu bewahren, Geheimnisse der Kirche in Wort oder Schrift an Außenstehende zu verraten, daß sie sogar den eigenen Körper verstümmelten?
Die Ordensschwester mit der Narbe wandte sich dem rothaarigen Priester in der Sitzreihe vor ihr zu und berührte ihn an der Schulter.
Der pater zuckte leicht zusammen, dann erhob er sich, strich die weiße Soutane glatt und wandte sich ebenfalls zu ihm um. Seine grünen Augen standen im reizvollen Kontrast zu der Haarpracht, die sein Haupt wie Feuermoos umschmeichelte. Wäre da nicht der gestrenge Zug um seine Lippen gewesen, Massimilio hätte den Priester geradezu als hübsch bezeichnet.
»Mater Schahikehe heißt dich willkommen, Bruder.« Der rothaarige pater sprach mit auffallend heller Stimme, und sein Dialekt ließ erkennen, daß er ebenfalls aus dem Merkantilischen Imperium stammte. »In ihrer Begleitung befinden sich pater Nutuga und pater Ephistaiphos.«
Der Priester deutete zu den Genannten, die beim Klang ihrer Namen kaum merklich nickten. Auch dies hatte etwas Gespenstisches.
»Ich selbst bin Bruder Darius. Ich diene dem ordo silentii mysteriorum als Sprecher.«
Massimilio atmete scharf ein. Es gelang ihm nicht, seinen Blick von den versiegelten Mündern und den Armstumpen abzuwenden. Die Roten Priester mochten als grausam gegenüber den Feinden der Kirche gelten, doch ihre Mitglieder schonten sich selbst auch nicht. Im Gegenteil.
»Wir sind aus Cantamo angereist«, fuhr der Priester fort, »da du eine Entdeckung von höchster Dringlichkeit gemacht hast. Ich bitte dich nun vorzutreten, damit mater Schahikehe, pater Nutuga und pater Ephistaiphos dich näher in Augenschein nehmen können.«
Massimilio räusperte sich befangen und fühlte ein unangenehmes Ziehen auf seiner kahlen Kopfhaut. War das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Keinesfalls konnte es bei alledem um den Verbleib Rawalpindas gehen. Es mußte vielmehr mit diesem Namen auf der Roten Liste zu tun haben ... Leomedes.
Wie gewünscht trat Massimilio einige Schritte vor und verbeugte sich knapp.
»Ich bin mir der Ehre bewußt, die mir in dieser Stunde zuteil wird«, verlautete er.
»Bruder Massimilio, mit deinem beständigen Kampf gegen die Feinde der Kirche hast du dir einen Ruf erworben, der bis nach Gandallo vorgedrungen ist«, fuhr pater Darius fort. »Bis heute warst du sehr erfolgreich darin, innere und äußere Feinde der Kirche aufzuspüren und diese vor ein Kirchengericht zu stellen. Der Rote Orden wünscht daher zu erfahren, ob du Aionar an anderer Stelle dienen möchtest. An einer Stelle, der es dem ordo silentii mysteriorum gestatten würde, dich mit einer Aufgabe zu betrauen, die ein höheres Geheimnis der Kirche berührt.«
Massimilio versteifte sich unmerklich, und seine Finger klammerten sich an den Stoff seiner Soutane. Er verstand sofort, wovon Bruder Darius sprach. Er konnte es auch in den stummen Blicken lesen, die ihm mater Schahikehe, pater Nutuga und pater Ephistaiphos zuwarfen.
»Der Grad der Weisheit, den du in diesem Fall erlangst, bedingt freilich, daß du dein Leben als Mitglied des Roten Ordens beschließt«, war Darius’ klare Stimme erneut zu vernehmen. »Willigst du ein, wird es kein Zurück mehr geben. Du weißt, auf welche Weise der Orden dafür sorgt, daß seine Mitglieder die gehüteten Geheimnisse bewahren.«