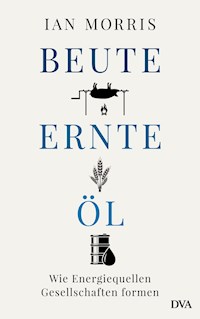
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was haben Ölplattformen mit unseren Wertvorstellungen zu tun?
Die meisten Menschen heutzutage halten Demokratie und Gleichberechtigung der Geschlechter für eine gute Sache und sprechen sich gegen Gewalt und Ungleichheit aus. Aber bevor sich solche Auffassungen und die damit verbundenen Wertvorstellungen allmählich im 19. Jahrhundert herausbildeten, galten 10000 Jahre lang genau gegenteilige grundsätzliche Annahmen und andere Werte. Woran liegt das? An unseren Energiequellen, sagt Ian Morris in seinem neuen großen Wurf, diese formen unsere Gesellschaft wie nichts sonst. Was kommt auf die Menschheit nach dem Ende der fossilen Ära zu? In seiner Bedeutung vergleichen führende Historiker »Beute, Ernte, Öl« mit Jared Diamonds »Kollaps« und Steven Pinkers »Gewalt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch:
Die meisten Menschen heutzutage halten Demokratie und Gleichberechtigung der Geschlechter für eine gute Sache und sprechen sich gegen Gewalt und Ungleichheit aus. Aber bevor sich diese Auffassungen allmählich im 19. Jahrhundert herausbildeten, galten 10 000 Jahre lang genau gegenteilige grundsätzliche Annahmen. Warum das so ist und wie es um unsere Gesellschaft in der Zukunft bestellt sein wird, erklärt Ian Morris in seinem neuen großen Wurf, in dem er Erkenntnisse aus Archäologie, Anthropologie, Biologie und den Geschichtswissenschaften zusammenführt. Durch den überraschenden Ansatz, die vielen Beispiele und die frische Sprache erinnert das Buch an Yuval Hararis »Kurze Geschichte der Menschheit«. In seiner Bedeutung vergleichen führende Historiker es mit Jared Diamonds »Kollaps« und Steven Pinkers »Gewalt«.
Über den Autor:
Ian Morris, gebürtiger Brite, ist seit zwanzig Jahren Professor für Geschichte und Archäologie an der University of Chicago und der Stanford University. Seine Arbeiten sind preisgekrönt und werden gefördert u. a. von der Guggenheim Foundation und der National Geographic Society. Von 2000 bis 2006 leitete er Ausgrabungen auf dem Monte Polizzo, Sizilien, eines der größten archäologischen Projekte im westlichen Mittelmeerraum.Sein Buch »Wer regiert die Welt?« (2011) wurde ein Bestseller.
Ian Morris
BEUTE, ERNTE, ÖL
Wie Energiequellen Gesellschaften formen
Aus dem Englischenvon Jürgen Neubauer
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe ist 2015 unter dem Titel Foragers, Farmers, and Fossil Fuels. How Human Values Evolve bei Princeton University Press in New York und Oxford erschienen. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2015 by Ian Morris Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: total italic, Thierry Wijnberg (Amsterdam/Berlin) Karten und Grafiken: Peter Palm, Berlin Lektorat: Andreas Wirthensohn Gesetzt aus der Minion Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-18276-2V001www.dva.de
Für Kathy und die Tiere
Inhalt
Einführung
Kapitel 1 Jedes Zeitalter bekommt die Werte, die es braucht
Kapitel 2 Wildbeuter
Kapitel 3 Bauern
Kapitel 4 Fossile Energie
Kapitel 5 Die Evolution der Moral: Biologie, Kultur und die Werte der Zukunft
Diskussion
Kapitel 6 Ideologie und die Werte, die ein Zeitalter braucht
Kapitel 7 Aber wie war es wirklich?
Kapitel 8 Wahre Werte, positive Werte und der Wert des Selbst
Kapitel 9 Wenn die Lichter ausgehen
Antwort
Kapitel 10 Meine korrekten Ansichten zu allem
Dank
Anmerkungen
Bibliografie
Register
Einführung
Stephen Macedo
Ian Morris’ elftes Buch Wer regiert die Welt?, das 2011 erschien, wurde als »genial«, »scharfsinnig« und »überwältigend« beschrieben. Es war ein in seiner Breite und Belesenheit beeindruckendes Werk, das obendrein noch packend geschrieben war. Morris gibt darin einen Überblick über 15000 Jahre Menschheitsgeschichte und fragt, warum sich Ost und West unterschiedlich entwickelt haben und warum die einen Kulturen aufstiegen, während die anderen untergingen. Am Ende wirft er die Frage auf, was die Zukunft bringen könnte, angesichts der zahlreichen Gefahren für die Menschheit – »Staatsversagen, Hungersnot, Seuchen, Klimawandel und Migration« –, die als unbeabsichtigtes Nebenprodukt die gewaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung begleiten, von der so viele Menschen profitieren.
Das vorliegende Buch ist ein Nachfolger zu Wer regiert die Welt?, in dem Morris ein weiteres Mal den ehrgeizigen Versuch unternimmt zu erklären, wie die rohen materiellen Kräfte unsere Kulturen, Werte und Überzeugungen prägen, darunter auch die Wertvorstellungen, die Menschen in den vergangenen 20000 Jahren entwickelt haben. Es basiert auf den beiden Tanner Lectures on Human Values, die Ian Morris im Oktober 2012 in Princeton hielt.
Morris’ These lässt sich wie folgt umreißen. Einige menschliche Grundwerte entstanden vor rund 100000 Jahren: »Fairness, Gerechtigkeit, Liebe und Hass, Selbstschutz und die gemeinsame Vorstellung, dass manche Dinge heilig sind«. Diese zentralen Anliegen (Kapitel 2), die sich in der einen oder anderen Form in jeder Kultur wiederfinden, wurden durch die »biologische Evolution unserer großen, schnellen Gehirne« (Kapitel 5) möglich. Morris erklärt außerdem, dass einige dieser Werte in gewissem Maße »bei unseren nächsten Verwandten unter den Menschenaffen« zu beobachten sind, eine These, die der Primatologe Frans de Waal bereits in einer früheren Tanner Lecture vertreten hat. 1
Die Menschen haben jedoch entscheidende Vorteile gegenüber anderen intelligenten Tierarten, und diese ermöglichen die Erfindung und ständige Weiterentwicklung der Kultur. Wir schaffen komplexe Wertsysteme, Normen, Erwartungen und kulturelle Muster, die Kooperation ermöglichen und unsere Überlebenschancen in einer sich verändernden Umwelt verbessern. Wie die biologische Evolution lässt sich die kulturelle Entwicklung verstehen als »Konkurrenzkampf, der sich in Millionen winzigen Experimenten abspielt« – der kulturellen Entsprechung von zufälligen Mutationen in der Biologie. Dabei »setzen sich diejenigen Eigenschaften durch, die in einer bestimmten Umgebung gut funktionieren, und ersetzen andere, die weniger gut funktionieren« (Kapitel 2).
Morris entwickelt eine Makrogeschichte der menschlichen Werte, die parallel zu drei aufeinanderfolgenden Phasen der menschlichen Entwicklung verläuft. Die Gestalt, die die menschliche Kultur in diesen drei Phasen annimmt, wird durch immer produktivere Formen der Energiegewinnung definiert: Wildbeuterei, Landwirtschaft und die Nutzung fossiler Energie. Morris stellt die These auf, dass diese Formen der Energiegewinnung die Formen der menschlichen Gesellschaft und damit der menschlichen Werte »bestimmen« oder zumindest deren Möglichkeiten »einschränken«. Jedes Zeitalter gelangt schließlich zu den Werten, die es braucht, weil sich erfolgreichere Formen der gesellschaftlichen Organisation durchsetzen und ihre Mitbewerber überflügeln. Diese funktionalistische Darstellung sieht menschliche Werte als »Produkt der evolutionären Anpassung, das heißt, Menschen passen ihre Werte an das sich verändernde gesellschaftliche Umfeld an, um ihre Wirksamkeit zu maximieren« (Kapitel 2).
Morris’ zentrale These ist, dass in jeder historischen Phase, von der Wildbeuterei über die Landwirtschaft bis zum Zeitalter der fossilen Energie, »die Form der Energiegewinnung ausschlaggebend war für die Größe und Dichte der Bevölkerung, dass sie die jeweils am besten funktionierende Form der gesellschaftlichen Organisation vorgab und dass diese ihrerseits bestimmte Werte erfolgreicher und attraktiver machte als andere« (Kapitel 5). Daher entwickelten frühe Gesellschaften von Jägern und Sammlern egalitäre Gesellschaftsstrukturen sowie Werte, die das Teilen in den Vordergrund stellten und Ungleichheit nur in geringem Umfang tolerierten, während sie zugleich relativ gewalttätig waren. Agrargesellschaften waren dagegen tendenziell stärker hierarchisch aufgebaut und weniger gewalttätig, weil sie auf diese Weise optimal funktionierten. Und die Fossilenergiegesellschaften, die im 18. Jahrhundert entstanden und zu denen wir gehören, sind ausgesprochen egalitär, was Politik und die Geschlechter angeht, sie tolerieren eine ungleiche Verteilung des Reichtums und sind weit weniger gewalttätig als alle früheren Gesellschaften.
Das ist eine grobe Vereinfachung von Morris’ Darstellung. Daneben betont Morris, dass auch technische Innovation und Geografie mit darüber entscheiden, welche Gesellschaften eine Vormachtstellung erlangen und wie das geschieht. Leser von Wer regiert die Welt? sind mit der Argumentation bereits vertraut: Innovationen in der Seefahrt machen beispielsweise den Zugang zum Meer zum Vorteil und ermöglichen den Aufstieg der großen europäischen Seefahrernationen.
In seiner Darstellung bezieht sich Morris auf einen großen Wissensschatz, und er entwickelt seine Argumentation mit außergewöhnlicher Klarheit und Witz.
Auf fünf kompakte Kapitel von Ian Morris folgen die Anmerkungen von drei herausragenden Wissenschaftlern und einer der bekanntesten Romanautorinnen der Welt.
Richard Seaford ist Professor für Altgriechische Literatur an der University of Exeter und Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze zu antiker griechischer Literatur, Religion und Philosophie sowie zum Neuen Testament. Nach Ansicht von Seaford ist Morris »ganz in der deterministischen Quantifizierung gefangen«, weshalb er mit seinen drei großen Phasen der menschlichen Entwicklung die Vielfalt der menschlichen Werte und kulturellen Formen vernachlässige. Nach Ansicht von Seaford bringt die Landwirtschaft nicht überall dieselben Werte hervor, und er führt das antike Athen als Gegenbeweis für Morris’ Determinismus an. Genau wie Jonathan Spence weist er auf die Tatsache hin, dass historische Dokumente in der Regel nicht auf die Sicht marginalisierter Völker eingehen, zumindest solange diese selbst nicht organisiert sind. Seaford fragt sich, warum Morris das gelegentliche Murren der Bauern nicht als Hinweis auf das Fortbestehen eines politisch machtlosen Egalitarismus ernst nimmt, der Zweifel daran aufkommen lässt, dass die bäuerlichen Gesellschaften die Ungleichheit akzeptiert oder gar für gut befunden haben könnten.
Seaford schließt mit einer Bemerkung zu Morris’ These, wonach jedes Zeitalter die Werte bekommt, die es braucht. Er wirft Morris vor, mit seinen Überlegungen zur historischen Entwicklung näher an den Vorstellungen der »Herrschenden« zu sein als an den Werten, die unser Zeitalter benötigt. Vor allem wirft er Morris vor, mit seinem Bezug auf die Evolutionstheorie und seiner Betonung von »Wettbewerb, Quantifizierbarkeit, Konsens und Effizienz« die Leitgedanken der kapitalistischen Wirtschaftsordnung allzu unkritisch übernommen zu haben. Wenn die Menschheit überleben soll, dann benötigt sie nach Ansicht von Seaford einen kritischeren und aufgeklärteren Umgang mit den von Morris benannten menschlichen Grundwerten: »Fairness, Gerechtigkeit, Liebe und Hass, Selbstschutz und die gemeinsame Vorstellung, dass manche Dinge heilig sind« (Kapitel 6).
Da sich Ian Morris in Wer regiert die Welt? mit der relativen Entwicklung und den künftigen Entwicklungschancen Chinas und des Westens auseinandergesetzt hat, passt es gut, dass unser zweiter Diskussionsteilnehmer Jonathan D. Spence ist, ehemaliger Sterling Professor für Geschichte an der Yale University und einer der führenden Experten zur Geschichte des modernen China. Wie die anderen Kommentatoren bewundert Spence die »formidablen Forscherqualitäten« von Morris, meldet jedoch gleichzeitig Vorbehalte an. Die Zahlen seien zwar erhellend, doch die Leser könnten davon profitieren, wenn er einen Eindruck vermittelte, ›wie es sich anfühlte‹, im Fruchtbaren Halbmond oder in den ›glücklichen Breiten‹ zu leben. Nach Ansicht von Spence war das Leben in diesen Regionen deutlich schwieriger, als diese Etiketten vermuten lassen. Wie Seaford bemängelt Spence, dass Morris mit seinen sehr allgemeinen Entwicklungsphasen eine gewaltige Vielfalt von menschlichen Erfahrungen zusammenfasst, die sich nur durch sehr viel detailliertere Beschreibungen verstehen ließen. Spence schließt mit einem Hinweis auf die Umwälzungen der vergangenen Jahre, zum Beispiel die Informationstechnologie und den »Cyberkrieg«.
Unsere dritte Diskussionsteilnehmerin ist Christine M. Korsgaard, Inhaberin des Arthur-Kingsley-Porter-Lehrstuhls für Philosophie an der Harvard University und vielleicht die führende kantianische Moralphilosophin der Welt. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zur Moralphilosophie und ihrer Geschichte, zur praktischen Vernunft, Normativität, Handlungstheorie und Identität sowie zur ethischen Beziehung zwischen Menschen und anderen Tieren. Korsgaard äußert Zweifel, dass Morris moralische Werte angemessen behandelt. In ihrem Beitrag unterscheidet sie zwischen »positiven Werten«, die konkret in bestimmten Gesellschaften vorherrschen, und »wahren moralischen Werten«, die wir leben sollten. Sie vertritt die Auffassung, »positive Werte erfüllen nur dann die evolutionäre und gesellschaftliche Funktion, die Morris ihnen zugedacht hat, wenn die Menschen glauben, dass es sich um wahre moralische Werte handelt«. Außerdem sei Bewertung im Sinne von Wertzuschreibung oder Inwertsetzung (valuing) etwas, »das sich gut oder schlecht ausführen lässt« (Kapitel 8). Und weiter führt sie aus: »Wenn Werte lediglich dazu dienen würden, Formen der gesellschaftlichen Organisation aufrechtzuerhalten, die mit bestimmten Formen der Energiegewinnung einhergehen, und wenn die Menschen dies wüssten, dann würden sie kaum funktionieren. Die Menschen müssen überzeugt sein, dass sie nach wahren moralischen Werten leben, denn sonst funktionieren diese Werte nicht.« Stattdessen beharrt sie auf dem Primat, oder zumindest der Gültigkeit der Ansichten der am moralischen Leben Beteiligten. Damit wirft Korsgaard folgerichtig die nächste Frage auf, »ob die Werte überleben könnten, wenn die Menschen an Morris’ Theorie glauben«. Das heißt, würden die Angehörigen zum Beispiel von bäuerlichen Gesellschaften die Werte dieser Gesellschaft – also ihre eigenen Werte – vertreten, wenn sie diese wie Morris lediglich als funktionale Anpassungen an bestimmte Formen der Energiegewinnung verstünden? Korsgaards Antwort ist Nein: Wir müssen den Akt der Bewertung aus Sicht der Bewertenden beurteilen, was die Existenz von »wahren moralischen Werten« voraussetze, die hinter unseren Bewertungen anderer Menschen und unserem eigenen »normativen Selbstverständnis« stehen.
Korsgaard geht sogar noch weiter und hält es für nicht unrealistisch zu glauben, dass sich unsere Fähigkeit zur Inwertsetzung diesen wahren moralischen Werten tendenziell annähert, weshalb wir im Laufe der Geschichte gewisse moralische Fortschritte beobachten können. Doch sie räumt auch ein, dass die Wertzuschreibung Gefahr läuft, von gesellschaftlichen Kräften verzerrt zu werden, beispielsweise von Ideologien, aber auch von anderen äußeren Kräften wie Mangel oder Unsicherheit. Sie lässt die Möglichkeit zu, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren Druck auf unsere Werte ausüben, ohne sie jedoch zu determinieren (Kapitel 8).
Schließlich fragt sich Korsgaard, ob Morris überhaupt an die Existenz »wahrer moralischer Werte« glaubt. Scharfsinnig weist sie darauf hin, dass Morris’ eigener Ansatz der historischen Erklärung den wissenschaftlichen Annahmen und Methoden verpflichtet ist, die er selbst mit Fossilenergiegesellschaften assoziiert. Morris zeige jedoch keinerlei Anzeichen, die vermeintliche Überlegenheit seiner (und unserer) wissenschaftlichen Methoden zum Beispiel gegenüber den theologischen Sichtweisen der bäuerlichen Gesellschaft zu hinterfragen, die die Welt als von einem transzendenten Gott beherrscht sehen. In Fragen der Geschichtswissenschaften könnten wir damit sagen, dass Morris keineswegs ein Skeptiker ist und keine rein funktionale Sichtweise vertritt, nach der »jedes Zeitalter die Werte bekommt, die es braucht«. Wenn diese Formen des menschlichen Wissens – Wissenschaft und Geschichte – Fortschritte machen können, warum dann nicht auch die Ethik?
Unsere letzte Diskussionsteilnehmerin ist eine Romanautorin, die mit ihrer literarischen Vorstellungskraft mögliche Zukunftsvisionen ausgemalt hat. Margaret Atwood ist eine der großen Schriftstellerinnen der Gegenwart und Autorin von mehr als fünfzig Gedichtbänden, Kinderbüchern, Romanen und Sachbüchern, darunter Der Report der Magd, Der blinde Mörder und Oryx und Crake. Atwood bringt ihre Bewunderung für Morris’ Darstellung zum Ausdruck und rückt dann unsere gefährdete Zukunft in den Blick. Um sich diese vorstellen zu können, hält sie unsere literarische Phantasie für hilfreicher als messbare Daten und wissenschaftliche Beobachtungen. Sie stimmt Morris zu, dass wir Menschen über Eigenschaften verfügen, die uns vielleicht liebenswerter, zumindest aber komplexer machen als »die von Natur aus egoistischen und aggressiven Fieslinge, als die uns der Sozialdarwinismus so lange beschrieben hat«. Aber was würde passieren, wenn unsere Biosphäre tatsächlich kollabieren würde? Aufgrund unserer engen Vernetzung meint sie: »Wenn wir untergehen, dann alle und in großem Stil, in einem Maßstab, wie er früher unvorstellbar gewesen wäre.« Und sie befürchtet: »Wenn die Technik immer komplizierter und die Gesellschaft immer größer wird, reicht ein immer kleinerer Fehler, um etwas Entscheidendes kaputt zu machen, das Zugunglück wird größer, die Folgen werden katastrophaler.«
Morris nennt fünf mögliche Faktoren, die den Untergang herbeiführen könnten: »unkontrollierbare Migration, Staatsversagen, Nahrungsmittelknappheit, Epidemien und … Klimawandel«. Atwood fügt zwei weitere hinzu: den Kollaps der Ozeane und die Biotechnologie. Sie beendet ihre Ausführungen, deren Esprit ich hier nicht vermitteln kann, mit einem Appell an unsere großen Gehirne, nach Lösungen zu suchen.
Das letzte Wort hat Ian Morris, und er nutzt es zu einer umfassenden und anregenden Replik. Morris geht detailliert auf seine Kritiker ein und klärt und vertieft dabei seine Argumentation. Er macht keine Zugeständnisse, räumt jedoch ein, dass seine Kritiker ihm geholfen haben, seine Darstellungen über den Zusammenhang von Energiegewinnung und menschlichen Werten weiter zu durchdenken.
In Antwort auf Spences Forderung nach einer detaillierteren Beschreibung stellt Morris klar, dass es ihm in erster Linie darum gehe, zu erklären, warum Menschen bestimmte Werte haben, und nicht darum, diese Werte von innen heraus zu verstehen.
Auf Seafords Vorwurf, er vernachlässige die Vielfalt innerhalb seiner drei großen Paradigmen Wildbeuterei, Landwirtschaft und Fossilenergienutzung, hält Morris fest, dass »Agrargesellschaften« so ziemlich alle Menschen umfassen, die in den 10000 Jahren vor dem 19. Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebten, und räumt mit leichtem Understatement ein, dass dies »eine gewaltige Vielfalt« sei. Es besteht kein Zweifel, so Morris, dass Stadtstaaten wie Athen insofern interessant sind, als sie moderne Werte und Institutionen teilweise vorwegnehmen. In geringerem Maße trifft dies auch auf England und andere vorindustrielle Staaten der frühen Neuzeit zu, die aus dem Seehandel gewaltige Mengen Energie gewannen. Trotzdem besteht Morris darauf, dass der Wohlstand Athens »die Zwänge der Landwirtschaft lockerte, aber nicht vollständig überwand«. Scheinbare Ausreißer wie das antike Griechenland und das frühneuzeitliche England modifizierten daher den Zusammenhang zwischen Energiegewinnung und Werten, aber sie widerlegten ihn nicht.
Am ausführlichsten versucht Morris zu klären, wie die aufeinanderfolgenden Formen der Energiegewinnung menschliche Werte in einem Prozess der »mehrstufigen Auslese« prägten. Die Energiegewinnung einer Gesellschaft zwinge den Menschen keine bestimmten Werte auf. Vielmehr setzten sich im Laufe vieler Jahrtausende und zahlloser gesellschaftlicher Experimente diejenigen Gesellschaften durch, die aufgrund ihrer Strukturen, ihrer wirtschaftlichen und politischen Institutionen, ihrer Kultur und ihrer Werte am besten geeignet seien, die verfügbare Form der Energiegewinnung zu nutzen, und verdrängten dabei weniger geeignete Gesellschaften.
Gleichzeitig verwirft Morris Korsgaards Unterscheidung zwischen »positiven Werten«, die Menschen tatsächlich vertreten, und »wahren moralischen Werten«, die sie vertreten sollten. Die einzigen Werte, die uns zur Verfügung stehen, sind diejenigen Werte, die Menschen zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten lebten, weshalb Korsgaards »Unterscheidung zwischen wahren moralischen Werten und positiven Werten sinnlos ist. Es gibt nur positive Werte.« Doch selbst wenn wir das erkennen, heiße das nicht, dass wir nicht an unsere Werte glauben können.
Morris geht auch auf den Vorwurf ein, er sei in der kapitalistischen Ideologie gefangen. Er leugnet dies und wirft Seaford und Korsgaard seinerseits unangemessenen »Essentialismus« vor. Damit meint er die Überzeugung, dass unsere freiheitlichen Werte der Aufklärung, darunter eine Vorliebe für egalitäre Gesellschaftsformen und eine Ablehnung der Gewalt als Mittel der Konfliktlösung, eine bessere Annäherung an »wahre moralische Werte« und sogar eine »Standardeinstellung« sein könnten, zu der Menschen unter günstigen Umständen und in Abwesenheit einer durch Gewalt gestützten Hierarchie tendieren.
Morris räumt ein, dass ein gewisser Essentialismus unausweichlich sei, um zu erklären, wie Menschen die Fähigkeiten erwarben, die zur Entwicklung komplexer Organisationsformen, Urteile und Erfindungen nötig seien, wie wir sie im Laufe der Geschichte beobachten. Er wiederholt, dass »alle Menschen« bestimmte Grundwerte gemeinsam haben – »Fairness, Gerechtigkeit, Liebe, Hass, Respekt, Loyalität, Selbstschutz und ein Gefühl, dass manche Dinge heilig sind« – und dass diese Grundwerte in den unterschiedlichen Phasen der menschlichen Entwicklung neu interpretiert werden. Während Korsgaard und Seaford der Ansicht sind, dass Gleichheit und Gewaltfreiheit aus moralischer Sicht besser und wahrer sind, beharrt Morris darauf, dass es sich nur um bestimmte Interpretationen der menschlichen Grundwerte handelt: Sie seien abgestimmt auf die Bedürfnisse der Fossilenergiegesellschaft, aber ungeeignet für Wildbeuter und Agrargesellschaften. »Meiner Ansicht nach ist falsches Verhalten etwas, das gegen meine durch die Fossilenergienutzung geprägte Interpretation biologisch entstandener Werte verstößt.« Zwar verurteilt Morris genau wie Korsgaard die Taliban, weil sie Frauen unterdrücken und von der Bildung fernhalten wollen, doch seiner Ansicht nach handeln die Taliban deshalb falsch, »weil das Agrarzeitalter zu Ende ist«. Die Taliban machten sich »in erster Linie der Rückständigkeit schuldig«.
Allerdings könnte man fragen, ob es hier in erster Linie um »Rückständigkeit« geht. Steht dahinter die Annahme, dass unser Ziel in erster Linie die wissenschaftliche und historische Erklärung ist und nicht das moralische Urteil? Denn wenn es um ein moralisches Urteil ginge, wären andere Begriffe angemessener, um den Umgang der Taliban mit Frauen zu beschreiben: grausam und abscheulich etwa und nicht einfach »rückständig« oder unzeitgemäß. Leben wir in einer Zeit, in der Frauen mehr Gerechtigkeit erfahren? Oder ist es nur eine andere Gerechtigkeit?
Eine weitere Frage drängt sich auf: Ist es nicht gefährlich, die Sprache des moralischen Urteils mit funktionalen Standards und gesellschaftlichem Erfolg zu verknüpfen? Ist es nicht denkbar, dass politische und wirtschaftliche Innovationen den Lebensstandard steigern und die Macht einer Gesellschaft (auch über andere) vergrößern, aber gleichzeitig einen moralischen Niedergang darstellen? Nehmen wir an, das autoritäre Ein-Parteien-Regime Chinas ist dem Wirtschaftswachstum dienlicher als die freiheitliche Demokratie, wie manche meinen – sollten wir daraus schließen, dass es aus moralischer Sicht sinnvoll wäre, wenn sich der chinesische Weg durchsetzte? Oder bin ich mit dieser Frage zu sehr meinen Umständen verhaftet?
Mit diesen Fragen möchte ich lediglich darauf hinweisen, dass es gute Gründe geben könnte, an dem Gedanken festzuhalten, dass das moralische Urteil unabhängiger von den jeweiligen Umständen sein sollte, als Morris dies hier zugesteht. Das soll nicht heißen, dass wir uns über sämtliche Vorurteile unserer Zeit erheben können, doch wir sollten unser Möglichstes versuchen.
Was ist von dem oben erwähnten Vorwurf zu halten, dass Morris in der kapitalistischen Ideologie gefangen sei? Morris definiert Ideologie als »einen Haufen Lügen …, von denen irgendjemand profitiert«, und schränkt sofort ein: »aber selten allzu lange, denn der gesunde Menschenverstand ist ein nützliches Instrument, wenn es darum geht zu erkennen, was unter den jeweiligen materiellen Umständen am besten funktioniert.« Dazu zitiert er den Abraham Lincoln zugeschriebenen Satz: »Man kann nicht alle Menschen immer zum Narren halten«. Die »böse Oberschicht« ist weder mächtig noch schlau genug, um die Mehrheit der Menschen lange zum Narren zu halten.
Das ist ein interessanter Ausdruck des Vertrauens in die Fähigkeit der menschlichen Erfindungskraft und des gesunden Menschenverstands, gesellschaftliche Umstände zu beseitigen, in denen eine Minderheit auf Kosten der Mehrheit lebt. Wenn neue Formen der Energiegewinnung neue Formen der gesellschaftlichen Organisation ermöglichen, die mehr Wohlstand und/oder Sicherheit für mehr Menschen bieten, dann können wir davon ausgehen, dass die Menschen diese neuen Gesellschaftsformen und ihre Werte früher oder später entdecken und übernehmen. Das lässt auch vermuten, dass die Notwendigkeit einer Hierarchie (oder zentralen Autorität) aus Sicht der gesamten Gesellschaft überprüft werden muss und wird.
Hilft uns dieses Vertrauen in die menschliche Fähigkeit, eigennützige Lügen der herrschenden Eliten zu durchschauen und zu überwinden, die Vorstellungen eines echten moralischen Fortschritts über verschiedene Phasen der Geschichte hinweg zu bewahren? Hat die Idee nicht nur des materiellen, sondern auch des moralischen Fortschritts Bestand? Argumentiert Morris von einer eigenen, unausgesprochen egalitären Überzeugung aus, dass es sich die Minderheit nicht auf Kosten der Mehrheit gut gehen lassen darf und dies letztlich auch nicht tun wird?
Diese und andere Fragen überlasse ich den Leserinnen und Lesern.
Morris schließt seine breit gefächerte Diskussion mit einem Blick in die Zukunft und erörtert die Möglichkeit, ob unsere Art heute die Bedingungen für ihr eigenes Aussterben schafft. Er würdigt Margaret Atwoods Versuch, sich das Leben nach dem nächsten Kollaps vorzustellen, und stellte eigene Spekulationen an.
Was folgt, ist ein lebendiger und anregender Ausflug unter der Anleitung eines Wissenschaftlers von bemerkenswerter Bildung und Sachkenntnis, der durch gewaltige Landschaften der menschlichen Geschichte führt, grundlegende Fragen zur Herkunft und Form unserer Werte stellt und einige überraschende Antworten bereithält.
Kapitel 1
Jedes Zeitalter bekommt die Werte, die es braucht
Herr Geórgios
Im Jahr 1982 nahm ich an meiner ersten archäologischen Ausgrabung in Griechenland teil. Ich war begeistert: Ich hatte zwar schon oft in Großbritannien gegraben, doch diese Exkursion war eine ganz andere Sache. Mit einem uralten Range Rover fuhr ich von Birmingham nach Thessaloniki und von da mit einem noch älteren Bus weiter in ein Dorf namens Assiros, wo sich die Ausgrabungsstätte befand (siehe Abbildung 1.1). 1 Dort machte ich mich an die Arbeit. Tagaus, tagein zählten, wogen und katalogisierten wir prähistorische Tonscherben, und nach Sonnenuntergang setzten wir uns vor unseren Geräteschuppen und entspannten uns bei ein paar Gläschen Ouzo.
Eines Abends kam ein alter Mann auf einem Esel an unserer Hütte vorbeigeritten. Zu Fuß neben ihm ging eine alte Frau, die unter der Last eines großen Sacks ächzte. Als die beiden vorüberkamen, grüßte sie einer meiner Kollegen in gebrochenem Griechisch.
Der alte Mann hielt sichtlich erfreut an. Er unterhielt sich ein wenig mit unserem Sprecher, dann trotteten er und seine Frau weiter.
»Das war Herr Geórgios«, erklärte unser Dolmetscher.
»Was hast du ihn denn gefragt?«, wollte einer von uns wissen.
»Wie es ihm geht. Und warum seine Frau nicht auf dem Esel sitzt.«
Wir schwiegen eine Weile. »Und?«, fragte dann jemand.
»Er hat gesagt, weil sie keinen hat.«
Es war das erste Mal, dass ich die klassische anthropologische Erfahrung des Kulturschocks machte. In Birmingham hätte ein Mann, der auf einem Esel reitet, während seine Frau zu Fuß einen schweren Sack schleppt, mindestens egoistisch gewirkt, wenn nicht schlimmer. 2 Hier in Assiros war diese Konstellation aber anscheinend so normal und die Gründe dafür waren derart offensichtlich, dass Herr Geórgios unsere Frage für einfältig hielt.
Abbildung 1.1 In Kapitel 1 erwähnte Orte und Gruppen
Drei Jahrzehnte später ist dieses Buch ein Versuch, die Begegnung in Assiros zu erklären. Es basiert auf zwei Vorträgen, die ich im Oktober 2012 im Rahmen der Tanner Lectures in Human Values an der Princeton University gehalten habe. 3 Eine Einladung zu dieser Vortragsreihe gehört zu den größten Ehren, die einem Wissenschaftler zuteilwerden können, und ich habe mich ganz besonders darüber gefreut, weil ich ein derart unwahrscheinlicher Kandidat bin. In den gut dreißig Jahren seit meiner Begegnung mit Herrn Geórgios habe ich nicht ein einziges Wort zum Thema Moralphilosophie veröffentlicht. Deshalb stutzte ich, als ich die Einladung erhielt, doch dann kam ich zu dem Schluss, dass dies das ideale Forum war, um mein Erlebnis von Assiros zu schildern, denn um den Kommentar von Herrn Geórgios und meine Reaktion darauf zu erklären, bedarf es nichts Geringerem als einer allgemeinen Theorie der Entwicklung menschlicher Werte während der letzten 20000 Jahre. Dazu schienen mir Kenntnisse in Geschichte und Archäologie nützlicher als in Moralphilosophie, und ich sagte mir, dass eine solche allgemeine Theorie vielleicht auch für Moralphilosophen interessant sein könnte.
Ob ich damit Recht habe oder nicht, das müssen Sie entscheiden, und dazu bekommen Sie die Unterstützung von mehreren Experten. Nach fünf Kapiteln, in denen ich meine These darlege, kommen in den Kapiteln 6 bis 9 die vier Teilnehmer des Diskussionspanels zu Wort, die im Anschluss an die Vorträge in Princeton meine Thesen erörterten – der Altertumsforscher Richard Seaford, der Sinologe Jonathan D. Spence, die Philosophin Christine M. Korsgaard und die Romanautorin Margaret Atwood. Das letzte Wort habe dann wieder ich mit einer Replik auf diese Reaktionen in Kapitel 10.
Die These
In den vergangenen vier oder fünf Jahrzehnten haben Wissenschaftler Hunderte Bücher und Tausende Artikel über Kulturschocks wie meine Begegnung mit Herrn Geórgios, seinem Esel und seiner Frau geschrieben. Was ich an dieser Stelle unternehmen möchte, unterscheidet sich jedoch erheblich von den meisten dieser Untersuchungen. Ich behaupte nämlich, dass wir, wenn wir den gesamten Planeten über die vergangenen 20000 Jahre hinweg betrachten, drei mehr oder weniger aufeinanderfolgende Wertesysteme identifizieren können. Jedes dieser Wertesysteme hängt mit einer bestimmten gesellschaftlichen Organisationsform zusammen, und diese wiederum wird dadurch vorgegeben, wie wir Energie aus unserer Umwelt gewinnen. Letztlich ist die Form der Energiegewinnung die Erklärung dafür, warum Herr Geórgios uns diese Antwort gab und warum mich seine Antwort derart verblüffte.
Allerdings muss ich sofort eine Einschränkung vornehmen: Weil Wertesysteme – oder Kulturen oder wie immer wir sie bezeichnen wollen – derart komplex sind, muss ich mich auf einige ausgewählte Aspekte konzentrieren, um meine These auf wenigen hundert Seiten darstellen zu können. Bei meinen Vergleichen beschränke ich mich daher auf Vorstellungen von Gleichheit und Hierarchie (in Bezug auf Politik, Wirtschaft und Geschlecht) sowie Einstellungen gegenüber Gewalt. Diese Werte habe ich zum einen gewählt, weil sie mich besonders interessieren, aber auch, weil sie mir besonders relevant erscheinen. Außerdem würde ich vermuten, dass sich bei der Auswahl anderer Werte ähnliche Muster ergeben würden – und wenn nicht, dann wären Vergleiche zwischen unterschiedlichen Werten eine naheliegende Möglichkeit, meine These zu widerlegen.
In den Kapiteln 2 bis 4 werde ich diese drei mehr oder minder aufeinanderfolgenden Wertesysteme vorstellen. Das erste bezeichne ich als »Wertesystem der Wildbeuter«, da es Gesellschaften kennzeichnet, die überwiegend Wildtiere jagen und Wildpflanzen sammeln. Wildbeuter bevorzugen Gleichheit gegenüber den meisten Formen der Hierarchie und sind relativ tolerant gegenüber Gewalt. Das zweite bezeichne ich als »Wertesystem der Bauern«, da es Gesellschaften kennzeichnet, die sich überwiegend von domestizierten Pflanzen und Tieren ernähren. Bauern bevorzugen Hierarchie gegenüber den meisten Formen der Gleichheit und stehen Gewalt ablehnender gegenüber. Das dritte System, das ich als »Wertesystem der fossilen Energie« bezeichne, kennzeichnet Gesellschaften, die ihren Energiebedarf nicht nur aus lebenden Pflanzen und Tieren decken, sondern zusätzlich die Energie aus fossilen Pflanzen, sprich: Kohle, Erdgas und Erdöl nutzen. Die Nutzer fossiler Energie stellen Gleichheit über die meisten Formen der Hierarchie und stehen Gewalt sehr ablehnend gegenüber. 4
Dieser Rahmen erklärt nicht nur, warum mich der Kommentar von Herrn Geórgios so verblüffte (seine Werte stammten überwiegend aus der bäuerlichen Phase, während meine aus der Phase der fossilen Energie stammen), sondern er hat auch zwei weitergehende Konsequenzen für die Beschäftigung mit menschlichen Werten. Wenn es stimmt, dass menschliche Werte durch die Form der Energiegewinnung vorgegeben werden, dann könnte daraus folgen, dass (1) die philosophische Suche nach universellen menschlichen Werten Zeitvergeudung ist und dass (2) die Werte, die wir (wer immer das sein mag) heute vertreten, in naher Zukunft keine Gültigkeit mehr haben könnten. Wenn meine Annahme stimmt, dann werden wir diese Werte irgendwann wieder aufgeben und in eine vierte, nachfossile Phase eintreten. Daher beende ich diesen Abschnitt in Kapitel 5 mit einigen Mutmaßungen darüber, wie diese Werte der Zukunft aussehen könnten.
Erklären und Verstehen
Meine Herangehensweise an den Kulturschock unterscheidet sich von den meisten jüngeren Untersuchungen, weil ich versuche, diese Erfahrung zu erklären, statt sie zu verstehen. Diese Unterscheidung wird meist auf Max Weber, den Begründer der modernen Soziologie, zurückgeführt. 5 Allerdings war Weber nicht der Erste, der bei der Beschreibung des gesellschaftlichen Handelns zwischen Verstehen und Erklären unterschied. Diese Ehre gebührt dem deutschen Philosophen und Historiker Johann Gustav Droysen, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte, dass Historiker und Naturwissenschaftler nach grundsätzlich verschiedenen Methoden vorgingen. 6 Historiker wollten ihren Gegenstand verstehen (also die subjektiven Absichten historischer Akteure begreifen), so Droysen, während Naturwissenschaftler ihn erklären wollten (indem sie Ursachen aufzeigten).
Weber weitete Droysens Überlegungen aus und gab der Soziologie ein drittes Ziel vor: eine Synthese zwischen Erklären und Verstehen. »Eine richtige kausale Deutung eines konkreten Handelns bedeutet: daß der äußere Ablauf und das Motiv zutreffend und zugleich in ihrem Zusammenhang sinnhaft verständlich erkannt sind«, schrieb er und fügte hinzu: »Fehlt die Sinnadäquanz, dann liegt selbst bei größter und zahlenmäßig in ihrer Wahrscheinlichkeit präzis angebbarer Regelmäßigkeit des Ablaufs (des äußeren sowohl wie des psychischen) nur eine unverstehbare (oder nur unvollkommen verstehbare) statistische Wahrscheinlichkeit vor.« 7
Webers Theorien wurden in den 1930er Jahren durch den Soziologen Talcott Parsons in die Vereinigten Staaten gebracht 8 und in den 1960er und 1970er Jahren in den Arbeiten des Anthropologen und Parsons-Schülers Clifford Geertz einer Neuinterpretation unterzogen. »Ich stimme mit Max Weber überein, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe«, schrieb Geertz. Daher war die Untersuchung der Kultur für ihn »keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht«. 9 Ausgehend von seiner Interpretation Max Webers kam Geertz zu dem Schluss, dass sich gesellschaftliches Handeln nur durch »langfristige, überwiegend (wenn auch nicht ausschließlich) qualitative, teilnehmende und nahezu zwanghaft detaillierte Feldforschung« verstehen ließ. Das Ergebnis war das, was er als »dichte Beschreibung« bezeichnete. 10
Das ideale Medium dieser dichten Beschreibung war nach Ansicht von Geertz der Aufsatz, »ob dreißig oder dreihundert Seiten lang, denn der Aufsatz ist die natürliche Textgattung für kulturelle Interpretationen und die Theorien, die sie stützen«. Allerdings fügte er einschränkend hinzu: »Das Interessante an ethnografischen Darstellungen ist nicht die Fähigkeit des Autors, primitive Zusammenhänge aus fernen Ländern darzustellen, sondern seine Fähigkeit, das Geschehen an diesen Orten zu erklären und das Rätsel (wer sind diese Menschen?) zu lösen, das diese unbekannten Handlungen vor unbekanntem Hintergrund notwendig darstellen.« 11
Mit seiner Forderung, Sozialwissenschaftler sollten sich auf das Verstehen konzentrieren, statt Webers Synthese zwischen Erklären und Verstehen anzustreben, traf Geertz eine an den Universitäten der Vereinigten Staaten verbreitete Stimmung. Bis Mitte der 1980er Jahre waren die meisten Geistes- und viele Sozialwissenschaftler seiner Aufforderung gefolgt und begriffen den Kulturschock nicht mehr als Problem, sondern als Chance. Nur wenige Jahre nach meiner Begegnung mit Herrn Geórgios meinte der Historiker Robert Darnton, damals ein Kollege von Geertz an der Universität Princeton, wir sollten uns darüber freuen, »dass der gesunde Menschenverstand unserer Vorfahren für uns vollkommen unverständlich ist«, denn »wenn wir ein Sprichwort, einen Witz oder ein Ritual nicht verstehen, dann wissen wir, dass wir auf einer Spur sind. Wenn wir ein Dokument an seiner undurchsichtigsten Stelle angehen, können wir ein fremdes Bedeutungssystem aufdröseln. Der Faden könnte sogar zu einer fremden und wunderbaren Weltsicht führen.« 12
Damals in Assiros kam es mir durchaus in den Sinn, dass sich Herr Geórgios über uns lustig machen könnte und dass er sich über die Arroganz der Westler gegenüber seiner bäuerlichen Lebensweise mokierte. Doch Tatsache war, dass er auf dem Esel saß, während sich seine Frau mit dem schweren Sack abschleppte. Wenn man seinen Kommentar in den Kontext einer dichten Beschreibung des Dorflebens von Assiros stellen würde, dann würde man zweifelsohne auf eine fremde und wunderbare Weltsicht stoßen. 13 Doch in diesem Buch möchte ich etwas anderes versuchen: Ich möchte das Verhalten von Herrn und Frau Geórgios nicht verstehen, sondern erklären.
Damit beziehe ich mich auf eine Denkrichtung, die nicht nur hinter Geertz zurückreicht, sondern auch hinter Droysen. 14 Wenn wir weit genug zurückgehen, vor allem in die Jahre zwischen 1720 und 1780, kommen wir in eine Zeit, in der Gelehrte die Kultur nicht verstehen, sondern erklären wollten. Von Montesquieu bis Adam Smith reagierten viele westeuropäische Vordenker auf die Flut von Informationen aus anderen Kontinenten, indem sie behaupteten (so wie ich das hier tue), dass die Menschheit eine Reihe von wirtschaftlichen Entwicklungsstadien durchlaufen hatte (in der Regel eine Spielart von Jagen, Viehzucht, Landwirtschaft und Handel) und dass jedes dieser Stadien mit seinem eigenen moralischen System einherging.
Einige dieser Denker bezeichneten ihre Arbeit als »philosophische Geschichtsschreibung«, andere waren sich bewusst, dass sie die Vergangenheit benutzten, um zentrale Fragen der Moralphilosophie zu klären, wieder andere bevorzugten die Bezeichnung »spekulative Geschichtsschreibung«, weil ihnen klar war, dass ihre Gedankengebäude eher auf Spekulation denn auf echten historischen Fakten beruhten. Von Beginn an provozierte die spekulative Geschichtsschreibung eine Mischung aus Spott (Walter Bagehot witzelte, Adam Smith wolle »zeigen, wie der Mensch vom Wilden zum Schotten wurde«) und Aggression (im ersten Band des Historischen Journals von Mitgliedern des Königlichen Historischen Instituts zu Göttingen aus dem Jahr 1773 wetterte Johann Christoph Gatterer gegen »affektierte Humechen oder Robertsonchen, teutsche Voltärchen« und versprach: »Diese Insekten wollen wir ohne Schonung aller Orten, wo wir sie antreffen, verfolgen«). 15 Spätestens 1790 waren viele Gelehrte zu dem Schluss gekommen, dass diese Art der historischen Spekulation mehr schadete als nützte, und damit endete die Konjunktur der spekulativen oder philosophischen Geschichtsschreibung. 16
Doch das Bedürfnis, den Kulturschock zu erklären, blieb. Mit einem Ansatz, den wir heute als klassische Evolutionstheorie kennen, kam ein neues Erklärungsmodell auf, und als Missionare und Kolonialbeamte ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine wahre Flut von Geschichten über die merkwürdigen Lebensformen von Nicht-Europäern mitbrachten, errichteten Wissenschaftler neue Theoriegebäude. 17 In den 1920er Jahren wiesen jedoch die ersten professionellen Anthropologen nach, dass die klassische Evolutionstheorie mindestens genauso spekulativ war wie die philosophische Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts. Einmal mehr trat die Erklärung den Rückzug an, nur um in den 1950er Jahren unter dem Etikett »Neoevolutionismus« einen neuen Aufschwung zu erleben. Bis dahin war eine beachtliche Menge an archäologischem und ethnografischem Material gesammelt worden, und die Erklärer konnten ihre Theorien mit der statistischen Auswertung von gewaltigen Datenmengen untermauern. Doch in den 1980er Jahren hatte die dichte Beschreibung auch dieser dritten Generation der Erklärer den Garaus gemacht, wenngleich diesmal vor allem auf theoretischer und nicht auf empirischer Basis. 18
Man könnte in dieser Geschichte einen weiteren Beweis dafür sehen, dass es in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften keinen Fortschritt gibt, doch das wäre meiner Ansicht nach ein Irrtum. In Wirklichkeit funktioniert Wissenschaft genau so. 19 Seit dem 18. Jahrhundert hat eine Gruppe von Akademikern Theorien über die Ursachen von kulturellen Unterschieden aufgestellt, und eine Gruppe von Kritikern nach der anderen hat sie widerlegt. In jeder Runde der Debatte waren Erklärer und Versteher gezwungen, bessere Theorien und Daten zu präsentieren, und heute, da die Versteher wieder die Oberhand haben, müssen wir aufstrebenden Erklärer erneut einen draufsetzen.
Ismen
Dazu müssen wir die vielen hundert dichten Beschreibungen von spezifischen Kulturen durch umfassende Vergleiche über große Gebiete und Zeiträume hinweg ergänzen. Das Ergebnis sind lockere Beschreibungen, die überwiegend (aber nicht ausschließlich) quantitativer Natur und kaum teilnehmend sind. Diese Beschreibungen sind grobkörnig, weil sie Hunderte Gesellschaften, Tausende Jahre und Millionen von Menschen in eine übergreifende Geschichte einbetten, und sie sind reduktionistisch, weil sie die brodelnde Vielfalt der gelebten Erfahrung auf einfache Grundprinzipien zurückführen.
Die von mir vorgeschlagenen drei Wertesysteme – das der Wildbeuter, der Bauern und der Nutzer fossiler Brennstoffe – sind Beispiele für das, was Max Weber als »Idealtypen« bezeichnet. Ein solcher Idealtypus, so Weber, »wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie.« 20 Idealtypen reduzieren die Lebenswirklichkeit von Milliarden von Menschen auf einige einfache Modelle, und weil sie eine derart gewaltige empirische Vielfalt erfassen, sind sie notwendig voller Ausnahmen. Aber das ist der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir hinter dem Chaos des wirklichen Lebens nach Ursachen suchen.
Mancher Leser wird zu dem Schluss kommen, dass dieser Weg über alle möglichen und wenig wünschenswerten Ismen führt. Da ist als Erstes der Reduktionismus, ein Wort, das in den meisten Geistes- und vielen Sozialwissenschaften als Schimpfwort gilt. Doch ich möchte diesen Vorwurf gar nicht leugnen, sondern ausdrücklich bejahen und zu meiner Verteidigung anbringen, dass Wissenschaft grundsätzlich reduktionistisch vorgeht – wer das abstreitet, sollte noch einmal darüber nachdenken. Um nur ein Beispiel zu nennen: Unlängst musste ich einige Einzelheiten in Martin Gilberts achtbändiger Biografie von Winston Churchill nachschlagen (die Biografie wurde ursprünglich in 13 Einzelbänden veröffentlicht, weil die meisten Bücher zu dick für einen einzelnen Band waren). 21 Das ist sicher eine der umfangreichsten Biografien, die jemals geschrieben wurden, doch auch sie ist notwendig reduktionistisch. Das Leben eines Menschen in geschriebene Sprache zu übersetzen heißt immer, eine komplexere Realität zu verzerren; und das Leben aller Menschen, die in den vergangenen 20 000 Jahren gelebt haben, auf eine Handvoll Kapitel zu reduzieren ist natürlich eine noch stärkere Verzerrung. Aber das ist in Ordnung. Wir sollten uns nicht fragen, ob Historiker, Anthropologen oder Soziologen reduktionistisch vorgehen – die Antwort ist immer Ja –, sondern welches Maß an Reduktionismus nötig ist, um eine bestimmte Frage zu beantworten. Große Fragen erfordern ein großes Maß an Abstraktion, und genau das nehme ich vor.
Meine These ist außerdem stark materialistisch. Das zeigen schon die Bezeichnungen, die ich für meine drei Phasen gewählt habe: Wie die philosophischen Historiker des 18. Jahrhunderts bin ich überzeugt, dass die verfügbaren Energiequellen den Werten, die sich in einer Gesellschaft entwickeln können, enge Grenzen setzen. Wildbeuter, die von wild in der Natur vorkommenden Tieren und Pflanzen leben, machen die Erfahrung, dass nur ein relativ schmales Spektrum von möglichen Organisationsformen für sie geeignet ist, und diese Organisationsformen belohnen bestimmte Werte. Weil Bauern von domestizierten Tieren und Pflanzen leben, sehen sie sich zu anderen Organisationsformen und Werten gedrängt, und Nutzer der fossilen Energie stellen fest, dass wieder andere Organisationsformen und Wertesysteme am besten funktionieren. Wenn das stimmt, müssen wir daraus schließen, dass Kultur, Religion und Moralphilosophie bei der Entstehung menschlicher Werte lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. Kultur, Religion und Moralphilosophie bestimmen zwar die regionalen Ausprägungen meiner drei Phasen – beispielsweise käme wohl niemand auf den Gedanken, Platons Apologie und die Lehrgespräche von Konfuzius gleichzusetzen –, und diesen Ausprägungen gebe ich in den Kapiteln 2 bis 4 einigen Raum. Doch auch wenn die Kultur für Variationen des übergreifenden Musters verantwortlich ist, bleibt unterm Strich die Energiegewinnung der eigentliche Motor.
Außerdem ist meine These fast universalistisch. Aber nur fast: Einige Regionen des Planeten bleiben ausgeschlossen, etwa die Steppenregion, die sich von der Mandschurei bis nach Ungarn erstreckt. Da hier außer Gras kaum etwas gedeiht, gestattet diese Region weder die herkömmliche Wildbeuterei noch die Landwirtschaft, weshalb hier seit Jahrtausenden Hirtengesellschaften leben, die sich von Weidetieren ernähren. 22 Obwohl meine These also nicht universalistisch ist, erfasst sie die überwältigende Mehrheit (vermutlich mehr als 95 Prozent) aller Menschen, die je auf unserem Planeten gelebt haben.
Daneben mache ich mich des Funktionalismus schuldig. 23 Werte sind ein Resultat der evolutionären Anpassung, das heißt, Menschen passen ihre Werte an das sich verändernde gesellschaftliche Umfeld an, um ihre Wirksamkeit zu maximieren. Das bedeutet nicht, dass alles so ist (oder war), wie es sein soll; doch es bedeutet sehr wohl, dass das eintritt (und eintrat), was immer schon sehr wahrscheinlich war. Werte sind Teil eines größeren Ganzen. Wenn wir sie aus dem Zusammenhang reißen, auf eine imaginäre Waage legen und beurteilen, gelangen wir nicht zu einem perfekten, allgemeingültigen Wertesystem, weil Werte immer in der wirklichen Welt existieren und Teil realer Gesellschaftssysteme sind.
Und zu guter Letzt ist meine These explizit evolutionistisch. Die menschliche Natur ist kein unbeschriebenes Blatt, auf das Wildbeuter, Bauern und Nutzer fossiler Brennstoffe dasjenige moralische System schrieben, das ihnen am besten gefiel. Die drei Systeme, die ich hier beschreibe, sind vielmehr evolutionäre Anpassungen an eine sich verändernde Umwelt.
Das heißt, dass sich die menschlichen Werte während der sieben oder acht Millionen Jahre, die seit der Abspaltung des Menschen vom letzten gemeinsamen Vorfahren mit den Menschenaffen vergangen sind, biologisch entwickelt haben. 24 Weil sich unsere biologische Grundausstattung in den zehn- oder fünfzehntausend Jahren seit Erfindung der Landwirtschaft kaum verändert hat, machen Anthropologen, Psychologen und Historiker die Beobachtung, dass einige zentrale Werte der Menschheit – Fairness, Gerechtigkeit, Liebe und Hass, Selbstschutz und die gemeinsame Vorstellung, dass manche Dinge heilig sind – unabhängig von Ort und Zeit in aller Welt anzutreffen sind. In gewissem Maße sind sie sogar bei unseren nächsten Verwandten unter den Menschenaffen zu beobachten, und möglicherweise sogar bei Delfinen und Walen. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt sind unsere Werte genetisch verankert, weshalb der Biologe E. O. Wilson vor vierzig Jahren schrieb: »Natur- und Geisteswissenschaftler sollten gemeinsam über die Möglichkeit nachdenken, dass es an der Zeit ist, die Ethik vorübergehend den Philosophen aus den Händen zu nehmen und sie zu biologisieren.« 25
Bislang sind es vor allem die Naturwissenschaftler, die diese Möglichkeit in Erwägung ziehen; bei der Suche nach einer Erklärung, wie sich unsere Werte wie Fairness, Gerechtigkeit und so weiter von unseren äffischen Vorfahren her entwickelt haben, konnten sie inzwischen große Fortschritte erzielen. Geisteswissenschaftler sind dagegen wenig begeistert von der »Biologisierung« der Moral. 26 Das mag auch der Grund sein, weshalb bislang kaum untersucht ist, wie sich die menschlichen Werte im Laufe der vergangenen 20000 Jahre entwickelt haben und warum Menschen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten die Werte Fairness, Gerechtigkeit und so weiter derart unterschiedlich interpretiert haben. Es ist eine große Leistung, die biologischen Wurzeln der menschlichen Werte erkannt zu haben, aber es ist nicht mehr als ein erster Schritt zu einer evolutionären Erklärung der Werte.
Der zweite Schritt beginnt bei der Tatsache, dass wir Menschen, von einigen unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, das einzige Tier sind, das im Laufe seiner biologischen Evolution die Gehirnkapazität entwickelt hat, die zur Erfindung einer Kultur nötig ist, wobei ich unter Kultur die Summe von Informationen verstehe, die wir durch Unterweisung, Nachahmung und andere Formen der Weitergabe von anderen Menschen übernehmen. 27 Unsere moralischen Systeme sind kulturelle Anpassungsleistungen. Mit den Veränderungen unserer Umwelt entwickelt sich der Mensch, wie alle anderen Lebewesen auch, biologisch weiter, doch er ist das einzige Lebewesen, das sich auch kulturell entwickelt und seine Verhaltensweisen und Institutionen so verändert, dass sie ihren Nutzen behalten (oder noch steigern), während sich die Umwelt verändert. 28
Vertreter der Evolutionstheorie führen hitzige Debatten, wie wir uns die kulturelle Evolution genau vorzustellen haben. Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die kulturelle Evolution analog zur natürlichen Auslese der biologischen Evolution funktioniert und dass eine kulturelle Variante eine andere ablöst, weil ihre Vertreter eher überleben und ihre Gene an die nächste Generation weitergeben. Andere Wissenschaftler sprechen von einer verzerrten Weitergabe (das heißt, eine kulturelle Variante löst eine andere ab, weil sie das Leben der Menschen so verändert, dass sie eher imitiert wird), die weit weniger mit der biologischen Auslese gemein hat, weshalb sich die kulturelle Evolution ihrer Ansicht nach deutlich von der biologischen Evolution unterscheidet. 29 Genauso umstritten ist die Frage, was im evolutionären Prozess genau weitergegeben wird. Auch hier gibt es zwei Gruppen: Die einen meinen, dass es kulturelle Replikatoren gibt, die gewisse Ähnlichkeit mit den Genen der biologischen Evolution haben (der Biologe Richard Dawkins spricht beispielsweise von »Memen«) und vollständig von einem Menschen zum anderen weitergegeben werden. Andere bevorzugen den Begriff »Attraktoren«, weil attraktive Vorstellungen nicht eins zu eins reproduziert, sondern bei der Weitergabe kreativ umgestaltet werden. 30 Besonders heiß diskutiert wird die Frage, auf welcher Ebene und in welchem Umfang die kulturelle Auslese greift. Hier behauptet die eine Seite, dass die Auslese letztlich auf der Ebene der Gene ansetzt (das heißt, dass Individuen, Familien oder Gruppen nur Ausdruck der genetischen Überlebensfähigkeit sind), während andere die Auffassung vertreten, dass die Auslese auf verschiedenen Ebenen wirkt, weshalb genetisch möglicherweise riskante Eigenschaften wie Selbstlosigkeit überleben, weil sie auf der Ebene der größeren Gruppe einen Anpassungsvorteil darstellen. 31
Das sind große und wichtige Fragen, aber zum Glück können wir die Entwicklung der menschlichen Werte erklären, ohne abwarten zu müssen, bis sich Experten auf die Mechanismen, Reproduktoren und Ebenen der Auslese geeinigt haben. »Es gibt Hinweise, dass sich kulturelle Varianten manchmal wie Gene verhalten und manchmal ganz anders«, schreiben der Evolutionsforscher Peter Richerson und der Anthropologe Robert Boyd. »Aber – und das ist ein großes Aber – in jedem Fall bleibt der Darwin’sche Ansatz nützlich.« Das trifft auch auf die Debatte um die Verwandtschaft und die Ebene der Auslese zu. Mitte des 19. Jahrhunderts wusste zwar noch niemand von der genetischen Vererbung, so Richerson und Boyd, doch das hinderte Darwin nicht daran, seine Theorie der natürlichen Auslese zu formulieren. »Aus diesem Grund können wir die Frage ausklammern, wie genau Kultur im Gehirn abgelegt ist, und unsere Arbeit mit plausiblen, auf beobachtbaren Eigenschaften basierenden Modellen fortsetzen.« 32 Bei dieser Vorgehensweise können wir beobachten, »dass manche Werte attraktiver sind und eher von einem zum anderen weitergegeben werden. Diese Werte halten sich, während weniger attraktive Alternativen verschwinden.« 33
Wenn dies der richtige Ansatz zum Verständnis von Wertesystemen ist, dann können wir vermutlich außerdem folgern, dass jedes Zeitalter die Werte bekommt, die es braucht – und genau das behaupte ich in diesem Buch. Um es mit dem Psychologen Jonathan Haidt zu sagen: »Wir kommen mit der Fähigkeit zur Welt, rechtschaffen zu sein, aber wir müssen erst lernen, in welcher Frage die Gesellschaft Rechtschaffenheit von uns erwartet.« 36 Die Menschheitsgeschichte lässt jedenfalls vermuten, dass die Fragen, in denen die Gesellschaft Rechtschaffenheit von uns erwartet, mit ihrer jeweiligen Form der Energiegewinnung zusammenhängen. Unsere Methoden der Energiegewinnung geben vor, welche Organisationsformen und demografischen Ordnungen am besten funktionieren, und diese wiederum bestimmen, welche Werte sich durchsetzen.
Die Evolution – ob kulturell oder biologisch – ist ein Konkurrenzkampf, der sich in Millionen winzigen Experimenten abspielt. Sie ist pfadabhängig, das heißt, der heutige Zustand eines Organismus oder einer Gesellschaft schränkt die Möglichkeiten für die Entwicklung von morgen ein. Außerdem ist sie chaotisch, laut und sogar gewalttätig. In diesem Konkurrenzkampf zwischen Mutationen setzen sich diejenigen Eigenschaften durch, die in einer bestimmten Umgebung gut funktionieren, und ersetzen andere, die weniger gut funktionieren. Das ist meiner Ansicht nach auch der Grund, weshalb wir innerhalb jeder der drei Phasen der Wildbeuterei, der Landwirtschaft und der Fossilenergie so viele Ähnlichkeiten hinsichtlich des Verhaltens, der Institutionen und der Wertesysteme erkennen können – warum beispielsweise gottgleiche Könige und Sklaverei in Agrargesellschaften so verbreitet und in Fossilenergiegesellschaften so selten sind. Bauern neigen zu hierarchischen Ordnungen, nicht weil sie als Tyrannen zur Welt kommen, sondern weil dieses System funktionierte; Fossilenergienutzer neigen dagegen zur Demokratie, nicht weil sie Heilige sind, sondern weil eine wahre Energieflut die Welt so verändert hat, dass nun dieses System besser funktionierte.
Die Menschheitsgeschichte lässt daher den Schluss zu, dass uns der Konkurrenzkampf der kulturellen Evolution zu Werten drängt, die in der jeweiligen Phase der Energiegewinnung am besten funktionieren. So habe zumindest ich selbst die Wechselbeziehung zwischen Werten und Umwelt erlebt. Im Jahr 1986, vier Jahre nach meiner Exkursion nach Assiros, unternahm ich einen kurzen Abstecher in die Kulturanthropologie. Ich reiste nach Kenia, um dort meine Freundin und heutige Frau zu besuchen, die bei den Luhya die traditionelle Medizin erforschte. 37 Mit den Werten von Studenten des fossilen Zeitalters im Rucksack wollten wir natürlich alles besser machen als die kolonialistischen Anthropologen von einst, die sich ihr Gepäck von unterbezahlten Trägern durchs Land schleppen ließen. Dabei mussten wir allerdings feststellen, dass sich die Vorstellungen, die sich in einer Kneipe im heimischen Cambridge gut anhörten, nur schlecht in die hügelige Gegend zwischen Kakamega und Kisumu übertragen ließen. Wir kamen in eine weitgehend präfossile Welt, die noch tiefer im bäuerlichen Zeitalter verwurzelt war als Assiros. Daher sahen wir uns gezwungen, jeden Tag einige Stunden damit zuzubringen, Wasser aus dem Fluss zu holen und Feuerholz zu sammeln, um es abzukochen, ehe wir es trinken oder damit kochen und waschen konnten. Aber Kathy wollte Interviews führen, und ich wollte mein erstes Buch zu Ende bringen und einen Vortrag vorbereiten, mit dem ich mich auf eine Stelle an der University of Chicago bewerben wollte. Deshalb hatten weder sie noch ich Zeit für die endlose Wasserschlepperei.
Aber in einer bäuerlichen Ökonomie, die sich weitgehend durch Unterbeschäftigung auszeichnete, hatten die Frauen aus dem Dorf viel Zeit zur Verfügung. Für knapp einen Dollar am Tag konnten wir uns wertvolle Zeit zurückkaufen. Für uns war das wenig Geld, aber für eine Familie aus dem Dorf war es ein beachtliches Zubrot. Es war eine Win-Win-Situation, aber da es auch nach klassischem Kolonialismus roch, wollten wir nichts davon wissen. Eine gute Woche lang rutschten wir durch den Matsch, kippten Eimer um und machten Feuer, die nicht brennen wollten. Zur Erleichterung aller stellten wir unsere Prinzipien schließlich auf den Prüfstand und heuerten am Ende einige Frauen an. Kathy konnte ihre Interviews führen, ich konnte mein Buch abschließen und bekam die Stelle in Chicago, und einige Familien verdienten sich ein hübsches Sümmchen dazu (Abbildung 1.2).
Abbildung 1.2 Die Wasserträgerinnen: Kenianische Frauen schöpfen Wasser aus einem Bach. Es handelt sich um eine Postkarte, die ich 1986 in Kisumu gekauft habe und die sich bis heute in meinem Besitz befindet.
Vielleicht hatten wir einfach kein Rückgrat. Vielleicht hätte Kant anders gehandelt (obwohl ich mir den Philosophen nicht beim Wasserschleppen vorstellen kann). Aber ich vermute, dass die meisten Menschen genauso gehandelt hätten wie wir. Auf einen Widerspruch hingewiesen, soll der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes einmal geantwortet haben: »Wenn sich die Tatsachen ändern, dann ändere ich meine Meinung. Wie halten Sie es?« Egal ob Keynes das wirklich gesagt hat oder nicht, 38 es ist eine gute Beschreibung dessen, was in den vergangenen 20000 Jahren milliardenfach passiert ist. Wenn uns die biologische Evolution etwas mitgegeben hat, dann den gesunden Menschenverstand, und der rät uns dazu, uns mit den Umständen zu arrangieren.
Falsifizierung
Seit den Tagen der philosophischen Geschichtsschreibung bestand die größte Herausforderung darin, umfassende Erklärungsmodelle anhand der Wirklichkeit zu überprüfen. Da Idealtypen eben ideal sind, gibt es für jede Verallgemeinerung unweigerlich zahllose Ausnahmen. Aber ab welchem Punkt ist die Zahl der Ausnahmen so groß, dass die Theorie als widerlegt gelten kann?
Diesem Problem begegnete ich schon bei meiner ersten Teilnahme an einer Tanner Lecture, als ich 1993 als Diskussionspartner zu Colin Renfrews Vorträgen über Archäologie, Sprache und Identität eingeladen wurde. 39 In der Debatte, die auf den ersten Vortrag folgte, führten Renfrew und die Philosophin Alison Wylie eine lebhafte Diskussion um das Thema der Falsifizierung. Renfrew hatte einen Zusammenhang zwischen Migration und Sprachwandel hergestellt, und die Archäologen im Raum hatten eine Ausnahme nach der anderen gefunden, doch es war nicht klar, ob die These damit widerlegt war oder ob sie sich überhaupt widerlegen ließ.
Der Biologe und Makrohistoriker Peter Turchin hat die Auffassung vertreten: »Die Wissenschaftsgeschichte ist eindeutig: Eine Disziplin wird erst dann erwachsen, wenn sie eine mathematische Theorie entwickelt hat.« 40 Wenn das zutrifft (und davon bin ich überzeugt), dann ließe sich das Problem der Falsifizierung nur dann lösen, wenn wir uns vom Geertz’schen Aufsatz als dem idealen Medium zur Beschreibung des Kulturschocks verabschieden. Stattdessen sollte ich dieses Buch beginnen, indem ich eine repräsentative Probe von Gesellschaften in unterschiedlichen Stadien der Energiegewinnung nehme, ihre Wertesysteme auf eine Ziffer reduziere und den Zusammenhang von Wertesystemen und Energiegewinnung vergleiche. Mit einem Chi-Quadrat-Test oder einer anderen statistischen Methode ließe sich dann ermitteln, ob der Zusammenhang signifikant ist oder nicht. Ich würde seitenweise die Auswahl meiner Stichprobe und die Berechnung meiner Kennziffern erläutern, und wenn der Test einen statistisch signifikanten Zusammenhang ergäbe, dann würde ich rasch zu meiner Erläuterung der Ursachen und Auswirkungen dieses Zusammenhangs übergehen.
Für viele großangelegte, kulturübergreifende Vergleiche ist dies prinzipiell einfach (selbst wenn in der Praxis die Ergebnisse quantitativer Tests alles andere als eindeutig sind). Große Datensätze wie die »Human Relations Area Files« 41 existieren bereits, bessere befinden sich zur Zeit im Aufbau. 42 Aber wer in diesen Datensätzen nach Werten sucht, wird wenig Glück haben. Das entscheidende Problem ist, dass es sich bei Auskünften zu moralischen Werten um Nominal- und nicht um Intervalldaten handelt – das heißt, wenn wir feststellen, dass eine Gesellschaft Einkommensunterschiede mehrheitlich gut findet, während eine andere sie mehrheitlich schlecht findet, dann enthält dies lediglich die Information, dass sich diese beiden Gesellschaften unterscheiden. Die Einstellungen lassen sich nicht gewichten oder in eine Rangfolge bringen: »gut« und »schlecht« sind einfach Bezeichnungen (also »Nominaldaten«) und nicht Punkte auf einer fortlaufenden Skala, die sich miteinander vergleichen lassen (also »Intervalldaten«)
Deshalb und aufgrund zahlreicher anderer Probleme machen die kulturvergleichenden Datensammler in der Regel einen großen Bogen um Werte, und bei meinen früheren Ausflügen in quantitative Vergleiche schloss ich mich ihnen nur zu gern an. 43 Es kann natürlich sein, dass ich zu faul war, genau wie ich zu faul war, mich unter den Luhya an meine Werte als Fossilenergienutzer zu halten. Andere Sozialwissenschaftler behaupten nämlich in der Tat, sie hätten eine Möglichkeit gefunden, um menschliche Werte von Nominal- in Intervalldaten umzuwandeln. Seit 1981 hat ein europäisches Großprojekt namens World Values Survey (WVS) 44 mehr als 400000 Personen in 100 Ländern zu ihren Werten befragt und ihre Antworten auf zwei Achsen übertragen. Die erste Achse verläuft von »traditionellen« zu »säkular-rationalen« Werten (sie misst die Einstellung zu Religion, Familie und Autorität) und die zweite von »Überleben« zu »Selbstentfaltung« (hier geht es um Fragen der physischen und wirtschaftlichen Sicherheit und das Niveau von Vertrauen und Toleranz). Aus diesen Werten ermittelt das WVS schließlich eine Ziffer, mit deren Hilfe sich jedes Land der Welt auf einer Kulturkarte verorten lässt. 45
Nach Ansicht der Politikwissenschaftler Ronald Inglehart und Christian Welzel vom WVS zeigt dies, »dass die sozioökonomische Entwicklung die Grundwerte und Überzeugungen der Menschen tendenziell verändert, und zwar in ungefähr vorhersagbarer Weise«. 46 Was sie unter der sozioökonomischer Entwicklung verstehen – der Übergang von überwiegend landwirtschaftlichen zu industriellen Gesellschaften und postindustriellen Dienstleistungsgesellschaften –, hat gewisse Ähnlichkeit mit dem, was ich unter Energiegewinnung fasse, entspricht dem aber nicht ganz. Deshalb nehme ich in Abbildung 1.3 und 1.4 eine direktere Überprüfung vor und stelle einen Zusammenhang zwischen den Zahlen des WVS und einem einfachen Maß für die Energiegewinnung her. Abbildung 1.3 ist die einfachere Version und stellt einen Zusammenhang zwischen der Position eines Landes auf der traditionell säkular-rationalen Achse und dem Anteil der Industrie und Dienstleistung am Bruttoinlandsprodukt dieses Landes her. 47 Daraus ergibt sich ein eindeutiger linearer Zusammenhang, das heißt, wenn eine Gesellschaft von der Landwirtschaft zur Nutzung fossiler Energie übergeht, verschieben sich die Werte von »traditionell« zu »säkular-rational«. Allerdings ist dieser Zusammenhang mit einem Korrelationskoeffizienten R2 von 0,24 nicht sonderlich stark ausgeprägt. 48 Es besteht also ein Zusammenhang zwischen Energiegewinnung und Werten, wenngleich er relativ lose ist, wie wir Abbildung 1.3 entnehmen können. Solange mindestens ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts eines Landes aus der Landwirtschaft stammt, bleiben die Werte traditionell, doch sobald die anderen Sektoren zusammengenommen mehr als 75 Prozent ausmachen, verschieben sich die Werte rasch in Richtung säkular-rationaler Normen (wenngleich mit erheblichen Unterschieden). Wie wir in Kapitel 4 noch sehen werden, wird dieses Muster durch historische Beweise gestützt.
Abbildung 1.3 Werte und Energiegewinnung, Version 1: traditionelle/säkular-rationale Werte eines Landes nach dem World Values Survey angetragen gegen den Anteil der Industrie und des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt dieses Landes (y=0,0506x – 2,8947; R2=0,23738).
Wie es in der Natur der Statistik liegt, kann man die WVS-Daten in vielfältiger Weise aufbereiten, aber sämtliche Vergleiche ergaben mehr oder weniger dasselbe Ergebnis. In Abbildung 1.4 habe ich beispielsweise an der vertikalen Achse die Summe aus beiden Ziffern der WVS-Kulturkarte (also die Summe der traditionell/säkular-rationalen-Achse und der Überleben/Selbstentfaltungs-Achse) angetragen. Auf der horizontalen Achse habe ich ein Maß für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes angetragen, das die Verteilung der Beschäftigten eines Landes auf die drei Sektoren in eine Ziffer umwandelt (konkret erhält ein Land für jedes Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft einen Punkt, für jedes Prozent in der Industrie zwei und für jedes Prozent im Dienstleistungssektor drei). Daraus ergab sich ein deutlicherer Zusammenhang mit einem Korrelationskoeffizienten R2 von 0,43, doch im Ganzen bleibt das Bild ähnlich wie in Abbildung 1.3. Je weniger entwickelt eine Volkswirtschaft, umso traditioneller die Werte der Bevölkerung. Doch mit der zunehmenden Bedeutung der Industrie und des Dienstleistungssektors verschieben sich die Werte hin zu säkular-rationalen Normen und Selbstentfaltung (wenngleich einmal mehr mit großen Unterschieden).
Abbildung 1.4 Werte und Energiegewinnung, Version 2: Zusammensetzung aus traditionell/säkular-rationalen und Überleben/Selbstentfaltungs-Werten eines Landes nach dem World Values Survey angetragen gegen einen Wert, der die relative Bedeutung von Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungssektor an der Wirtschaft dieses Landes wiedergibt (y=0,0499x – 8,7655; R2=0,43188).
Abbildung 1.5 Kulturkarte des World Values Survey, entwickelt von den Politikwissenschaftlern Ronald Inglehart und Christian Welzel, die den Zusammenhang zwischen kulturellen Traditionen und Werten darstellt.
Dieses unklare Muster erklären die Wissenschaftler des WVS damit, dass wirtschaftliche Entwicklung nicht der einzige Faktor ist, der sich auf die Werte niederschlägt. »Die sozioökonomische Entwicklung bewirkt zwar tendenziell vorhersagbare Veränderungen in der Weltsicht der Menschen«, so Inglehart und Welzel, »doch kulturelle Traditionen – etwa der historische Einfluss von Protestantismus, Konfuzianismus oder Kommunismus – schlägt sich nach wie vor spürbar in der Weltsicht einer Gesellschaft nieder. Die Geschichte spielt eine Rolle, und die vorherrschende Wertorientierung einer Gesellschaft spiegelt die Wechselwirkungen zwischen den verändernden Kräften der Modernisierung und den beharrenden Einflüssen der Tradition wider.« 49
Die Kulturkarte von Inglehart und Welzel, die auf den Daten der Erhebung des Jahres 2010 basiert und 74 der untersuchten Länder wiedergibt 50 (siehe Abbildung 1.5), verdeutlicht diese Wechselwirkungen. Die kulturellen und/oder sprachlichen Cluster sind auffällig und können kein Zufallsprodukt sein, doch es gibt auch eine Menge Ausreißer, die einer Erklärung bedürfen. Ingleharts und Welzels Kategorie des »katholischen Europa« mit seinem schmalen Korridor zu Polen erinnert beispielsweise erschreckend an einen manipulierten Wahlbezirk. Wenn man nur von der Karte ausginge, dann wären die meisten Rumänen lieber Muslime, die Guatemalteken eher Afrikaner, während sich die Iren (Katholiken wie Protestanten) in Lateinamerika zu Hause fühlen würden. Auf dieser Version der Karte kommen weder Griechenland noch Israel vor (auf früheren Versionen wurden sie noch eingezeichnet), doch mit ihren WVS-Werten liegen die Griechen irgendwo zwischen den Slowenen und Belgiern, während der jüdische Staat im Herzen des katholischen Europa landet.
Diese merkwürdigen Ergebnisse sind natürlich amüsant, doch die interessantesten Schlüsse lassen sich aus der Anomalie der Länder in der Mitte der Karte ziehen. Chile, Zypern, Äthiopien, Indien, Malaysia, Polen, Thailand, die Türkei und Vietnam haben sehr wenig gemeinsam, außer der Tatsache, dass sie eine rasante wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen – was nach Ansicht des WVS darauf schließen lässt, dass die Werte entscheidend durch die Entwicklung geprägt werden, während die Kultur lediglich den Pfad beeinflusst, auf dem sich die Werte verändern. »Nach einer Steigerung des Lebensstandards und einem Übergang vom Entwicklungsland über die Industrialisierung zu einer postindustriellen Wissensgesellschaft bewegt sich ein Land tendenziell diagonal von der linken unteren Ecke (arm) in Richtung der rechten oberen Ecke (reich)«, heißt es auf der WVS-Website. 51 Die Entwicklung gibt die Richtung vor, und die Tradition lenkt den Pfad in die eine oder andere Richtung. Die Industriegesellschaften Lateinamerikas und Osteuropas bekommen in der WVS-Skala höhere Werte als die deutlich weniger industrialisierten Gesellschaften Afrikas und des Nahen Ostens, doch aufgrund ihrer Kultur erzielen Lateinamerikaner bei der Selbstentfaltung tendenziell einen hohen und bei der Säkularisierung einen niedrigen Wert, während bei orthodoxen Europäern genau das Gegenteil der Fall ist.
Die WVS-Daten lassen weitreichende Schlüsse zu. Unterm Strich erlauben sie jedoch nur eine teilweise Überprüfung der These dieses Buchs. Das eigentliche Problem ist, dass sich systematische Daten zu Wertvorstellungen nur durch Befragungen erheben lassen und diese erst seit Kurzem durchgeführt werden. Im Jahr 1981, als das WVS





























