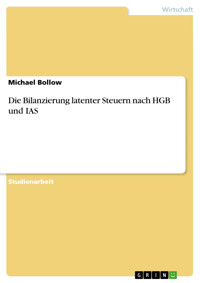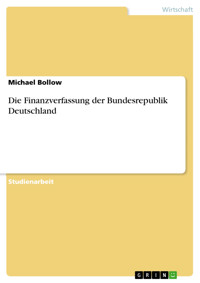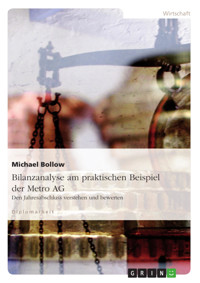
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1,3, Universität Hamburg (Department für Wirtschaft und Politik), Veranstaltung: Konzernbilanzen, Sprache: Deutsch, Abstract: Unternehmen haben über den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit und über ihre wirtschaftliche Situation, insbesondere über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, mindestens einmal jährlich Rechenschaft abzulegen. Instrument dieser Rechenschaftslegung ist der Jahresabschluss. Dieser ist eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und finanziellen Stabilität eines Unternehmens. Ob ein Unternehmensergebnis gut oder schlecht ist, lässt sich nicht ohne Weiteres aus dem Jahresabschluss ablesen, insbesondere nicht aus dem ausgewiesenen Gewinn oder Verlust. Das im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresergebnis kann durch ungewöhnliche Einflüsse und vor allem stark durch die Bilanzpolitik des Unternehmens beeinflusst sein. Daher ist eine Analyse des Jahresabschlusses zwingende Voraussetzung, um zuverlässige Erkenntnisse hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zu erhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis:
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis:
1. Einleitende Betrachtung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
1.2. Vorgehensweise
2. Grundlagen der Bilanzanalyse
2.1. Begriff der Bilanzanalyse
2.2. Zweck und Ziel einer Bilanzanalyse
2.3. Arten von Bilanzanalysen
2.3.1. Interne Bilanzanalyse
2.3.2. Externe Bilanzanalyse
2.3.3. Formelle und materielle Bilanzanalyse
2.4. Ablauf einer Bilanzanalyse
2.5. Adressaten einer Bilanzanalyse
2.6. Grenzen der Bilanzanalyse
3. Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG
3.1. Rahmenbedingungen
3.1.1. Die Metro AG
3.1.2. Konzernstruktur der Metro AG
3.1.3. Rechnungslegung der Metro AG
3.2. Aufbereitung der Daten des Jahresabschlusses der Metro AG
3.3. Bilanz nach IFRS
3.3.1. Aufbereitung der Bilanz zur Erstellung der Strukturbilanz
3.3.2. Aufbereitung der Aktivaseite der Bilanz
3.3.3. Aufbereitung der Passivaseite der Bilanz
3.4. Strukturbilanz Metro AG
3.5. Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung nach IFRS
3.5.1. Aufbereitung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung
3.5.2. Aufbereitung der GuV/ des Betriebsergebnisses der Metro AG nach dem Umsatzkostenverfahren (IAS/IFRS-Abschluss)
3.5.3. Aufbereitung der GuV/Finanzergebnis der Metro AG nach dem Umsatzkostenverfahren (IAS/IFRS-Abschluss)
3.5.4. Aufbereitung der GuV/ordentliches Betriebsergebnis der Metro AG (IAS/IFRS-Abschluss)
4. Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse
4.1. Investitionsanalyse
4.1.1. Vermögensintensität
4.1.2. Anlagenintensität
4.1.3. Sachanlagenintensität
4.1.4. Umlaufintensität
4.1.5.Vorratsintensität
4.1.6. Forderungsintensität
4.2. Finanzierungsanalyse
4.2.1. Eigenkapitalquote
4.2.2. Finanzierungskoeffizient
4.2.3. Fremdkapitalquote
4.2.4. Verschuldungsgrad
4.2.5. Rücklagenquote
4.2.6. Selbstfinanzierungsgrad
4.3. Liquiditätsanalyse
4.3.1. Langfristige Fristenkongruenz
4.3.2. Kurzfristige Fristenkongruenz
4.3.3. Working-Capital-Analyse
4.4. Cashflow-Analyse
4.4.1. Cashflow-Eigenkapitalrendite
4.4.2. Cashflow-Umsatzrendite
4.5. Kapitalflussrechnung als Bestandteil der Liquiditätsanalyse
5. Erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse
5.1. Gewinnanalyse
5.1.1. Gewinnentwicklung
5.1.2. Umsatzerlöse
5.1.3. Einstandskosten der verkauften Waren (Materialaufwand)
5.1.4. Personalaufwand
5.1.5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
5.1.6. Sonstige betriebliche Erträge
5.1.7. Vertriebskosten
5.1.8. Allgemeine Verwaltungskosten
5.1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
5.1.10. Zinsaufwand
5.1.11. Steuern
5.2. Rentabilitätsanalyse und Return on Investment
5.2.1. Eigenkapitalrentabilität
5.2.2. Gesamtkapitalrentabilität
5.2.3. Umsatzrentabilität
5.2.4. Return on Investment (ROI)
5.3. Rendite und Börsenbewertung
5.3.1. Ergebnis je Aktie (€)
5.3.2. Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV)
5.3.3. Dividendenrendite
6. Ergebnis und Auswertung der Bilanzanalyse
6.1. Ertragslage
6.2. Finanzlage
6.3. Vermögenslage
Literaturverzeichnis
Webseitenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Rahmenbedingungen der Metro AG, eigene Darstellung
Abbildung 2: Aufbereitungsmaßnahmen der Bilanz-Aktivaseite, eigene Darstellung
Abbildung 3: Aufbereitungsmaßnahmen der Bilanz-Passivaseite, eigene Darstellung
Abbildung 4: Strukturbilanz der Metro AG, eigene Darstellung
Abbildung 5: Struktur-GuV/Betriebsergebnis, eigene Darstellung
Abbildung 6: Struktur-GuV/Finanzergebnis, eigene Darstellung
Abbildung 7: Struktur-GuV/ordentliches Betriebsergebnis, eigene Darstellung
Abbildung 8: Cashflow-Berechnung der Metro AG, eigene Darstellung
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis:
Die Bilanzanalyse am praktischen Beispiel der Metro AG
1. Einleitende Betrachtung
1.1. Problemstellung und Zielsetzung
Unternehmen haben über den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit und ihre wirtschaftliche Situation, insbesondere über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, mindestens einmal jährlich Rechenschaft abzulegen. Instrument dieser Rechenschaftslegung ist der Jahresabschluss.[1] Dieser ist eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und finanziellen Stabilität eines Unternehmens.[2] Ob ein Unternehmensergebnis gut oder schlecht ist, lässt sich nicht ohne Weiteres aus dem Jahresabschluss ablesen, insbesondere nicht aus dem ausgewiesenen Gewinn oder Verlust. Das im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresergebnis kann durch ungewöhnliche Einflüsse und vor allem stark durch die Bilanzpolitik des Unternehmens beeinflusst sein.[3] Daher ist eine Analyse des Jahresabschlusses zwingende Voraussetzung, um zuverlässige Erkenntnisse hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens zu erhalten.
Seit dem 1. Januar 2005 sind kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (EU) aufgrund der europäischen IAS-Verordnung verpflichtet, ihren Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. Für europäische Konzernunternehmen, die bisher nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsregeln (US-GAAP) bilanzierten, wurde die Verpflichtung zur Bilanzierung nach IFRS um zwei Jahre verschoben.[4] Die IFRS sind eine Zusammenstellung von Standards, die nach und nach entwickelt worden sind. Dabei handelt es sich nicht um ein Regelwerk mit dem Anspruch auf vollständige Regelung aller Zweifelsfragen. Da ständig neue Standards entwickelt und übernommen werden, wird die Regelungsdichte jedoch zunehmend höher.[5] Die IFRS bieten für die Bilanzanalyse eine deutlich bessere Datengrundlage als das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB).