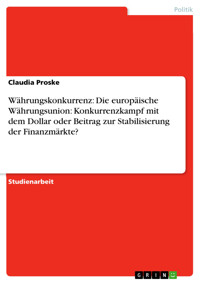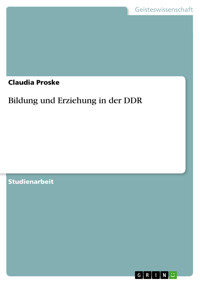
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Soziologie - Kinder und Jugend, Note: 2,0, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Sozialwissenschaftliches Institut), Veranstaltung: Soziale Transformationsprozesse in Ostdeutschland, Sprache: Deutsch, Abstract: Bildung und Erziehung in der DDR. Wie war das staatliche Bildungssystem der Deutschen Demokratischen Republik aufgebaut? Welche Vor- und Nachteile besaß es für Kinder und Jugendliche? In welchem Umfang wurde es vom SED-Regime als Instrument staatlicher Kontrolle genutzt? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigt sich die folgende Seminararbeit. Im Rahmen des Hauptseminars "Transformationsprozesse in Ostdeutschland" sollen die verschiedenen Bildungseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Universität näher untersucht und dargestellt werden. Dabei werden auch besonders die beiden großen Jugendorganisationen Thälmann-Pioniere und Freie Deutsche Jugend (FDJ) berücksichtigt und erklärt, welche Rolle diese beiden Organisationen innerhalb der Machtstellung des Regimes innehatten und wie sich eine Mitgliedschaft bzw. Nichtmitgliedschaft in einem der beiden Verbände auf das Leben der jungen Menschen und ihrer Familien auswirkte. Bei der Recherche nach Hintergrundliteratur zum Thema Bildung und Erziehung in der DDR fiel der Autorin bereits auf, wie wenig objektive Dokumente und Publikationen zur Deutschen Demokratischen Republik veröffentlicht wurden. Auch Untersuchungen und Erhebungen, die sich neutral mit den Einstellungen der Jugend zur DDR befassten und die bereit waren, auch positive Erkenntnisse miteinzubeziehen, wurden kaum gefunden. Aus diesem Grunde finden sich innerhalb der folgenden Kapitel auch hin und wieder kleine, persönliche Anmerkungen und Schilderungen aus der Erinnerung der Autorin, die in der DDR geboren wurde und bis zu ihrem 11. Lebensjahr in Halle an der Saale lebte. Diese Anmerkungen dienen jedoch hauptsächlich dazu, zum Nachdenken anzuregen und erheben selbstverständlich keinen Anspruch auf Repräsentativität. Die DDR-Bürger als Menschen zweiter Klasse, die sich jahrzehntelang ein sozialistisches Regime gefallen ließen, ohne aufzubegehren? Diese Meinung herrscht noch immer in vielen Köpfen vor. Anhand der folgenden Kapitel soll unter anderem versucht werden, der Deutschen Demokratischen Republik auch positive Aspekte abzugewinnen. Am Beispiel des Bildungssystems ist dies nach Meinung der Autorin durchaus möglich. Es soll aufgezeigt werden, dass die politischen Institutionen des Staaten zwar jede Möglichkeit nutzten für den Versuch, bereits die Jugend zur sozialistischen Persönlichkeit heranzubilden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Bildung und Erziehung in der DDR. Wie war das staatliche Bildungssystem der Deutschen Demokratischen Republik aufgebaut? Welche Vor- und Nachteile besaß es für Kinder und Jugendliche? In welchem Umfang wurde es vom SED-Regime als Instrument staatlicher Kontrolle genutzt? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigt sich die folgende Seminararbeit.
Im Rahmen des Hauptseminars „Transformationsprozesse in Ostdeutschland“ sollen die verschiedenen Bildungseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur Universität näher untersucht und dargestellt werden.
Dabei werden auch besonders die beiden großen Jugendorganisationen Thälmann-Pioniere und Freie Deutsche Jugend (FDJ) berücksichtigt und erklärt, welche Rolle diese beiden Organisationen innerhalb der Machtstellung des Regimes innehatten und wie sich eine Mitgliedschaft bzw. Nichtmitgliedschaft in einem der beiden Verbände auf das Leben der jungen Menschen und ihrer Familien auswirkte.
Bei der Recherche nach Hintergrundliteratur zum Thema Bildung und Erziehung in der DDR fiel der Autorin bereits auf, wie wenig objektive Dokumente und Publikationen zur Deutschen Demokratischen Republik veröffentlicht wurden. Auch Untersuchungen und Erhebungen, die sich neutral mit den Einstellungen der Jugend zur DDR befassten und die bereit waren, auch positive Erkenntnisse miteinzubeziehen, wurden kaum gefunden. Aus diesem Grunde finden sich innerhalb der folgenden Kapitel auch hin und wieder kleine, persönliche Anmerkungen und Schilderungen aus der Erinnerung der Autorin, die in der DDR geboren wurde und bis zu ihrem 11. Lebensjahr in Halle an der Saale lebte. Diese Anmerkungen dienen jedoch hauptsächlich dazu, zum Nachdenken anzuregen und erheben selbstverständlich keinen Anspruch auf Repräsentativität.
Die DDR-Bürger als Menschen zweiter Klasse, die sich jahrzehntelang ein sozialistisches Regime gefallen ließen, ohne aufzubegehren? Diese Meinung herrscht noch immer in vielen Köpfen vor. Anhand der folgenden Kapitel soll unter anderem versucht werden, der Deutschen Demokratischen Republik auch positive Aspekte abzugewinnen. Am Beispiel des Bildungssystems ist dies nach Meinung der Autorin durchaus möglich. Es soll aufgezeigt werden, dass die politischen Institutionen des Staaten zwar jede Möglichkeit nutzten für den Versuch, bereits die Jugend zur sozialistischen Persönlichkeit heranzubilden. Anhand von fundierten Untersuchungsergebnissen anderer Wissenschaftler soll jedoch auch verdeutlicht
Page 4
werden, dass allein der Versuch des Staates, seine Bürger unter Kontrolle zu halten, aus ihnen noch keine kontrollierten Bürger machte.
2. Struktur des Bildungswesens in der DDR
Bis zum 3. Lebensjahr stand der Besuch der Krippe auf dem Programm. Es folgte der Kindergarten bis zum 6. Lebensjahr, an den sich die Unterstufe der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule (POS) bis zum 10. Lebensjahr anschloss. Die Mittelstufe der OS reichte i.d.R. bis 13 Jahre, die Oberstufe bis zum 16. Lebensjahr. In der Altersstufe von 16 bis 18 folgte dann eine Berufsausbildung, eine Berufsausbildung mit Abitur oder der Besuch der erweiterten Oberschule (EOS). Anschließend gab es die Möglichkeit, 1. eine Ingenieurs- und Fachschule zu besuchen, die das Fern- und Abendstudium einschloss oder 2. eine Weiterbildung für Erwachsene (Erwachsenenqualifizierung in staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen) mit anschließender Möglichkeit zum Studium oder 3. nach dem Besuch der EOS der direkte Einstieg ins Studium.
Anders als in der BRD, wo das Schulwesen durch die Kulturhoheit der Länder im föderalistischen System sehr unterschiedlich ist, ging man in der DDR von Anfang an den Weg des Zentralismus, das heißt, der einheitlichen Regelung aller Schulfragen in den Ländern, die 1952 aufgelöst und durch Bezirke ersetzt wurden. Deshalb waren die bildungsmäßigen Voraussetzungen in allen Teilen der DDR gleich. Auf der einen Seite kommt man nicht umhin, die fachlichen Leistungen des Bildungssystems zu würdigen, ohne auf der anderen Seite den Versuch der massiven ideologischen Beeinflussung außer Acht zu lassen, der aufs Engste mit der gesamten Schulbildung verbunden wurde. So erklärte Walter Ulbricht auf dem 7. Parteitag der SED:
„Jeder Pädagoge muss beachten, dass eine hohe Allgemein-Bildung nicht spontan sozialistisches Bewusstsein hervorbringt. In allen Unterrichtsfächern muss die Einheit von Bildung und Erziehung, von Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit hergestellt werden.“1
1vgl. Protokoll des 7. Parteitages der SED, Band 1, S. 251 in: Maerker, Rudolf S. 24
Page 5
Nachdem die Struktur des Bildungswesens zunächst in groben Zügen dargestellt wurde, beschäftigen sich die folgenden Kapitel näher mit den einzelnen Bildungsabschnitten.
2.1 Ganztägige Kinderbetreuung - Krippen und
Kindergärten
Kindererziehung und Haushaltsführung waren in der DDR gesetzlich festgelegt. So ging das Familiengesetzbuch grundsätzlich von der Annahme aus, dass beide Eltern einem Beruf nachgingen und trug ihnen deshalb die Führung des Haushaltes und die Erziehung der Kinder gemeinsam auf. (§10 Abs. 1 FGB)
Jedoch ließ der Gesetzgeber die Möglichkeit offen, zugunsten der Hausarbeit auf die Berufstätigkeit zu verzichten. (§12 Abs. 2 FGB)
Arbeit galt offiziell als zentraler Wert in der sozialistischen Gesellschaft der DDR. Die Erziehung der jungen Generation zur Arbeit, die Entwicklung einer sozialistischen Arbeitsmoral, die rechtzeitige und planmäßige Vorbereitung auf die Erfordernisse der Arbeitswelt waren zentrale politische Zielsetzungen und Erziehungsziele. Entsprechend der marxistisch-leninistischen Theorie prägte der besondere Typus der Arbeit unter sozialistischen Produktions- und Eigentumsverhältnissen das Verhältnis der Menschen zur Arbeit in positiver Weise. Arbeit bedeutete für sie die zentrale Lebensspähre, die Freude und Befriedigung gewährte und die ihre Entwicklung zu sozialistischen Persönlichkeiten positiv beeinflusste wurde vom SED-Regime angenommen.2
Dabei ist es zunächst irritierend, dass die sogenannte „Hausfrauen-Ehe“ in der DDR von offizieller Seite gebilligt wurde. Gilt doch schließlich die Erwerbstätigkeit der Frau in der marxistisch-leninistischen Gesellschaftstheorie als Grundvoraussetzung für ihre Gleichberechtigung. Offiziell hieß es jedoch, die Frau könne voll in den Produktionsprozess involviert werden, sobald genug Krippenplätze zur Verfügung stünden. Eine logische Schlussfolgerung, denn 1984 beispielsweise standen für 1000 Kinder nur 675 Krippenplätze zur Verfügung. Andererseits gab es auf alle Kinder gerechnet in jenem Jahr ein Kindergarten-Kontingent in dem für über 90 Prozent der drei- bis sechsjährigen Kinder Kindergartenplätze zur Verfügung standen. Der Besuch der Kinderkrippe war bis zum 3. Lebensjahr vorgesehen. Anschließend folgte der Kindergarten bis die Kinder sechs Jahre alt waren. Beide
2vgl. Hille, Barbara; Jugend und Beruf in beiden deutschen Staaten in: Hille, Barbara/Jaide, Walter (Hrsg.);
DDR-Jugend - Politisches Bewusstsein und Lebensalltag S. 37
Page 6
Einrichtungen hatten Tradition als Ergänzung der Familienerziehung und wurden weitgehend zum festen Bestandteil des Bildungssystems.3
Die logische Schlussfolgerung aus Helwigs Erkenntnissen wäre demnach, dass auch über 90 Prozent der Mütter drei- bis sechsjähriger Kinder berufstätig sein können, oder nach marxistisch-leninistischer Theorie sein müssen. Inwieweit diese Mütter die Möglichkeit nutzten, einer geregelten Arbeit nachzugehen oder wie viele von ihnen stattdessen die Kinder zu Hause behielten, ließ sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Seminararbeit leider nicht nachprüfen, da der Autorin keine fundierten wissenschaftlichen Daten vorlagen.
In der DDR unterlagen die Kinder im Vorschul-Alter weit stärker als in der Bundesrepublik der Betreuung durch öffentliche Einrichtungen. Rudolf Maerker schreibt dazu: „Das ist an sich kein negativer Zug, denn Eingliederung und Einordnung des Kindes in größere Gemeinschaften hat nach pädagogischen Erfahrungen, die in aller Welt gemacht wurden, positive Einflüsse auf die spätere Schulzeit.“ In der DDR käme noch der erheblich größere Anteil an Frauenarbeit hinzu, der laut Maerker die Einrichtung von Kinderhorten für die Kleinsten sowie von Kindertagesstätten und Kindergärten für die Größeren erzwinge.4
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: