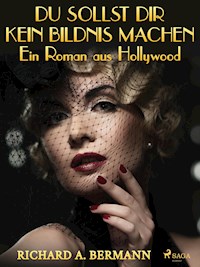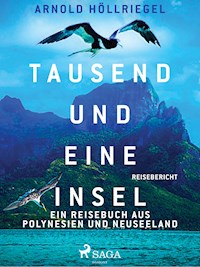Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist mehr als nur eine Insel der Bahamas. In Bimini ist der Starreporter Olaf Jensen einem ebenso unglaublichen wie sensationellen Geheimnis auf der Spur. Zwischen Revolution, karibischer Exotik und der Liebe zu der vermeintlichen Revolutionärin Doña Escobar entwickelt sich eine atemberaubende Geschichte mit einer unglaublichen Auflösung. Der österreichische Reiseschriftsteller und Feuilletonist Arnold Höllriegel alias Richard A. Beermann (1883–1939) schreibt mit diesem Filmroman eine ebenso amüsante wie intelligente Satire auf die Film- und Medienbranche der Zeit. Die Aktualität seiner Analysen reicht jedoch weit über die Weimarer Republik hinaus bis in die Gegenwart.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Boeschens Filmromane
Herausgegeben von
Michael Grisko und Erhard Schütz
Arnold Höllriegel
Bimini
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehenvon Michael Grisko
Bimini
© 1923 Arnold Höllriegel
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517727
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
»Kleiner Vogel Kolibri, Führe uns nach Bimini;
Fliege du voran, wir folgen
In bewimpelten Pirogen. Kleines Fischchen Brididi,
Führe uns nach Bimini;
Schwimme du voran, wir folgen
Rudernd mit bekränzten Stengen.«
(Heinrich Heine)
I. Olaf Jaspersen
Olaf Jaspersen hob in seinem Wiener Hotelzimmer zögernd das Sprachrohr des Telephons ab und nannte, vor ihr tief errötend, dem unsichtbaren Telephonfräulein eine Nummer.
Vielleicht ahnte das Telephonfräulein dieses Erröten, diese zitternde Erwartung. Sie tat etwas Ungewöhnliches: Sie stellte sofort die richtige Verbindung her. »Hallo?« sagte in der Ferne Frau Julia Amberg.
Als Olaf Jaspersen Julia Ambergs Stimme hörte, sang er in der ersten Aufwallung ins Sprachrohr hinein: »Ist dort Julia?« – und besann sich erst eine Sekunde später auf seine wohlerzogene nordische Höflichkeit und einiges andere. Er setzte nochmals an, um »gnädige Frau« zu sagen, schloß aber dann, rot im Gesicht und schwer atmend, einen Kompromiß mit seiner Seele und sprach ins Rohr: »Hallo, sind Sie dort Frau Julia? Hier ist Olaf Jaspersen!«
Die Antwort, obgleich durchaus in einem Ton freudiger Überraschung, schien ihn ein wenig zu verstimmen. Eine andere Julia hätte vielleicht doch anders ins Telephon gesprochen, wenn Romeo eins gehabt hätte. Olaf Jaspersens glattes Knabengesicht wurde rot, seine Seele verkroch sich hinter ihre nordische Wohlerzogenheit, die nächsten Fragen galten sittsam dem Befinden Frau Julias und der ganzen werten Familie. Aber Julias Stimme unterbrach die Formalitäten. Julia kannte ihr Telephon, ein gräßliches Wiener Sechs-Minuten-Telephon und wußte, daß die Verbindung sofort abschnappen würde; so erbat sie sich die sachlichen Auskünfte: »Woher so plötzlich? Wie lange bleiben Sie in Wien?«
Olaf Jaspersen erstarrte förmlich. Seine Stimme wurde immer höflicher. »Woher? Nun aus Amerika, über Genua. Wie lange? Ja, leider, Verehrteste – «
Er hätte vielleicht unter Umständen etwas anderes gesagt. Er sagte: »Ja, leider, Verehrteste, muß ich morgen früh schon wieder abreisen. Die Redaktion der »Ny Eidende« rüstet eine Grönlandexpedition aus und ich soll mit. Ich muß so rasch wie irgend möglich nach Kopenhagen – «
Seine graublauen Augen leuchteten plötzlich auf, Julia hatte ihn heftig unterbrochen, gegen einen so kurzen Aufenthalt protestiert, ja, sicher in dem alten herzlichen Ton. Was, nur so wenige Stunden? Unsinn! Und warum telephonierte er erst, warum kam er denn nicht direkt in die Cottagegasse? Rasch ein Auto nehmen, man wartet auf ihn mit dem Nachtmahl!
Leider riß das Telephonfräulein nicht in diesem Augenblick schon die Verbindung auseinander, sondern erst drei Sekunden später; und Julia sagte rasch noch einen Satz, der Olaf Jaspersen unglücklich machte.
Julia sagte: »Dr. Hofmann wird sich auch riesig freuen, er ist gerade bei mir und – «
Das Telephon gluckste, man hörte nichts mehr. Olaf Jaspersen behielt das Rohr in der Hand und starrte es lange an.
Olaf Jaspersen war jung, kaum in den ersten Dreißigern und schien viel jünger zu sein. Er war blond und bartlos, sein Gesicht wäre kindlich hübsch gewesen, ohne die eigentümliche Nase. Sie war wie aus hartem Holz geschnitzt und dem Schnitzer war das Messer abgerutscht; es war eine zu kurze, eine zu spitze und zu scharfe Nase herausgekommen. Vielleicht hätten auch die Lippen fleischiger sein können. Kinn und Stirn waren gut, die Augen außerordentlich klar; Olaf Jaspersen trug seit Menschengedenken immer einen kornblumenblauen Anzug, peinlich gebürstet mit lächerlich weiten Hosen. Er sah aus wie ein Marinekadett in Zivil, vielleicht auch, wenn man seine Hände in Betracht zog, wie ein Musiker; er sah ganz gewiß nicht aus, wie Olaf Jaspersen, der vielerfahrene Reise-Sonderberichterstatter der »Ny Eidende«, ordentlicherweise hätte aussehen müssen.
Irgendein anderer junger Mann hätte sich jetzt, um seine Nerven zu beruhigen und um vor sich selbst eine Pose einzunehmen, eine Zigarette angezündet, ein rauher Weltbummler aber eine kurze Shagpfeife. Olaf Jaspersen öffnete zerstreut eine Schublade, kramte mit zitternden Fingern darin und brachte Kolumbia-Pastillen zum Vorschein, Pfefferminz mit einem Schokoladenüberguß. Er naschte wie ein kleines Mädchen und rauchte niemals. Mit spitzen Fingern schob er die Pastillen in seinen Mund, dann kam eine kleine rosige Zunge zum Vorschein und leckte die Mundwinkel aus, das Näschen schnupperte den Pfefferminzgeruch ein, in dem glatten Gesicht mischten sich Genuß und Liebesgram, Liebesgram und Pfefferminzschokolade.
Olaf Jaspersen dachte:
Der Doktor Hofmann! Ich habe es die ganze Zeit gewußt, daß der Kerl sich jetzt an Julia heranmachen wird. –
Oh, dachte Olaf Jaspersen, warum bin ich denn so lange weggeblieben, ein ganzes Jahr! Ich lief davon, weil ich es nicht ertragen konnte, sie mit ihrem Mann zusammen zu sehen, mit diesem Schwein, diesem Amberg. Als sie mir nach New-York schrieb, daß die Scheidung vollzogen war, hätte ich mit dem nächsten Schiff zurückkommen müssen, aber sie hätte mir doch schreiben sollen: Komm! Ich hätte sie nie verlassen dürfen, sie ist schwach, sie muß sich immer an jemand anlehnen, sogar an den Amberg hat sie sich angelehnt, als zufällig sonst niemand in der Nähe war. Ich habe sie verloren, gewiß habe ich sie verloren. Nein, die Stimme klang zuerst gar nicht herzlich. Später, als ich sagte, ich wollte nicht in Wien bleiben, taute sie förmlich auf. Soll ich gar nicht hingehen? Blumen schicken und einen Entschuldigungsbrief? Ermüdet von der Reise und so?
Sein Hirn entwarf blitzschnell den Brief. Es wäre ein zarter, feiner Brief gewesen, jene Mischung von Sentiment und leichter Ironie, die Olaf Jaspersens Leser lieben. Aber er zerriß den Brief im Geiste. Nicht hinzugehen, rasch weguzufahren, direkt nach Grönland, irgendwohin, wäre das richtigste gewesen, aber unhöflich; und man hätte den Abend einsam in irgendeinem Lokal verbringen müssen. Das bloße Grauen davor, vor belanglosen Wiener Bekannten in einem Café, trieb Olaf Jaspersen die Hoteltreppe hinab. Jetzt stand er in der Halle neben der Drehtür, mit einem kleinen Plüschhütchen schief auf dem Kopf, und war zu schüchtern, um dem Hotelportier nach einem Auto zu schicken. Immer wenn Olaf Jaspersen an den Portier herantreten wollte, kam ein anderer Gast zuvor, sprach den Vielumworbenen an. Olaf Jaspersen wurde ganz rot vor Unbeholfenheit, seine Nase aber wurde ganz bleich und immer spitzer, er hatte beide Hände in den tiefen Taschen seiner zu weiten kornblumenblauen Hosen. Wer ihn kannte, der hätte gewußt, daß er jetzt verschüchtert weggehen würde oder aber den Portier mit unerhörter Arroganz anschnauzen. Er ging, verhaspelte sich in dem Mechanismus der Drehtür, so daß ein Herr, der in dem Sektor hinter ihm stak, grob zu werden begann. Olaf Jaspersen, tief beschämt, zog den Hut vor dem Herrn, stotterte eine Entschuldigung. Dann stand er endlich draußen auf der Ringstraße, maß ihr Menschengewühl ganz erschreckt. Dieser scheue und weltfremde junge Mann tat offenbar übel daran, in so einer gefährlichen großen Stadt ganz allein auszugehen, wenigstens das Auto nicht vor die Hoteltür vorfahren zu lassen, ein gut geschlossenes Auto ohne Zugluft. Wie sollte er denn quer über die Straße gelangen? Man sah ihm genau an, daß er sich verlaufen konnte wie im Urwald. Es gab in Europa und Amerika keine Straße und in den Tropen keinen Urwald, in denen sich Olaf Jaspersen schon einmal verlaufen hätte. Das merkwürdigste war, daß er sich schließlich zwar nicht immer in den Hauptstraßen Europas und Amerikas zurechtgefunden hatte, aber immer im Urwald oder in der Wüste. Eines Tages kam er bestimmt am anderen Ende wieder heraus, mit einem verwirrten und zerstreuten Blick, mit der letzten seiner Pfefferminzpastillen zwischen seinen Lippen, mit den Händen in den tiefen Taschen seiner kornblumenblauen Hosen, und mit den denkbar genauesten Informationen in seinem Kopf über die letzten und interessantesten Ereignisse in diesem Urwald oder in dieser Wüste, zum Entzücken der Leser der »Ny Eidende« und der vierzig Weltblätter, die sich jeden Reisebericht Olaf Jaspersens sofort aus dem Dänischen übersetzen ließen.
Jetzt, während er unsicher und wie in einem unruhigen Schlaf die Ringstraße kreuzte, zehnmal in Gefahr, überfahren zu werden und immer in der letzten Sekunde durch einen flinken Sprung, eine verwegene Wendung gerettet und am Leben erhalten, kam Olaf Jaspersen an einer Plakatsäule vorbei, auf der ein gewisses Plakat klebte. Das Plakat rief auf eine kotzengrob sentimentale Weise das Mitleid des »Goldenen Herzens« von Wien für hungernde Kinder an; es sollte eine große Tanzerei veranstaltet werden. Olaf Jaspersen blickte eben nur einen Augenblick hin, aber eine Woche später las man in »Ny Eidende« den wörtlichen Text dieses Plakates; Olaf Jaspersens Augen photographierten Objekte besser als eine Kamera, und sein Film bewahrte eine einmal belichtete Platte lange, lange auf. Verblüffende Wahrheit des kleinsten Details und unanfechtbar wahrscheinliches Lügen machten Olaf Jaspersens Artikel so ungemein lesenswert. Es war wie ein Kodak mit einer wilden Phantasie.
Der große Reisende suchte die Kärntner Straße hartnäckig, aber vergeblich an einer Stelle, wo sie keineswegs einmündet, versuchte zweimal in schon besetzte Autos einzusteigen, ging mit der Absicht Rosen zu kaufen, statt in einen Blumenladen in ein daneben liegendes Papiergeschäft, kaufte aus purer Verlegenheit eine Kassette Briefpapier und ließ sie dann listig auf dem Tisch des Blumenladens stehen, sehr zum Vergnügen der kleinen Verkäuferin, denn es war ein sehr feines überseeisches Leinenpapier. Schließlich stieg Olaf Jaspersen, mit einem wunderbaren Rosenstrauß in der Hand, vor dem Haus Cottagegasse 14 aus einem Auto, keine Minute früher oder später als zu der Zeit, zu der zu kommen er der Frau Julia Amberg versprochen hatte.
Während des Abendessens war Olaf Jaspersen sehr still, und er aß eigentlich nur von der Schokoladentorte. Julia bemerkte es nicht; ein Jahr früher hätte sie es ganz bestimmt bemerkt. Sie war überhaupt ganz anders geworden; jener Zug von leidvoller Sehnsucht war verschwunden, sie schien fester, selbständiger zu sein, ein klein bißchen laut. Das Gespräch kehrte immer wieder zu einem gewissen Film zurück, den Doktor Hofmann verfaßt hatte und dessen Hauptrolle Julia darstellen sollte. Olaf Jaspersen bat den Doktor Hofmann, ihm den Inhalt des Filmdramas zu erzählen, es hatte sieben Akte und war lang, etwas verwickelt. Jaspersen hörte mit dem höflichsten Interesse zu und verstand kein einziges Wort; er sah über seine Schokoladentorte hinweg den Erzähler an, der ein schöner, schwarzer Herr mit einem weichen Kinnbart und einem horngefaßten Zwicker war, im übrigen von angenehmen Manieren und intelligent. Der Däne sah ihn an, dachte: Liebt Sie ihn? Er fand die Antwort nicht, aber das sah er wohl, daß jener irgendeine Macht über Julia gewonnen hatte. Sie saß da, groß, ernsthaft, von weichen Umrissen. Ihre Haare strahlten wieder jene bläulichen Reflexe aus, die Olaf Jaspersen berauschten. Sie schien Doktor Hofmanns langer Erzählung mit fieberhaftem Interesse zu folgen, obwohl sie den Film längst kennen mußte. Olaf Jaspersen begann zu ahnen, daß es ihr nur um den Film zu tun war und nicht um den Mann, aber das tröstete ihn nicht. Die Leidenschaft in ihren Augen galt nicht ihm, das war genug. Sie würde ihn ruhig nach Grönland fahren lassen oder zu den Botokuden.
Er sagte sofort nach dem Abendessen: »Leider werde ich mich bald empfehlen müssen, Frau Julia, mein Zug geht zeitig früh. Nun ich komme nach meiner Grönlandexpedition bald wieder nach Wien und werde mir dann gewiß gestatten – – – «
Er sah sie durstig an. Sie sagte: »Aber Jaspersen, was für ein Unsinn!« Olaf Jaspersen betete: Wenn sie mich doch nicht reisen ließe, wenn ich mich doch geirrt hätte!
Sie stand auf, legte ihm ihre Hand auf die Schulter, ergriff förmlich wieder Besitz. »Kommen Sie!«, sagte sie und zog ihn ins Nebenzimmer. Doktor Hofmann ging hinter ihnen drein, ein wenig verlegen.
Das Nebenzimmer, Julia Ambergs berühmtes Sitzzimmer, enthielt Sitzgelegenheiten, nur Sitzgelegenheiten. Man konnte sich auf den Fußboden setzten, auf den phantastische Polster gelegt waren, oder auf ganz hohe Aussichtswarten, von deren lederbezogenen Höhe man die Beine herabschlenkern lassen konnte. Es gab Schaukelstühle, Diwane, Klubsessel, gepolsterte Ecken. Julia Amberg wußte sich am schönsten, wenn sie saß, sie brauchte weiche Lehnen, Armstützen, verstand es, mit einem edlen alten Lehnessel in einem guten Umriß zu verschmelzen. Der Doktor Hofmann hatte in dem Film lauter Szenen hineingeschrieben, in denen Julia sitzen mußte oder sich setzen. So schön ist sie, pflegte Olaf Jaspersen von ihr zu sagen, daß sie sogar gut aussieht, während sie sich niedersetzt; die wunderbarsten Frauen sind sonst in diesem Augenblick häßlich.
Jetzt wählte Julia für sich den rechtwinkligen Diwan, der die Zimmerecke füllte; der Doktor Hofmann bekam einen Klubsessel, aber für Olaf Jaspersen wurde auf dem Teppich ein ganzes Nest gebaut, aus seidenen Daunenkissen und vergoldeten Polstern aus geschmeidigem japanischen Leder. Ein niederes türkisches Tischchen stand in der Reichweite seiner Hand, darauf Schalen mit Pralinés und einer Flasche des süßesten Likörs. Mit melancholischer Freude erkannte er, daß Julia es ihm behaglich machen wollte: Will sie doch, daß ich bleibe?
Julia setzte sich, glitt herrlich auf den Sitz. Sie zündete sich eine Zigarette an und sagte:
»So, lieber Jaspersen, jetzt werden Sie die ganze Nacht hier sitzenbleiben und erzählen. Schlafen können Sie auch morgen im Zug. Ich bin gewiß, Sie haben die interessantesten Dinge erlebt! Passen Sie gut auf, Hofmann, Sie werden Stoff für einen neuen Film bekommen!«
Olaf Jaspersen griff zu den Pralinés. Er sah aus, wie ein müdes Kind, das unausstehliche Erwachsenen plagen. Muß im Salon hübsch gerade sitzen und Gedichte aufsagen. Möchte viel lieber fortlaufen und spielen. Um das zu kurze Näschen zuckte ein Wetterleuchten; man hatte diesen Urwaldforscher, diesen Augenzeugen von hundert entsetzlichen Schlachten mehr als einmal öffentlich weinen gesehen, wenn er Ärger erlitten hatte.
Vielleicht bewahrte ihn diesmal der Doktor Hoffmann davor. Der zog sachlich eine Füllfeder, den etwaigen Filmstoff zu notieren. Die Literatengebärde hatte einen sonderbaren Einfluß auf Jaspersens Stimmung, sie behob ihm gleichsam die peinliche Realität seines Leides. Er sagte mit einem merkwürdigen Lächeln:
»Filmstoff? Filmstoffe können Sie von mir kriegen. Auch zuviel. Warten Sie, wenn ich erst anfange zu erzählen, dauert es tatsächlich bis morgen früh!«
(Er empfand: Morgen früh nach Grönland, irgendwohin, rasch. Sie wird mich nicht zurückhalten, sie braucht mich nicht. Da ich gerade hier bin, kann ich ihr ja vielleicht einen guten Filmstoff erzählen. Sie ist anders geworden, ich habe sie verloren. Ich glaube, die ganze Welt ist ihr nur noch ein guter Filmstoff, mit einer prächtigen Hauptrolle für Frau Julia Amberg. Gut. Sehr gut. Ich erzähle ihr jene Geschichte von Bimini, die ganze Nacht lang – .)
»Oder wollen sie vielleicht vorlesen?« fragte Julia. »Haben Sie Ihre Reisebereichte schon an ihr Blatt geschickt?«
»Ja,« sagte Olaf Jaspersen, »sie werden gewiß schon zu erscheinen beginnen. Eine Sensation, denke ich, meine Enthüllungen über die unglaublichen Zustände in Bimini.«
»Bimini?« wunderte sich Doktor Hofmann.
»Republica Federal de las Provincias Unidas de Bimini«, sagte Olaf Jaspersen. »Der jüngste der zentralamerikanischen Staaten. Nicht weiter erstaunlich, daß Sie ihn nicht kennen, hier in Europa weiß kein Mensch, was in Mittelamerika vorgeht. Aber doch, lesen Sie denn gar keine Zeitungen? In der letzten Zeit war Bimini sogar einigermaßen aktuell.«
»Nie gehört«, beharrte der Doktor Hofmann. Aber Julia lächelte weise:
»Ich schon. Ich kann Bimini sogar auswendig!«
Sie richtete sich in ihrer Diwanecke auf, wippte mit dem Fuß, rezitierte halb singend Verse von Heine:
»Auf der Insel Bimini
Quillt die allerlieblichste Quelle;
Aus dem teuren Wunderhorn
Fließt das Wasser der Verjüngung.
Nach dem ew’gen Jugendlande,
Nach dem Eiland Bimini
Geht mein Sehnen und Verlangen;
Lebet wohl, ihr lieben Freunde!
Alte Katze Mimili,
Alter Haushahn Kikriki,
Lebet wohl, wir kehren nie,
Nie zurück von Bimini!«
Olaf Jaspersens höfliche Miene gefror und sah aus wie Himbeereis. Diese kokette Rezitation verstimmte ihn. Anders war Julia Amberg. Schon ganz eine Schauspielerin. Er setzte ein strenges Gesicht auf, als ein gestörter Erzähler.
»Bimini«, sagte er, »liegt durchaus nicht nur in den gesammelten Gedichten von Heine, sondern es liegt unter dem fünfzehnten Grad nördlicher Breite und wird begrenzt von Guatemala und Honduras…«
»Kleiner Vogel Kolibri,
führe uns nach Bimini!«
trällerte Julia und sah Olaf Jaspersen lächelnd an, so daß das Wort Kolibri wie ein Kosename klang. Olaf Jaspersen war zu schwach, um sich dieses Lächelns nicht zu freuen, aber er wußte, daß er Julia verloren hatte.
»Gut, nach Bimini!« sagte er, und niemand konnte den Seufzer hören.
Er erzählte die ganze lange Nacht, in seinem weichen Nest aus vergoldeten Kissen, zu Julia Ambergs Füßen, während der Doktor Hofmann für einen fabelhaften Sensationsfilm Notizen machte.
II. Führe uns nach Bimini
Ich war in New-York, erzählte Olaf Jaspersen, und hatte meinen Beruf aufgegeben, diesen sonderbaren Beruf, Dinge zu erleben, um sie dann niederzuschreiben. Ich fühlte mich damals allein und unglücklich, ich sage nicht, weswegen. Ich dachte: muß ich außerdem noch ein Reporter sein? Ich kann einige andere Dinge viel besser, zum Beispiel tanzen.
Ich gab meinen Beruf auf, weil ich in der Laune war, mein ganzes bisheriges Leben aufgeben zu wollen. Ich hörte plötzlich auf, der »Ny Eidende« Berichte zu schicken, da hörte sie auf, mir Geld zu schicken. Ich zog aus dem Hotel Astoria aus, nahm ein Zimmer in einem billigen Boardinghouse, schrieb keinem Menschen meine Adresse. Dann hörte ich auf, Zeitungen zu lesen. Gerade als mein letztes Geld ausging, fand ich ein Engagement im Ballett der Metropolitan-Oper. Elf Dollars wöchentlich. Ich tanzte, als Hurone kostümiert. In dem indianischen Ballett »Minne-Haha«, nach Longfellows Hiawatha, braun angestrichen, mit Federn auf dem Kopf und einer Friedenspfeife in der Hand. Ich tat es nicht ungern, weil ich nicht gezwungen wurde, nachher die Impressionen eines Indianerhäuptlings lebendig zu beschreiben. Nur elf Dollars wöchentlich waren wenig. Ich bin immer so ein Schwein, so oft ich ein neues Leben anfange, stört mich die Erinnerung, daß ich im alten Leben meine gehaßte Redaktion anständige Diäten zu zahlen pflegte. Es ist im Grunde lächerlich, weil ich doch eigentlich sehr gut tanzen kann. Hätte ich nur mit Geduld ausgehalten, gewiß hätte man mir schließlich fürs Tanzen so viel bezahlt wie fürs Schreiben. Plötzlich wieder aus der Vergessenheit auftauchen, ein weltberühmter Tänzer sein, mich von allen Kollegen interviewen zu lassen, welch ein Traum! Ich, Olaf Jaspersen, hätte ich den Reportern gesagt, bin ich selbst, in tausend Masken ich selbst, in Millionen Gesten ich selbst, das heißt: ich tanze. Ich lehne es ab, fortwährend von Dingen zu erzählen, die mich nichts angehen, von Attentaten, Kongressen, Kriegen und Ausstellungen. Ich erzähle fortwährend von mir selbst, das heißt: ich tanze. Das mit dem Schreiben, hätte ich dem Interviewer gesagt, wäre noch nicht so arg, wenn man fortwährend von sich selbst schreiben dürfte. Nur der Tänzer hat das Recht, stets den Gegenstand auszudrücken, der doch jeden Menschen einzig und allein interessiert, sein durch die eigene Haut begrenztes absolutes Königreich –
Aber für elf Dollars wöchentlich bekommt man zu wenig Bohnen mit Speck und zu viele Wanzen. Vielleicht hätte ich es ausgehalten, und nächstens versuche ich es bestimmt wieder, nur ein Zufall machte mich von neuem zum Journalisten.
Es geschah an einem Winterabend, an dem »Minne-Haha« nicht gegeben wurde. Ich saß in meinem kläglichen kleinen Zimmer im Osten und weinte, nicht aus Heimweh oder sonst einer Sentimentalität, sondern einfach, weil mir kalt war; wenn ich friere, muß ich immer weinen. Ich hatte noch fünfundsiebzig Cents und überlegte, ob ich mir davon etwas Kohle kaufen konnte. Ich ging auf die Straße, aber der Kohlenhändler hatte schon geschlossen. Ich kam an einem Kino vorbei; da löste ich mir die billigste Eintrittskarte und trat ein, nicht weil mir nach einer Kinovorstellung verlangte, sondern weil das Kino sicher gut geheizt sein würde.
Drinnen wurde es mir auch wirklich wunderbar warm, und nicht nur wegen der Zentralheizung. Das Filmbild an der weißen Wand strahlte Sonnenlicht aus, die herrlichste tropische Sonne. So verdrossen ich eingetreten war, der Film fesselte mich vom ersten Augenblick an; einen so schönen, einen so natürlichen glaubte ich noch niemals gesehen zu haben. Das Abenteuerstück, das man vorführte, hieß »Der Schleier der Soledad Ramon«. Es spielte irgendwo im spanischen Amerika und war sicherlich an Ort und Stelle aufgenommen worden, weder vor den Leinwänden eines Ateliers, noch in einer der Filmstädte Kaliforniens, wo es zwar echte Sonne und echte Palmen gibt, wo sie aber zivilisiert und in ein ordentliches Grundbuch eingetragen sind. – Nein, die Szenerie dieses Films war echt bis in die kleinste Einzelheit; das war der wirkliche Urwald, der wirkliche Alligatorensumpf, ein wirklicher Vulkan. Die Illusion war vollkommen; man meinte, die Handlung müßte sich wirklich zugetragen haben. Diese Handlung war romantisch genug, romanhaft sogar, eine Geschichte von wilden Räubern, wilden Bestien, Dolchen, Mord und Eifersucht, aber wirklichen Lebens voll, von einer frappierenden, einer hinreißenden Wahrheit im kleinen und einzelnen. Diese Frau, die Heldin, Soledad Ramon, schien keinen einzigen Augenblick Komödie zu spielen, oder vielmehr immer, wie es eine schöne Frau eben tut; – wenn sie aber auf dem Theater Komödie spielen oder vor dem Kinoobjektiv, dann pflegen sie befangen zu sein und ganz gewöhnlich natürlich zu werden, darum ist alle Schauspielerei so unecht. Diese Frau auf der weißen Wand ließ mich die Existenz aller weißen Wände vergessen; ich sah ihre Schicksale und erlebte sie mit, bangte, wenn sie in Gefahr war, triumphierte, wenn sie gerettet wurde – von einem schönen, dunklen, heldenhaften Mann, der mit ihr durch dieses Stück Leben schritt; wie ein naiver Bauernjunge hätte ich in die Vorstellung hineinschreien wollen, warnen, jammern oder frohlocken, so eng verband ich mich mit den Erlebnissen der Soledad Ramon. Kannte ich nicht ihre ganze Seele? Wenn Sie in tausend Gefahren, in ihrer bunten, heißen Heimatwelt diese sprechenden Augen aufschlug, bedurfte ich keiner erklärenden Inschrift. Was sie mit ihrem männlich schönen Schicksalsgefährten sprach, war deutlich gesprochen ohne Laut. Welch ein Zusammenspiel, welch ein Ausdruck, welch eine große, große Künstlerin! Diese Frau hätte es verdient, der berühmteste Filmstar der Vereinigten Staaten zu sein; aber ich erinnerte mich nicht, ihren Namen jemals gelesen zu haben, noch auch den der »Mirador Company«, der Filmgesellschaft, deren Produkt nach dem Zettel dieses erstaunliche Kinodrama war. Entweder eine ganz neue Gesellschaft, oder eine, die jede Kunst meisterhaft verstand, nur nicht die der Reklame.
Ich saß da und starrte die göttliche Tropenlandschaft des Films an, Lianengestrüpp, Kolibris, besonnte Estancias, grell belichtete Adobehäuser unter Palmen. Eine tolle Sehnsucht nach all der bunten Welt überkam mich. Olaf Jaspersen, sagte ich mir, mußt du denn wirklich in dieser gräßlichen großen Stadt sitzen, in einem verwanzten Boardinghouse bei zehn Grad Kälte? Olaf Jaspersen, weißt du nicht mehr, wo deine Seele zu Hause ist? Warum ruhst du nicht auf einer von Palmen beschatteten Veranda, warum blickst du nicht auf eine blaue und diamantene Meeresbrandung? Mußt du unbedingt Bohnen und Speck essen, statt Bananen und Mangopflaumen? Rede dir nichts vor, Bananen und Mangopflaumen sind dir lieber! Und dabei weißt du doch sehr gut, wie du dazu gelangen könntest, noch am Ende dieses kalten Monats irgendwo in einer paradiesischen Tropenlandschaft auf einem sehr bequemen Lehnsessel zu liegen; du müßtest nur morgen früh im Depeschenteil des »New York Herold« nachsehen, in welchem Teil Südamerikas jetzt gerade eine Revolution stattfindet, und morgen nachmittag an »Ny Eidende« in Kopenhagen telegraphieren, daß du im Begriffe bist, eine ungemein interessante Expedition nach Bolivien anzutreten oder nach Ecuador; kein Zweifel, daß dir Pedersen sofort das nötige Geld kabelt.
Vielleicht hätte ich der Verlockung widerstanden, wenn Soledad Ramon auf dem Film nicht in diesem Augenblick so gelächelt hätte, daß ich in diesem Frauenlächeln alles sah, was auf der Welt schön ist: die Sonne, das südliche Meer, ein Tropenwald und der Geschmack exotischer Früchte, mit einem Wort: das Paradies, nach dem wir alle verlangen, ohne es immer zu wissen. Ich ging nach Hause wie in einem Opiumrausch. Zu Hause war es sehr kalt und trotz der Kälte bissen die Wanzen sehr. Ich hatte eine Nacht voll schwerer Versuchungen und bestand sie nicht. Es ist so leicht, gegen sich selbst unanständig zu sein, und es rentiert sich so gut. Ich weiß in jedem Augenblick meines Daseins, daß ich gegen meine Natur lebe, aber – –
Ich will es kurz sagen: am nächsten Morgen kaufte ich mir für meine letzten Cents Zeitungen. Irgend etwas in mir hoffte noch, es würde nichts darin stehen, kein überzeugender Anlaß, von »Ny Eidende« Geld für eine journalistische Reise zu verlangen. Aber mein Unterbewußtsein zweifelte nicht daran. Es war die erste Zeitung, die ich seit langen Monaten in die Hand bekam; es hätte nichts von Belang darin sein müssen. Aber nein; mein zufälliger Griff schlug sofort die richtige Stelle auf. Sogleich sah ich eine von den ungeheueren amerikanischen Überschriften:
»Das Geheimnis von Bimini«
Worin dieses Geheimnis bestand, konnte ich aus dem Artikel nicht ohne weiteres ersehen; offenbar war der Aufsatz der letzte einer langen Reihe und eine große Sensation bereits im Verklingen; jetzt erinnerte ich mich auch, daß im Theater von der Sache gesprochen worden war, ich hatte nur weggehört. In dem Artikel war von dem Morgan-Konzern die Rede und von dem Kupfertrust; nach der Ansicht des Verfassers sollten sie zu General Juan Iriarte, dem Diktator der Republik Bimini, in bedeutsamen geschäftlichen Beziehungen stehen. Warum aber Don Juan Iriarte fortwährend
»Die Sphinx von Zentralamerika«
genannt wurde und die Republik, die dieser Mann regierte,
»Das Verschlossene Land«,
das brachte ich nicht heraus. Die Angelegenheit war offenbar schon so viel besprochen worden, daß jemand, der die Zeitungen eifriger gelesen hatte als ich, das Problem jedenfalls schon kennen mußte. Die Lösung aber schien dem Kollegen den der New-Yorker-Presse, aus ihrem vagen Herumreden zu schließen, in keiner Weise gelöst zu sein; was immer es war, es war
»Das grosse Rätsel«.
Soviel war klar, in den lateinischen Tropenländern, nach denen meine Sehnsucht war, mußte es in diesem Augenblick eine sehr lohnende Aufgabe für reisende Journalisten geben, ein großes politisches oder weltwirtschaftliches Problem, dem die Presse vergeblich auf den Grund zu kommen suchte. Ich sah sofort, daß der große alte Mann Pedersen von der »Ny Eidende« entzückt sein müßte, wenn ich in diesem Augenblick plötzlich wieder auftauchte, und zwar gerade in diesem Bimini; der Kerl liebt solche exotischen Angelegenheiten mehr als den pikantesten Kopenhagener Scheidungsfall und ist ungeheuer stolz darauf, wenn einer seiner Mitarbeiter seine Nase in derartige Sachen steckt, die den Kopenhagener Spießer möglichst wenig angehen. Kein Zweifel, das Geld für diese Expedition war zu bekommen. Wenn ich meinen Herrn Herausgeber richtig kannte, hatte er verzweifelt ins Blaue herumgekabelt, um mich zu erreichen und mir die Reise nach Bimini vorzuschlagen. So grundwenig ich von der Sache bisher wußte, sie hatte den richtigen Geruch; der Zeitungsteufel, der sich da meine unsterbliche Seele wieder einmal kaufte, hatte sich nicht lumpen lassen und mir einen prächtigen Köder hingelegt.
Wie ich nach Bimini gelangen sollte, den Präsidenten Don Juan Iriarte interviewen, das Geheimnis des verschollenen Landes enthüllen, die Sphinx von Zentralamerika enträtseln, das machte mir keine großen Sorgen. Unendlich viel schwerer war es, das kürzeste Telegramm an Pedersen zu schicken. Ich hatte keinen Heller mehr, und meine wöchentlichen elf Dollars sollte ich erst in zwei Tagen bekommen; dann aber mußte ich mindestens neun davon der Mrs. O’Rafferty geben, meiner Pensionswirtin. Ich war ihr viel mehr schuldig; keine Rede davon, daß sie mich etwa mit meinem Gepäck ausziehen lassen würde. Ich besaß noch einen anständigen Koffer; wenn ich mit ihm vor dem Astoria-Hotel vorfuhr, war alles in Ordnung, man kannte mich dort sehr gut und würde ohne den geringsten Verdacht den Wagen für mich bezahlen, das Geld für die Kabeldepesche auslegen und mir so lange Kredit gewähren, bis Pedersen Geld angewiesen haben würde. Aber das alles doch nur unter der Voraussetzung, daß ich mich in einem anständigen Winterrock, guten Schuhen und sauberer Wäsche präsentierte, und eben daran fehlte es. Wie mit einem imposanten, wenn auch leeren Schrankkoffer die Boardingspelunke der guten Deborah O’Rafferty verlassen? Auf welche Weise kreditwürdig aussehen? Ich trug einen meiner blauen Anzüge, aber schon sehr lange, und einen Sommerüberzieher, in dem ich zu schlafen pflegte, wegen der Kälte. Die Schwierigkeit schien unüberwindlich; ich gestehe, daß ich zuerst ganz verzweifelt war und ein wenig geweint habe.