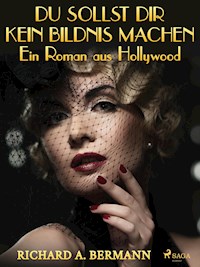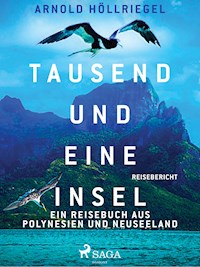
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Niemand ist eine Insel, gestellt auf sich allein" – dieses Wort des englischen Schriftstellers und Theologen John Donne Ist einem sofort verinnerlicht, wenn man an die Lektüre dieses außergewöhnlichen Buches geht. Und doch ist alles anders: "Das Gästehaus, in dem ich schlafen soll, ist ein ganz gewaltiges Gebäude, groß, hoch und leer, wie eine Ballonhalle, denn: keine Kokosnuss darf aus dieser Insel wachsen, keine Brotfrucht. Was die großen Herren brauchen, bringt man von den anderen Inseln – hier wird weder gesät noch geerntet." Also ein Paradies des Nichtstuns mitten in Polynesien. "Und dann ist da noch Neuseeland. Als Neuseeland noch Aotearoa war, das Land der Maon, lebten die heimischen Vögel dort wie in einem wirklichen Paradies. Deshalb haben viele Vögel das Fliegen verlernt, weil sie die Furcht verlernten." So gibt dieser einzigartige Schriftsteller Kunde von zwei Paradiesen in Inselform – und dem Leser bleibt die Sehnsucht.Arnold Höllriegel ist das Pseudonym von Richard Arnold Bermann (1883–1939), einem österreichischen Journalisten und Reiseschriftsteller. In Wien geboren und aufgewachsen studierte Bermann bis zu seiner Promotion 1906 an der Universität Wien Romanistik. 1908 ging er auf Anraten Hermann Bahrs nach Berlin, wo er zunächst als Angestellter des Scherl-Verlags tätig war. Bei der Konkurrenz "Berliner Tageblatt" begann er in dieser Zeit, unter dem Pseudonym Arnold Höllriegel zu schreiben. Geprägt durch die Tradition des Wiener Feuilletons und den Stil Peter Altenbergs, führte er in Berlin das Kurzfeuilleton ein. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges musste Bermann nach Wien zurückkehren, wo er bis 1928 seinen Wohnsitz hatte. Er schrieb als "pazifistischer Kriegsberichterstatter" – so Hermann Broch – für verschiedene Zeitungen. Ab 1923 war er hauptsächlich als Reiseschriftsteller tätig. Seine Reisen, die ihn auch nach Ägypten und Palästina, an den Amazonas, in die Südsee, in die USA und nach Hollywood führten (wo er u. a. Charlie Chaplin begegnete), verarbeitete er in Feuilletons für das "Berliner Tageblatt" und in erfolgreichen Büchern. 1933 führte ihn eine Expedition gemeinsam mit Ladislaus Almásy (bekannt als der "englische Patient") in die libysche Wüste, wo sie die sagenumwobene Oase Zarzura entdecken. Hier, mitten in der Wüste, erreicht ihn im Frühjahr 1933 die Kündigung durch das "Berliner Tageblatt". Nach 1933 arbeitete Bermann mit Hubertus Prinz zu Löwenstein für die "American Guild for German Cultural Freedom". Bermans sämtliche Schriften wurden 1938 im Deutschen Reich verboten. Nach dem Anschluss Österreichs und seiner Flucht konnte er in die USA emigrieren, wo er im Herbst 1939 in der Künstlerkolonie Yaddo in Saratoga Springs, New York, einem Herzinfarkt erlag.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnold Höllriegel
Tausend und eine Insel
Ein Reisebuch aus Polynesien und Neuseeland
Saga
Tausend und eine Insel. Ein Reisebuch aus Polynesien und Neuseeland
German
© 1927 Arnold Höllriegel
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517697
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
„Der erste Eindruck kann niemals wiederholt werden. Die erste Liebe, der erste Sonnenuntergang, die erste Südseeinsel, das sind Erinnerungen für sich, die haben eine jungfräuliche Stelle der Empfindung berührt.“
Stevenson
Ich hatte die Endstation der elektrischen Strassenbahn hinter mir gelassen und die Gartenstrasse zwischen den lieben luftigen Bungalows. Ich ging, durch eine angenehme und duftende Sonnenhitze, langsam bergauf, dem Bergpass Pali zu; über meinem leinenen Anzug hing mir eine lange, dicke Girlande aus dem weissen Jasmin der Insel, den sie Nau nennen; ich hatte mir diese Girlande um den Hals gehängt, nicht aus besonderer Verschmocktheit, sondern weil ich der lachenden Bitte eines kanakischen Knaben nicht hatte widerstehen können; einen anderen Kranz, aus stark riechenden scharlachroten Blüten, hatte er mir um meinen Panama gelegt; so ging ich, geschmückt wie ein König oder wie ein Pfingstochse, die Bergstrasse empor, bis sie einsamer wurde und an der Seite eines tiefen Abgrundes höher stieg. Ab und zu rollte ein Auto an mir vorbei, mit Touristen von unserem Schiff, die die berühmte Aussicht sehen wollten oder die Ananasplantagen; oder es sass ein alter Amerikaner im Auto oder eine Dame mit japanischen Gesichtszügen, zwischen reizend drolligen Kindern; einmal war es eine ganz alte, fette Chinesin, in Hosen und einem Hemd aus schwarzem Satin. Ich kam auf den Serpentinen höher und höher, bis ich tief unter mir Honolulu liegen sah, den Hafen, die beiden roten Riesenschornsteine des Schiffes, das mich hergebracht hatte, und die ganze grausame Geometrie einer westamerikanischen Stadtarchitektur, in die lieblichste aller Landschaften hineinliniiert.
An dieser Stelle setzte ich mich auf einen Stein, im Schatten eines Baumes, voll von purpurnen Blütenbällen, den ich den Ohiabaum zu nennen bereits gelernt hatte. Ich hatte ein Buch bei mir, die schönen und krausen Legenden des braunen Volkes von Hawaii enthaltend; ich sass ganz glückselig da, mit einer von den leichten Manilas im Mund, die ich mir zu dem Spaziergang gekauft hatte. Manchmal las ich, und manchmal sah ich hinab, mit verliebten Blicken, die den holden Küstenumriss liebkosten, das Blau des Meeres und die weisse Linie des umbrandeten Korallenriffs. Nach einiger Zeit kam ein Mann des Weges, mit einem sonderbaren Ding in der Hand. Er achtete nicht auf mich, sondern setzte sich, langsam und unbeholfen, mir gerade gegenüber, jenseits des Strassenbandes, auf der Seite der Schlucht von Nuuanu, deren Wände hier steil abfielen, ganz bedeckt von einem unsagbaren Gewirr schwarzgrüner Laubbäume, ganz heller Farne und schreiend bunter Blüten ohne Zahl. Nun sass der Mann. Er trug schmutzige Leinenschuhe, eine Hose aus Segelleinwand, ein Hemd und den groben Strohhut des Landes. Jetzt wandte er mir sein Gesicht zu. Er war ein nussbrauner Kanake, zwischen Vierzig und Fünfzig, pockennarbig und offenbar blind. Er packte das Ding aus, das er mitgebracht hatte, es war eine von diesen dreisaitigen Gitarren, die, glaube ich, Ukulele heissen. Als der Mann das Geräusch eines nahenden Autos hörte, begann er mit einer schönen vollen Stimme zu singen, während er auf seinem Instrument mehr trommelte als Musik machte. Er sang in jener wunderbaren Sprache Polynesiens, deren vokalreiche Dialekte einander auf all den vielen, weit zerstreuten Inseln so sehr gleichen; die Melodie schien mir nur ein rhapsodischer Rhythmus; ich bildete mir von Anfang an ein, dass der Mann nicht lyrisch, sondern episch sang, dass er eine lange Geschichte zur Ukulele rezitierte.
Ich sass ganz still, und ich wusste nicht, ob der Blinde von meiner Anwesenheit wusste. Aber er wandte sein ernstes und hässliches Gesicht fortwährend mir zu, und er sang auch dann weiter, wenn kein Auto vorbeifuhr. Ich nahm mir vor, ihm nachher ein Almosen in den Schoss zu legen, und empfand unterdessen das nicht unangenehme, wenn auch einförmige Rezitativ als Bestandteil der Landschaft, wie die wenigen hellen Vogelstimmen, die manchmal aus den Bäumen kamen. Es sass sich so angenehm da am Rand des wilden Busches; nichts von den höllischen Plagen, die den brasilischen Urwald verpesten. Hawaii und ganz Polynesien ist ein Land, in dessen Wäldern keine giftigen Schlangen sind und keinerlei bedenkliches Getier. Keine Mücke kam mich stören, keine Fliege noch Ameise; ich konnte mich von meinem Stein in weiche Farne zurücklehnen, so dass ich besser nach unten sah, wo sich die Umrisse der Insel ins Wasser tauchten, genau gefolgt von der Linie des Riffs, ein Stückchen weiter draussen. Mir fiel auf, dass all das aussah, als hätte ich ein Prisma vor den Augen gehabt: mit unglaublichen farbigen Rändern rings um das ganze Bild und um seine einzelnen Linien. In meinem Buch stand, dass die alten Polynesier Hawaii genannt hatten: die Regenbogeninseln. Wirklich, es war ein Land im Regenbogen! Nur über mir, auf der Höhe des Pali, brach das prismatische Spiel fast unirdischer Spektralfarben auf einmal ab und dämpfte sich ab bis zum tiefsten Grau. Eine grosse Wolke lag bäuchlings auf dem Berge. So hatte Maui ...
Ich fuhr zusammen. Ich hatte, mit meinem Legendenbuch in der Hand, gedacht: Maui — und dieser blinde Rhapsode hatte den gleichen Namen gesungen: Maui. War es möglich? Sang dieser kanakische Homer da von Helden und Göttern? War das wirklich und wahrhaftig eine echte alte Mele des sterbenden braunen Volkes von Hawaii?
— — Lasst mich dabei! Also gut, die alten Barden Hawaiis sind längst ausgestorben oder gehen mit einem Zylinder auf dem Kopf in die Sonntagsschule. Aber ich habe, im Tal von Nuuanu, auf der Strasse zum hohen Bergpass Pali, einen Haku Mele von Hawaii eine uralte „Mele“ singen gehört, ein wahres Lied von Helden und Göttern!
Von Maui sang der blinde Mann, von Maui, der Himmel und Erde schied. Wisset, dass der Himmel einst schwer auf Hawaii lag, das Land fast erstickend. Da wachten die Pflanzen auf, alle die Bäume, die Blumen, die Gräser, und strebten empor. Da schoben sie den Himmel ein wenig aufwärts, und bis zum heutigen Tag sind alle Blätter ganz platt von der furchtbaren Last. Die guten, schönen, duftenden Pflanzen drängten den Himmel empor; schon konnten die Menschen auf ihren Bäuchen kriechen, zwischen Himmel und Erde. Da sprach Maui zu einem Weibe: „Gib mir einen Schluck aus deiner Kürbisflasche, so will ich den Himmel von der Erde trennen!“ Da gab das Weib ihm zu trinken, und Maui ging zu seinem Vater Ru, der den Himmel auf seiner Schulter trug. „Wir wollen dem Himmel einen Stoss geben!“ sagte Maui. Da schoben sie die Flächen ihrer Hände unter den schweren Himmel, dann die Spitzen ihrer Finger und stiessen den Himmel, dass er aufwärts schnellte. Nur manchmal wagt er seither, auf die hohen Berge zu fallen; die Menschen der Ebene atmen frei zwischen Erde und Himmel. Sprach Hinavon-dem-Feuer, die Mutter Mauis, sie, die unter dem Wasserfall in der Höhle haust: der Himmel drückt mich nicht mehr, doch zu schnell eilt die Sonne. Wie soll ich all mein Kapatuch trocknen, wenn der Tag so kurz ist?
Denn Hina-von-dem-Feuer war kunstreich im Färben von Basttuch. Da machte Maui eine Schnur von Kokosfasern und machte eine Schlinge daraus und fing die Sonne, dass sie nicht so rasch laufen konnte — —
Das ist die Mele von Maui, die ich singen gehört habe. Sicherlich sang dieser Sänger auch von des Helden herrlichen Fahrten über das ganze Meer, zwischen den tausend und tausend Inseln, von denen alle die braunen Völker des Ozeans wissen, von Hawaii bis nach Neuseeland. Sicherlich sang er vom Tod des Helden, der wie Prometheus den Menschen das Licht und das Feuer gebracht hat und der doch kein unsterblicher Gott war: er ist auf einer fernen, fernen Insel gestorben, im Innern der grossen Hina, die die Hüterin des Lebens ist. Er sprang in ihren ungeheuren Mund, um in dem dunklen Riesenleib die verborgene Quelle des Lebens zu suchen, die dort sein musste, irgendwo bei dem Herzen der grossen Göttin — —
Sicherlich sang dann der blinde Sänger auch, warum Maui den Menschen die Unsterblichkeit nicht erobert hat und warum er selbst gestorben ist, im grauenhaften Dunkel des Götterleibes. Seht, das Vögelchen Patatai begann schrill zu lachen, als es Mauis schön tätowierten Körper zwischen den Lippen der Göttin verschwinden sah. So verriet der kleine Vogel den Helden; und Hina schnappte ihre grossen Zähne zu, die aus hartem Obsidian gemeisselt waren.
Dies ist das Lied von Maui, und ich habe es singen gehört.
Als er das Lied von Maui zu Ende gesungen hatte, hörte der blinde Sänger auf, vielleicht, weil er um den herrlichen Helden trauerte, oder vielleicht, weil die Mittagszeit da war und gar keine Autos mehr vorbeikamen, aus denen Centmünzen hätten fallen können. Aber der blinde Homer von Hawaii ging nicht weg, vielleicht, weil ich noch da war und ihm noch nichts gegeben hatte; er sass da, mit seiner Ukulele auf den Knien, und seine blinden Augen blickten hinunter auf das Land mit den Regenbogenrändern, und vielleicht dachte er darüber nach, ob jemand da war und ihm vielleicht einen ganzen Quarter geben würde, auch vielleicht hatten seine blinden Augen eine Vision: sie sahen die Sonne des 18. Januars 1778 und ein grosses Ding, das auf einmal im Meere sichtbar war, sonderbar, herrlich anzusehen und bedrohlich.
Fragten die Leute von Oahu die Leute von Kauai: „Welch ein Ding ist das, dieses Schiff?“ — Sagten die Leute von Kauai, die Seiner Majestät Schiff „Resolution“, Captain James Cook, zuerst gesichtet hatten: „Dieses Schiff ist wie ein Heiau, wie ein Tempel des Gottes Lono, mit Stufen, die zu den Altären hinaufführen, mit hohen Bäumen, die ihre Äste nach allen Seiten strecken, und vorn ein grosser Stock, wie die scharfe Nase eines Schwertfisches. Die Männer, die auf dem Schiff sind, haben weisse Köpfe mit Ecken, Kleider wie faltige Haut, Löcher in ihren Seiten, aus denen sie die Schätze holen, die in ihrem Leib versteckt sind, spitzige Dinge an ihren Füssen und Feuer in ihrem Mund, so dass Rauch aus ihm kommt wie aus dem Vater der Vulkane, Kilauea.“
Ich sehe meinen blinden Barden noch einmal an, und nun hoffe ich, gegen die Vernunft, dass er, blind geboren, vielleicht um das Hawaii von heute nicht weiss. Er ist ein Sänger, der die Götter preist und die Helden, kein Zweifel, dass er Kamehameha kennt, „den Grossen“, wenn er auch seine Statue nicht gesehen hat, unten, vor dem „Kapitol“, das einst sein Palast war. Dort steht er, mit einem hellenischen Helm auf dem Kopf, denn die Häuptlinge Hawaiis trugen einen Helm wie die griechischen Hopliten — und ist ein sehr grosser König, zweifelt nicht: weil er den neuen weissen Göttern rasch, rasch ein paar alte Schiffskanonen abzukaufen verstanden hat und mit ihnen die anderen Häuptlinge zu unterwerfen, in der Seeschlacht, die heisst: Kapuwahu-ulaula, das ist: Kanone mit dem roten Maul.
Sicherlich weiss mein Barde das und wie die Kanaken einander nun viel rascher totschlagen konnten, nachdem die Weissen zu ihnen gekommen waren. Auch weiss er um die anderen Segnungen: wie mit den hübschen anständigen Kleidern die Schwindsucht kam, mit der neuen Geschlechtsmoral die Syphilis, mit der herrlichen neuen Medizin jede Art von Krankheit und Tod — —
Ich weiss, dass der Blinde das alles kennen muss, die grosse Tragödie der liebreizenden braunen Kindervölker von Polynesien; und ich möchte nicht, dass er die Melancholie dieses Bewusstseins misste, da er doch ein Sänger ist — —
Aber die volle Wahrheit, nein, die volle Wahrheit soll er mir nicht wissen! Möge dieser Blinde, hier hoch oben über der neuen Stadt Honolulu, sich einbilden, dass sein Volk diesen überlegenen weissen Wesen nicht gewachsen war, dass es zu ihren Füssen stirbt und dass sie siegreich sind, ohne Erbarmen, doch gross — —
Nicht die Wahrheit, nicht die volle Wahrheit, ihr Götter von Hawaii, ihr viertausend Götter, ihr vierzigtausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter, ihr Reihe von Göttern, Versammlung von Göttern, o Götter des Waldes und der Gebirge, o Götter des Wassers, alle — —
Nicht die volle Wahrheit lasst diesen Blinden wissen, ich schäme mich so.
Nicht, dass diese Stadt, die ich da zu meinen Füssen sehe, gar keine Stadt des weissen Mannes geworden ist, sondern dass sie, mitsamt ihren Warenhäusern und Autos und Strassenbahnen, mit ihren Quick Lunch Counters und dem Kamehameha-Kino, mit ihren Hotels und Telephonen und Ansichtskarten, mit Verkehrspolizei und Prohibition und Radio, mit ihrem Reisegeschäft und Ananasgeschäft und Fremdengeschäft, dass sie schon heute mehr den Gelben gehört als den Weissen. Dass in dem amerikanischen Territorium von Hawaii zwar heute drei Weisse auf einen Kanaken kommen, aber ebenso drei Asiaten auf einen Weissen, dass diese Inseln zwar nicht mehr das Land des braunen Blumenvolkes sind, aber auch nicht das Land der weissen Eindringlinge!
Ihr viertausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter Hawaiis, lasst diesem blinden alten Manne den Triumph der Japaner verborgen sein und das Gewimmel der Chinesen, der Koreaner und Filipinos. Sagt ihm nicht, dass die Vorstädte Honolulus aussehen wie jene von Nagasaki!
Lasst ihn nicht ahnen, dass diese schönen alten Sagen, die er liebt, ganz umsonst gestorben sind und dass nicht, wie er glaubt, der weisse Christ das Erbe des kanakischen Heilands Maui erlangt hat: dass heute, so gross ist der Erfolg der Missionare aller christlichen Konfessionen, dass heute die Mehrheit der Inselbewohner den grossen Buddha verehrt, Laotse oder die Ahnen des Kaisers von Japan.
Ihr viertausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter, lasst den letzten kanakischen Barden, lasst diesen blinden Haku Mele, den ich von Mauis Taten singen hörte, im Hochtal von Nuuanu, auf dem Wege zum Passe Pali, lasset ihn sterben, bevor er diese Wahrheit errät, dass dieses ganze Jahrhundert des weissen Mannes auf Hawaii, all die Brutalität und all die Heuchelei, all die Philanthropie, und seine Religiosität, und seine Hygiene, und seine Elektromotoren und Ford-Autos, dass all das zwar ein liebenswertes und schönes Volk ausgemordet hat, nicht aber das Reich des weissen Mannes begründet hat oder seinen Kindern eine Zukunft gegeben in diesem Paradies des Stillen Ozeans, wo freilich einer der nächsten grossen Akte des menschlichen Dramas spielen wird, doch nicht vor einem Parkett von siegreichen weissen Göttern.
Das Potsdam der Südsee
Ich habe dem Apotheker Brown auf der Victoria-Parade sein altes grüngestrichenes Segelboot mit dem Hilfsmotor abgemietet — es ist, stellt sich heraus, der schäbigste alte Kahn auf Fidschi, dafür aber steuert ihn der Apotheker Brown selbst, und der ist immer besoffen. Da wir unsere Fracht geladen haben und von Suva fortwollen, kommt der ärgste tropische Wasserguss, den ich bisher erlebt habe; es ist nötig, das Ende des Unwetters abzuwarten, und das kostet mich den ganzen Tag: denn da wir endlich ausfahren können, am Inselstrand und den Palmen und den roten Wellblechdächern der Kolonialstadt vorbei, hinaus zur schaumumspritzten Linie des Korallenriffs und dann, immer innerhalb der Lagune, bis zur Mündung des Rewaflusses, der, erstaunlich breit und geruhig, von den umnebelten Zackenbergen kommt, aus dem Innern der Insel Viti Levu — da wir, sage ich, aus der Lagune in den Fluss gefahren sind, durch eine Mündung des grossen Deltas, gewillt, eine andere als Kanal zu gebrauchen und über sie hinweg wieder das freie Meer zu gewinnen — da wir recht hübsch inmitten der Mangrovesümpfe stekken, ist, kurz und gut, die Ebbe gekommen, und wir sitzen auf einer Schlammbank fest, zwischen phantastischen Ufern, die nicht aus Erde sind, sondern ganz aus wirrem Stammgestrüpp, Luftwurzelwerk, tiefgrünem Laub und Moskitos. Man kann nichts tun, als dasitzen, einen herrlichen grauen Kranich bewundern und die Flut erhoffen.
Der Apotheker Brown, ein alter, ganz rot gebeizter Neuseeländer, tröstet sich mit der Whiskyflasche. Ich denke, er ist überhaupt nur mitgefahren, weil ihn seine Frau zu Hause nicht allen Whisky trinken lässt, den er trinken möchte. Der Maschinist liegt auf der Bank beim Motor und schläft; er ist ein nussbrauner Wilder von Ellis Island und vielleicht ein geborener Kannibale. Der Matrose, ein zwölfjähriger Fidschijunge, schwarz und ölig, mit einer enormen weichen Haartolle und einem ganz kleinen Lendenschurz auf all dem üppig muskulösen, dunkelhäutigen Fleisch, hockt auf seinen beiden Schinken und kaut glückselig an einem grossen Stück Zuckerrohr. Ich selbst bin auf allen vieren in die niedrige Kabine gekrochen und krame dort, in einer nach Benzin und Alkohol stinkenden, schweisstreibenden Schwüle, zwischen Schachteln und Kisten herum: ich inspiziere die Fracht meines Schiffes:
64 Yards Kalikostoff, meistens rosa und rot, mit breiten Streifen, aus dem Geschäft von Naurijee Singh, All Nations Street, Suva.
Eingeborenentabak, in einer riesigen gerollten Wurst, etwa zehn Meter davon.
Zuckerzeug, indisch und klebrig.
Alle Mundharmonikas, die in Suva vorhanden gewesen sind. Deutsche Mundharmonikas, Marke: „Fröhliches Terzett“. Auf der Schachtel die Schutzmarke: drei heulende Kater.
Dies ist die Fracht meines Schiffes. Und Whisky. Ich schäme mich, es zu gestehen, aber ich habe auch einen Korb Whisky an Bord für die Häuptlinge. Die sachkundigen Freunde in Suva, die mich beraten hatten, waren der Meinung gewesen, es ginge nicht ohne Whisky.
Nachdem ich die ganze Fracht inspiziert habe, hole ich behutsam einen unschätzbaren Wertgegenstand aus einer Pappschachtel, ein Geschenk für eine Königin: einen kleinen mechanischen Fächer aus Wien, Kärntnerstrasse. Man drückt auf einen Knopf, und die Propellerflügel des Fächers beginnen zu rotieren — —
Ich steige wieder auf Deck, mit dem kleinen Fächer in der Hand, und lege mich auf die Bank und lasse den Fächer schnurren, und ich sauge gierig die Luft ein, die er mir zuweht. So liege ich geduldig und sehe dem Flug phantastischer Vögel zu, die über dem Wasser treiben.
Wir müssen warten, bis die Flut uns flottmacht. Was hat unterdessen der Apotheker mit dem Motor angefangen? Der Motor versagt in dem Augenblick, da die Flut wiederkommt, und es gibt keinen Wind zum Segeln. Erst spät am Nachmittag gelingt es uns, das Flussdelta zu verlassen und seewärts ins Freie zu kommen, in eine traumhaft schöne Bai mit silbergrauen Inselsilhouetten rund um den Horizont. Ein kleines, rundes Eiland, ganz nahe an der Küste der grossen Hauptinsel Viti Levu, wird deutlicher: niedere, vulkanische Klippen und Hügel, wunderbar umgrünt. Wie ich auf diese Berge und Wälder blicke, auf dieses unwirkliche Bild aus Grau und Blau und Giftgrün, empfinde ich, wie an allen diesen Tagen, dass ich jetzt also da bin: in jenen blauen Bergen, die ich einst in meiner Jugend am Horizont gesehen habe und die dann, wenn man hinkam, wirkliche gewöhnliche Berge waren — — Diese bleiben blau umhaucht, auch wenn man sie betritt. Dieser Wald bleibt, auch wenn man ihn betritt, der Wald des Paradieses; das ist nicht der angsterregende Urwald Brasiliens, der von mörderischem Leben wimmelnde asiatische Dschungel, sondern nur ein frohes und freundliches Durcheinander von lieblichen Blumen, von heiter schönen Pflanzen, von köstlichen wilden Früchten. Dieser Wald, der kein einziges schädliches Tier verbirgt, nicht einmal eine Fiebermücke, sieht wie ein ungeheuerer Blumenkorb aus mit Girlanden, Buketten, über den Rand hängenden Farnen. Es gibt Zehntausende dieser Farne, glaube ich, winzig, winzig kleine und andere, die wie Palmbäume in die freie Luft wachsen über das Gestrüpp hinaus. Und das alles, Kluft und Berg, Wildbach, Farne, Blütenbusch, all dieses Grüne, Rote, Silberne hat über sich diesen bläulichen Schatten der Blauen Berge, die echte Farbe der Sehnsucht, des Unerreichbaren — —
Dieser Wald wächst und hängt und taumelt bis in die silberne Bai, durch die unser Boot nun segelt, und die kleine Insel, auf die wir zuhalten, ist auch ganz überfüllt von dieser bläulich bereiften Vegetation. Ein Kanu der Eingeborenen kommt uns entgegen, ein grosses Fischerkanu mit einem Ausleger und dreieckigen Segeln aus Bastmatten. Prachtvolle Menschen, nackt bis zum Lendenschurz, winken lachend.
Jetzt sehen wir unter den hohen Bäumen ein Dorf. Das also ist Mbau, die heilige, die königliche Insel, dies ist das Dorf, in dem die grossen Häuptlinge wohnen, die letzten Enkel der Könige und der Götter — —
Wir legen an einer kleinen wackeligen Landungsbrücke an. Auf ihr erwartet uns ein würdevoller alter Herr, der um seine dunkelbraunen Beine ein eng gebundenes Sulu-Tuch trägt und ein Ruderleibchen um den Oberkörper. Das ist der Tui Savura, ein sehr grosser Fürst unter den vielen Häuptlingen dieser kleinen Insel Mbau.
Wir geben einander die Hand. „Komm an Bord, Tui, have a drink!“
Wir trinken Whisky und Soda in der kleinen Kabine. Der alte Häuptling mit dem eisengrauen Haar über der Runzelstirne sitzt ernst und wohlerzogen da, wie nur irgendein weisser Gentleman. Da wir getrunken haben, nimmt er meine Hand und sagt in einem stockenden Englisch:
„Komm. Deine Sachen, meine Leute bringen sie Ufer, nach und nach. Komm, sieh Dorf.“
Ich erfahre, dass Tui Savura in diesem Augenblick der ranghöchste von den Häuptlingen ist, die auf Mbau weilen; Ratu Pope, der Enkel des letzten Königs von Fidschi, ist auf eine andere Insel gesegelt, wo er bei der Einsetzung eines neuen Häuptlings anwesend sein muss.
Ich habe viel von diesem Häuptling gehört, und es tut mir leid, dass ich ihn nicht sehen werde. Er ist, wie ich weiss, fünfunddreissig Jahre alt, ein schöner tiefdunkler Riese, und er hat mit vierzig Frauen genau hundert Kinder gezeugt. Er ist gebildet wie ein weisser Gentleman, da man ihn auf dem College zu Wanganui in Neuseeland erzogen hat. Er ist ein berühmter Kricketer und Fussballspieler. Er besitzt die unsäglichen Schätze der weissen Menschen, Maschinen, die sprechen, und Maschinen, die fahren, aber auch die Besitztümer, die den Leuten von Fidschi teuer sind, jene unvergleichlich wertvollen Walfischzähne, um deren geringsten in früheren Zeiten ein Mann hätte getötet werden können und nachher gefressen — —
Obwohl Ratu Pope nicht in Mbau ist, muss ich gleich in das Haus des Ratu kommen, das Haus muss jeder Fremde sehen, der auf die Insel kommt. Es ist auch wirklich ein königliches Haus, wenn es auch nur aus porösem Geflecht erbaut ist, mit einem steilen, strohgedeckten Dach, aus dem die beiden leicht gekrümmten Enden des Firstes ins Freie ragen, eines grossen Kokosstammes, der die Form eines abgenagten Knochens hat. Aussen sieht das Haus ein bisschen wild und ruppig aus, aber innen ist es so sauber wie das Haus einer Holländerin, so luftig und kühl wie das Grand Pacific Hotel in Suva, so vornehm wie irgendeine Villa im Faubourg Saint Germain. Der Fussboden, der ein wenig erhöht über Pfählen liegt und daher auch von unten kühlende Luft durchlassen kann, ist mit prachtvollen elastischen Matten belegt, die, schwarz und weiss, aus feinem Stroh geflochten sind, mit bunten Wollfransen an den Rändern. Die ebenfalls geflochtenen und luftdurchlässigen Wände sind an riesigen Pfeilern aus hartem Holz befestigt, die man mit schwarzen, weissen und roten Kokosschnüren umwickelt hat; mit den gleichen vornehm diskreten Mustern sind die ungeheueren Querbalken unter dem Dach geschmückt. Die Wände sind mit Tapa verhangen, dem seidig glänzenden und herrlich gefärbten Bastzeug, das die Frauen Polynesiens aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums machen. Dieses Haus, weil es das Haus des Königsenkels Pope ist, hat, oh, Triumph, oh, raffinierter Luxus, in der Mitte eine niedere Zwischenwand, hinter der ein Schlafzimmer abgeteilt ist, mit einem wirklichen Bett; auch in dem Hauptraum gibt es ein paar europäische Möbel: Korbsessel, einen blank polierten Tisch, eine Bücherstellage, auf der ich ein Buch von Wells liegen sehe. Eine Petroleumlampe hängt vom Deckbalken; eine Photographie hängt an der Wand: Ratu Pope und die Kricketmannschaft von Mbau, vor einem Wettspiel aufgenommen.
Wie mich der alte Tui in dieses schöne Haus führt, empfinde ich sogleich jene besondere Atmosphäre königlicher Paläste und wundere mich nicht, dass ich sofort einer Prinzessin vorgestellt werde. Es ist die Kusine Ratu Popes, wie er ein Abkömmling des letzten unabhängigen Königs von Fidschi, Thakombau. Der alte Kannibale hat im Jahre 1884 ungemein freiwillig seinem Thron entsagt, zugunsten der Königin von England und gegen Zusicherung einer Pension von 2000 Pfund und auch einer Dampfjacht. Der Titel des alten Thakombau, „Tui Viti“, König von Fidschi, hat sich auf seine Nachkommen nicht vererbt; eine Königstochter hat in der Sprache von Fidschi nie irgendeinen Titel gehabt, dennoch nennt jedermann diese Frau, die mich jetzt im Haus ihres Vetters empfängt, eine Prinzessin. Die Prinzessin Andi Thakombau trägt einen roten Kittel, der lose von mageren Schultern hängt. Sie hat sich von der kleinen Nähmaschine erhoben, neben der sie hockte. Jetzt streckt sie mir eine schöne, beringte Hand entgegen und lächelt. Ihr alterndes Gesicht zeigt nicht die melanesischen Negerzüge der Leute von Fidschi; ihre Mutter war eine Fürstentochter aus Tonga, eine von jenen polynesischen Frauen, die den schönsten Europäerinnen aus dem Süden gleichen.
Ich habe nie ein weibliches Wesen gesehen, das mehr einer königlichen Prinzessin geglichen hätte. Unwillkürlich verbeuge ich mich sehr tief. Auch der alte Tui begegnet ihr mit Respekt, obwohl sie doch nur ein Weib ist und Weiber auf Fidschi nicht zählen. Aber um das Haupt der Prinzessin Andi schwebt die „Mana“, das ungeheuere Prestige des alten und heiligen Häuptlingshauses, aus dem sie stammt, dieser Familie der Inselkönige von Mbau, die seit dem Urbeginn der Zeiten da war. Auch ist die Prinzessin Andi reich. Sie hat das beste Kokosnussland, mehr als 350 Acres Pflanzungen. Der Mann, den sie geheiratet hätte, wäre auf weichen Matten dick und fett geworden. Aber sie hat niemals geheiratet.
„Seien Sie willkommen,“ sagt sie zu mir. „Wohnen Sie in unserem Gästehaus? Wir wollen Ihnen ein Fest geben. Es ist spät. Wären Sie früher gekommen, dann hätten wir viele Blumenkränze gewunden — —“