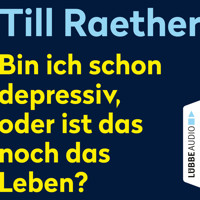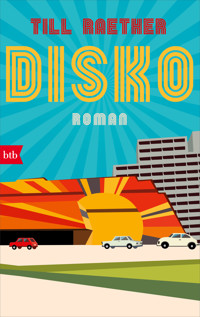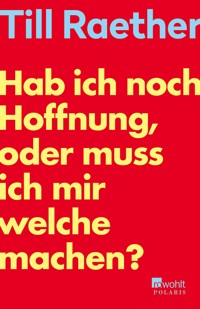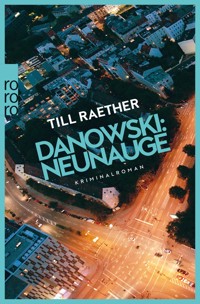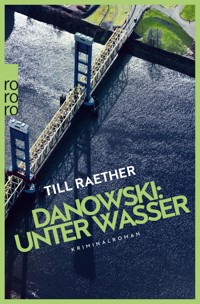4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Depression kann alle treffen, und oft ist sie schwer zu erkennen. Till Raether war in seinem Leben oft traurig und erschöpft – immer wieder, über Wochen. Und ebenso oft stellte er sich die Frage, ob das nun eine Depression sei, oder ob ihn einfach nur das normale, graue Leben beutelte. In seinem Buch erzählt Till Raether offen über eine Krankheit, mit der er seit vielen Jahren lebt und die er häufig mit großem Energieaufwand zu überspielen versuchte. Er schreibt über seine Jagd nach Anerkennung, seine Hilflosigkeit und Überforderung und den dauernden Gedanken, dass er sich doch einfach nur zusammenreißen müsste – und über den Zusammenbruch. Ein ehrliches, warmes Buch über eine Lebenssituation, die vielen Menschen vertraut ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Till Raether
Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?
Über dieses Buch
Depression kann alle treffen, und oft ist sie schwer zu erkennen. Till Raether war in seinem Leben oft traurig und erschöpft – immer wieder, über Wochen. Und ebenso oft stellte er sich die Frage, ob das nun eine Depression sei oder ob ihn einfach nur das normale, graue Leben beutelte. In seinem Buch erzählt Till Raether offen über eine Krankheit, mit der er seit vielen Jahren lebt und die er häufig mit großem Energieaufwand zu überspielen versuchte. Er schreibt über seine Jagd nach Anerkennung, seine Hilflosigkeit und Überforderung und den dauernden Gedanken, dass er sich doch einfach nur zusammenreißen müsste – und über den Zusammenbruch. Ein ehrliches, warmes Buch über eine Lebenssituation, die vielen Menschen vertraut ist.
Vita
Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, unter anderem für «Brigitte Woman», «Merian» und das «SZ-Magazin». Seine Kriminalromane über den hochsensiblen Kommissar Adam Danowski wurden von der Kritik gefeiert und mehrfach für Preise nominiert, sie erscheinen bei Rowohlt Polaris. Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2021 by Till Raether
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
ISBN 978-3-644-00880-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorweg: Ein Gruß aus der Psyche
Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitschrift Brigitte einen Essay geschrieben, der «Bin ich depressiv, oder ist das nur das Leben?» hieß. Die Reaktionen auf meinen Text haben mich damals überwältigt. So, dass ich vielen gar nicht geantwortet habe. Wer sich für dieses Buch und sein Thema interessiert, ahnt den Grund: Ich war zu schwach, ich hatte einfach nicht die Energie. Ich habe eure Nachrichten gelesen, aber dann bin ich lieber liegen geblieben. Ich schäme mich.
Und davon handelt dieses Buch. Vom Liegenbleiben und Schämen. Von fehlender Energie und davon, es besser machen zu wollen. Sich besser fühlen zu wollen. Und, offen gesagt: Das Buch handelt von mir. Also davon, wie ich mich seit zwanzig, dreißig Jahren mit der Frage herumplage, ob ich depressiv bin oder ob das einfach nur das Leben ist. Seit den Reaktionen auf meinen Brigitte-Text weiß ich, was ich vorher nur geahnt habe: dass andere nachempfinden können, was mir durch den Kopf und durch die Seele geht. Darum habe ich mich entschieden, in diesem Buch subjektiv und autobiographisch zu bleiben. Als Angebot, sich darin wiederzufinden oder sich abzugrenzen, als Einladung, aus meinen Fehlern zu lernen, und wenn es geht: als Entlastung. Ich danke allen, die sich bei mir mit ihren persönlichen Geschichten gemeldet haben, nachdem ich meine geteilt hatte. Ihnen und allen, denen es ähnlich geht, möchte ich dieses Buch widmen. Lasst es euch besser gehen.
1. (Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das) Leben?
Ich habe nie daran gedacht, mich umzubringen. Ich habe nur sehr oft daran gedacht, mich hinzulegen und nicht wieder aufzustehen.
Alle paar Monate, ein oder zwei Wochen lang. Sobald alle aus dem Haus waren, habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Kurz, dachte ich. Um Kraft zu schöpfen. Für diesen unüberwindbaren, unbezwingbaren, schweren, grauen Tag. Und für alle anderen Tage danach. Und sobald ich wieder auf dem Bett lag, verließ mich alle Kraft, und ich blieb liegen.
Aber stimmt das, mich verließ alle Kraft? Ein bisschen Kraft hatte ich ja noch. Kraft genug, um mich im Bett zu verstecken. Kraft genug, um mich schlecht zu fühlen, weil ich nicht arbeitete, nicht aufräumte, nichts erledigte, nicht funktionierte. Kraft genug, um mich am Ende aus dem Bett zu wälzen und das Nötigste auf- und abzuräumen, kurz bevor die Kinder aus der Schule kamen oder meine Frau von der Arbeit.
«Und, was hast du heute gemacht?»
«Ach, es lief schleppend. Nichts Besonderes.»
Wie gesagt, ich habe nie daran gedacht, mich umzubringen. Mein Leben war nie in Gefahr. Dieses Leben war nur einfach kein besonders gutes.
Ich weiß nicht, ob ich mir einen Beruf und ein Leben ausgesucht habe, in dem ich mich mit meinen depressiven Phasen besonders gut verstecken kann und konnte. Ich habe nur wenige Jahre als Angestellter gearbeitet. Wenn man depressiv ins Büro muss, weil man den Anspruch hat, niemanden im Stich zu lassen, oder weil man nicht auffallen will oder weil man sich schämt, dann wird einem der Tag zur Hölle. Einfach liegen bleiben: Was mir später, als ich es konnte, wie eine Niederlage erschien, war mir als Angestellter eine wunderbare Utopie. Nicht aufstehen. Als Selbständiger kann man das. Für einen Tag oder zwei. Sofern man bereit ist, dann das nächste Wochenende durchzuarbeiten oder die eine oder andere Nacht. Was wiederum nicht gut ist, wenn man die nächste depressive Phase in Schach halten will: Die leichte bis mittlere Depression liebt Schlafmangel und Stress.
Da, ich habe es gesagt: leichte bis mittlere Depression. Die Formulierung stammt von meinem Hausarzt. Depression hat viel mit Schuldgefühlen zu tun: weil man es nicht hinkriegt, glücklich zu sein, weil man denen, die man liebt, das Leben schwer macht, weil man unzuverlässig und schwach ist. Bei mir zusätzlich: weil ich mir manchmal gewünscht habe, ich hätte einfach eine richtige Depression, also: eine schwere. Weil dann alles so klar gewesen wäre. Meine Mutter ist manchmal ein, zwei Tage wortlos im Bett geblieben, als wir Kinder waren. Da gab es kein So-tun-als-ob mehr, kein Sichzusammenreißen, kein Ihr-sollt-mich-so-nicht-sehen. Manchmal habe ich mich in einer Art Selbstbestrafungsphantasie nach dieser Klarheit gesehnt: so depressiv zu sein, dass es völlig unmöglich ist, die unmenschliche Kraft aufzuwenden, doch noch durch den Tag zu kommen. (Wobei ich mich für diesen Wunsch jedes Mal aufs Neue augenblicklich geschämt habe.)
Das, was ich hatte und habe, war nie so klar. Mein zweiter Therapeut sagte nach unserem ersten längeren Gespräch in etwa: «Ich denke, dass Sie an einer periodisch wiederkehrenden, lang anhaltenden depressiven Verstimmung leiden. Wir nennen das Dysthymie.» Er machte eine Pause, und sein nächster Satz fiel in meine seltsame Erleichterung und in das Erschrecken, eine Diagnose erhalten zu haben.
«Aber», fuhr er fort, «es kann natürlich auch sein, dass das einfach das Leben ist.»
Es gibt Depressive, die werden «hochfunktional» genannt. Weil sie ihre Depression gerade noch überspielen können und weil der hohe Energieaufwand, den sie das kostet, durchaus auch dazu führt, dass sie als fleißig und erfolgreich gelten. Ich bin, denke ich, einer davon gewesen. Und dieser Gedanke, es könnte ja auch «einfach das Leben» sein, gehört sicher dazu. Mein Großvater aus Ostholstein pflegte scheinbar scherzhaft, aber in Wahrheit tief empfunden zu sagen: «Das Leben ist eines der schwersten.» Und das gilt trotz unterschiedlicher Lebensumstände und Persönlichkeiten für alle Menschen, vermute ich. Warum also sollte ich für mich in Anspruch nehmen, es wäre für mich besonders schwierig, schwerer als für die meisten anderen Menschen? Nur weil ich hin und wieder «nicht hochkomme», wie wir Mittel-Depressiven das nennen?
Es hat, würde ich sagen, über fünfundzwanzig, fast dreißig Jahre gedauert, bis es mir besser ging. Warum hat es so lange gedauert, bis ich etwas gefunden habe, was angefangen hat, mir zu helfen? Warum habe ich so lange gedacht, ich brauche es nicht oder ich verdiene es vielleicht nicht?
Die ersten wirklich erschütternden depressiven Phasen hatte ich ab Anfang zwanzig. Mit erschütternd meine ich: Phasen, die Tage und Wochen und mich und mein Selbstbild durcheinanderbrachten. Traurigkeit und Sinnlosigkeit in allem, die Unfähigkeit, eine Hose anzuziehen, ans Telefon zu gehen, einen Stift zu halten. Auf dem Weg von der U-Bahn zur Uni kam ich jeden Morgen an dem Schild «Psychologische Studienberatung» vorbei. Ich mache der Frau dort keinen Vorwurf. Vielleicht hatte sie, als ich eines Morgens abbog und in ihre Sprechstunde ging, selbst einen schlechten Tag, vielleicht gelang es mir auch einfach nicht zu erklären, wie es mir wirklich ging.
Weil ich mir als Depressiver selbst nie gefallen habe, habe ich immer den großen Wunsch gehabt, anderen zu gefallen. Niemandem zur Last zu fallen. Das zu sagen, was die Leute hören wollen. Weshalb ich damals in der Sprechstunde nicht sagte: Ich hasse mich und mein Leben, ich bin so traurig, wenn ich mich sehe, ich will mich nicht bewegen, ich will nur liegen und die Augen zumachen, und ich wünschte, ich könnte weinen, den ganzen Tag. Das klang mir schon damals zu sehr nach deutschem Songtext. Stattdessen redete ich über Stress und Überforderung und vielleicht Versagensangst, und ich erinnere mich an das Wort «Niedergeschlagenheit», weil es so klang, als hätte einen jemand oder etwas gehauen und man müsste sich nur kurz berappeln.
«Kein Wunder, Sie sind ja ganz am Anfang des Studiums», sagte die Psychologin. «Sie müssen erst lernen, sich zu organisieren. Das ist ein schwieriger Übergang. Am besten, Sie suchen sich eine Lerngruppe.»
Wie viele Depressive, die ich kenne, hasse ich leider Gruppen. Vielleicht hätte ich in der «Lerngruppe» andere getroffen, denen es ähnlich ging. So habe ich das immer mit mir allein ausgemacht. Und ich bin sehr empfänglich für jede Argumentation, die mit «Kein Wunder» anfängt: Kein Wunder, dass es mir schlecht geht. Kein Wunder, denn ich habe mich für einen stressigen Job mit viel Konkurrenzkampf entschieden. Kein Wunder, denn ich bin neu in einer fremden Stadt. Kein Wunder, denn meine Freundin wohnt an der Westküste der USA, ich in Berlin. Kein Wunder, denn ich bin frisch getrennt nach langer Fernbeziehung. Kein Wunder, denn ich bin schon wieder neu in einer fremden Stadt. Und kein Wunder, der Job ist immer noch stressig.
Wie sollte ich jemals wagen, das jetzt alles in Frage zu stellen? Es scheint doch so eine Kette von leicht erklärbaren Notwendigkeiten und Unausweichlichkeiten zu sein. Also ist es kein Wunder, dass die Gesellschaft uns hochfunktionale Depressive liebt und fürchtet zugleich. Liebt, weil wir viel mitmachen. Wir sind die nach außen hin Flexiblen, Mobilen, die, die alles möglich machen wollen und niemanden enttäuschen. Und zugleich sind wir gefürchtet, weil wir doch nie so ganz verhehlen können, dass hinter unserer wackligen Fassade ein Abgrund gähnt aus Nicht-mehr-Können und Nicht-mehr-Wollen. Das System lebt davon, dass Menschen ignorieren, was gut für sie wäre und was ihnen schadet. Bei Depressiven aber besteht immer die Gefahr, dass es ihnen plötzlich doch noch klar wird. Weil sie es nicht mehr aushalten. Und dass dann plötzlich kein Verlass mehr ist auf sie.
Ich denke, darauf war auch die «Psychologische Studienberatung» ausgerichtet: die Leute zum Weitermachen zu bewegen. Also machte ich weiter.
Mir wurde klar, dass ich das alles nicht mehr aushalten will, als ich Vater wurde. Tatsächlich hat dieses so oft in Männergeschichten mystisch überhöhte Lebensereignis bei mir genau diese eine Sache bewirkt: zu wollen, dass es mir besser geht. Dass ich Kinder liebe und eine Familie möchte und gern zu Hause bin und auf dem Fußboden rumkrieche und gern koche und bastele, wusste ich schon sehr lange. Aber spätestens, als meine Tochter da war, drei Jahre nach meinem Sohn, wurde mir klar: Es wäre für dich und andere schön, wenn du glücklicher wärst.
Ich denke und fürchte, das ist recht typisch für Depressive, die gerade noch so funktionieren: Man braucht einen Umweg oder, besser gesagt, eine Erlaubnis, um sich besser zu fühlen. Solange ich für mich selbst verantwortlich war, dachte ich: Es muss reichen, es wird reichen, ich kriege das hin. Sobald wir eine Familie wurden, dachte ich: Vielleicht kriege ich das doch nicht mehr hin. Und es wäre besser für die Kinder und die Frau, wenn ich mir helfen lasse.
Dass es auch für mich besser wäre, wurde mir erst beim zweiten oder dritten Gespräch mit dem Therapeuten klar. Und dass ich in dem Moment in Tränen ausbrach, ist mir, wenn ich ehrlich bin, noch heute peinlich.
Ich hatte mich für einen Verhaltenstherapeuten entschieden. Zum Teil, weil ich mir davon schnelle Abhilfe versprach: Ich ändere selbst was an meinem Verhalten, und voilà: neues, besseres Ergebnis. So stellte ich mir das vor. Zum Teil, weil durch Zufall ein Therapeut genau dieser Fachrichtung für mich schnell verfügbar war. Und zum Teil, weil ich mich nicht mit der Aufarbeitung meiner Vergangenheit aufhalten wollte. Weil, wie gesagt: schnelles Resultat erwünscht, und: Als recht frühes Scheidungskind mit recht viel Verantwortung schien mir die Sachlage recht eindeutig.
Während sie lief, war meine Verhaltenstherapie mir Anker und Erleichterung, und manchmal lachte ich auf dem Fahrrad, wenn ich auf dem Nachhauseweg war, weil mir beim Gedanken ans Schwere zum ersten Mal so leicht ums Herz wurde, weil mir das alles nun nicht mehr als meine Privatangelegenheit erschien, sondern als ein Übel, das besiegbar und in gewisser Weise normal erschien: Vielen ging es so wie mir, es gab was dagegen, es würde gut werden. Tatsächlich half mir sehr, was ich in den zwei Jahren lernte. Vor allem, besser auf mich und meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Von scheinbar einfachen Dingen wie mehr schlafen bis zu schwierigen wie: mich aus privaten und beruflichen Verbindungen lösen, die mir nicht guttaten.
Das Seltsame aber war: In gewisser Weise gab mir die Verhaltenstherapie einfach noch ein paar Instrumente mehr an die Hand für meinen großen Besteckkasten, aus dem ich mich als hochfunktionaler Depressiver bediente, um über die Runden zu kommen. Anfangs dachte ich, es würde reichen, meine Energien gezielter einzusetzen, nein zu sagen, Menschen und Verpflichtungen loszulassen. Ich bin immer noch dankbar, dass ich das gelernt habe in der Verhaltenstherapie. Aber in gewisser Weise waren das für mich Flicken, Pflaster und Reparaturanleitungen: Ich brauchte sie, sie halfen mir, aber sie änderten nicht grundsätzlich was.
Das Ermüdende an der Depression ist, dass sie immer noch und immer wieder da ist, auch wenn sie weg ist. Was ich damit meine: Nachdem ich mein Leben mit Hilfe der Verhaltenstherapie geflickt, gepflastert und repariert hatte, war dieses Leben wirklich sehr viel besser, und ich war in diesem Leben sehr viel zufriedener. Aber die Depression lächelte im Hintergrund und sagte: Wie schön, jetzt bist du ein Depressiver mit einem reparierten Leben. Aber denk nicht, dass du mich los bist.
Der Verhaltenstherapeut verabschiedete mich, als die Therapie abgeschlossen war, mit den etwas vagen Worten: «Man kann es sonst natürlich auch immer noch mit Medikamenten versuchen.» Ich nickte tolerant. Ich verurteilte niemanden, der Medikamente brauchte. Aber sie waren nicht für mich. War Pillenschlucken nicht auch ein bisschen wie Schummeln? Als die Depression sich einmal bei mir eingenistet hatte, wurde ich den Gedanken so schnell nicht wieder los, dass es vielleicht irgendwie hilft, sich zusammenzureißen, und dass man das irgendwie am besten alleine hinkriegt, ohne pharmazeutische Hilfsmittel. Und, ein aus heutiger Sicht, wie ich finde, recht selbstverliebter Gedanke: Würden Medikamente nicht meine Persönlichkeit verändern? War die Depression nicht auch etwas, was mich ausmachte, meine Arbeit? Nicht, dass ich mich als Künstler gesehen hätte. Aber schon als jemanden, der davon lebt, dass er grübelt (Schreiben ist Grübeln in Zeitlupe). Und das schien mir, was die Depression anging, dann doch, als hätte ich in dieser Hinsicht mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht.
Es dauerte sechs oder sieben Jahre, bis die Flicken und Pflaster aufgebraucht und verschlissen und die Werkzeuge korrodiert waren. Bestimmt hätte ich weiter regelmäßig zur Verhaltenstherapie gehen sollen. Bestimmt hätte mir auch eine andere Form von Gesprächstherapie geholfen. Bestimmt gibt es ganz viele gute Tipps, und bestimmt habe ich viel falsch gemacht und missverstanden. Aber das Tückische an der milden Depression ist, dass sie so beherrschbar wirkt; denn vielleicht ist sie ja auch nur das Leben. Und leben, das wird man ja wohl noch hinkriegen, so von Tag zu Tag. Und gleichzeitig lähmt sie einen: Denn was, wenn sie einen in Wahrheit doch gerade am Leben hindert, und man merkt es nicht, weil man zu beschäftigt damit ist, sich zusammenzureißen? Sie ist nicht schlimm genug, um alle paar Monate zum Therapeuten-Check-up zu gehen oder sich in die neue Therapiesuche zu stürzen, und zugleich hindert sie einen daran, sich solchen, schon logistischen Herausforderungen konstruktiv und konsequent zu stellen, weil man ja schließlich immer noch oft genug niedergeschlagen und energielos ist.
Ich würde sagen, ich bin eine Zeitlang gut über die Runden gekommen. Das Depressiven-Leben ist voll von solchen Metaphern: über die Runden kommen, sich durchhangeln, sich zusammenreißen, das schon hinkriegen. Aber es wurde immer mühsamer. Ende 2017 hatte ich eine Art Zusammenbruch. Ich sage «eine Art», weil es wieder nicht dieses ganz große Ding war, mit Blaulicht ins Krankenhaus oder wochenlang im Bett ohne Appetit und ohne Duschen. Aber es gab einen klar erkennbaren Tag, an dem ich so unglücklich und gestresst, so energielos und überfordert war, dass ich wusste: Es muss sich was ändern, und zwar deutlich mehr als bisher.