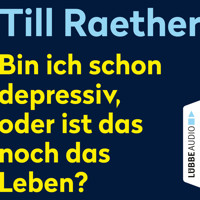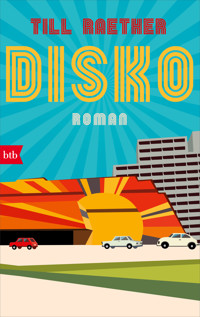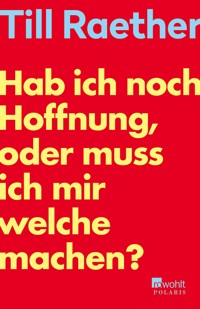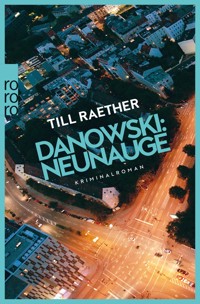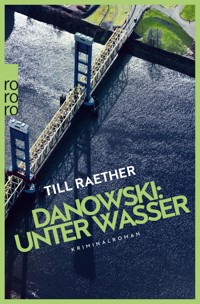10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Männer, Geld und Häuser kann man nie genug haben.« West-Berlin in den frühen Siebzigerjahren. Inmitten der klammen, grauen, von Männern geprägten Stimmung der Zeit zieht eine Baulöwin ihre Kreise. Als glamouröse Person der High-Society nutzt sie ihre Verbindungen in die Politik, um gewaltige Bauvorhaben durchzuboxen. Doch dann kommt ihr Otto in die Quere, gerade neunzehn Jahre alt, Praktikant einer Vorort-Zeitung, der ein wenig blauäugig von seltsamen Vorkommnissen auf der Großbaustelle berichtet und damit ins Visier der Architektin gerät. Otto wird jede Hilfe brauchen, die er finden kann, um sich ihrem Bann zu entziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
West-Berlin in den frühen Siebzigerjahren. Inmitten der klammen, grauen, von Männern geprägten Stimmung der Zeit zieht eine Baulöwin ihre Kreise. Als glamouröse Person der High-Society nutzt sie ihre Verbindungen in Politik und Wirtschaft, um gewaltige Bauvorhaben durchzuboxen. Doch dann kommt ihr Otto in die Quere, gerade neunzehn Jahre alt, Praktikant einer Vorort-Zeitung, der ein wenig blauäugig von seltsamen Vorkommnissen auf der Großbaustelle berichtet und damit ins Visier der Architektin gerät. Otto wird jede Hilfe brauchen, die er finden kann, um sich ihrem Bann zu entziehen.
Zum Autor
TILLRAETHER, geboren 1969 in Koblenz, aufgewachsen in Berlin, arbeitet als Autor und freier Journalist in Hamburg, unter anderem für »Brigitte Woman«, »Merian« und das »SZ-Magazin«. Er studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von »Brigitte«. Seine Kriminalromane über den hochsensiblen Kommissar Adam Danowski wurden von der Kritik gefeiert und mehrfach für Preise nominiert. 2021 erschien bei btb sein Roman »Treue Seelen«. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Till Raether
Die Architektin
Roman
Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt, jedenfalls von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfasst.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalveröffentlichung 2023
btb Verlag, ein Unternehmen der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2023 Till Raether.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Michael Gaeb.
Covergestaltung und Illustrastion: semper smile, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-27775-8V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Brenda und Patrick Kuster
»Sie werden oben erwartet.« Eigentlich ein ganz unverdächtiger Satz. Aber je weiter Otto sich vom Erdboden entfernt, desto bedrohlicher klingt er für ihn. Erwartet wovon? Oder von wem?
»Sie müssen nur aufpassen, wo Sie hintreten.« Nur.
Nie ist ein Hochhaus so hoch wie im Rohbau. Eine Konstruktion, die nicht dafür gemacht ist, von Menschen betreten zu werden. Linien, die bodenlos in den Himmel gezeichnet sind. Es ist ein Skelett, kein Körper. Ein verwelkter Richtkranz hängt am rostigen Haken eines gelben Krans, in der Nachbarschaft des bisher Erreichten. Solange die Fassade nicht vorgehängt ist, hat das Hochhaus keine Grenzen. Es gibt nur Andeutungen von Innenwänden, das Auge des Fahrstuhlschachts steht offen. Die Rettungstreppen haben keine Geländer, die Flure keinen Anfang und kein Ende.
Otto, Anfang zwanzig, hat vielleicht doch so was wie journalistischen Ethos, vielleicht sind ihm die Ereignisse der vergangenen Monate auch einfach zu Kopf gestiegen. Jedenfalls hat er eingewilligt, sich auf diesen Materialfahrstuhl hier zu stellen, auf dieses rostige Gitter. Hinter ihm hängt der Polier eine Kette vor. Jetzt vibriert es unter seinen Füßen.
Der Polier hat sorgfältig geprüft, ob Ottos Schutzhelm richtig sitzt, festgezurrt unterm Kinn, bis ihm das Plastik in die gereizte Haut schneidet. So gründlich rasiert, dass man denkt, Otto hätte nie einen Bart gehabt. Es halten ihn sowieso alle für drei, vier Jahre jünger.
Erst mal ist im vierzehnten Stockwerk nur Wind. Otto schließt die Augen im wehenden Baustaub. Er stützt sich an einem Wandrahmen ab, der stabil genug scheint.
Ist er jetzt eigentlich auf eigene Gefahr hier? Was hat er den Kollegen in der Redaktion erzählt, als er vor einer guten Stunde nach Steglitz aufgebrochen ist?
Er hat nur kurz gewunken und sich dann in die U-Bahn gesetzt, die einmal von oben nach unten durch West-Berlin fährt, durch den unterirdischen Schlamm. Wann würden sie bemerken, dass er nicht da ist, unerreichbar? Morgen gegen sechzehn Uhr, wenn er am Telefon seinen Bericht vom ersten Tag des Untersuchungsausschusses durchgeben soll. Wie hat die Architektin sich geschlagen? Hat sie etwas zugegeben? War sie souverän, war sie zickig? Die werden erst merken, dass er fehlt, wenn sie seinen Text über eine blonde Frau Mitte vierzig brauchen, wie sie HB in einem Sitzungssaal des Rathauses Schöneberg raucht. Wie sie den Kopf in den Nacken legt, während sie darüber nachdenkt, mit welchen Mitteln sie das Geld aufgetrieben hat, um das höchste Haus der Stadt zu bauen. Und darüber, wo das Geld geblieben ist.
Dieses Hochhaus hier, wo Otto jetzt die Abwesenheit von Wänden zu schaffen macht, und die Entfernung zum Erdboden. Wo die südlichen Ausläufer der Stadt durch die Wandlosigkeit eine Verlängerung unendlicher Räume sind, grünbraune Frühsommerstraßen, die sich von seinen Augen weg in die Stadt entziehen, die graue Behauptung der Stadtautobahn. Hier sind Zimmer zum Wahnsinnigwerden, eines nach dem anderen. Wenn er an die Architektin denkt, zieht sich etwas in ihm zusammen, eine Region zwischen Herz und Bauchnabel, wo die Gespenster der verpassten Gelegenheiten wohnen.
»Treffpunkt ist am Ende des Flures.« Zu ebener Erde hat sich das aus dem Munde des Poliers ganz einfach und klar angehört, aber hier oben hat der Flur kein Ende und keinen Anfang, er durchschneidet einfach den Rohbaukörper auf seinem Weg durch die Welt. Der Fußboden ist provisorisch und hat eine ganz sanft gewellt Oberfläche, wie eine spätsommerliche Seeoberfläche aus Beton.
Otto bleibt stehen und sagt »Hallo«, eine Windbö entreißt ihm die Silben. Er nimmt seinen Notizblock aus der Jackentasche, weil er sich bewaffnen will. Er hat keinen Stift dabei. Er kommt sich lächerlich vor und ist damit endlich ganz bei sich. Darüber reden sie in der WG hin und wieder. Wie wichtig es ist, bei sich zu sein. Er hat Heimweh nach der klebrigen Tischtennisplatte im Hof, nach dem Kühlschrank, wo ganz hinten immer noch irgendwas zu finden ist, Ruinen niemals umgesetzter Kochpläne.
Otto dreht sich um, aber die Aufzugplattform ist bereits wieder nach unten gefahren. Er darf sich nicht vornüberlehnen, um nach ihr zu schauen.
Otto denkt an die Wunderkammer, an die Zeichnung von der Frau mit den Händen als Füßen, an die schreckliche Eisenbahn im Keller, daran, wie er in der Fasssauna vor der Westküste von Sylt beinahe ertrunken wäre, bei Ostwind hört dich keiner schreien.
Ein Kondensstreifen teilt den Himmelsausschnitt, den Otto durch die offene Wand sieht. Er flockt aus, verfedert, löst sich auf.
Vielleicht trägt die nächste Windbö einen Fetzen von Zigarettenrauch, vielleicht ein Parfum wie den Duft von Orangen. Vielleicht sind aber auch das bloß Gespenster. Mit der Nachlässigkeit eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat, setzt Otto sich in Bewegung. Rückenwind, Gegenwind, er kann es nicht mehr unterscheiden. Hier und da ist der Boden offen, Versorgungsschächte, Abstiege ins Stockwerk darunter, schmale Leitern.
Am Ende des Flures liegt ein zylinderförmiger Gegenstand, verrostet oder verschmutzt, eine Bombe von vor dreißig Jahren oder eine von hier und heute. Ein Fall für die Kampfmittelräumung oder ein Fall für Otto Bretz?
… 1 23 4 …
Mit Befriedigung hörte Walter Ladius, wie der Einfahrtkies unter den breiten Reifen seines neuen Mercedes-Coupés knirschte, 250 CE. Hinter ihm schloss sich das automatische Gartentor der Architektin.
Zwischen hohen, geraden Grünpflanzen, die er als Stadtmensch nicht identifizieren konnte, machte die Einfahrt eine sanfte Kurve. Der Kies knirschte weiter. Das Geräusch war Ladius immer der Inbegriff der Angekommenheit gewesen, ganz besonders in dieser letzten Sekunde vorm Aussteigen und dann, wenn man in die Stille nach dem Türöffnen den Fuß auf den Kies setzte. Auf diesen Moment freute er sich. Er hatte sich am Tauentzien italienische Lederslipper gekauft, die er heute zum ersten Mal trug, ohne Socken, denn die Architektin hatte zu ihm gesagt, »ach, dann kommen Sie doch zu mir an den Pool«, und dabei hatte sie den Blick so auf ihm ruhen lassen, als wollte sie sagen: Sie interessieren mich.
Der Kies aber fuhr fort mit dem Knirschen. Wie lang war diese Einfahrt. Auf einer Grünfläche standen Pfauen und Fasane, gelangweilt oder zufrieden. Ladius gab ein wenig Gas, die Vögel schritten indigniert in andere Richtungen. Dabei spritzte ihm der Kies in die Radkästen, und dafür war der Wagen zu neu, eines der ersten Exemplare, angeblich. Das hatte er sich in Russland auch nicht träumen lassen. Dass das noch mal wieder so aufwärtsgehen würde. Die Schuhe klebten an seinen Füßen, das Sitzpolster an seinem Rücken. Der Oktober war viel wärmer als nötig, und Ladius geriet ohnehin ins Schwitzen, wenn es ums Geld ging. Und um Frauen. Heute hatte er also jeden Grund.
Das Kiesknirschen fing an, ihm auf die Nerven zu gehen. Was das kostete, allein das Material. Und das wurde dann ja alles angekarrt aus dem Bundesgebiet, über die Transitstrecke. Schon auch beeindruckend.
Über dem Lenkrad und seinen mittlerweile etwas weißen Knöcheln kam das Anwesen der Architektin in Sicht. Auf einer leichten Anhöhe, sodass das flache, elegante Gebäude für einen Moment auf ihn herabzublicken schien. Rechts der Bürotrakt, wo die Zeichenknechte die Kleinarbeit machten. Das Wort Zeichenknechte hatte Ladius in der Zeitung gelesen, eine halbe Million Mark an Gehältern zahlte die Architektin im Monat. Der Bürotrakt verschwand hinter Hecken in einer Senke, damit man die Leute nicht bei der Arbeit sehen musste.
Befriedigt registrierte Ladius, dass auf dem Kiesrondell vor der Eingangstür nur der rote Alfa Romeo der Architektin stand, und ein grüner Mini Cooper, vermutlich von der Tochter. Der Mann war also nicht da, und vor allem: niemand sonst, der hier gerade seine Aufwartung machte. Das war seine größte Befürchtung gewesen: nicht der Einzige zu sein heute Vormittag und dann so um die Architektin herumscharwenzeln zu müssen, sich anstellen. Das lag ihm nicht. Stehempfänge und Partys waren ihm eine Qual, selbst die eigenen runden Geburtstage. Wie neulich, die große Fünf. Normalerweise blieb man in seiner Branche unter sich. Das Öffentlichste, was er machte, war, sich den großen Aufdruck auf dem Seitenschnitt des Branchenbuchs zu gönnen, »AUSKUNFTEILADIUS 66 55 77«. Älteste westdeutsche Auskunftei für Wirtschafts- und Privatinformationen, mit Firmensitz in Frankfurt am Main und Außenstelle in West-Berlin, damit Ladius in den vollen Genuss der Berlinzulage und aller anderen verfügbaren Subventionen kam. Der Vertriebsleiter bei der Schering war ein Stammkunde, der wollte gern über die West-Berliner Apotheker Bescheid wissen. Denen kam das Geld aus allen Löchern, das war schon was. Der Schering-Mann hatte einen Umtrunk am Wannsee gegeben nach dem Absegeln. Für eine Segelyacht interessierte Ladius sich auch. Und während die Apotheker von Sylt erzählten, Gogärtchen, rechnete er im Kopf durch, wie viel von deren Geld beim Vertriebsleiter an Provision hängen blieb. Genug, um Ladius sehr hohe Honorare zu bezahlen, die er hier und da über die Spesenabrechnung etwas auspolsterte, das wurde so erwartet. Jeder bediente sich bei jedem, es war ein Perpetuum mobile des Nehmens und Nehmens. Beim Vertriebsleiter hatte er auch die Architektin kennengelernt und sich gut mit ihr verstanden. Gut genug, um von ihr beim nächsten Aufeinandertreffen mit einem strahlenden Lächeln begrüßt zu werden.
Ladius stellte den Benz zwischen den Mini und den Alfa und stieg aus. Sofort hatte er Kies im Schuh. Humpelnd rettete er sich auf den Gartenweg. Er sollte »gleich ums Haus kommen«, hatte sie ihm gesagt, als sie sich beim Bausenator wiedergesehen hatten, informell, Grillfest, der Senator wendete da selbst die Würstchen und wischte sich den Schweiß aus dem Nacken mit einem Hertha-Handtuch, das allerdings so aussah, als hätte sein Referent es noch schnell vorm Eintreffen der Gäste besorgt.
Zwischen zwei Fenstern stützte Ladius sich an die Hauswand und schüttelte seinen Schuh aus, Herbstluft an seinem rauen alten Fuß, vier Zehen. Hoffentlich sah ihn niemand, vor allem nicht die Architektin. Vorsichtig fasste er in seinen Schuh, kalt und feucht, um zu prüfen, dass kein Kies mehr darin war. Ein Schatten huschte über ihn. Ladius blickte auf und fand sich, seinen nackten Fuß mühsam auf dem Knie und den Schuh in der Hand, Auge in Auge mit einem Mann, der innehielt und ihm dabei bekannt vorkam. Ein Stehempfangsgesicht, jemand, der andere um sich scharte. Ein schmales Gesicht, ein weicher, dunkler Haarkranz um das Oval der Glatze. Freundliche Augen, keine Krawatte, Kragenspitzen bis übers Sakkorevers, Brusthaare zwischen den Knöpfen. Der Blick, wer sich besser gehalten hatte, die gleiche Generation, eine Ahnung, dass der andere auch im Getümmel gewesen war, wie man selbst.
Sie wichen einander aus, als hätten sie Grund, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ladius drückte sich ein wenig näher an die Wand, der andere machte einen Schritt in die Rabatten und hob die Hand, als suchte er einen unsichtbaren Hut.
»Wachablösung!«, rief er ein wenig zu laut, als er schon an Ladius vorbei war, Rettung in einen Scherz.
»Melde gehorsamst!«, rief Ladius hinterher, witzig, aber es schmerzte ihn ein wenig, wie man sich hier die Klinke in die Hand gab.
An der hinteren Längsseite des Hauses öffnete sich der Blick auf den Pool, dahinter der leicht nach unten geschwungene Rasen, dann märkische Kiefern, Stadtwald. Dazwischen der Funkturm, seine angestrengte Spitze. Wie der Pool dampfte.
Die Architektin lag auf einer hinten leicht hochgestellten weißen Drahtliege mit sonnenblumengelbem Polster, eine Hand im Nacken, unter dem blonden, sorgfältig gewellten Haar. Sie trug einen weißen Badeanzug, dessen Träger sich für Ladius’ Begriffe auf geradezu mystische Weise von ihren braunen Schultern abhoben. Braun schien die Farbe des Jahrzehnts zu werden, das zeichnete sich ab, aber niemand sprach darüber, eigentlich seltsam, es war ja noch gar nicht so lange her mit dem Braun, dachte Ladius. Der Pool musste beheizt sein, Anfang Oktober.
Häuser, Geld und Männer konnte man nie genug haben.
Ladius hatte nie gehört, dass die Architektin diesen Satz gesagt hatte, aber sie wurde seit Jahren damit zitiert. Auf Festen wie dem beim Bausenator, beim Ball der Nationen in den Messehallen, beim Presseball im Palais am Funkturm. Sie war in West-Berlin weltberühmt für diesen Satz. Und für ihre Häuser. Und ihr Geld. Das mit den Männern blieb in der Schwebe. Also, man wusste von mehreren, aber hintereinander. Die Doppeldeutigkeit blieb. Oder ging das nur ihm so?
Er wollte Teil dieser Geschichte werden. Ihr für den Bau eines ihrer Häuser sein Geld geben. Damit viel mehr daraus wurde, wenn das Haus fertig war und verkauft wurde. Ein sicheres Geschäft, denn angeblich garantierte die Stadt für die Einlagen. Sieben bis zwanzig Prozent Rendite, da fielen einem doch die Augen aus dem Kopf. Und die Investitionssumme plus zehn Prozent konnte er von der Steuer absetzen, das war das Berlinförderungsgesetz. Geld konnte man wirklich nie genug haben, vor allem, wenn der Staat einem das sozusagen aufdrängte, man musste sich ja fast die Taschen zuhalten, um nichts davon abzubekommen.
Und dann das mit den Männern. Nun, seine Frau Doris hatte ihn vorige Woche erst »stattlich« genannt, und mit den nackten Füßen in den italienischen Schuhen fühlte Ladius sich, als wäre der Sommer für ihn noch nicht vorbei. Er räusperte sich, eigentlich gegen seinen Willen.
Die Architektin wandte sich zu ihm um, ließ die Hand aber im Haar. In der anderen hielt sie eine Zigarette.
»Da ist er ja, der liebe Ladius«, sagte sie. Er fand ihr Lächeln klar und unverstellt, das war ja eine ganz handfeste Frau. Vergeblich hielt er nach einer Sitzgelegenheit Ausschau.
»Haben Sie den Präsidenten noch getroffen?«, fragte sie. »Burose?«
Ladius hörte den Alfa-Motor ums Haus, dann das Kiesspritzen. Der lieh sich das Auto der Architektin, oder wie musste man das verstehen?
»Den Präsidenten?«
»Von der Oberfinanzdirektion. Burose. Ein guter Freund.«
Ladius nickte und hoffte, dass man ihm die Mischung aus Neugier und Neid, die er unterm Brustkorb spürte, nicht anmerkte. Andererseits, ja gut, wenn die Architektin Freunde in diesen Kreisen hatte, das gab einem dann doch eine gewisse Sicherheit, falls man sich hier engagierte. Finanziell.
»Wollen Sie sich kurz abkühlen?«, fragte sie und bedeckte mit der Zigarettenhand ihre Stirn und Augenbrauen, als fiele helles Sonnenlicht auf sie. Er sah, dass ihr Badeanzug nass war und dass sie Gänsehaut an Beinen und Armen hatte.
»Ich hab gar keine Badehose dabei«, sagte Ladius und hob das Hosenbein an, als wäre das der Beweis oder als wollte er durchs Bekanntgeben seiner Sockenlosigkeit dennoch eine gewisse ausgelassene Spätsommerlichkeit signalisieren. Die Frau verwirrte ihn. Dabei war sie doch auch nicht viel jünger als er, fünf Jahre vielleicht.
Die Architektin sah nachdenklich auf seinen Knöchel, bis er das Hosenbein wieder sinken ließ.
»Ich hab mich gefreut über unsere Begegnung beim Senator«, sagte sie und berührte die Zigarette mit den Lippen, aber nur kurz, als hätte sie es sich anders überlegt und keinen Gefallen mehr am Rauchen.
»Ganz meinerseits«, sagte Ladius und verfluchte sich für seine Steifheit. Wo kam die jetzt plötzlich her? Er war im kleinen Kreis doch eigentlich ein lustiger Kamerad. Ein lockerer Typ, wie das inzwischen hieß.
»Wenn Sie keine Badehose dabeihaben«, sagte die Architektin, »was haben Sie denn dann dabei, lieber Ladius?«
Er verstand nicht. Er schob die Hände in die Flanellhosentaschen und ließ den Blick ratlos Richtung Kiefern schweifen.
Ein Glücksgriff offenbar, denn die Architektin sagte: »Ich verstehe. Sie sind keiner, der mit der Tür ins Haus fällt.«
Ladius nickte, ermutigt. »Auch nicht mit der Hintertür.«
Sie lachte. »Aber Sie sind auch nicht gekommen, um nur mal zu gucken, oder?«
Ladius lächelte, nicht zu doll, denn Doris sagte dann immer: Was grienst du so? Er hob ein bisschen den Kopf gen Himmel, damit die Architektin von unten keinen Blick auf sein Doppelkinn hatte, das musste ja nicht sein.
»Ganz bestimmt nicht«, sagte er. Dann, mutiger: »Obwohl es hier ja genug zu sehen gibt.« Und jetzt griente er womöglich doch.
»Werfen Sie mir mal das Handtuch rüber?« Sie zeigte auf einen Stapel. Er nahm eins, festes, dickes Frottee, und reichte es ihr. Sie tupfte sich damit über die Stirn, legte es sich dann über die Schultern und winkelte ein Bein an. In ihrer Kniekehle glänzte noch Schwimmbeckenwasser.
»Danke«, sagte sie. »Wie kann ich mich revanchieren?«
Er räusperte sich.
»Mit einem Stück vom Kegel vielleicht?« Es klang, als böte sie ihm was von einer prachtvollen Torte an.
»Haben Sie die Modelle denn hier?«, fragte er, fast heiser.
Sie schüttelte den Kopf, als sei er ein bisschen naiv. »Im Büro. Aber«, sie wiegte den Kopf, und er bewunderte die Stabilität ihrer Frisur, »die schönsten Hochhäuser stehen im Kopf.«
Er nickte, als wüsste er das längst. »Und warum Kegel?«
»Das Hochhaus ist das eine, das bauen wir jetzt. Und drumherum organisieren wir die Stadt ganz neu. Ein Kegel ist ja rund, damit die Dinge in Bewegung bleiben. Um den dreht sich alles.«
»Ist das denn ein rundes Gebäude«, fragte Ladius, »also, kegelförmig?«
Sie sah ihn an, bis er sich begriffsstutzig vorkam. »Nein«, sagte sie. »Wie sieht denn das aus? So was Rundes ist schon für die Überbauung vom U-Bahnhof Schlossstraße geplant, wer will denn das sehen. Waren Sie mal in Steglitz?« Als sprächen sie über San Francisco oder Wladiwostok.
»Ich bin da aufgewachsen«, sagte Ladius. »Albrechtstraße.«
Sie nickte, als hätte sie ihn deshalb ausgesucht. »Dann wissen Sie ja, was ich meine. Steglitz ist abgehängt vom Rest der Stadt. Wir bauen da ein Drehkreuz, Stadtautobahn, Busbahnhof, zwei U-Bahn-Linien, alles aus einer Hand, die große Drehscheibe für den Süden der Stadt. Was fahren Sie für einen Wagen?«
»Mercedes 250 CE«, sagte Ladius, andächtig, so, wie er früher, als Pimpf, den Namen seines liebsten Wehrmachtpanzers aufgesagt hatte. Panzerkampfwagen III, PzKpfw III, genau wie der 250 CE von Daimler-Benz entwickelt, Tarnname: Zugführerwagen. Panzer durfte man ja nicht mehr sagen, wegen der Schande von Versailles.
Die Architektin nickte anerkennend. »Das Coupé. Dann wissen Sie ja genau, was ich meine. Wir planen das genau für diesen Wagen. Diese Straßen, das Drehkreuz, den Kegel. Genau für Ihren Wagen. Und mittendrin bauen wir das höchste Haus der Stadt. Also, ich baue das. Und Sie.«
»Der Wagen ist wirklich ein Vergnügen«, sagte er. »Rassig. Wenn Sie möchten, machen wir eine kleine Spritztour, also …«
Sie runzelte kurz die Stirn, als würde sie überlegen. »Nein, das, was Sie dabeihaben, ist nicht im Auto. Sondern hier.«
Er sah an sich hinunter und wusste nicht, was sie meinte. Sie streckte die Hand nach ihm aus, und einen Moment durchfuhr ihn der Gedanke, sie würde ihm nun in den Schritt fassen. Aber sie hielt inne und zeigte auf seinen Kopf und dann auf seinen Brustbereich, womit sie wohl das Herz meinte.
»Da«, sagte sie. »Da ist alles, was ich brauche.«
»Was brauchen Sie?«
»Was brauchen denn Sie, lieber Ladius?«
»Ja, vielleicht ein Stück vom Kegel.«
»Vielleicht?«
»Wie groß sind denn die Stücke?«
»Groß. Zu groß für Sie?«
Er wusste aus der Dienstleistungsbranche, dass man irgendwann die Zahlen auf den Tisch legen musste, also, sie sagen. Er konnte das ganz gut. Etwas lauter oder etwas leiser, als man den Rest der Unterhaltung sprach. In geschlossenen Räumen leiser, hier draußen lieber lauter. Und nicht zu schnell, aber auch nicht künstlich in die Länge gezogen.
»Fünf, hundert, tausend«, sagte er.
Sie hob das Handtuch von der einen Schulter und verdeckte mit dem Zipfel den Mund, als wollte sie einen Tropfen von der Nase auffangen, aber vielleicht war da gar kein Wasser. Vielleicht wollte sie ein mitfühlendes Lächeln verbergen.
»Das wäre mal so ein erster Vorschlag«, sagte er, obwohl er wusste, dass man nach der ersten Zahl normalerweise gar nichts sagte. Unter Männern.
»Sie sind doch Marktführer in Ihrer Branche, oder? Sie arbeiten zum Beispiel für die Schering?«
Er nickte. Schering, das bedeutete was. Der letzte Industriebetrieb mit Hauptsitz in West-Berlin. Er begriff, dass das in ihren Augen auch eine Verpflichtung war.
»Ich wollte Sie nicht gleich mit der Million überrumpeln«, sagte er und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich bin nicht so leicht zu überrumpeln«, sagte sie.
»Gibt es denn überhaupt noch Stücke, die so groß sind, also, Hausnummer eine Million?«, fragte er, als hätte er nur aus Bescheidenheit erst mal einen Anteil von einer halben zeichnen wollen und nicht, weil er in Wahrheit bestenfalls vierhunderttausend flüssig hatte.
Sie wiegte den Kopf. »Nicht so richtig. Die letzten Stücke sind immer die größten. Und viele sind nicht mehr übrig. Ich verstehe aber, wenn das jetzt zu kurzfristig für Sie ist. Ich will Sie da auch nicht … überrumpeln.«
Er schluckte. »Wie groß?«
»Zwei.« Sie zog das Handtuch von den Schultern und fing an, sich die Beine abzutrocknen, schnell, pragmatisch, ohne Anflug von Verführungskunst. »Zwei Millionen.«
Als er sich wieder ins Auto sinken ließ, spürte Walter Ladius, dass er die ganze Zeit nicht gesessen hatte. Dieses Teufelsweib bot einem nicht mal einen Stuhl an, die ließ einen stehen. Und er begriff, dass er für das Bauvorhaben Kegel Anteile im Wert von anderthalb Millionen D-Mark gezeichnet hatte und dass das mehr als dreimal so viel war, als er ohne Risiko lockermachen konnte. Er lachte, fast erleichtert. Er hatte das Gefühl, alles falsch und alles richtig gemacht zu haben.
…1 2 34 5 …
Die Propellermaschine der PanAm stand schon auf dem Rollfeld vom Flughafen Tempelhof bereit, im gleichen Oktober Anfang der Siebzigerjahre. Es lag so ein komischer karamellfarbener Herbst in der Luft, zäh, wie sollte man da überhaupt die Stadt verlassen.
Wenn er betrunken oder aus anderem Grund in ausgelassener Stimmung war, erzählte Otto Bretz die Geschichte seiner vereitelten Abreise aus West-Berlin, als hätte er die Hand schon an der Reling der Flugzeugtreppe gehabt, den rechten Fuß auf der ersten Stufe, und übers Rollfeld kam jemand mit einem alten Telefon gerannt. Das Telefon sah aus wie im Kinofilm, »Bei Anruf Mord«, kein modernes dunkelgrünes oder orangefarbenes, sondern ein schwarzes mit hoher Gabel. Auf einem roten Samtkissen entrollte sich eine unendlich lange schwarze Telefonschnur über die hundert, zweihundert Meter vom Flughafengebäude, dem größten Verwaltungsbau der Welt.
Eine livrierte Person, pfiffig und beflissen wie bei Tim und Struppi, rief »Herr Bretz! Ein dringender Anruf für Sie!« und schwenkte den Hörer. Also, Otto Bretz erzählte das metaphorisch, »es war wie«, »als ob«, »also, als wenn«, aber er wusste, was im Kopf seiner Zuhörerin für Bilder entstanden.
Also wandte Otto sich um, ließ die Flugzeugtreppenreling los und die Nachdrängenden passieren, sie trugen alle Hüte oder Kopftücher. Wer flog, war älter als er und staffierte sich aus. Otto hob fragend eine Augenbraue, straffte die Schultern unter dem geliehenen Sakko (»Das bringst du mir zurück, die Taschen voller Geld«, so sein Schulfreund Harald) und nahm den Hörer, der kalt wie Stein war.
»Bretz?«
»Hier ist deine Mutter.« Vor dem inneren Auge seiner Zuhörerin war nun schon das Bild entstanden, wie Otto entschuldigend in die Runde der bereitstehenden Einwinker blickte, die ihre Kellen unter dem Arm trugen und noch eine rauchten, aber langsam mit den Hufen scharrten. Wohl ließ sich bei dieser Propellermaschine, DC6, das seitliche Cockpitfenster öffnen. Der Pilot streckte den Kopf heraus, handflächengroße Koteletten, und schaute fragend in Ottos Richtung: ob er eine schriftliche Einladung benötige, oder was man so sagte, das waren ja Amerikaner.
»Mama.« Otto Bretz war neunzehn und hatte sich noch keine andere Anrede einfallen lassen für seine Mutter. Ihr Vorname, Martha, klang für ihn, als käme er von einem Bauernhof. Allerdings, so seine Erwartung, würde er eine ganze Zeit lang keine Anrede brauchen für seine Mutter/Mama/Martha, weil er während der nächsten zwei Jahre in München seine ersehnte Ausbildung machen würde. An der Journalistenschule, die sich, wegen des Prestiges und der Alleinstellung, Deutsche nannte, wie eine Bank oder Schiffsversicherung oder Kollektivschuld. Sein Vater hatte ihm den Flug spendiert, damit Otto nicht zwölf Stunden Reichsbahn fahren musste. Otto hatte ein Zimmer am Stadtrand zur Untermiete in Aussicht, angezahlt für einen Monat, und vage Vorstellungen von einer künftigen, noch fiktiven Wohngemeinschaft in Schwabing, Uschi Obermaier, keine Ahnung, was ihn erwartete, aber die feste Überzeugung, dass es sich dabei um die Zukunft handelte: golden oder wenigstens orange. Und dass von nun an nichts mehr schiefgehen konnte, weil er sich gegen etwa fünfhundert Bewerber durchgesetzt hatte, darunter auch Frauen.
»Dein Vater ist verschwunden.« Die Stimme seiner Mutter klang sehr weit weg, dabei wohnte sie quasi in Sichtweite des Flughafens. Otto runzelte die Stirn. Über seinem Arm hing in dieser Version der Geschichte ein Trenchcoat, den er nie besessen hatte und nie besitzen würde, der Stoff glatt und schwer, tröstlich.
»Wie meinst du das?«, fragte er.
»Dein Vater ist weg«, sagte seine Mutter. Seine Mutter, sein Vater. Besitzanzeigende Fürwörter. Er war für beide zuständig.
Manchmal hörte er sich später diesen Satz sagen, und ihn schauderte dabei ein wenig: Den Flieger hab ich dann natürlich sausen lassen. Er sagte normalerweise lieber Flugzeug und: Ich hab den Flug verpasst. Aber manchmal verfiel er in diesen Angeber-Sound, das kam von der Zeitung.
Eine Taxe vom Flughafen, das lohnte eigentlich nicht, aber er wollte das jetzt hinter sich bringen, schnell wie Pflasterabreißen, vier Mark für anderthalb Kilometer, inklusive Wartepauschale und Trinkgeld. Das Gepäck hatten sie ihm noch aus dem Maschinenbauch geholt und aufs Rollfeld gestellt. Zwei Koffer mit allem. Die wuchtete Otto jetzt wieder die Treppe hoch in der Theodor-Francke-Straße, bei Chmielewskis hatte es heute wohl Kohlrouladen gegeben, wie seit zwanzig Jahren.
Er schloss die Wohnungstür auf, den Schlüssel hatte seine Mutter ihm am Ende doch wieder in Haralds Sakkotasche gesteckt, eigentlich wollte er den wortlos auf dem Küchentisch liegen lassen. »Du ziehst doch hier nicht aus wie so’n Untermieter.«
Links neben der Wohnungstür lag das sogenannte Gästezimmer, aber außer der Großtante aus Thüringen und einer Schwägerin aus Göttingen kam nie jemand. Die Eltern hatten wohl vor langer Zeit einmal zwei Kinder geplant und dann, als sie sich an Otto gewöhnt hatten, ihre Pläne geändert oder aufgegeben. Ein sinnloses Bett, glatt und unberührt, darauf ein kleiner Stapel alter Post. Sollte das nicht Mamas Handarbeitszimmer sein? Ihre Knüpfhaken lagen seit Langem auf dem Stuhl, eingestaubt. Rechts die Küche, dann das Klo. Wieder links das Elternschlafzimmer. Er blieb im Türrahmen stehen, die Hände rot vom Gewicht der München-Koffer, neues Leben, altes Leben. Fuhr er halt ein bisschen später doch »auf der Reichsbahn«. Erst mal sehen, was jetzt hier wieder los war im Katastrophengebiet Kindheitswohnung.
Der Kleiderschrank offen, helles Holz, Lamellentüren, was Neues, Modernes, keine zwei Jahre alt. Die Vaterseite demonstrativ leer, die völlige Abwesenheit von allem, was der Vater jemals getragen hatte, unterstrichen durch eine einzelne, fast vom Bügel gerutschte altbackene Krawatte, breit wie eine Flunder, in einen Harung jung und schlank, lindgrün.
Otto ließ seine Koffer im Türrahmen stehen und drehte sich um, über den schmalen Flur sein kleines Zimmer, die sogenannte Kammer, wo er sich wohler fühlte als im Gästezimmer, weil das direkt neben dem Elternschlafzimmer lag, hellhörig. Die Familienwohnung war wie ein leer gefressener Adventskalender, hinter jedem Türchen nichts. Die Seegrastapete an der Wand über seinem Bett war hell, dort, wo Otto seine drei liebsten Postkarten abgenommen hatte, die waren jetzt in der inneren Reißverschlusstasche in einem der München-Koffer, Max Ernst, sagenhafte Stadtlandschaften. Auf seinem Kopfkissen lag ein Brief. »Otto.«, in der Nazischrift seines Vaters. Warum der Punkt? Otto nahm den Brief und fand die Ecken spitz und hart.
Seine Mutter saß im Wohnzimmer, sie war um die vierzig, vor einigen Jahren hatte die Familie sie an den Sessel verloren. Hausfrauenkrankheit, hatte sein Vater einmal gesagt. Ich rauch noch eine, sagte seine Mutter. Meinte sie eine Schachtel, eine Stange? Eine kleine Frau mit Mittelscheitel, die Größe hatte Otto von ihr. Sie lehnte sich nicht an, sondern hatte die Hände auf den Knien und sah nach vorn auf den Schafwollteppich, als sammelte sie Kraft zum Aufstehen. Eines Tages!
Otto zog die Vorhänge von den Doppelfenstern, dazwischen runtergebrannte Kerzen für die Brüder und Schwestern in den Gefängnissen im Ostblock, die hatte sein Vater voriges Jahr aufgestellt. Wie Brandt da den Diener gemacht hatte, vor den Kommunisten in Warschau. Was konnten wir denn dafür.
»Du, ich krieg da Kopfschmerzen von. Von dem Licht.«
»Was ist denn jetzt mit Papa?« Der Brief war leicht wie ein Einkaufszettel, aber zugeklebt, Ordnung musste sein, der Vater mit der dicken Zunge.
Seine Mutter blickte zu ihm auf, nachdenklich. Die linke Hand mit der Zigarette auf dem Knie, runtergebrannt bis kurz vor der Strumpfhose, kariertes Wollkleid, dunkelgrün mit Brandflecken.
»Du bist jetzt aber nicht meinetwegen wiedergekommen, oder?«
… 12 3 45 6 …
Wie alle Optimisten dachte die Architektin zum Zeitvertreib gern an die Vergangenheit, denn das hinderte sie daran, über die Zukunft zu brüten. Auf dem Rauchglastisch lag ein Exemplar von »Die Grenzen des Wachstums«, das ihr Mann mitgebracht hatte, Gesprächsstoff für Gäste. Ein glänzender dunkelblauer Einband, auf dem ein kleiner Globus, offenbar ein Bleistiftanspitzer, ein Ei geknackt hatte, links und rechts von ihm lagen zwei Schalenhälften. Was sollte das bedeuten? Das Buch lag in Kniehöhe, da konnte es auch bleiben. Lieber dachte sie an Ladius, und wie leicht das gegangen war und dass sie dieses Erfolgserlebnis nach dem eher unerfreulichen Gespräch mit dem Präsidenten der Oberfinanzdirektion nötig gehabt hatte. Am Ende hatte sie sich in den Pool vor Burose und seinen Ausführungen gerettet, sein »Ich verstehe dich nicht«, aufgebracht und erschöpft zugleich, für sie endlich nur noch ein Geräusch über dem Plätschern des Wassers.
Die Architektin und Burose, der Präsident der Oberfinanzdirektion, hatten sich vor Jahren an einem See kennengelernt, bei einer Konferenz der Bauwirtschaft. Stadt der Chancen, Chancen der Stadt. Er war noch nicht der Präsident, sie war noch verheiratet mit dem Bezirksbürgermeister. Der brachte sie mit zu solchen Anlässen und zeigte sie herum. Spätsommer, Fluxus im Haus am Waldsee. Stockhausens »Originale« lief im Hintergrund von Tonbändern, aus denen auf beiden Seiten die losen Enden hingen. Parallel dazu die Filmaufnahmen der New Yorker Aufführung vom vorigen Jahr, auf vierundsechzig Röhrenmonitoren, die immer asynchroner wurden zum Soundtrack von den Bändern.
Die Architektin wandte der Kunst den Rücken zu, hier in West-Berlin gab es immer den zweiten oder dritten Aufguss davon, was die Moderne und die Avantgarde und das Geld in vollständigen Städten machten. Klaviergeklimper, irritierende Crescendi und Kakofonien, die gar nicht mehr irritierend waren, weil die einander seriell umrankenden Baugespräche alles übertönten, was die Avantgarde sich als Störgeräusche vorgestellt hatte.
Es wurden Jakobsmuscheln und Fasan im Wechsel gereicht, mal stand man, mal saß man. Peter Rühmkorfs Lieblingsessen, sagte ihr Mann, der Hamburg für den Nabel der weiten Welt hielt.
Die Architektin sah sich die Leute an, während sie so tat, als wäre sie es, die sich anschauen ließ. Wie die anderen Frauen sich wunderten, dass sie nicht am Gattinnenprogramm teilnahm. Wie die Männer sich wunderten, dass sie nicht am Gattinnenprogramm teilnahm. Ach, Sie bauen auch? Was bauen Sie denn? Kenne ich etwas, das Sie gebaut haben? Sie hatte ein paar Wohnhäuser gebaut, Mehrfamilien, Richtung Heerstraße. Immerhin, sagte einer. Manche waren väterlich oder onkelhaft und sagten: Sie müssten an die großen Bauvorhaben der Stadt ran. Es blieb beim Konjunktiv. Es war weniger ein Rat, mehr ein abschließendes Urteil: Wohnhäuser zählten nicht, aber mehr war nicht erreichbar für sie.
Sie stand am Seeufer und schaute hinaus aufs Wasser. Sie konnte die Wasserläufer mit ihren runden Fußspuren auf der Oberflächenspannung genauso erkennen wie das große Ganze, die Stimmung, die Vibrationen: die abgestandene Enge dieses kleinsten Süd-Berliner Sees, das Wasser zum Ende des Sommers nicht mehr frisch, die Spiegelbilder der Anliegergrundstücke in der Seeoberfläche, ein endloser Abgrund in den gespiegelten Himmel, zerrissen von den unruhigen Ruderblättern eines schlingernden Bootes auf der anderen Seite. Abendhitze mit einem Hauch von Herbst. Aus der Villa hinter ihr die Geräusche von Menschen, die mit Gläsern, Zigaretten und einander hantierten. Von der Goethestraße das Nageln von Dieselmotoren beim An- und Abfahren; die Ersten gingen, die Letzten kamen. Sie blieben fast immer zu lange, der Bezirksbürgermeister und sie.
Weiter rechts von ihr stand ein Mann, die dunkle Silhouette einer Glatze und eines Anzugs. Er stand bis fast zu den Knien im Wasser. Sie zog an ihrer Zigarette, niemals würde sie sich von irgendwas alarmieren lassen. Hin und wieder drehte einer durch, das gehörte dazu. Männer sprangen von Häusern, wenn das Geld weg war. Sie warfen sich in der Lipschitzallee vor den Zug, wenn sie den Mut verloren. Sie stellten sich ins Wasser, wenn sie betrunken waren, einfach, um auf sich aufmerksam zu machen.
Der Mann bemerkte sie und wandte ihr sein Gesicht zu, was sie daran erkannte, dass sein Profil in einer dunklen Fläche verschwand, er stand vielleicht zehn Meter entfernt.
»Das Wasser ist herrlich«, sagte er, ohne die Wörter zu rufen, das gefiel ihr. Sie sah, dass er seine Schuhe in der Hand hielt, und war trotz all ihrer Beobachtungslust doch erleichtert: Der hatte nichts Theatralisches vor. Er kam langsam auf sie zu, die Hosenbeine bis zu den Knien hochgezogen.
Sie musste fast lächeln, tat es aber nicht. Sie erkannte ihn. Vor einer halben Stunde hatte sie ihn am Büfett abgetastet, russische Eier, die jetzt Freiheitseier hießen, kleine, harte Mürbeteigförmchen mit Sylter Krabbensalat. Referatsleiter irgendwas in der Oberfinanzdirektion. Sie hatte ihm einen Moment zugehört und sich dann etwas zu trinken geholt, ohne sich etwas zu trinken zu holen. Du fängst oben an, nach unten durcharbeiten kannst du dich immer noch, das hatte sie von ihrem Mann gelernt, dem Bezirksbürgermeister. Der war mehrfach im Gefängnis gewesen, erst bei den Nazis, dann noch mal bei den Nazis, dann bei den Kommunisten. Im Knast musste man auch immer oben anfangen, wenn man sich Respekt verschaffen wollte. Sie hielt es für einen guten Rat, darum sprach sie mit Referatsleitern erst, wenn es nötig war.
»Wir gehören hier beide nicht so richtig hin«, sagte der Referatsleiter jetzt, sein Name fiel ihr auch wieder ein: Burose. Wie eine Krankheit, die man sich in Verwaltungsräumen zuzog. Sie traute ihren Ohren nicht. Eine Anzüglichkeit oder eine Zote hätte sie weniger aus dem Konzept gebracht. Zum Glück konnte man hier rauchen. Er missverstand ihr Schweigen als Interesse.
»Ich bin eine Stufe zu niedrig, um hier für die Bauleute wirklich was möglich machen zu können, und Sie haben noch keinen großen Zweckbau der öffentlichen Hand abgewickelt.« Die Hacken seiner Schuhe klackerten aneinander, weil er seine Hand in ihre Richtung bewegte, als wollte er ihr die Budapester Maßarbeit demonstrieren. »Wir sind beide nicht im Klub.«
Sie sah ihm ins Gesicht, auf das jetzt der Widerschein der Partylichter fiel. Chancen, Stadt. Sie verzog einen Mundwinkel und die dazu gehörende Augenbraue auf eine Art und Weise, von der sie jetzt schon wusste, dass sie eines Tages in der Presse als »mokant« beschrieben werden würde.
»Ich bin in gar keinem Klub«, sagte sie. Ich bin der Klub.
»Ich auch nicht«, sagte er, aber sie merkte, dass er es anders meinte. Zehn Jahre älter als sie, die Zeit lief ihm davon. Noch einer aus dem Krieg. Solange die da waren, ging das immer so weiter. Als wären sie nur kurz aus den Schützengräben getreten, um ein paar Geschäfte abzuwickeln. Und wenn man wollte, konnte man sie dabei erwischen, wie sie sich umsahen, als könnten ihnen überall und jederzeit die Kugeln um die Ohren pfeifen.
Sie schnippte ihren Zigarettenstummel weit ins Wasser: eine Baustellengeste, eine Angeberei aus dem Studium. Das passte nicht hierher, aber diesem Burose schien es zu gefallen.
»Vielleicht sollten wir gemeinsam einen Klub gründen«, sagte er. Sie mochte diese leichte Heiserkeit, das Ungeduldige.
»Ich sagte doch, ich bin in keinem Klub.«
»Sie wissen doch noch gar nicht, was das für ein Klub ist.«
»Einer, in den ich nicht eintreten will.«
»Dann will ich auch nicht.«
»Ein beeindruckender Klub.« Sie stellte fest, dass sie schon wieder eine Zigarette in der Hand hatte, und bot ihm eine an. Er schüttelte den Kopf und zeigte auf seine Brust.
»Ich hätte vielleicht eine Idee für Sie«, sagte er und überraschte sie damit. Weil er es vorsichtig sagte, als wollte er ihr helfen.
»Danke«, sagte sie. »Ich hab noch.«
»Ideen kann man nie genug haben.«
»Ach, doch. Sogar zu viele.«
»Und Grundstücke?«
Sie rauchte und lächelte jetzt doch, weil es sowieso zu dunkel war, um daraus Interesse oder eine andere Schwäche lesen zu können.
»Kennen Sie Steglitz?«, fragte er und drehte sich mit dem Rücken zum See, sodass das Feierlicht auf ihn fiel. Sie mochte, dass er keinen Bart hatte, und braune Augen. »Die Gegend zwischen Unter den Eichen und Schlossstraße. Richtung Südwesten. Da sind eine Menge alte Gewerbehöfe, ein Schrottplatz, Werkstätten. Schuppenbebauung.«
»Ein Schrottplatz«, sagte sie mit stillem Vergnügen.
Er nickte. »Das kostet alles nichts. Aber …«, er klapperte wieder mit den Absätzen seiner schweren Schuhe in der linken Hand. »Wir sind dabei, die Wirtschaftlichkeit des einen oder anderen Verkehrsvorhabens zu prüfen, das die Senatsverwaltung uns vorlegt.«
Sie musste aufpassen, dass ihr Vergnügen weiter still blieb. Rauchen half.
»Wenn Sie sich das mal anschauen, also diese Grundstücke … Dann wären Sie, falls Sie das interessiert, für wenig Geld in einer guten Position. Sobald da was gebaut werden soll. Der Bezirk und der Senat müssten Ihnen das für viel Geld abkaufen.«
Sie nickte.
»Sie nicken. Was halten Sie davon?«
»Warum erzählen Sie mir das?«
Burose zuckte mit den Achseln und setzte seine Schuhe ins Gras. Sie sah, dass sorgsam ineinandergesteckte Socken daraus hingen wie durstige Zungen. »Nur so. Weil Sie sich für Grundstücke interessieren. Und ich mich damit auskenne.«
»Sind Sie sicher?«
Er sah sie fragend an. Sie wusste, dass er ihr nicht hinterhergehen konnte auf die Schnelle, barfuß, die Socken noch nicht einmal entpellt. Sie beugte sich zu ihm und sagte etwas leiser, als er bisher gesprochen hatte: »Ich weiß, welche Grundstücke Sie meinen. Ich könnte Ihnen sogar die Flurnummern nennen, und wenn Sie einen Moment warten, könnte ich Ihnen die Grundbuchauszüge aus dem Wagen holen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie ablegen zu lassen.«
Er atmete ein, um ein bisschen mehr Zeit für eine Antwort zu gewinnen, aber die Zeit reichte nicht. Er musste grinsen.
Sie nickte. »Ich habe die Grundstücke vorige Woche gekauft. Alle.«
Als sie den Rasen hinauf ins Haus am Waldsee ging, um ihren Mann zu suchen, meinte sie, erkennen zu können, wie ihr der Mann von der Oberfinanzdirektion hinterherblickte. Hoffentlich kam er noch weiter oder weit, denn eigentlich mochte sie ihn.
Später, da lief Stockhausen zum vierten oder fünften Mal, stand sie noch einmal in einer Baurunde, es waren auch Leute von der TU da, Fachleute, die man daran erkannte, dass sie schroff gestrickte Pullover trugen. Einer sagte, man müsste in die Breite und für die Breite bauen, wie die nordenglischen Brutalisten. Oder in Terrassen, demokratischer, nicht so hierarchisch, nicht so phallisch wie diese Wolkenkratzer im internationalen Stil.
Die Architektin trank vom etwas zu süßen Wein, den einer von der CDU aus Österreich importiert hatte, Scheurebe, und erfreute sich am Wort Wolkenkratzer: Sie mochte, dass man hier im Westen immer noch ganz altmodische Wörter hörte, die von ganz altmodischen Menschen verwendet wurden, die nicht merkten, dass sie und die Wörter von gestern waren und nicht von morgen.
Im Stockhausen-Film zog sich eine Frau im schwarzen BH vor einem Spiegel und vor dem Publikum an oder aus.
Das Wort phallisch kannte sie, weil sie ihren Freud gelesen hatte, als der in der DDR verpönt gewesen war, Anfang, Mitte der Fünfziger. Auch so ein schönes altes Wort. Verpönte Wolkenkratzer.
»Haben Sie phallisch gesagt?«, fragte einer aus der Baudirektion, der offenbar noch ein bisschen länger brauchte, um sich eine Zote zurechtzulegen.
»Hochhäuser sind phallisch«, sagte der Fachmann und wurde ein wenig rot, als er ihren aufmerksamen Blick bemerkte. Oh, es war eine Frau in der Runde.
»Dagegen ist doch nichts einzuwenden«, sagte sie und nahm noch einen Schluck, nicht der süßen Plörre wegen, sondern für den dramatischen Effekt. »Also, ich mag phallisch.«
Das gab, wie es später hieß, ein großes Hallo. Am Rande ihres Blickfeldes stand der Mann aus dem See und versuchte, nicht nach ihrer Aufmerksamkeit zu heischen.
… 1 23 4 56 7 …
Otto setzte sich auf sein Bett, vertraut, wie ihm der Holzrahmen in den Oberschenkel drückte. Einen Moment überlegt, den Brief vom Vater einfach wegzuschmeißen, direktemang in den Ascheimer. Aber dann würde seine Mutter den am Ende finden, oder der Hausmeister, der wühlte im Müll die Post durch, Informationen waren Macht.
Es wäre gut gewesen, sich jetzt erst mal eine anzustecken, schon allein, um Zeit zu gewinnen. Nachdenkliche Kringel. Hinterherschauen. Eine weitere Sache, die jetzt mal dringend losgehen musste. Sex eigentlich auch. »Schulmädchen« beispielsweise waren damit viel früher dran als er, das zumindest entnahm er den Ankündigungen immer neuer »Reporte«, die in Tempelhof in sogenannten Flohkinos liefen. Wann würde das bei ihm anfangen? Und was auch hatte anfangen sollen: in die große weite Welt, dort Journalist werden, dann anderen diese große weite Welt erklären. In der Hoffnung, diese Welt bis dahin selbst zu verstehen. Oder so tun, als ob. Er wollte in München in eine Disko gehen. Er wollte mit einem oder einer BMW nach Italien. Das kam ihm alles größer vor als die klebrige Werthers-Echte-Welt von Tempelhof, freier, nach allen Seiten offener. Hier war man immer gleich in Mariendorf, was sollte er da.
Otto Bretz hatte sich noch nie in seinem Leben einer Sache wegen angestrengt, das machte seinen Vater wahnsinnig. Der Vater fand seit der Hitlerjugend, dass alles ein Kampf sein musste. Der Vater verdiente sehr gut bei Siemens, Unterhaltungselektronik, der hatte Löten und Schaltkreise noch als Funker bei der Marine gelernt, Seeblockade. Aber alles musste man sich erkämpfen. Es wurde einem ja nichts geschenkt. Weil ihm diese Kindheitssätze zum Halse heraushingen, mochte Otto sich nicht anstrengen. Niemals stand in seinen Schulzeugnissen, er hätte sich stets bemüht, mehrmals stattdessen: schade, wie er unter seinen Möglichkeiten bliebe. Dass ihm zwar viele Dinge leichtfielen und dass das eben auch eine Verpflichtung wäre. Otto sah das gar nicht ein. Warum für ein Gut viel oder für ein Sehr gut sehr viel tun, wenn er für nichts tun ein Befriedigend oder Ausreichend bekam?
Der Vater nannte ihn dann manchmal einen Gammler oder Hippie, als hätte Otto irgendwas zu tun mit den fünf, sechs Jahre Älteren, die so was wie Revolution gemacht oder zumindest versucht hatten. Otto fand das eher schmeichelhaft. Alles, was ihn irgendwie aus der Tempelhofer Etagenwohnungsenge heraushob, zog ihn an. Vor allem das Geräusch, wenn er morgens beim Frühstück die steife neue Zeitung aufschlug und zurechtfaltete. Sein Vater hatte das Handelsblatt und die Frankfurter Allgemeine abonniert, auf Bürokosten, wegen der Wirtschaftsnachrichten, Lokalzeitungen brauchte man nicht, dafür gab es die Berliner Abendschau. Sein Vater suchte nach Berichten über neue Entwicklungen im Bereich der Elektroindustrie und Unterhaltungselektronik, Erwartungen der Branche für die Internationale Funkausstellung, den Rest legte er weg. Otto griff zu und verschwand in den Bleiwüsten der kleinen Überschriften und eng gesetzten, kaum verständlichen Texte aus der weiten Welt, als stiege er aus einem Fenster. Die Mutter schmierte ihm ein Brot, der Vater ärgerte sich, konnte aber nichts sagen, denn ein Kind, das schon mit zehn mit gerunzelter Stirn die Rubrik »Deutschland und die Welt« las, das war auch was, damit konnte man sogar ein bisschen renommieren.
Deutschland und die Welt, so hieß das, wenn von Verbrechen, Unfällen und Unwettern dort berichtet wurde, wo nicht Tempelhof war.
Otto konnte es kaum abwarten, als er die Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sah: Deutsche Journalistenschule in München, 11. Lehrredaktion 1972 bis 1974, Kompaktausbildung, Bewerbungsunterlagen anfordern, folgende Frist. Zum ersten Mal investierte er was: zwei Briefmarken und mehrere Vormittage. Er schrieb einen Lebenslauf, verwies auf die Schülerzeitung, dort hatte er einmal ein Lehrerzitat beigesteuert. Er wählte eins von drei Themen für die Übungsreportage. »Willkommen in der Freiheit – Wie Ostflüchtlinge sich zurechtfinden«, das war nichts für ihn, das hatte eine Schwere, die lag ihm nicht. »Zankapfel Haushaltsgeld? – Wie moderne Paare den Alltag meistern«, na ja, da hätte er lange recherchieren müssen, um eines zu finden, hier im Haus gab es keines.
Also verbrachte er zwei schulgeschwänzte Vormittage im Zoo am gleichnamigen Bahnhof, am Ende konnte er die Tiere am Scheißegeruch in der Luft unterscheiden: »Oma hat eine Jahreskarte – Wenn Menschen jeden Tag in den Zoo gehen.« Reporterglück: Nach einer halben Stunde hatten ihn drei alte Damen vorm Affenhaus gefragt, was er denn hier so belämmert rumstehen würde, ob er was verloren hätte, seine Eltern vielleicht. Als er seinen Block aus der Anoraktasche friemelte, lachten sie ihn aus. Dann nahmen sie ihn mit ins Café am Wildgehege, kauften ihm ein Schultheiß (auf der Gedächtniskirche war es kurz nach elf Uhr vormittags), erklärten ihm den Zoo (»Die Tiere spinnen alle, aber herzig sind die«) und gaben ihn am nächsten Tag am Eingang als ihren Enkel aus, »lass mal unsern Steppke mit rein, Werner«.
Das mit dem Steppke tat weh, aber aus der Geschichte über »Die Königinnen der Tiere« hatte einer der Prüfer bei Ottos Auftritt vor der Prüfungskommission zitiert. »Edith hat die Möhren, Irmgard die Kartoffelschalen, und Käthe weiß, wo die Füttern-verboten-Schilder so verrostet sind, dass man sie nicht mehr lesen kann, und wann die Tierpfleger Kaffeepause machen. Keiner soll mehr hungern, sagt Käthe. Auch nicht Hängebauchschwein Erwin.« Wie man da von Anfang an drin sei in dieser Welt, beeindruckend, von so einem jungen Burschen. Er sei dann jetzt hier also ihr Nesthäkchen, willkommen am 1. November in München am Altheimer Eck.
Käthe las das auch und fragte, wann sie das denn gesagt haben sollte, aber gefallen würde es ihr schon. Es war stickig, als er sie im »Altersruhesitz am Zoo« besuchte, der Streuselkuchen, die dicke Luft, aber Otto mochte, wie er dort auf dem Sofa für ein halbes Stündchen quasi bewusstlos wurde.
Er riss den Brief von seinem Vater auf, ein Zettelchen, wenig Materialverschleiß. Der Vater habe darauf gewartet, bis er, »mein Sohn«, »in der Maschine« nach München säße (aha, daher das spendierte Ticket), denn nun sei es wichtig, »deine Mutter« auch einmal »auf eigenen Füßen« stehen zu lassen (also, sie stehen zu lassen, aha, aha), denn er, der Vater, ginge nach Stuttgart, für »den Subarashi-Konzern«, die Japaner, man habe ihn dort von Siemens abgeworben, und er werde »fürderhin« das Nord- und Mitteleuropa-Geschäft von Subarashi aufbauen.
»Deine Mutter ist eine erwachsene Frau«, schrieb sein Vater. »Sie muss, wird und kann alleine zurechtkommen. Ihre unüberlegten Entscheidungen vom vorigen Herbst werden sich nicht wiederholen. Wenn du dies liest, bist du sicher auf deinem ersten Heimaturlaub und hast dich in München«, der Hauptstadt der Bewegung, ergänzte Otto in der Familienfeier-Stimme seines Vaters, »bereits eingelebt, da bin ich froh, denn ich möchte nicht, dass deine Mutter dir dies nun noch verderben kann.«
Aus dem Wohnzimmer hörte Otto ein Seufzen oder einen Raucherhusten, seine Mutter hatte da so eine Mischung erschaffen, die so was wie der Soundtrack seines Lebens war, Ennio Morricone der Etagenwohnung. Das Nachmittagslicht war kurz vorm Sonnenuntergang bernsteinfarben, als wäre er die Mücke darin, gefangen und konserviert für immer. Wenn sein Vater wollte, dass er die Mutter allein ließ, dann würde er eins ganz bestimmt nicht tun: die Mutter allein lassen.
Daher vielleicht die Geschichte mit dem Rollfeld und dem Telefonanruf, mit dem Livrierten und dem Telefonkabel. Weil es am Ende einfach so war, dass Otto Bretz seinen Ausbildungsplatz an der Deutschen Journalistenschule in München nicht antreten konnte wegen seiner Mutter. Stattdessen ging er zum Spandauer Volksblatt, wo er eine Zusage für ein dreimonatiges Praktikum bekommen hatte, Beginn genau wie in München. Zum Glück hatte er vergessen, das abzusagen.
Ob der Platz noch frei …, also, ob sie ihn erwarteten …, fragte er am Telefon, hellgrau und vergilbt, auf dem Tischchen im Flur.
Hä, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung. Ja, was denn sonst. Und jetzt aber mal flinke Füße.
Es gab aber auch noch eine ganz andere Version der Geschichte. Vielleicht wurde Ottos Geschichte fortlaufend aktualisiert, wie die Zeitung. Von der ersten Ausgabe, die ab 18 Uhr am Bahnhof Spandau und am Bahnhof Zoo auslag, bis zur letzten, um Mitternacht, die dann ab vier Uhr dreißig an die Abonnenten ging.
In dieser Version kam Otto vom Einkaufen nach Hause, seine Mutter sagte, »Dein Vater ist am Flughafen«, und Otto wusste sofort, was das bedeutete: dass er das Angebot von den Japanern angenommen hatte. Eine Generalvertretung irgendwo in Wessiland. Er quietschte die Treppe hinunter und schwang sich auf sein Fahrrad, Herkules, 26er, Torpedo-Dreigang, von denen aber nur zwei gingen. Auf dem Weg zum Flughafen strampelte Otto im Stehen, sodass er sich vorkam wie ein Kind in einem Vorkriegsfilm. Der Vater würde ihn nicht allein lassen mit der Mutter, sie würden die Mutter nicht beide allein lassen, denn Otto saß ja auf gepackten Koffern, sozusagen, er hatte bei Hertie tatsächlich schon Gepäckanhänger besorgt und seinen Namen in harten Druckbuchstaben draufgeschrieben. Das konnte der Vater ihm nicht antun. Vielleicht erzählte Otto diese Version der Geschichte deshalb nicht so gerne, weil er darin heulte. Der Vater, schon in der Schlange zum Rollfeld, der Vorhang zum Gate war noch nicht auf, aber die Männer davor hatten schon dieses Aufbrüchige: »Du bist jetzt erwachsen, Otters, du kannst deiner Mutter nicht ewig das Händchen halten. Natürlich gehst du nach München.«
So, wie der Vater jetzt nach Stuttgart flog, um von da aus den Staubsaugerimport für die Tokyoter Firma aufzubauen. West-Berlin war eine Sackgasse, aus ihrer beider Sicht. Aus jeder Sicht. Ein absterbender Wurmfortsatz, wo die Bazillen sich noch mal austoben konnten, bis für immer das Licht ausging, finito la musica.
Die Tränen kamen ihm, als sein Vater ihm die Schulter quetschte und sagte: »Das kriegst du hin.« Nicht, weil ihn das so besonders gerührt hätte. Sondern weil das so unfassbar nichtssagend war. Da war wirklich gar nichts mehr. Wenn der Vater etwas sagte, war hinterher weniger da, als vorher in der Welt gewesen war. Der Vater schuf Leere, wenn er Wörter sagte.
Als Otto München absagte, sprach seine Mutter eine Woche kein Wort mit ihm, in dieser anderen Version, wütend, enttäuscht von ihm. Dann holte sie die Praktikumszusage aus Spandau, die Otto vor Wochen weggeworfen hatte. Die hatte sie rechtzeitig aus dem Müll gefischt und sicherheitshalber aufbewahrt.
… 2 34 5 67 8 …
»Garmisch oder Sylt?«
»Was ist der Unterschied?«
»Die Entfernung. Das ganze Fluidum.«
Die Architektin blies den Rauch an ihrem Büroleiter Vollrath vorbei.
»Oder Baden-Baden.« Das war seine Abschussvariante, das merkte sie sofort. Manchmal wusste sie nicht, ob es gut war, dass sie genau wusste, wie ihr Sekretär funktionierte, oder ob es nicht besser war, mit Leuten zu arbeiten, die einen auch mal überraschen konnten.
»Das Brenner’s Park?«, fragte sie, nicht uninteressiert. Da meldete sich ihre Buchhalterseele. Weil sie wusste, dass im Grand Hotel Brenner’s Park noch Rechnungen offen waren von der letzten Kommanditisten-Versammlung. Ein alter Trick aus der Baubranche: Leuten Aufträge geben, denen man noch Geld schuldete, weil mit jedem neuen Auftrag deren Hoffnung wuchs, man würde sie am Ende doch noch bezahlen. Das war einfache Psychologie.
»München und Baden-Baden sind mir zu umständlich«, sagte die Architektin, als gebe sie damit etwas von sich preis, und jetzt sei er dran.
»Sylt im Winter ist natürlich …«, er zögerte. Vollrath trug dreiteilige Anzüge und Brokatkrawatten, weil er die ungefähre Ahnung zu haben glaubte, dass so die Manager von Rockstars in London oder Los Angeles aussahen. Er war Anfang dreißig, und die wenigen Haare, die er noch hatte, trug er nicht, wie sein Vater oder Heinz Erhardt, mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit quer über den Kopf gelegt; er überließ sie sich selbst, sodass sie, scheinbar nicht der Schwerkraft unterworfen, in verschiedene Richtungen flusten. Wenn er vor Lampen stand, hatte er einen regelrechten Heiligenschein. Das Arbeitszimmer der Architektin war nur durch den Lichtkegel ihrer Schreibtischlampe beleuchtet. Sie sah auf und durch ihn hindurch, ihr war egal, wie er aussah.
»Sylt im Winter ist eben Sylt im Winter«, sagte sie. »Wir machen eine Strandsauna. Sie lassen, was Sie dafür brauchen, aus Skandinavien kommen.« Sie sagte nicht Dänemark, weil sie immer die größte Kategorie wählte. Für Vollrath waren die Leute, die in Berlin bauten, die Rockstars von Deutschland. Warum mit Udo Lindenberg oder Vicky Leandros durch das südliche Niedersachsen touren, wenn man für die mächtigste Frau Berlins Veranstaltungen auf die Beine stellen konnte, die schon im Moment der Einladung Legende waren? Es war Vollrath egal, dass er sich dafür Büroleiter nennen lassen musste. Zur Auswahl hatte noch Chefsekretär gestanden. Für ihn war Belohnung genug, dass sie ihm hin und wieder einen Superlativ gönnte, den er dann im Freundeskreis in der Wir-Form weiterverwenden konnte: Wir bauen das höchste Haus Berlins.
»Also auch diese …«, sie suchte nach dem englischen Wort, landete dann aber selbstbewusst bei: »Wasserbottiche. Mit heißem Wasser.«
»Also jetzt nicht einfach nur ein Abend im Gogärtchen oder …«
»Das reservieren Sie mal auch, beide Tage von 15 Uhr bis open end. Aber Übernachtung machen wir im Meeresgöttin Ran 2000 …«
»Ekke Nekkepenn wäre auch frei«, unterbrach er, und sie sah, wie er darüber erschrak. Sie lächelte, denn er hatte einen guten Moment erwischt, sie nahm die Unterbrechung als kreatives Chaos, gemeinsamen Enthusiasmus. Ekke Nekkepenn war ein Meeresgott, die Sylt erschaffen hatte. Die Architektin hatte sich den Namen ausgedacht für das Sylter Lokal, dessen stille Teilhaberin sie war. Sie dachte sich gern Firmennamen aus, darin war sie gut. Sie brauchte viele Namen, weil sie viele Firmen hatte.
»Abendessen im Ekke Nekkepenn, viergängig rustikal«, entschied sie, »aber kein Fondue. Vormittags Büfett. Und nichts mit Aspik.«
»Nichts mit Aspik«, bekräftigte Vollrath, als würde er sich Notizen machen, dabei, so gut kannte sie ihn, war er in Gedanken bei der Frage, wie er das einer wichtigen Schmargendorfer Großsülzerei beibringen sollte, die bereits mit gespitzten Bleistiften über den Auftragsbüchern saß und auf seinen Anruf wartete.
»Canapés, Krabben-Cocktail, Chicorée-Schiffchen«, improvisierte sie. »Nicht immer alles so schwer.«
»Busservice zwischen dem Meeresgöttin Ran 2000 und dem Ekke Nekkepenn?«, fragte er.
»Oldtimer«, sagte sie. »Vorkriegsmodelle.«
»Soll ich Heidi anrufen?«
»Mit Chauffeur. Chauffeurinnen. Was fürs Auge. Sechs, sieben Stück müssten reichen. Siebensitzer. Das ist ja nicht weit. Pendelverkehr.«
»Wir rechnen mit …«
»Hundert Personen. Und ein paar Zerquetschte.«
Er nickte.
»Und – Vollrath.« Er beugte sich ein Stück Richtung Schreibtischlampe, damit sie sah, wie sehr er ihr zuhörte.
»Das ist das wichtigste Ding, das wir jetzt noch für den Kegel machen. Das ist die entscheidende Phase gerade.« Sie wusste, dass er dramatische Formulierungen zu schätzen wusste.
Vollrath schaute alarmiert. »Haben wir immer noch keine Mieter für den Kegel? Also, dass sich das dann trägt am Ende?«
Sie schloss kurz die Augen, um ihn wenigstens für einen Moment nicht sehen zu müssen. Weil Vollrath so zuverlässig im alltäglichen Kleinkram war, vergaß sie manchmal, wie wenig er vom großen Ganzen begriff.
»Vollrath«, sagte die Architektin. »Darum geht es doch gar nicht.«
»Ich weiß«, log Vollrath, das merkte sie immer gleich. »Nur, weil wir im ersten Quartal diese große Sause zur Mieterakquise in den Wannsee-Terrassen gemacht haben, also …«
»Sagen Sie bitte nicht Sause«, sagte sie. »Und natürlich machen wir so was. Das ist doch klar. Vielleicht möchte ja wirklich jemand diese Büroräume mieten. Aber dafür sind die Quadratmeterpreise, die wir kalkuliert haben, vermutlich zu hoch. Muss ich Ihnen das wirklich alles noch mal erklären?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: