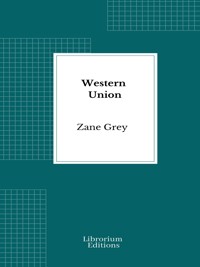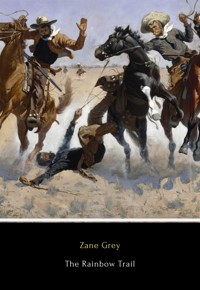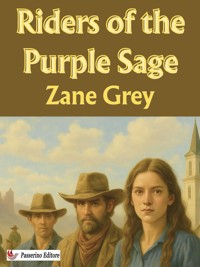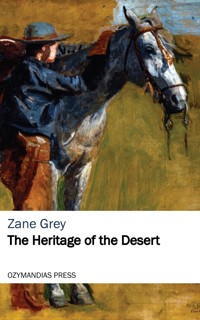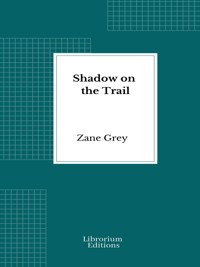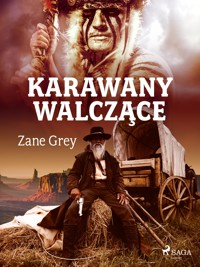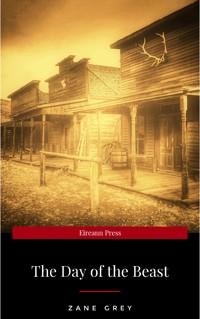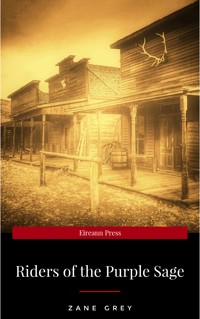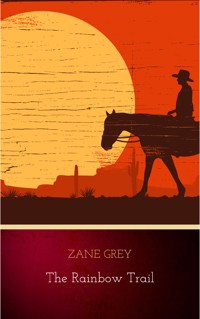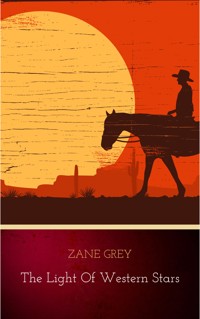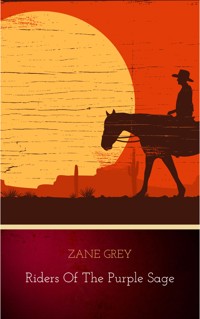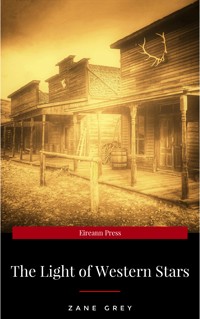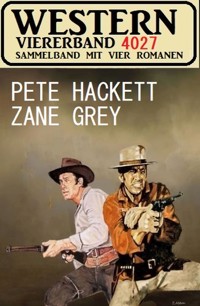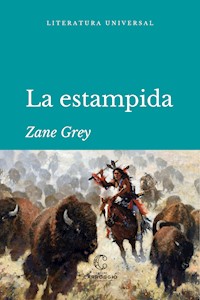6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Mann liegt mitten auf der Straße, mit dem Gesicht im Staub. Jean Isbel weiß, dass er nicht der erste war und dass er nicht der letzte sein wird in diesem blutigen Krieg, der zwischen Ranchern und Schafzüchtern tobt.
Doch hinter all dem steckt weitaus mehr als nur der Kampf um gutes Weideland: Im Pleasant Valley suchen zwei Familien, die eine uralte Fehde zu unversöhnlichen Feinden gemacht hat, eine Entscheidung auf Leben und Tod. Auf der einen Seite steht Gass Isbel mit seinen Söhnen, auf der anderen Colonel Lee Jorth mit seinen verwegenen Männern. Für beide... gibt es kein Zurück mehr.
Aber noch schlimmer sind die zweibeinigen Wölfe, die zwischen ihnen stehen...
Zane Grey ist einer der bedeutendsten Klassiker unter den Autoren des amerikanischen Western: Sein Roman Bis zum letzten Mann gilt überdies als eines der großen tragischen Werke dieses Genres. Der Apex-Verlag präsentiert diesen Roman in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene Neu-Ausgabe, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ZANE GREY
Bis zum letzten Mann
Apex Western, Band 6
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
BIS ZUM LETZTEN MANN
Vorwort
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Romanze und blutige Familienfehde: Zane Greys »Bis zum letzten Mann«
Ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth
Das Buch
Der Mann liegt mitten auf der Straße, mit dem Gesicht im Staub. Jean Isbel weiß, dass er nicht der erste war und dass er nicht der letzte sein wird in diesem blutigen Krieg, der zwischen Ranchern und Schafzüchtern tobt.
Doch hinter all dem steckt weitaus mehr als nur der Kampf um gutes Weideland: Im Pleasant Valley suchen zwei Familien, die eine uralte Fehde zu unversöhnlichen Feinden gemacht hat, eine Entscheidung auf Leben und Tod. Auf der einen Seite steht Gass Isbel mit seinen Söhnen, auf der anderen Colonel Lee Jorth mit seinen verwegenen Männern. Für beide... gibt es kein Zurück mehr.
Aber noch schlimmer sind die zweibeinigen Wölfe, die zwischen ihnen stehen...
Zane Grey ist einer der bedeutendsten Klassiker unter den Autoren des amerikanischen Western: Sein Roman Bis zum letzten Mann gilt überdies als eines der großen tragischen Werke dieses Genres. Der Apex-Verlag präsentiert diesen Roman in seiner Reihe APEX WESTERN als durchgesehene Neu-Ausgabe, ergänzt um ein Essay von Dr. Karl Jürgen Roth.
BIS ZUM LETZTEN MANN
Vorwort
Es war unvermeidlich, dass ich in meinen Bemühungen, die romantische Historie des großen Westens zu schreiben, schließlich auf die Geschichte einer Fehde stoßen musste. Lange bin ich dieser Klippe ausgewichen; schließlich aber begegnete ich ihr und muss über sie hinweg - getrieben von meinem Verlangen - die packenden Ereignisse der Pionierzeit aufzuzeichnen.
Selbst heute ist es nicht möglich, in die entlegenen Winkel des Westens zu reisen, ohne im Leben der Leute immer noch die Spuren der kampfreichen Vergangenheit zu sehen. Wie kann man die Wahrheit über die Erschließung des Westens berichten, wenn man die Mühsal, den Kampf, das Blut beiseitelässt? Unmöglich. Wie soll ein Roman packend und spannend sein gleich jenen Zeiten, sofern er nicht ein gewisses Maß an Sensationen enthält? Meine langjährige Arbeit war dem Versuch gewidmet, meine Geschichten den Zeiten ähnlich zu machen, die sie schildern. Ich habe den Westen geliebt wegen seiner Unendlichkeit, seiner Kontraste, seiner Schönheit und bunten Lebendigkeit, seiner Wildheit und Gewaltsamkeit, und um der Tatsache willen, dass ich gesehen habe, wie er große Männer und Frauen hervorbrachte, die unbekannt und unbesungen starben.
In diesem materialistischen Zeitalter, diesem harten, praktischen, raschlebigen, gierigen Zeitalter des Realismus scheint kein Platz mehr zu sein für romantische Dichter, kein Platz mehr für die Romantik selbst. Viele Jahre hindurch waren all die Ereignisse, die zum Weltkrieg führten, realistisch, der Krieg selbst war von einer grauenhaften Realistik, und die Nachernte ist ebenso. Romantik ist nur ein anderer Name für Idealismus; und ich behaupte, dass ein Leben ohne Ideal nicht lebenswert ist. Nie in der Geschichte der Welt waren Ideale so furchtbar notwendig wie heute. Walter Scott dichtete Romantik; ebenso Victor Hugo; und auch Kipling, Hawthorne, Stevenson. Besonders Stevenson hat den Knüppel gegen die Realisten geschwungen. Die Menschen leben für den Traum in ihrem Herzen. Und ich muss erst noch dem Menschen begegnen, der nicht einen geheimen Traum besitzt, eine Hoffnung, sei sie auch noch so trübe, eine vielsimsige Mauer, die er im Dämmergrau betrachtet, ein bemaltes Fenster, das zur Seele führt.
Es war Wordsworth, der schrieb: Die Welt ist zu viel bei uns; und wenn ich in wenigen Worten das Geheimnis meines schriftstellerischen Ehrgeizes sagen könnte, es würde in diesem Zitat enthalten sein. Meine Inspiration zum Schreiben ist stets von der Natur ausgegangen. Charaktere und Geschehnisse sind dem Rahmen untergeordnet. In allem, was ich getan habe, wollte ich den Menschen zeigen, dass die Welt zu viel bei ihnen sei. Raffend und verschwendend legen sie ihre Kräfte brach, ohne jemals das freie und wunderbare Leben der offenen Weite zu atmen!
So kehre ich zu dem Hauptpunkt dieses Vorworts zurück, in dem ich zu erzählen versuche, warum und wie es kam, dass ich die Geschichte einer in Arizona als Pleasant-Valley-Krieg berühmten Fehde schrieb.
Vor einigen Jahren sagte mir Mister Harry Adams, ein Viehzüchter aus Vermajo Park, Neu-Mexiko, er sei im Tontobecken, in Arizona, gewesen und ich könnte dort seiner Ansicht nach interessantes Material über den Pleasant-Valley-Krieg finden. Seine Wiedergabe dieses Krieges zwischen Rinderleuten und Schafzüchtern rief meinen Entschluss wach, mir die Sache näher anzusehen. Mein alter Führer Al Doyle aus Flagstaff hatte mich durch halb Arizona geführt, aber noch nie in jenes wunderbare wilde und raue Becken zwischen Mogolon Mesa und den Mazatzal-Bergen. Doyle hatte lange an der Grenze gelebt, und sein Bericht vom Pleasant-Valley-Krieg unterschied sich merklich von dem Mister Adams’. Ich erkundigte mich auch bei anderen Überlebenden aus der alten Zeit, und ihre Bemerkungen erregten meine Neugier noch mehr.
Doyle und ich fanden in diesem Becken die wildeste, raueste und merkwürdigste Gegend, die wir beide je gesehen hatten; und die wenigen Bewohner waren wie ihre Landschaft. Ich tat so, als wollte ich Bären, Panther und Truthähne jagen, aber die eigentliche Beute, um die es mir ging, war die Geschichte des Pleasant- Valley-Krieges. Ich mietete mir die Dienste eines Bärenjägers, der drei stämmige Söhne hatte, Männer, ebenso zurückhaltend, seltsam und stolz wie er. In einem meilenweiten Umkreis um ihr Blockhaus war noch nie eine Radspur aufgetaucht. Ich verbrachte zwei wunderbare Monate in diesen Wäldern, jagte und schwelgte in der Schönheit und Größe des Rim-Rock-Landes, aber bei meiner Abreise wusste ich nicht mehr über den Pleasant-Valley-Krieg als zuvor. Die Texaner und die wenigen Nachbarn, die gleichfalls aus Texas stammten, wollten nicht mit der Sprache heraus. Aber alles, was ich sah und fühlte, steigerte nur noch meine Begeisterung. Dieser Ausflug fand im Herbst 1918 statt.
Das nächste Jahr zog ich wieder los mit den besten Pferden, mit der besten Ausrüstung und den besten Leuten, die die Doyles mir verschaffen konnten. Und diesmal stellte ich keinerlei Fragen. Aber ich ritt - Pferde, die bisweilen zu wild für mich waren - mit der Flinte auf dem Rücken so manche hundert Meilen, zuweilen dreißig und vierzig am Tag, und ich kletterte in den tiefen Canons ein und aus, voll Verzweiflung an den Fersen eines jener langbeinigen Texaner klebend. Ich lernte das Leben der Hinterwäldler kennen, aber ich erfuhr nicht die Geschichte des Pleasant-Valley-Krieges. Immerhin hatte ich mir die Freundschaft dieser harten Menschen erobert.
1920 kehrte ich mit einer noch größeren Ausrüstung zurück, bereit, zu bleiben, solange es mir beliebte. Und diesmal, ohne dass ich gefragt hätte, kamen verschiedene einheimische Bewohner des Tonto zu mir und erzählten mir von dem Pleasant-Valley-Krieg. Keine zwei von ihnen stimmten in irgendeinem Punkte überein, außer darin, dass nur ein einziger der aktiven Teilnehmer den Kampf überlebt habe. Daher mein Titel: Bis zum letzten Mann. So wurde ich mit einer Fülle von Material überschüttet, aus der ich mich nur zu meinem eigenen Entschluss aufraffen konnte. Einige der Geschichten, die man mir erzählt hat, sind für einen Roman-Schriftsteller ausgesprochen verlockend. Aber obgleich ich selbst ihren Inhalt für wahr halte, kann ich ihre Unwahrscheinlichkeit unmöglich einem Publikum zumuten, das von der Wildheit wilder Menschen in einer wilden Zeit nicht die leiseste Ahnung hat. Es hat tatsächlich eine schreckliche und blutige Fehde gegeben, vielleicht die tödlichste und unbekannteste in all den Annalen des Westens. Ich habe den Schauplatz gesehen, die Hütten, die Gräber, die düsteren Zeugen dessen, was geschehen war.
Den wahren Anlass des Pleasant-Valley-Krieges habe ich nie erfahren, und wenn ich ihn gehört habe, so besaß ich nicht die Möglichkeit, ihn zu erkennen: Denn alle die Gründe, die angeführt wurden, waren einleuchtend und überzeugend. Es ist seltsam, aber im gesamten Tontobecken herrscht immer noch eine gewisse Verschwiegenheit und Zurückhaltung bezüglich der genaueren Tatsachen dieser Fehde. Zahlreiche Nachkommen der Getöteten leben noch. Aber niemand spricht gerne davon. Zweifellos haben sich viele der Vorfälle, die man mir erzählte, wirklich ereignet, wie zum Beispiel die schreckliche Episode der beiden Frauen, die unter den Augen unbarmherziger Feinde die Leichen ihrer toten Männer vor dem Schicksal retteten, ein Fraß der wilden Schweine zu werden. Es sei genug, wenn ich sage, dass diese romantische Geschichte meiner Auffassung von jener Fehde entspricht, und sie gründet sich auf die Landschaft, die ich so genau kennen und lieben lernte, auf die sonderbaren Leidenschaften primitiver Menschen und auf meine instinktive Empfänglichkeit für die Tatsachen und Gerüchte, die ich gesammelt habe.
- Zane Grey,
Avalon, Kalifornien, April 1921.
Erstes Kapitel
Am Ende eines Rittes durch trockenes, unfruchtbares Land kampierte Jean Isbel am Rande eines Zedernhaines, wo ein kleiner, felsiger Canyon mit grünen Weiden und Cottonwoods Aussicht auf Wasser und Gras bot.
Die Tiere waren müde - besonders das schwerbeladene Maultier. Mit sichtlicher Erleichterung ließen sie sich niedersinken und rollten sich im Staub. Auch Jean warf erleichtert die Chaps ab, denn er war nicht an die heißen, sonnengrellen Tage in dem unfruchtbaren Land gewöhnt. Er streckte sich der Länge nach neben einem Rinnsal aus. Das Wasser war kühl, aber es hatte einen beißenden Alkaligeschmack. Seit Jean aus Oregon gekommen war, hatte er kein klares, süßes Wasser mehr getrunken, und er vermisste das ebenso wie die schattigen Wälder, die er so geliebt hatte. Er war nahe daran, das wilde, endlose Arizona zu hassen.
Die Dämmerung senkte sich schon über das Land, als er seine Camp-Arbeiten beendet hatte, und die Coyoten stimmten ihr Abendlied an.
»Vielleicht lerne ich es noch, Arizona zu lieben«, überlegte er. »Doch jetzt habe ich Sehnsucht nach Wasserfällen und kühlen, grünen Wäldern. Aber Dad braucht mich, und so werde ich wohl hier bleiben.«
Er warf einige Zedernäste in das Lagerfeuer und zog den Brief seines Vaters aus der Tasche. Vielleicht begriff er mehr von dem seltsamen Inhalt, wenn er ihn noch einmal las. Vor zwei Monaten hatte ihn der Brief erreicht auf dem umständlichen Weg über Boten, Postkutschen, Eisenbahn und Flussboot. Die Bleistiftschrift auf dem Blatt eines alten Hauptbuches wäre auch kaum leserlicher gewesen, wenn sein Vater besser geschrieben hätte.
»Dads Handschrift war nie gut«, dachte er, »aber so zitterig habe ich sie noch nie gesehen.«
Mein Sohn Jean!
Komm heim. Hier ist Dein Zuhause, und hier wirst Du gebraucht. Als wir Oregon verließen, glaubten wir, Du würdest nicht lange dort Zurückbleiben. Aber das ist jetzt schon Jahre her, und ich werde alt. Du warst immer mein zuverlässiger Junge, obwohl Deine Wildheit besser in die Wälder passt. Du ähnelst Deiner Mutter, so wie Deine Brüder Bill und Guy mir. Du hast etwas von einem Indianer, und das brauche ich hier. Ich bin reich an Rindern und Pferden, und meine Weide ist gut. In der letzten Zeit haben wir Vieh verloren. Aber das ist nicht alles. Schafzüchter sind in den Tonto gekommen und grasen das Grass Valley entlang. Rinder- und Schafzüchter können in diesem Lande nicht nebeneinander leben. Wir haben böse Zeiten zu erwarten, denn es gibt noch andere Gründe zur Besorgnis. Doch darüber kann ich nur mit Dir selbst sprechen. Was du jetzt auch tun magst, gib es auf und komme hierher, damit Du im Frühling eintriffst. Ich bitte Dich, bringe Waffen und eine große Menge Patronen mit, aber verbirg sie unter Deiner Ausrüstung. Solltest Du auf dem Wege in das Tonto-Becken jemand begegnen, dann höre zu, aber sprich selbst wenig. Und noch eines, Sohn: lass Dich durch nichts in Oregon aufhalten. Ich nehme an, dass Du eine Liebste hast. Wenn es so ist, bring sie mit.
Alles Liebe von Deinem Vater
Gaston Isbel.
Jean dachte nach. Das Schreiben war eine große Überraschung für ihn - so wie er seinen Vater kannte. Auch auf dem wochenlangen Ritt hatte er die Bedeutung zwischen den Zeilen nicht erkennen können.
»Ja, Dad, du wirst alt«, dachte Jean, und dabei stieg ein Gefühl von Rührung und Traurigkeit in ihm auf. »Er muss weit über Sechzig sein, aber er hat nie alt ausgesehen. Er ist also jetzt reich, büßt Rinder ein und soll durch Schafzüchter von seiner Weide verdrängt werden. Etwas Viehdiebstahl hat Dad immer schon vertragen, aber von Schaf Züchtern lässt er sich nichts gefallen.«
Es hatte Jean Überwindung gekostet, sich von Oregon zu trennen. Auf der Schiffsreise nach San Diego, während der Postkutschenfahrt durch die Sierra Madres und während des langen Rittes hatte er gespürt, wie der stille, träumerische und glückliche Teil seines Wesens immer mehr zurückgedrängt wurde von jenem unbekannten, düsteren Ich, das auch zu ihm gehörte. Während er jetzt in seinen Decken lag, erfüllte ihn Bedauern über den Verlust, und zugleich lockte ihn die abenteuerliche Zukunft in dem wildromantischen Arizona.
Der starke Zedernduft vermischte sich mit dem Rauch des Lagerfeuers und hüllte allmählich seine Gedanken in einen Nebel des Vergessens.
In der Morgendämmerung rollte er sich aus den Decken und schlüpfte in die Stiefel, mit dem Eifer eines Mannes, der einer lockenden Zukunft näherkommen will. Der klirrende Frost erfrischte ihn ebenso wie an einem Morgen in Oregon - und doch war die Stimmung jetzt anders. Er fühlte sich berauscht wie von einem starken, süßen Wein. Pferd und Maultier wirkten munter und ausgeruht, und Jean stieg auf und ritt in die Zedern.
Endlich lagen die Meilen unfruchtbaren Landes hinter ihm. Er ritt auf einem wenig benützten Pfad, der nach den kärglichen Hinweisen, die er in der letzten Siedlung erhalten hatte, unmittelbar zu dem sogenannten Rim führte. Von dort sollte das Grass Valley unten im Tonto-Becken zu sehen sein. Allmählich stieg der Boden an, und die Vegetation deutete darauf hin, dass es immer höher hinaufging. Dürre Zedern wichen buschigeren Bäumen der gleichen Art, und dann erschienen hohe Laubbäume mit grünen Beeren. Auf den offenen Flächen wuchsen Sage und Gras üppiger als zuvor. Er ritt an Pinons vorüber und begrüßte schließlich die erste Fichte mit einem herzhaften Schlag gegen die braune, rissige Rinde. Noch war es eine winzige Zwergfichte, aber dann zeigten sich viele, und bald ragten sie allenthalben über den niederen Bäumen empor. Der Duft von Fichtennadeln vermischte sich mit anderen trockenen Gerüchen, die den Wind angenehm machten. Nach einer Stunde lag das Gebiet der Zedern hinter ihm, und er ritt in einen allmählich dichter werdenden Fichtenwald hinein. Jeans Blick suchte nach Eichhörnchen, Vögeln und Rehen, aber der Wald schien dürr und unbewohnt zu sein. Gegen Mittag erreichte er einen Weiher, der offenbar aus geschmolzenem Schnee bestand, und hier ließ er seine Tiere trinken. Er bemerkte Rehe und stieß auf große Vogelspuren, die anscheinend von wilden Turkeys stammten.
Der Weg teilte sich hier, und Jean hatte keine Ahnung, welche Richtung er einschlagen musste.
»Wird wohl nicht so wichtig sein«, dachte er und wollte aufsteigen. Sein Pferd spitzte die Ohren und blickte den Weg zurück. Dann hörte auch Jean den Huf schlag und sah gleich darauf den Reiter.
Jean tat so, als zöge er die Sattelgurte fest, während er über den Pferderücken hinweg den Reiter beobachtete. Aus der Entfernung wirkte der Mann wie alle Arizona-Leute, denen Jean bisher begegnet war. Er saß ausgezeichnet im Sattel und war groß und schlank. An seiner Kleidung fielen ein riesiger, schwarzer Sombrero und ein schmutziges, rotes Halstuch auf. Seine Weste war offen, und er trug keinen Rock.
Der Reiter näherte sich im Trab und hielt einige Schritte vor Jean an.
»Hallo, Fremder!«, sagte er mürrisch.
»Hallo!«, antwortete Jean, und er fühlte, dass diese Begegnung wichtig für ihn war. Noch nie hatten Augen ihn und seine Ausrüstung so scharf gemustert. Das Gesicht des Fremden war sonnenverbrannt, hager und hart. Er trug einen großen, sandfarbenen Schnurrbart, der seinen Mund verdeckte, und seine Augen waren hell und von einem durchdringenden Glanz. Der Mann schien an Jahren noch nicht alt zu sein. Als er abstieg, wirkte er sogar für einen Arizona-Mann sehr groß.
»Habe da hinten Ihre Spuren gesehen«, bemerkte er und ließ sein Pferd trinken. »Wohin?«
»Wahrscheinlich habe ich mich verirrt«, meinte Jean. »Das Land ist mir fremd.«
»Das habe ich an Ihren Spuren und Ihrem letzten Camp erkannt. Wohin wollten Sie, ehe Sie sich verirrten?«
Die Frage klang kühl, und Jean vermisste Freundlichkeit und Höflichkeit im Benehmen des Fremden.
»Ins Grass Valley«, sagte er. »Mein Name ist Isbel.«
Der Mann versorgte sein Pferd und schwang sich wieder in den Sattel.
»Ich wusste schon, dass Sie Jean Isbel sind. Jedermann im Tonto weiß, dass der alte Isbel nach seinem Sohn geschickt hat.«
»Warum fragen Sie dann?« forschte Jean freimütig.
»Ich wollte nur wissen, was Sie sagen.«
»So? Na gut! Aber mir ist es gleich, was Sie sagen.«
Ihre Blicke wurden hart, während sie einander maßen.
»Das ist klar.« Der Fremde sprach langsam, und ebenso ruhig waren die Bewegungen seiner Finger, als er sich eine Zigarette drehte. »Da Sie einer der Isbels sind, werde ich Ihnen etwas sagen, ob Sie es hören wollen oder nicht. Ich heiße Colter und bin einer der Schafzüchter, mit denen Gass Isbel aneinandergeraten ist.«
»Sehr erfreut. Sie zu sehen, Colter - und wer meinen Vater reizt, hat es auch mit mir zu tim.«
»Sicher! Sie wären sonst kein Isbel«, meinte Colter. »Merke schon, dass Sie noch nicht auf einen der Tonto-Jungs gestoßen sind. Ihr Alter hat übrigens wie ein Weib in Greaves Store geschwätzt. Er hat geprahlt, wie gut Sie kämpfen, schießen und Spuren verfolgen können. Er meint, dass Sie jeden Schafzüchter über den Rand des Tonto-Beckens zurückdrängen würden. Ich spreche mit Ihnen, weil ich Ihnen unseren Standpunkt klarmachen will. Wir werden weiterhin Schafe in das Grass Valley treiben.«
»Aha! Und wer ist wir?«
»Wir - die Schafleute auf dem Rim vom Black Butte bis zum Apachenland.«
»Colter, ich bin fremd in Arizona und weiß wenig über Rancher oder Schafzüchter. Es stimmt, dass mein Vater nach mir geschickt hat, und es mag auch sein, dass er geprahlt hat - das ist seine Art. Er wird langsam alt. Aber wenn sein Standpunkt den Schafzüchtern gegenüber richtig ist, dann werde ich seine Prahlerei wahrmachen.«
»Wir verstehen einander, und das ist eine große Hilfe. Sie haben mir einen Tip gegeben, nun geben Sie Ihrem Alten meinen Tip weiter.« Colter wandte sein Pferd nach links. »Ihr Weg führt nach Süden. Wenn Sie zum Rim kommen, sehen Sie unten im Becken eine kahle Stelle: das ist das Grass Valley.«
Als Colter davongeritten war, lehnte sich Jean gegen sein Pferd und dachte nach. Es war schwierig, gegen Colter gerecht zu sein, weniger wegen seiner Ansprüche als wegen der Feindseligkeit, die er ausstrahlte. In Colters Äußerem, seinem harten Gesicht und seiner gedehnten Sprechweise prägte sich ein Wesen aus, das Jean gewöhnlich mit unehrlichen Menschen in Verbindung brachte. Selbst ohne die Beeinflussung durch den Brief seines Vaters hätte ihn Colter unangenehm berührt.
Er stieg auf und trieb das Maultier zur rechten Weggabel. Den ganzen Nachmittag über ritt er, und am Abend erreichte er einen dichten Fichtenwald. An den geschützten Nordhängen bemerkte er noch Schneebänke. Er ritt immer höher, bis ihn eine parkartige Landschaft umgab; sie wurde von Schluchten durchzogen. Bald entdeckte er eine neue Baumgattung, die er für Tannen hielt. Die Rinde war dick, und die Zweige waren gleichmäßig am Stamm verteilt. Zartes, graugrünes Moos hing wie in Schleiern von den Ästen herab. Die Luft war hier nicht mehr so trocken, aber kälter. An einer geeigneten Stelle bereitete Jean sein Lager, und er schlug sein Bett diesmal vorsichtshalber etwas abseits vom Feuer unter den Bäumen auf. Bald fühlte er sich behaglich und verlor das Gefühl der Einsamkeit, das ihm unter dem unendlichen Himmel der Wüste zu schaffen gemacht hatte.
Die Lockrufe wilder Truthähne weckten ihn am Morgen. »Chag- a-lag, chag-a-lag - chag-a-lag.« Jean nahm sein Gewehr und versuchte den Standort der Hähne zu erkunden. Noch war es dunkel, und als die Dämmerung kam, waren die Vögel fort. Das Maultier war etwas abgewandert, und bis er es eingefangen und sein Frühstück bereitet hatte, war es ziemlich spät. Er ritt jetzt langsamer, weil er die Hast und Eile der letzten Wochen satt hatte. Nach dem langen Ritt unter der stechenden Sonne genoß er den kühlen Schatten des Waldes. Er wollte hier noch etwas verweilen, weil er sicher glaubte, den Rim noch an diesem Tage zu erreichen. Als er tiefer in den Wald eindrang, stieß er auf die Spuren von Truthähnen, Rehen und Bären. Die Zahl der Bärenspuren überraschte ihn. Dann witterte er plötzlich Schafe und traf auf eine breite Schaffährte. Anscheinend waren die Tiere erst gestern vorbeigekommen. Die Schafherde hatte eine breite, kahle Gasse ohne Gras und Blumen zurückgelassen. Wo Schafe grasten, zerstörten sie den Boden, und das brachte Jean gegen die Schafe auf.
Eine Stunde später erreichte er den Kamm eines langen, parkartigen Hanges, auf dem überall frisches Gras wuchs. Knorrige Eichen standen zwischen den Fichten, und ein Streifen Schnee blinkte wie ein Bachlauf unter den Bäumen.
Das melodische Klingen kleiner Glocken drang an Jeans Ohr, das Bää-Bää von Schafen und das schwache Blöken von Lämmern. Als er näherritt, rannte ihm ein Hund bellend entgegen. Jean witterte ein Lagerfeuer und sah bald eine blaue, gekräuselte Rauchwolke und ein spitzes Zelt. Jenseits der Eichen stieß er auf einen Mexikaner-Jungen mit einem Gewehr. Der Junge hatte ein dunkles, freundliches Gesicht und beantwortete Jeans Gruß mit einem Buenas Dias. Obwohl Jean nicht viel Spanisch verstand, erfuhr er durch einfache Fragen, dass der Junge nicht allein war und dass Lammzeit war.
Diese Tatsache erwies sich bald in sehr geräuschvoller Art. Der Wald hallte wider von unaufhörlichem Blöken. Auf dem Hang, zwischen den Bäumen, in der Lichtung - überall waren Schafe. Einige grasten, andere lagen widerkäuend auf der Erde, und andere wieder säugten winzige Lämmchen, die unsicher auf ihren Beinen standen. Das helle, klagende Blöken dieser Neugeborenen übertönte selbst das laute Bää-Bää ihrer Mütter.
Jean stieg ab und ging auf das Camp zu; er wollte von einem der älteren Mexikaner weitere Auskünfte.
»Hallo!«, rief er heiter, als er sich dem Zelt näherte. Doch er erhielt keine Antwort.
Von der Seite her überraschte ihn eine Stimme. »Guten Morgen, Fremder!«
Ein Mädchen trat hinter einer Fichte hervor. Sie trug ein Gewehr in der Hand, und ihr Gesicht war braungebrannt, obwohl sie keine Mexikanerin war.
»Entschuldigung«, stotterte Jean verwirrt. »Hatte nicht erwartet, ein Mädchen zu sehen. Ich habe mich verirrt und suche nach dem Rim. Ich dachte, ich könnte hier einen Hirten finden, der mir den Weg zeigt. Was der Junge sagt, kann ich nicht richtig verstehen.«
Während er sprach, schien die Spannung aus ihrem Gesicht zu weichen, und ein Ausdruck von Feindseligkeit schwand aus ihren Zügen.
»Ich zeige Ihnen den Weg gern.«
»Danke, Miss, jetzt ist mir wohler. Der Weg von San Diego her war heiß, und ich bin ziemlich müde.«
»San Diego! Sie kommen von der Küste?«
»Ja.«
Jean hatte zuvor den Hut gezogen und hielt ihn noch in der Hand. Das schien ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
»Setzen Sie Ihren Hut auf, Fremder. Ich kann mich an keinen Mann erinnern, der den Kopf vor mir entblößt hätte.« In ihr Lachen mischten sich Überraschung, Offenheit und eine leichte Bitterkeit.
Jean setzte sich mit dem Rücken an eine Fichte, und legte den Sombrero neben sich. Das Mädchen saß gegen einen Baumstamm gelehnt und hatte das Gewehr über die Knie gelegt. Sie schaute ihn offen und neugierig an. Der Blick ihrer großen, länglich geschnittenen Augen war klar und fest. In ihren amberbraunen Tiefen schien Nachdenklichkeit zu ruhen. Der Blick ging durch ihn hindurch, und er musste schließlich als erster zu Boden schauen. Dann bemerkte er ihren zerrissenen handgewebten Rock und darunter die braunen, nackten Fußgelenke, sowie abgetragene Mokassins, die ihre wohlgeformten Füße nicht verbergen konnten. Plötzlich zog sie die Füße an sich, und als Jean aufblickte, sah er die Röte auf ihren braunen Wangen.
»Ich denke, Sie sind aus Texas«, meinte Jean.
»Sicher.« Sie hatte die lässige Sprechweise des Südens, und ihre Stimme klang angenehm. »Wie haben Sie das erraten?«
»Einen Texaner kann man leicht erkennen. Dort, von wo ich herkomme, gab es viele Pioniere aus dem alten Lone-Star-Staat. Ich habe für einige gearbeitet, und ich höre ein Texasmädchen lieber sprechen als jeden anderen.«
»Haben Sie viele Texasmädchen gekannt?«
»Wahrscheinlich ziemlich viele.«
»Sind Sie mit ihnen gegangen?«
»Mit ihnen gegangen? Sie meinen, ob ich näher bekannt wurde? Ich denke - ein wenig.« Jean lachte. »Manchmal - am Sonntag bei einem Ball - im Freien oder bei einem Ritt«.
»Das erklärt alles«, sagte sie wehmütig.
»Was?«
»Daß Sie ein Gentleman sind«, erwiderte sie fast heftig. »Oh, ich habe das nicht vergessen. Ich hatte Freunde, als wir noch in Texas wohnten - vor drei Jahren. Es scheint aber viel länger her zu sein. Drei elende Jahre in diesem verdammten Land.«
Dann biss sie sich auf die Lippen, als wollte sie einem Fremden nicht mehr eingestehen. Dabei fiel Jean ihr Mund auf. Er war schön geschwungen, aber Trauer und Bitterkeit ließen sich nicht verbergen. Das braune Mädchengesicht war jung und voller Leidenschaft. Es besaß eine Macht, die Jean in ihren Bann zog, und er fühlte, dass seine Anteilnahme wuchs.
»Ich glaube, Sie schmeicheln mir«, sagte er in der Hoffnung, sie wieder in frohe Laune zu versetzen. »Ich bin nur ein Jäger, Fischer, Holzfäller und Spurenleser. Ich habe nicht genug Erziehung - nicht annähernd so viel, wie nötig wäre für die Gesellschaft netter Mädchen wie Sie.«
»Bin ich nett?«, fragte sie schnell.
»Das sind Sie bestimmt«, erwiderte er lächelnd.
»In diesen Lumpen?«, fragte sie in einer plötzlichen Aufwallung von Leidenschaft, die ihn überraschte. »Sehen Sie sich die Löcher an!« Sie deutete auf die Risse im Ärmel ihrer Hirschlederbluse. »Ich würde nähen, wenn ich etwas zum Nähen hätte! Mein Rock - schauen Sie - nur ein schmutziger Fetzen - und ich habe nur noch einen. Sehen Sie!« Sie war wieder rot geworden, und eine lange aufgestaute leidenschaftliche Bitterkeit schien alle Dämme von Scham und Zurückhaltung zu brechen. Sie hob den Rock bis fast zu den Knien hoch. »Keine Strümpfe! Keine Schuhe! Wie kann ein Mädchen nett sein, wenn es keine anständigen Frauenkleider tragen darf?«
»Ich bitte Sie um Verzeihung, weil ich Sie so in Erregung brachte«, begann Jean. »Aber lassen Sie mich etwas über Frauenkleider richtigstellen. Die meisten Frauen tragen nette Kleider und meinen, das mache sie hübscher. Falsch. Es ist von einem Mädchen vielleicht zu viel verlangt, auch ohne schöne Kleider glücklich zu sein. Aber sicher ist, dass Sie auch so auf einen Mann anziehend wirken und für manche vielleicht noch mehr.«
»Sie müssen diese Szene vergessen«, erwiderte sie ruhiger. »Das war nicht schön. Und ich will nicht, dass jemand besser von mir denkt, als ich es verdiene. Meine Mutter ist in Texas gestorben, und ich lebe seither unter rauen Männern. Nachdem ich Ihnen begegnet bin, weiß ich wieder, was für eine wilde Horde es ist.«
Jean bezähmte seine Neugierde und versuchte das aufkeimende Gefühl zu unterdrücken; er hatte Mitleid mit ihr, und sie gefiel ihm.
»Sind Sie eine Schafhirtin?«, fragte er.
»Das bin ich auch hin und wieder. Mein Vater lebt dort unten in einem Canyon - er ist Schafzüchter. Neulich wurden Hirten angeschossen, und da wir knapp an Leuten sind, musste ich einspringen. Aber ich liebe diese Arbeit - den Wald - den Rim Rock und das ganze Tonto-Becken. Wenn es nur darum ginge, wäre ich glücklich.«
»Hirten angeschossen!«, meinte Jean nachdenklich. »Von wem - und aus welchem Grund?«
»Zwischen den Ranchern unten im Becken und den Schafzüchtern oben auf dem Rim braut sich etwas zusammen. Dad meint, bald wird die Hölle los sein. Ich sagte ihm, mir wäre es am liebsten, die Rinderleute würden ihn nach Texas zurückjagen!«
»Dann - stehen Sie auf Seiten der Rancher?«, fragte er und bemühte sich, nur beiläufiges Interesse zu zeigen.
»Nein - ich werde immer auf der Seite meines Vaters stehen. Aber ich muss zugeben, dass die Rancher im Recht zu sein scheinen.«
»Weshalb?«
»Weil es überall Gras gibt. Es hat keinen Sinn, dass Schafzüchter einen Rancher umzingeln und seine Weide kahlfressen lassen. So begann der Kampf, und der Himmel allein weiß, wie er enden wird. Denn fast alle Männer hier sind aus Texas.«
»Davon hörte ich - und auch davon, dass die meisten von ihnen aus Texas verjagt wurden. Stimmt das?«
»Ich glaube«, erwiderte sie ernst. »Aber es wäre unklug, Fremder, wenn Sie das irgendwo erwähnten. Mein Vater wurde beispielsweise nicht aus Texas verjagt. Allerdings weiß ich nicht, weshalb er hierher kam. Er hat wieder Vieh, aber er ist nicht so reich, wie wir daheim waren.«
»Werden Sie immer hier bleiben?«, fragte Jean plötzlich.
»Das wäre mein Grab«, erwiderte sie düster. »Aber was nützt das Grübeln. Menschen bleiben irgendwo, bis sie fortgetrieben werden. Man kann nie wissen... Nun, Fremder, ich halte Sie nur auf.«
Sie wirkte plötzlich mürrisch, und Jean ging zu seinem Pferd. Wenn das Mädchen nicht mehr sprechen wollte, so würde er ihr nicht weiter lästig fallen. Sein Maultier hatte sich zu den Schafen gesellt, und er trieb es zurück. Dann führte er sein Pferd zu dem Mädchen hin. Als sie jetzt stand, wirkte sie größer; sie sah geschmeidig und kräftig aus und passte gut in diese Umgebung. Beim Abschied zögerte Jean.
»Wo liegt der Rim?«, fragte er.
»Im Süden - nur eine Meile von hier. Ich werde mit Ihnen gehen. Sie wollen wohl in das Grass Valley?«
»Ja, ich habe dort Verwandte.« Er fürchtete, ihre nächste Frage würde seinem Namen gelten. Aber sie nahm nur ihr Gewehr auf und wandte sich ab.
»Wenn Sie laufen, werde ich auch nicht reiten.«
Das Mädchen hatte den freien, elastischen Schritt der Gebirgsbewohner. Sie reichte ihm fast bis zur Schulter, und wenn er zur Seite blickte, hatte er das hellschimmernde, dichte, braune Haar vor Augen. Sie trug es in unordentliche Zöpfe geflochten, deren Fülle mit einem Lederriemen gebändigt wurde. Alles in ihrem Äußeren deutete auf Armut hin.
Jean konnte sich nicht entschließen weiterzusprechen. Er war zufrieden damit, nur neben ihr zu gehen und ihr schöngezeichnetes Profil zu bewundern.
Sie versuchte mehrmals ein Gespräch zu beginnen, aber Jean schwieg beharrlich. Dann wusste er endlich, was er sagen wollte, und er meinte entschlossen:
»Das Abenteuer gefällt mir.«
»Welches Abenteuer? Mir im Walde zu begegnen?« Sie lachte. »Dann müssen Sie aber wenig Abenteuer erlebt haben, Fremder.«
»Mädchen, wir sind zwar Fremde, aber was macht das. Wir sind einander begegnet, und das hat etwas für mich zu bedeuten. Ich habe Mädchen monatelang gekannt, ohne so etwas zu empfinden. Ich weiß nicht, wer Sie sind, und es ist mir auch gleich. Sie haben mir jedenfalls verraten, dass Sie einsam und nicht glücklich sind. Wenn ich Sie also nicht meinetwegen Wiedersehen möchte, dann schon Ihretwegen. Manches, was Sie sagten, werde ich nicht so bald vergessen. Ich habe eine Schwester, und da Sie keinen Bruder haben, denke ich...«