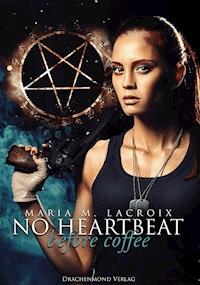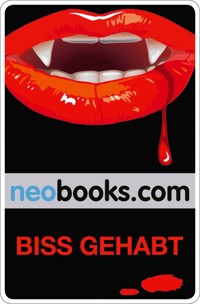
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Vampirjägerin mit meinem dunklen Geheimnis…Ein dämonischer Barkeeper in der Hölle…Ein Vampir, der kein Blut sehen kann, eine nymphomanische Elbenfrau und ein Werwolf mit Angst vor Katzen auf Mörderjagd: Drei Fantastische Kurzromane, in denen es um ganz besondere Leckerbissen geht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Maria Magdalena Lacroix / Tonja Züllig / Nathan Jaeger
Biss gehabt
Drei fantastische Leckerbissen
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Roy Murpers war schon immer ein Blödmann gewesen; seitdem er aber den Prototyp des Antiwerwolfmittels entwickelt hatte, war er noch unausstehlicher. Während ich ihm in der Laborküche schräg gegenübersaß und an meinem zweiten Kaffee des Morgens nippte, brüstete er sich mit seiner Erfindung. In der Lederjacke und der Used-Look-Jeans hätte er fast cool aussehen können – wenn er nicht so ein Schleimbolzen gewesen wäre. Das mit zu viel Gel zu Stacheln gestylte blonde Haar und seine niedlichen Pausbacken gaben ihm das Flair eines Schwiegermutter-Lieblings. Er sah aus wie einer dieser Football spielenden Klassenbesten aus einem Teenie-Film. Die Sympathie beruhte wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit; aber hier lebte man in einer friedlichen Koexistenz.
Wir waren Teil einer mehr oder weniger geheimen Forschungseinrichtung, die sich mit der Untersuchung und Vernichtung paranormaler Aktivitäten und Wesen beschäftigte. Die Öffentlichkeit wusste zwar von unserer Existenz, wurde jedoch nicht darüber unterrichtet, was genau wir hier trieben. Offiziell hieß die Abteilung, in der ich arbeitete, RIPA – nein, das stand nicht für »Rest in Peace, assholes«, sondern für »Research and Identification of Paranormal activities« – was die Typen der anderen Dezernate abschätzig wie Reaper, also »Sensenmann« aussprachen. Die Bevölkerung hatte uns liebevoll den Spitznamen Van Helsings verpasst. Jap, wir waren beliebt und nope, niemandem suspekt!
Nachdem ich den letzten Tropfen meines Kaffees getrunken hatte und meine Tasse abspülte, ließ sich Roy weiter unermüdlich verbal auf die Schultern klopfen. Mein Verschwinden aus der Laborküche bemerkte wie üblich niemand.
Silbernitratlösung in Glaser Safety Ammunition füllen – darauf hätte jeder Depp kommen können. War vor Roy aber niemand. Nun galt es, die Munition am lebenden Objekt zu testen, und das war das eigentlich gefährliche Unterfangen. Erst dann konnte man sagen, ob unser Department einen Erfolg verbuchen und Roy als Erstautor ein Paper veröffentlichen konnte, oder nicht. Im Falle einer Veröffentlichung wäre die Finanzierung unseres Departments für mindestens zwei weitere Jahre gesichert. Natürlich würde nicht Roy die Tests durchführen – er war Postdoc, kein Kämpfer –, sondern jemand, der die Feldforschung am Lebendobjekt betrieb und es anschließend eliminierte. Erst letzte Woche war einer von uns beerdigt worden. Ich hatte ihn nicht gekannt, war aber trotzdem auf die Beerdigung gegangen. Man zollte sich gegenseitig Respekt, wenn ein Kämpfer während eines Einsatzes fiel. Ein ungeschriebenes Gesetz.
Roy gehörte zu den Werwölflern, das hieß, er untersuchte und entwickelte Möglichkeiten zur Bekämpfung der Mondsüchtigen oder – politisch korrekt – Lykanthropen.
Ich war im Vampir-Team. Einige Laborkollegen der anderen Gruppen zogen mich damit auf, dass ich mit meiner hellen Haut und der scharlachroten Lockenmähne der perfekte Lockvogel war. Vielleicht war das wirklich der Grund für meine hohe Tötungsquote, vielleicht auch nicht. Fakt ist jedoch, dass ich bisher siebzehn dieser Biester zur Strecke gebracht hatte. Nur einer war mir entkommen, weil sich mein Laborkollege hatte profilieren wollen und entgegen der Absprache allein das Versteck des Vampirs aufgesucht hatte. Greg hatte mit seinem Leben dafür gezahlt.
Vergesst das Bild des anmutigen, betörenden Vampirs, das lange Zeit in Filmen und Romanen vermittelt wurde. Eine naive, romantisierende Vorstellung, die rein gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Als eine der wenigen, die Begegnungen mit diesen Blutsaugern überlebt hat, weiß ich, wovon ich spreche. An denen ist nichts charmant, romantisch oder betörend. Gar nichts!
Kein Mensch wusste, weshalb Vampire, Werwölfe und die restlichen Viecher vor ungefähr einem Jahrzehnt aus der Welt des Aberglaubens wieder zu uns zurückgekrochen waren. Inzwischen wurde angenommen, dass es sie tatsächlich schon immer gegeben hatte. Dazu brauchte man nur die Berichte aus dem Mittelalter oder dem 18. Jahrhundert zu lesen. Nur waren sie im Zuge der Aufklärung und des Durchbruchs der Wissenschaft als dummer Aberglauben abgetan und Überfälle die letzten zweihundert Jahre auf Unfälle, Tiere oder geisteskranke Menschen geschoben worden. Doch die verbesserte Technologie hatte uns gezeigt, dass die Menschen von damals so doof nicht waren und es sich mitnichten um Aberglauben handelte. Welch eine Ironie. Spätestens, nachdem eine der Überwachungskameras in London gefilmt hatte, wie ein Werwolf einen Menschen frisst, war die Zeit gekommen, unsere arrogante Haltung zu überdenken.
»He, Diana«, hörte ich Meta hinter mir im Gang rufen, während ich in den Lichtsensor starrte, um meine Identität per Netzhaut-Scan überprüfen zu lassen. »Warte auf mich!« Bis sich die Schleuse öffnete, hatte sie mich eingeholt. Auf der anderen Seite wartete ich darauf, dass sie den Durchgang ebenfalls passieren durfte. Meta war eine PhD-Studentin der Vampir-Gruppe und das, was einer Freundin am nächsten kam.
»Hast du von dem Überfall gestern Nacht gehört?«, fragte sie, noch völlig außer Atem von der kurzen Strecke.
Ich warf ihr einen skeptischen Seitenblick zu. »Du solltest mal mit mir zusammen trainieren, statt immer nur im Labor zu hocken. Ich könnte dir ein Programm zusammenstellen.«
»Ach was.« Sie winkte wie üblich ab. »Sport ist Mord. Also?«
»Nein, hab ich nicht.« Statt davon zu erzählen, öffnete Meta ihre Umhängetasche und drückte mir eine Mappe in die Hand. Während wir, wie jeden Montag, zum Konferenzraum liefen, um mit den anderen die Wochenplanung zu besprechen, überflog ich rasch den Bericht und warf einen Blick auf die Fotos.
»Shit«, murmelte ich. Am östlichen Stadtrand war eine Gruppe Menschen überfallen worden, die sich im Park zum Grillen getroffen hatten. Innerhalb der letzten sechs Wochen der vierte Überfall mit ähnlichem Muster. Das hieß, dass wir nun eindeutig von einer Serie sprechen konnten. Allerdings hatten sich die Überfälle bisher außerhalb von Seattle ereignet, das war der erste innerhalb der Stadt. Das Monster wurde offenbar selbstbewusster, zudem verkürzten sich die Abstände zwischen den Attacken. Anhand der Fotos nahm ich an, dass es sich entweder um einen besonders bösartigen Vampir oder aber um einen Kuss handelte.
Werwölfe formten Rudel, bei Ghulen nannte man es eine Horde, und Vampire waren in Küssen unterwegs. Zombies bildeten keine Sozialverbände – die waren dafür zu doof. Wenn sie mal durch die Gegend schlurften, dann allein. Fragt mich nicht, wer den bescheuerten Einfall hatte, einen Haufen Vampire als Kuss zu definieren.
Im Bericht stand, dass nur Überreste der Menschen gefunden worden waren. Aufgerissene Kehlen, abgerissene Köpfe, zerfetzte Handgelenke und Schenkel. Damit keine Panik ausbrach, ließen die Behörden die Leichenteile im Morgengrauen fortschaffen – gleich nachdem die Meldung bei ihnen eingegangen war. Sie lagen nun in der Pathologie bei uns im Keller. Die Teile konnten drei Frauen, zwei Männern und … einem Kind zugeordnet werden. Doppel-Shit. In meinem Hals bildete sich ein Kloß. Wenn Kinder umkamen, war die Tragödie zehnmal schlimmer. Kinder hatten nicht zu sterben, verdammt!
Lange würden die Einzelheiten nicht geheim bleiben können. Früher oder später sickerte mit Sicherheit etwas durch, und bis dahin hatten wir gefälligst Ergebnisse zu liefern. Vielleicht sollte ich irgendwann nach Feierabend selbst zum Tatort fahren und mich dort umsehen? Die Typen vom Geheimdienst kannten sich nicht aus und übersahen oft wichtige Hinweise. Heute jedoch nicht mehr, denn nach der Arbeit hatte ich keine Zeit. Und nach Einbruch der Dunkelheit hinzugehen kam ohnehin nicht in Frage; das wäre glatter Selbstmord.
»Und?«, fragte Meta, die inzwischen wieder Atem geholt hatte. »Was meinst du? Die Geheimdienst-Typen tippen auf Werwölfe. Das wär doch ideal, um Roys neuestes Spielzeug …«
»Blödsinn!«, unterbrach ich sie. Zum Glück kannte sie mich gut genug, um das nicht persönlich zu nehmen. Es gab wohl Gründe, weshalb ich nicht sehr viele Freunde hatte. »Das war hundertprozentig ein Vampir. Oder sogar mehrere. Verdammt.« Missmutig gab ich ihr die Mappe zurück.
»Das ist eine interessante Theorie, aber wir sollten Werwölfe nicht ausschließen, Di, weil …«
»Keine Wölfe, Meta. Vampire.«
»Du gehst sehr unwissenschaftlich vor, außerdem töten Vampire sauberer. Eine kleine Bisswunde am Hals, mehr nicht.« Sie hatte ihr Wissen aus Büchern.
Bei den Weißlicht-Inkubatoren blieb ich stehen und funkelte sie genervt an. »Wir sind diejenigen, die da rausgehen, klar? Und ich habe keine Lust, diese Silbergeschosse auf einen dieser Blutsauger abzufeuern. Der fängt die Kugeln mit den Zähnen und macht sich aus dem Silber ´ne Kette. Wegen so einem Fehler hat seit letzter Woche das Team für die Untoten einen Kämpfer weniger.«
»Deshalb meine ich doch, dass wir jegliche Theorie in Erwägung ziehen sollten.« Sie senkte ihren Blick beschämt zu Boden. »Konnte doch außerdem keiner wissen, dass es Ghule und keine Zombies waren. Die unterscheiden sich schließlich kaum.«
»Stimmt. Nur darin, dass Ghule schnell, stark und in Horden und Zombies langsam und allein unterwegs sind.« Grundsätzlich war jeder der Kämpfer für alles ausgebildet, aber jeder von uns hatte sich in seinem Gebiet spezialisiert. Vor allem die Kämpfer des Wolf- und die des Vampir-Teams. Das Untoten-Team hatte seinen Mann letzte Woche mit der falschen Ausrüstung und noch dazu allein ausgesandt. Sie waren sich ihrer Sache zu sicher gewesen. Ein unverzeihlicher Fehler, der ihn das Leben gekostet hatte. Man musste die Hinweise aus der Bevölkerung immer überprüfen, statt ihnen blind zu vertrauen. Es war nicht Metas Schuld, nichts von alledem. Und für mein anderes, kleines Problemchen konnte sie erst recht nichts. Wie hatte ich nur meine Vorräte zur Neige gehen lassen können? Hoffentlich hatte Jamie heute Abend Zeit.
Seufzend rieb ich mir das Gesicht. »Tut mir leid«, sagte ich leise. »Ich bin wegen allem noch etwas angespannt. Erst Greg vor zwei Monaten und nun der Jäger aus dem Untoten-Team letzte Woche …«
»Schon okay«, erwiderte sie und lächelte. Doch das Lächeln erreichte nicht ihre Augen. In gespannter Stille setzten wir den Weg bis zum Ende des Flures fort. Dort angekommen holte ich tief Luft und wollte etwas sagen, doch ich war noch nie sehr gut darin gewesen, die richtigen Worte zu finden. Daher schloss ich den Mund wieder und öffnete die Tür zum Konferenzzimmer. Die anderen warteten bereits auf uns.
»Ah. Meta, Diana«, grüßte Mac. »Dann sind wir ja vollzählig.« Unsere Einheit bestand, als kleinste von allen, aus nur fünf Leuten. Mac, Faust, Ivy, Meta und mir. Faust war in Ordnung. Ich an seiner Stelle hätte meine Eltern für diesen Vornamen verklagt. Mac – eigentlich Arthur MacDougall – war der Leiter unseres Teams und mit seinen neunundvierzig Jahren recht gutaussehend. Sein militärisch kurz geschnittenes Haar war bis auf zwei graue Rallyestreifen über den Ohren noch dunkel, das markante Gesicht meist ernst. Er war derjenige am Institut mit der höchsten Tötungsquote. Seitdem er die Operationen jedoch nur noch aus dem Hintergrund steuerte, war ich ziemlich zuversichtlich, ihn irgendwann einzuholen. Seit Gregs Tod war ich zudem die einzige Kämpferin des Teams. Bisher hatten wir keinen Ersatz für ihn gefunden, und das Wissen der anderen Kämpfer reichte bestenfalls aus, um mir zu assistieren. Wenn es hart auf hart käme, würde Mac wieder einspringen. Er erwartete von seinen Leuten nichts, was er nicht selbst bereit war zu tun. Mac hasste Vampire fast ebenso inbrünstig wie ich.
»Wer ist denn das?«, fragte ich und deutete mit dem Kinn auf ein zitterndes Etwas, das meinen Platz besetzte. Meta ließ sich auf ihren Stuhl nieder.
»Auch dir einen wunderschönen guten Morgen, Diana«, sagte Mac freundlich. Statt auf seine Begrüßung einzugehen, warf ich ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Seine Miene blieb weiterhin freundlich. »Das ist ein junger Mann, den du lieben wirst. Sei also nett zu ihm.«
Mein Blick schwenkte zu dem verängstigten Bündel, dann zurück zu Mac. Ich verschränkte meine Arme vor der Brust und beobachtete ihn durch zu Schlitzen verengte Augen, während er sich in seinen Sessel lümmelte und mich selbstzufrieden angrinste. Was zum Teufel heckte der alte Kauz jetzt schon wieder aus?
»Das ist Benjamin Wood«, fuhr Mac nach einer kunstvoll inszenierten Pause fort, »und er ist ein Augenzeuge des Gemetzels von letzter Nacht.«
»Oh«, erwiderte ich überrascht. Mir war nicht entgangen, dass Benjamin Wood bei dem Wort Gemetzel zusammengezuckt war. Typisch Mac. Ich gehörte auch nicht zu den sensibelsten Leuten, aber so viel Feingefühl hatte ich gerade noch. Nachdem ich mir einen Stuhl aus einer Ecke des Zimmers genommen und mich zwischen Mac und Meta gesetzt hatte, bemühte ich mich um eine entspannte Haltung. Der Junge hatte genug durchgemacht, es gab keinen Grund, ihn weiter zu verschrecken. Anhand seiner Größe und Statur schätzte ich ihn auf mein Alter, Mitte Zwanzig. Er war ziemlich groß und hatte breite Schultern, wirkte jedoch etwas schlaksig. Dann sah ich in sein Gesicht und zog wieder ein paar Jahre ab. Es war noch weich und glatt, als ob sich die Konturen, die er einmal bekommen würde, erst herausbilden müssten. Neunzehn oder zwanzig, jedenfalls noch nicht volljährig.
»Benjamin …«, begann ich sanft. Er zuckte erneut zusammen. »Darf ich Benjamin sagen?«
Bei seinem ersten Versuch, eine Antwort zu geben, brach seine Stimme. Er räusperte sich.
»Ben«, flüsterte er schließlich, »Ben ist okay.«
»In Ordnung, Ben. Erzähl bitte alles, woran du dich erinnern kannst. Waren es ein oder mehrere Vampire?«
»Vampire?«, fragte Faust. Er lehnte sich über den Tisch und zog die vor Mac liegende Mappe zu sich. »Stand das da irgendwo drin?«
»Nein. Lass sie bitte zu, Faust«, entgegnete ich – auf die Mappe und gleich darauf auf Ben deutend. Faust wirkte über meine Zurechtweisung nicht sehr erfreut, kam meiner Bitte aber nach.
»Und woher willst du so genau wissen, dass es Vampire waren?«, fragte er. »Könnte doch alles Mögliche gewesen sein.« Als Wissenschaftler musste er alles gegeneinander abwägen, ich nahm es ihm nicht übel. Gerade als ich tief Luft holte, räusperte sich Mac laut. Vor dem Zeugen streiten kam nicht sehr professionell, daher schwiegen wir fürs Erste und blickten erwartungsvoll zu Ben.
»Ungeheuer …«, sagte er dann leise, »es war ein Ungeheuer. Ein Monster …«
Also doch nur einer, registrierte ich im Hinterkopf.
Ben schluckte schwer, und seine Augen weiteten sich, bis zu viel von dem Weiß der Augäpfel zu sehen war. Statt uns anzusehen, starrte er ins Leere. Seine Hände verkrampften sich unter dem Tisch zu Fäusten, und sein Knie wippte nervös. »Er war groß und stark. Ist einfach über uns hergefallen … über uns hergefallen. Wie ein Tier!« Die letzten zwei Sätze flüsterte er hysterisch.
Ich stand auf, holte an unserem Wasserspender ein Glas Wasser und stellte es vor ihm auf den Tisch. Wir hatten Hochsommer, meine Haare klebten mir im Nacken und meine Jeans an den Oberschenkeln. Ich zerging fast, während Ben so aussah, als würde er furchtbar frieren. Irgendwer murmelte, dass die Beschreibung perfekt auf Werwölfe passe.
»Okay«, sagte ich, nahm meinen Stuhl und setzte mich mit der Lehne nach vorne rittlings vor Ben. »Versuche bitte, dich an Einzelheiten zu erinnern. Wie sah er oder sie aus?«
Er griff nach dem Glas, das vor ihm auf dem Tisch stand, und verschüttete die Hälfte. Dann umschloss er es zitternd mit beiden Händen, trank einen Schluck und beruhigte sich etwas.
»Er«, sagte er schließlich. »Er hatte keine Haare …« Womit den Verfechtern der Werwolf-Theorie das Hauptargument genommen worden war. So sehr es mich reizte, den anderen einen Seht-ihr-Blick zuzuwerfen, konzentrierte ich mich weiter auf Ben. Hier ging es um Wichtigeres als meine persönliche Genugtuung. Nun sah er mir direkt in die Augen, und in seinen spiegelte sich der Schrecken der letzten Nacht. »Und er hatte eine ganz weiße Haut. Nicht wie du oder er …« Mit dem Kopf deutete er zu Faust, der auch sehr hellhäutig und rothaarig war. Faust hat jedoch, anders als ich, karottenrotes Haar, Sommersprossen, und hellblaue Augen. Meine Haut ist hell, ohne Sommersprossen und meine Augen sind dunkelbraun, nahezu schwarz. »... sondern richtig weiß, so wie … wie …«
»Waschmittel?«
»Genau!«, erwiderte er aufgeregt. »Woher …?« Um seine Frage zu beantworten, zog ich den Ausschnitt meines T-Shirts ein wenig hinunter und zeigte ihm mein deformiertes Schlüsselbein und die riesige, wulstige Narbe. Ich sah, wie sich seine Augen weiteten und er schwer atmete, doch er verlor nicht wieder die Nerven.
»Als ich vierzehn war, haben sich mein großer Bruder und ich mit Freunden an Halloween auf einem Friedhof getroffen. Wir fanden es cool. Dann wurden wir angegriffen«, erklärte ich. »Die Kerle trugen keine Kostüme, die sahen wirklich so aus. Wie Max Schreck in Nosferatu. Einer von ihnen machte sich über mich her. Bei dem Versuch, mich gegen ihn zu wehren, verfehlte der Kerl meinen Hals und verbiss sich in mein Schlüsselbein. Er hat mir den Knochen gebrochen und, wie du siehst, ziemlich übel an mir gerissen. Mac hat mich gerettet.« Das war nun zwölf Jahre her. Dass ich den Überfall überlebt hatte, grenzte nahezu an ein Wunder. Außer mir überlebte noch ein anderes Mädchen. Mein Bruder starb in jener Nacht. Das andere Mädchen beging Jahre später Selbstmord.
Mac hatte mich direkt nach dem Angriff regelmäßig im Krankenhaus besucht. Meine Eltern waren dazu nicht in der Lage gewesen. Die Trauer über den Tod meines Bruders schien für sie größer gewesen zu sein als die Freude über mein Überleben. So kam es, dass ich immer öfters bei Mac auf der Türschwelle stand. Irgendwann wurde ihm wohl klar, dass er mich so einfach nicht mehr loswerden würde. Er nahm mich unter seine Fittiche und trainierte mich. Es wurde keine »Vater-Tochter«-Sache daraus. Dafür war ich zu alt und Mac zu sehr Mac. Aber es war das Beste, das mir passieren konnte.
»Mach dir keine Sorgen, Ben«, fuhr ich fort. »Du bist hier jetzt in Sicherheit.«
Wir brachten Ben in das Krankenzimmer des Instituts und spritzten ihm ein Beruhigungsmittel, dann gingen wir zurück und besprachen alles Weitere.
»Wieso geht eigentlich jeder davon aus, dass diese Fälle zusammenhängen?«, fragte Ivy, die sich mit einem Blatt Papier frische Luft zufächerte. Auch mir war heiß. Der Schweiß rann mir die Wirbelsäule hinab. Offenbar konnten die Klimaanlagen nicht mehr mit der Hitze mithalten. »Bisher kann ich jedenfalls noch keinen Zusammenhang erkennen, außer, dass die Opfer außergewöhnlich brutal getötet wurden. Wir tappen weiterhin im Dunklen und sollten die Möglichkeit eines oder mehrerer Trittbrettfahrer in Erwägung ziehen. Manchmal entwickelt sich eine Eigendynamik aus so etwas.« Ich musste ihr zustimmen. In der Tat war es so, dass die Behörden nur aufgrund der Brutalität von einem übernatürlichen Täter ausgingen und uns deshalb eingeschaltet hatten. Ein Mensch hätte nicht die Kraft, einen anderen mit bloßen Händen auseinanderzureißen. Die Opfer schienen jedoch zufällig gewählt. Beim ersten Fall hatte es sich um einen Tankstellenwart gehandelt. In Stücke gerissen. Das Auto, das vollgetankt bei einer der Zapfsäulen gestanden hatte, gehörte einer Frau, die Tage später mit aufgerissener Kehle im Wald gefunden worden war. Bibliothekarin. Bei der Gruppe von letzter Nacht waren es Studenten gewesen. Wer auch immer für die Morde verantwortlich war, schien sich nicht um das Geschlecht, die soziale Stellung, das Alter oder den Bildungsstand zu kümmern. Dennoch war eine bestimmte Vorgehensweise zu erkennen, die mehr strategisches Denken erforderte, als ein wildes, hungriges Tier es hätte aufbringen können.
»Ich habe möglicherweise einen Zusammenhang gefunden«, sagte Mac, während er konzentriert die Akte studierte. Gleichzeitig hob er beschwichtigend die Hand, um unsere Hoffnung zu mildern. »Ist aber nur eine Vermutung.«
»Schieß los«, sagte ich.
»Bei jedem der Fälle war eine rothaarige Frau unter den Opfern. Auffällig daran ist, dass die Leiche immer Tage später und vom Tatort entfernt aufgefunden wurde. So, als wolle der Täter erst ein wenig mit ihr spielen, bevor er genug hat und sie entsorgt.«
Auf einmal waren alle Augen auf mich gerichtet. Niemand wagte, es laut auszusprechen, doch falls Macs Theorie stimmte, wäre ich der geeignete Lockvogel. Gefährlich, wenn es sich tatsächlich um einen Einzeltäter handelte. Bei einer Gruppe hätten wir von einem wilden, unorganisierten Haufen ausgehen können. Wenn aber ein Einzelner dahintersteckte, war er extrem grausam.
»Und wie erklärst du dir die anderen Opfer, wenn er es tatsächlich nur auf rothaarige Frauen abgesehen hat?«, fragte ich.
»Kollateralschaden«, antwortete er ungerührt. Daraufhin wurde es still im Raum. Der einzige Laut war das Summen der Klimaanlage.
»Beim letzten Überfall war aber keine Rothaarige dabei«, bemerkte Faust schließlich und durchbrach das kollektive Schweigen.
»Einem weiblichen Opfer fehlt der Kopf«, erwiderte Mac. »Und bisher hat man ihn nicht finden können. Ratet, welche Haarfarbe sie gehabt hat. Aus diesem Grund bin ich auf diese Theorie gekommen.«
»Grundgütiger«, sagte Faust. Ich stimmte ihm zu. Leider hatte ich Ben nicht fragen können, wie er es geschafft hatte, zu entkommen. Sobald es ihm besser ging, würde ich das nachholen.
Unsere übrigen Projekte legten wir vorerst auf Eis. Die Lösung dieses Falles hatte höchste Priorität.
Während die anderen den Raum verließen, ging ich noch mal kurz zu Mac. »Benjamin braucht psychologische Betreuung.«
Mac hörte auf, die Akten zu ordnen, und sah mich mit einem warmen Lächeln an. »Ich weiß«, erwiderte er. »Ich werde mich darum kümmern.«
»Gut.« Ich nickte ihm zu und gesellte mich zu Meta, die vor der Tür auf mich wartete. Während sie ins Labor abbog, ging ich den Gang ein Stück weiter hinunter zum Waffen- und Trainingsraum. Für die nächsten Wochen stellte ich mir, zusätzlich zu meinem normalen Fitness- und Waffenerprobungsprogramm, einen regelrechten Kriegsplan aus Training und Schießübungen zusammen. Es würde die Hölle werden, doch für den bevorstehenden Einsatz konnte ich mich nicht genug vorbereiten. Gegen Mittag holte Meta mich zum Essen ab. Ich aß eine Kleinigkeit und ging gleich darauf in den Trainingsraum zurück. Faust rief mir etwas wie: »Davon werden sie auch nicht wieder lebendig, Di«, hinterher.
Ich konnte jedoch nur an das Kind denken, das bei uns im Keller lag, und dieser Gedanke stachelte mich an. Seit einiger Zeit bereitete mir das Training erhebliche Mühen, ich erschöpfte schnell und fühlte mich ausgepowert. Ich musste mich doppelt so sehr anstrengen und schaffte dennoch nicht mein gewohntes Pensum. Woran das lag, wusste ich nicht. Ob ich mit meinen sechsundzwanzig Jahren langsam zu alt für den Job wurde?
Als Meta ihren Kopf in den Trainingsraum steckte, sich verabschiedete und vorschlug, ich solle für heute Schluss machen, realisierte ich, dass es bereits gegen sechs Uhr abends war. Ich machte trotzdem weiter.
Nach dem Training duschte ich und verließ schließlich gegen neun das Institut. In der Bionik ein Stockwerk höher war in den Laboren noch Betrieb, doch auf meiner Etage war ich die Letzte.
Es war Gott sei Dank noch nicht dunkel, als ich mich auf den Weg zur Straßenbahn machte. Die Dämmerung setzte gerade ein und der frische Abendwind versprach Kühlung nach diesem heißen Tag. Ich zog den Reißverschluss meiner Kapuzenjacke auf und ließ sie offen stehen. Ausziehen konnte ich sie nicht. Die meisten Menschen wurden nervös, wenn sie mein Holster mit der Waffe sahen. Der Wind wehte recht kräftig, und die Luft roch nach Regen. Vermutlich würde es heute Nacht gewittern. Als die Bahn einfuhr, ging ein Luftstoß über die Haltestelle, der mir meine Locken aus dem Gesicht riss und alte Zeitungen aufwirbelte.
Während der Fahrt lehnte ich an der Wand nahe bei den Türen und wurde sanft umhergeschaukelt. Im Kopf ging ich den Bericht und die Fotos durch. Heute Abend würde ich jedoch vermutlich nicht mehr daran arbeiten. Bei meiner Station stieg ich aus und wartete, bis die Bahn mit einem müden Kreischen um die Ecke bog. Inzwischen war der Himmel eine dunkelgraue Suppe, der Wind wehte erstaunlich kalt. Einige Menschen saßen auf den Bänken oder liefen umher, doch keiner schien mich zu beachten. Auf meinem Weg nach Hause drehte ich mich immer wieder um und achtete darauf, nicht verfolgt zu werden.
Ich nahm mein Handy aus der Tasche, wählte Jamies Nummer und hoffte, dass er da war. Nach dem dritten Freizeichen nahm er ab. Wie jedes Mal machte mein Herz einen kleinen Satz, als ich seine Stimme hörte.
Und wie jedes Mal verfluchte ich mich dafür.
Kapitel 2
Und?«, fragte ich, als ich Jamie zwei Stunden später die Tür öffnete. »Hast du das Zeug bekommen?«
»Hast du was gekocht?«
Ich rollte mit den Augen. »Ich habe vor einer halben Stunde zwei Pizzen bestellt. Müssten jeden Moment da sein. Hast du das Zeug?«
»Habe ich dich je hängenlassen, Di?«, fragte er mit einem schelmischen Lächeln, während er den Rucksack von seiner Schulter gleiten ließ, sich die Sneakers auszog und Richtung Kücheninsel lief, die sich am anderen Ende des großen Raumes befand. Sein T-Shirt war etwas zu eng und schmiegte sich wie eine zweite Haut um seinen Oberkörper. Bei jedem anderen hätte es lächerlich ausgesehen. Bei ihm sah es großartig aus.
In der Ferne war ein leises Donnergrollen zu hören, hin und wieder zuckte ein Blitz über den schwarzen Himmel. Durch die schlecht isolierten Fenster meiner Loftwohnung wehte ein leichter Luftzug zwischen Rahmen und Wand hindurch. Trotz des Wetters war Jamie ohne Jacke gekommen.
Werwölfe hatten einen schnelleren Metabolismus als Menschen und grundsätzlich eine höhere Körpertemperatur. Er roch nach feuchter Erde.
»Du riechst, als hättest du dich gerade aus einem Grab gebuddelt«, sagte ich und sah zu, wie er sich über meinen Kühlschrank hermachte. Bis auf einen angebrochenen Karton Milch, zwei Joghurts, eingelegten Knoblauch und Coke würde er darin jedoch nichts finden.
»Ich war im Wald rennen«, erwiderte er, ohne sich nach mir umzudrehen. »Jeez, Di, was soll ich denn essen, bis die Pizzen kommen?« Frustriert schloss er die Tür, widmete sich meinen Vorratskörben und richtete sich eine Schale mit Cornflakes und Milch. »Du hattest übrigens Glück«, fuhr er fort, während er anfing, laut knirschend die Kellogs zu essen. »Als du angerufen hast, bin ich gerade zur Tür reingekommen. Hast mir nicht mal Zeit zum Duschen gelassen. Kann ich deine benutzen?«
Ich stand gegen die Eingangstür gelehnt, verschränkte meine Arme und verdrängte rasch das Bild seines nackten, eingeschäumten Köpers, das in meinem Kopf erschien.
»Sicher«, antwortete ich knapp und senkte den Blick, damit er weder meine Wut noch die aufflammende Hitze in meinem Gesicht sah. Jamie war ein Vollidiot. Es war verdammt gefährlich, mitten am Tag als Wolf durch den Wald zu rennen, selbst wenn er sich die einsamen Ecken suchte.
Die älteren Wölfe konnten sich, abgesehen von der erzwungenen Verwandlung bei Vollmond, jederzeit in einen Wolf verwandeln. Das war natürlich sehr leichtsinnig. Die Menschen wussten nur von den wildgewordenen Wölfen, die jegliche Kontrolle über ihr Tiersein und ihre Menschlichkeit verloren hatten. Ihr wisst schon, An American Werwolf in London, Big bad Wolf und so ein Zeug. Das passierte scheinbar, wenn sie zu viel Zeit in ihrer Wolfsform verbrachten und die Fähigkeit verloren, sich zurückzuverwandeln. Zumindest hatte Jamie mir das irgendwann erzählt. Von denen, die ihren Wolf kontrollieren konnten und ein relativ normales Leben mit alltäglichem Beruf führten, wusste man nichts. Jamie war Rettungssanitäter. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn jemand von dem haarigen Problem erfuhr, das ihn einmal im Monat heimsuchte. Dass ich einen Blick hinter die Fassade hatte werfen dürfen, war purer Zufall. Es war gewissermaßen einer Hexe zu verdanken, die mich im November letzten Jahres verflucht hatte.
»Danke«, erwiderte er. Doch sein Tonfall war skeptisch und er hatte aufgehört zu essen. Offenbar war er zu schlau, um meinen gesenkten Blick als Geste der Unterwürfigkeit zu interpretieren. »Stimmt was nicht?«