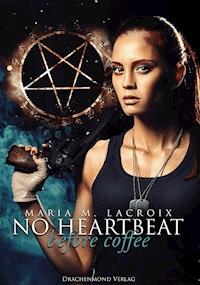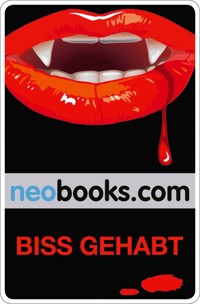Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Geheimnis der Feentochter
- Sprache: Deutsch
Nachdem sie von einem grausamen Fay-Prinzen in den Síd entführt wurde, ist Emmas Wille gebrochen. In letzter Sekunde wird sie aus der Feenwelt gerettet. Sich wieder im Alltag zurechtzufinden, ist schwer, denn der Prinz hat ihr die Lebensfreude geraubt und will sein perfides Spiel mit ihr fortführen... Unterstützung erhält sie von ihren Freundinnen Nessya und Jada, die alles tun, damit es Emma besser geht. Und ausgerechnet Tadhg, einstiger Gott des Todes und in der magischen Welt zuhause, bietet Emma seinen Schutz an. Anfangs erträgt sie den Gedanken nicht, einen anderen Unseelie in ihre Nähe zu lassen. Aber etwas an diesem Mann mit den Dämonenaugen fasziniert sie - reicht das aus, um ihm zu vertrauen? Kann sie mit dem Gott des Todes an ihrer Seite den Mut aufbringen, sich ihrem Peiniger zu stellen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Kiss of Fay
Das Geheimnis der Feentochter - Band 2
Maria M. Lacroix
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Tanja Selder
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Anja Uhren
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN ISBN 978-3-95991-208-2
Alle Rechte vorbehalten
Für alle Träumerinnen & Träumer,
Weltenreiserinnen und Weltenreiser,
Optimisten, Idealisten,
an-das-Gute-Glauber und niemals-Aufgeber.
Dieses Buch ist für euch, denn ihr macht die Welt
zu einem besseren Ort.
Inhalt
Namensregister und Aussprache
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Ein etwas anderes Glossar …
Danksagung
Über die Autorin
Bücher von Maria M. Lacroix
Namensregister und Aussprache
(alphabetisch geordnet)
Bansheegesprochen wie Bänschie
Cathal Ca-Hal (Betonung liegt auf der zweiten Silbe)
Clíodhna Kliothna (th wie in Englisch ›the‹)
Emma Emma
Jada englische Aussprache (J wie in Englisch ›Jungle‹,
erstes a wie ay, zweites a wie das deutsche ›a‹)
Krystal Krys-tAl (Betonung liegt auf der zweiten Silbe)
Nessya Nässi-Ja (Betonung liegt auf der zweiten Silbe)
Nassaïr Nass-Air (Betonung liegt auf der zweiten Silbe)
Síd Schie
SeelieSchii-li (Betonung liegt auf der ersten Silbe)
Königin Siobhànn Königin Scha-Wuan
(Betonung liegt auf der zweiten Silbe)
Sluagh Sluu-ach (langes u; ch wie in Rache)
Tadhg Tath (th wie in Englisch ›the‹; g bleibt stumm)
Uisdean Ischdan
UnseelieAn-schii-li (Betonung liegt auf der ersten Silbe)
Liebe Leserin, lieber Leser:
Das ›etwas andere Glossar‹ befindet sich am Ende des Buches. Du kannst also ruhig die letzte Seite lesen, haha. Aber bitte nur vom Glossar!
Prolog
Aus Emmas Tagebuch.
In der Wüste,
Sah ich ein Geschöpf, nackt, bestialisch,
Welches, am Boden kauernd,
Sein Herz in Händen hielt
Und davon aß.
Ich sagte, »Ist es gut, Freund?«
»Es ist bitter-bitter«, antwortete es.
»Aber ich mag es,
Weil es bitter ist
Und weil es mein Herz ist.«
Stephen Crane, irgendwann vor dem 05. Juni 1900
Früher, in der Schule, habe ich nie kapiert, was dieses Gedicht bedeuten sollte. Jetzt verstehe ich es besser, als mir lieb ist.
1
Emma sog tief Luft ein, sobald sie wieder Atem holen konnte. Was zum Teufel war eben passiert?
Gerade hatte sie sich noch vor dem Badezimmerspiegel in ihrer kleinen Studenten-Wohnung in Dublin abgeschminkt, jetzt saß sie auf einem spiegelglatten, dunklen Steinfußoden – das musste grauer Marmor oder Ähnliches sein – und blickte zur Decke hinauf. Sie befand sich hoch über ihrem Kopf und lief wie in einer gotischen Kirche zu einer Kuppel zusammen. Das prachtvolle Zimmer war, bis auf das mit dunklem Stoff verzierte King-Size-Himmelbett, leer und die Wand direkt vor ihr sah aus wie ein riesiger Spiegel, der den ganzen Raum einfing und ihn doppelt so groß wirken ließ, als er ohnehin war. Während sie sich umsah, kamen ihr unwillkürlich die Worte ›erhaben‹ und ›trostlos‹ in den Sinn. Die vielen glatten, grauen Flächen, die hohen Säulen in jeder Ecke des Zimmers und die in den Himmel reichende Decke mochten zwar majestätisch wirken, doch sie waren auch ebenso kühl und unpersönlich. Sie stand vom Boden auf, klopfte sich den kaum vorhandenen Staub ab – der spiegelglatte Boden war picobello sauber – und versuchte sich einen Reim aus dem zu machen, was eben geschehen war.
Etwas war mit dem Spiegel nicht in Ordnung gewesen, er hatte vibriert, und als sie ihre Finger auf das Glas gelegt hatte, war es warm gewesen, fast heiß. Dann ging alles sehr schnell. Es fühlte sich an, als würde sie mit einer klebrigen Lackschicht überzogen werden, wie ein kandierter Apfel, bis sie nicht mehr atmen konnte. So schnell, wie es begann, war es auch wieder vorbei, und sie fand sich auf dem Boden dieses kalten, majestätischen Raumes wieder.
Das Bild des kleinen weißen Kaninchens aus Alice im Wunderland erschien in ihrem Kopf, doch statt in einen Kaninchenbau zu fallen, war sie von ihrem Spiegel verschluckt worden. Das musste ein Traum sein.
Nur, wieso fühlte es sich nicht wie ein Traum an?
Bevor sie sich darüber nähere Gedanken machen konnte, öffnete sich die Tür am anderen Ende des Raumes und ein junger, attraktiver Mann trat ein, der freundlich und etwas verwegen lächelte. Wow, Badboy-Charme hoch fünfundneunzig. Mann, dafür hatte sie eine Schwäche. Er kam ihr bekannt vor. Uni? Nein. Aus dem Yoga-Kurs? Auch nicht …
Dann fiel es ihr wieder ein. Sie war ihm vor einigen Nächten in dem neuen Club begegnet. Sie hatten miteinander geflirtet, bevor Nessi sie von ihm weggezogen hatte. Was zum Teufel machte er in ihrem Traum?
»Ich habe dich schon erwartet, Emma«, grüßte er mit einem schiefen Lächeln, als er vor ihr stand und sie in die Arme nahm. Er senkte seine Lippen zu ihren, doch bevor sie sich berührten, stemmte sie ihre Hände auf seine Brust und beugte sich nach hinten.
»Woah, immer langsam. Auch wenn das ein Traum ist. Willst du mir nicht wenigstens deinen Namen verraten oder so?«
»Selbst wenn ich ihn dir verraten würde, könntest du nichts mit ihm anfangen, Emma, meine Süße. Genieße doch einfach die Dinge, die ich mit dir tun werde.«
Okay, normalerweise stand sie nicht auf Männer, die dermaßen von sich selbst überzeugt waren, aber … ach, es war ein Traum und er war echt heiß. Auch wenn sie sich über diesen kalten Gothic-Ort, den ihr Verstand entworfen hatte, etwas wunderte, konnte sie sich doch einfach fallen lassen und aufhören, alles zu hinterfragen.
Aber war es nicht ungewöhnlich, dass ihr dermaßen viele Details in dem Zimmer auffielen? Waren Träume sonst nicht verwaschener? Eher wie Eindrücke und Gefühle, weniger präzise? Normalerweise spürte man im Traum nicht, ob es einer war oder nicht. In der Realität wusste man aber für gewöhnlich genau, dass es … keiner war. Sie studierte das Gesicht ihres Gegenübers. Die sinnlich geschwungenen Lippen, die halb geschlossenen Augen. Der Kerl sah geradezu unverschämt gut aus, dunkelbraune Haare, Dreitagebart, um die Mitte zwanzig wie sie selbst, athletischer Körperbau.
Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. War das überhaupt ein Traum? Oder war sie betäubt und entführt worden? Konnte sie sich deshalb nicht erinnern, wie genau sie hierhergekommen war?
Als sie versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien, hielt er sie wie in einer Schraubzwinge, was ihre Befürchtungen nur bestätigte.
Sie riss die Augen auf. »Das ist kein Traum«, flüsterte sie. »Lass mich los!«
Mit dem Knie versuchte sie ihm zwischen die Beine zu treten, doch mit einer geschickten Bewegung wirbelte er sie herum, sodass sie mit dem Rücken gegen seine Brust gepresst wurde.
»Hmmm«, raunte er in ihr Ohr, »nur zu, wehr dich, Menschenmädchen. Das gefällt mir.«
Angst überflutete die Verwunderung und ließ sie in kurzen, scharfen Zügen atmen. »Menschenmädchen?«
»Ja, meine Süße. Ich bin ein Fay-Prinz. Hast du schon von der Welt der Fay gehört?«
Schwer schluckend schüttelte sie den Kopf, ihre Stimme versagte.
»Na, na, nicht lügen, meine Süße, ich bin sicher, dass du schon von den Sídhe gehört hast.«
»Aber das sind doch nur alte Legenden oder Gutenachtgeschichten für kleine Kinder.« Ihr Herz hämmerte spürbar gegen ihren Brustkorb. Ihre Stimme klang so dünn, dass sie nicht sicher war, ob er sie gehört hatte.
»Früher war es so viel lustiger, euch Menschen in unsere Welt zu entführen. Jetzt muss man euch erst einmal davon überzeugen, dass es uns überhaupt gibt und was wir sind.« Er seufzte. »Es wird höchste Zeit, dass mein Bruder seinen Plan ausführt, damit ihr euch wieder erinnert. Erzähl mir, was du vom Síd weißt.« Als sie nicht antwortete, bog er eines ihrer Handgelenke nach hinten, bis es mit einem lauten Krachen brach. Sie schrie vor Schmerzen, Tränen schossen ihr in die Augen.
Das Spielerische verschwand aus seiner Stimme. »Ich habe dich etwas gefragt«, grollte er. »Antworte mir. Was weißt du vom Síd, Emma?«
»Der … der Síd ist eine Bezeichnung für die Feenhügel«, wimmerte sie, um ihn nicht noch mehr zu verärgern. »Im Volksglauben heißt es, dass die Welt irgendwann einmal in zwei Bereiche aufgeteilt wurde. In den der Menschen und den der Sídhe oder Fay. Die Menschen können den Síd nur an bestimmten Orten oder zu bestimmten Tagen betreten, wie am 31. Oktober, an Samhain. Die Fay können aber jederzeit hinaus.«
»Braves Mädchen. Dann bist du doch nicht so unwissend, wie ich befürchtet hatte.«
Der verspielte Tonfall war zurück, doch er jagte ihr mehr Angst ein als sein Zorn. Sein stinkender Atem strich über die Haut ihres Nackens und sandte Übelkeitsstöße durch ihren Körper.
»Erzähl mir, was du über die Seelie- und die Unseelie-Fay weißt.«
»Nicht viel, ehrlich nicht«, wimmerte sie, »nur, dass die Seelie wohl zu den guten und hilfsbereiten Feen gehören und die Unseelie Schaden und Unheil bringen. Lässt du mich jetzt gehen, bitte? Das ist alles, was ich weiß. Wirklich.«
»Was weißt du über uns Prinzen?«
Die Antwort lautete ›nichts‹. Sie versuchte ihm das zu sagen, doch mehr als ein Schluchzen bekam sie nicht heraus. Zu groß war ihre Angst, dass ihn das verärgern würde.
»N-Nicht viel«, wimmerte sie schließlich.
»Wir sind die Schlimmsten von allen«, flüsterte er in ihr Ohr und strich liebevoll über ihr Haar. »Wir können so viel Spaß miteinander haben. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, du hättest es noch länger für einen Traum gehalten. Ich hätte das Spiel dann etwas hinauszögern können.«
Er wirbelte sie wieder zu sich herum und hielt sie fest an sich gedrückt. Ihr Handgelenk schmerzte so stark, dass ihr davon übel und schwindelig wurde.
Nessi hatte völlig recht gehabt, ihm zu misstrauen. Sie hatte einen sechsten Sinn für solche Dinge. Hatte sie etwa gewusst, was er war? Wie konnte das sein? Nessi hatte als Teenager-Ausreißerin eine turbulente Vergangenheit, doch eine Verbindung zu der Welt der Feen erschien Emma völlig absurd. Aber was dachte sie da für einen Quatsch … die Welt der Feen gab es nicht, das waren nur Märchen und Sagen.
Oder?
Sie war bisher nie in gefährliche Situationen geraten. Ihr Leben war ein ruhiger, gleichmäßig strömender Fluss gewesen. Sie würde hier mehr oder weniger unbeschadet herauskommen. Ganz bestimmt. Es gab keinen Grund, ihr weitere Schmerzen zuzufügen, wenn sie sich kooperativ verhielt, nicht wahr? Sein verwegenes Badboy-Lächeln verwandelte sich in eines, das ihre Furcht noch mehr schürte.
»Ich hätte zunächst die Vorspeise genießen können«, fuhr er fort, und der Klang seiner Stimme jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken. »So muss ich gleich zum Hauptgericht übergehen.«
Mit den Worten presste er seinen Mund auf ihren. Sie wehrte sich gegen den Kuss, doch ihre Zähne drückten schmerzhaft gegen ihre Lippen, sodass sie nachgeben und sie für ihn öffnen musste. Nach wenigen Augenblicken überzog ein seltsames Kribbeln ihre Haut, und ihre Lippen fühlten sich taub an. Je länger er sie küsste, desto schwieriger wurde es, klar zu denken, beinahe so, als wäre sie betrunken. Längst wehrte sie sich nicht mehr und hing schlaff in seinen Armen.
»Schon besser, meine Süße«, sagte er.
Eine merkwürdige Freude überkam sie, weil er zufrieden war. Sie wollte ihm gefallen, wollte sich so benehmen, dass seine Bedürfnisse befriedigt wurden und er sie lobte. Nachdem er sich von ihr gelöst hatte, streifte ein kühler Luftzug ihre Lippen, und sie fühlten sich kalt und taub an. Sie streckte sich ihm entgegen, um den Abstand zu seinem Mund zu überbrücken und seine Zunge wieder in sich zu spüren. Sie wollte es, brauchte es, hielt es nicht länger ohne seine Berührung aus.
»Es ist so einfach, euch Menschen faysüchtig zu machen«, sagte er und lachte laut. »So leicht, wie einen kleinen Brownie zu treten. Du, meine Süße, scheinst besonders empfänglich dafür zu sein.«
Sie lächelte, weil sie offenbar alles richtig machte. Er schien zufrieden mit ihr. Während sie sich an ihn schmiegte, veränderte sich sein Aussehen. Seine Erscheinung fiel von ihm ab, als würde er sich wie eine Schlange häuten. Seine Haut wurde fahl und gelblich, die erotisch geschwungenen Lippen wichen Hundelefzen, hinter denen eine Reihe säbelartiger Zähne zum Vorschein kam, die so lang waren, dass er die Lefzen nicht um sie herum schließen konnte. Die Haare verschwanden und hinterließen eine Glatze, und seine dunkelbraunen Augen wurden spiegelglatt und milchig in der Farbe. Sie wich einen Schritt zurück, weil er so eklig und widerwärtig aussah.
»Nein, meine Süße«, sagte er und hielt sie fest, als könne er ihre Gedanken lesen. »Dich stört mein Aussehen nicht. Du hältst mich für den bestaussehenden Mann, den du je gesehen hast.«
Natürlich. Wie konnte ihr das vorher nicht aufgefallen sein? Aber etwas in ihrem Innern versuchte gegen diese honigsüße Stimme anzukämpfen. So sah doch kein gut aussehender Mann aus. Ihr Verstand klärte sich langsam, und sie konzentrierte sich auf diese Gedanken. Sie kämpfte gegen seine Worte an. Wirklich. Bis er seinen Mund mit diesen langen Zähnen wieder auf ihren presste und sie mit einem tiefen Kuss belohnte. In seinen Armen schmolz sie dahin. Sie schmeckte Blut, dann erst spürte sie den Schmerz an ihrer Lippe. Er hatte sie mit seinen säbelartigen Zähnen verletzt, doch das machte nichts.
»Du liebst mich«, sagte er zwischen zwei Atemzügen. »Nein, mehr noch, du vergötterst mich.«
Ja, sie liebte ihn. Sie liebte ihn mehr, als sie je jemanden geliebt hatte, und es entsprach der Wahrheit. Sie ergab sich seiner Umarmung, seinem Kuss voll und ganz, bis er seine Hand auf ihren Kopf legte und sie hinunterdrückte.
»So, meine Süße«, sagte er und löste den Gürtel seiner Hose. »Jetzt will ich deine Lippen woanders spüren.«
Vor ihm kniend nahm sie ihn in den Mund, als er ihn ihr grob hinein schob und seine Hüften vor und zurück bewegte. Was immer er von ihr verlangte, wollte sie ihm geben. Dazu war sie da, das war ihre Bestimmung. Seine Bewegungen wurden schneller, heftiger, und er hielt ihren Kopf fest gegen seinen Schoß gedrückt, bis sie keine Luft mehr bekam und würgen musste. Aber das war nicht schlimm, denn seinen Lauten nach zu urteilen, gefiel es ihm. Eine zähe, schleimige Flüssigkeit ergoss sich in ihren Mund. Süßer Nektar aus seinen Lenden, und er befahl ihr zu schlucken, obwohl sie kaum atmen konnte. Das war falsch, das wollte sie nicht. Tränen schossen ihr in die Augen, weil er noch immer ihren Kopf fest gegen seinen Schoß gedrückt hielt. Kurz bevor ihr Magen revoltierte, ließ er sie endlich los. Sie löste sich von ihm, und frische Luft strömte in ihre Lungen. Ihre Kehle schmerzte. Trotzdem verzehrte sie sich nach seiner Berührung, seinen Liebkosungen auf ihrem Körper.
»Leg dich auf das Bett«, befahl er, und sie tat es, doch nicht mehr ganz so euphorisch wie zuvor. »Du willst mich. Sag es«, grollte er. »Sag es!«
Selbstverständlich wollte sie ihn. Es gab nichts, was sie mehr ersehnte, und Begierde und Lust ließen ihren Körper schlaff werden. Geradezu teilnahmslos. Als er über sie kletterte, versuchte sie sich auf die Ellenbogen zu stützen und ihre gesunde Hand um seinen Nacken zu legen, um ihn an sich zu ziehen, seinen Körper zu küssen, doch er stieß sie grob zurück. Sie blieb ruhig liegen. Er schien die Nähe nicht zu mögen, und sie wollte ihm doch so gerne gefallen, wollte alles richtig machen.
Oder?
Wollte sie das wirklich? Ihre Gedanken fühlten sich nicht mehr ganz so betäubt an. Etwas blitzte durch all den Nebel in ihrem Kopf hindurch, doch es war, als würde der Funke diffus herumfliegen und sich außerhalb ihrer Reichweite befinden.
»Sag, dass ich dich hart nehmen soll«, knurrte ihr Geliebter über ihr.
»Nimm mich hart«, kam sie seiner Bitte tonlos nach.
Als er sie schlug, flog ihr Kopf zur Seite, doch sie spürte die Schmerzen kaum. »Nicht so! Es muss so klingen, als würdest du es wirklich wollen.« Er fletschte die gewaltigen Zähne. »Was beim Síd stimmt mit dir nicht, dummer Mensch? Du vergötterst mich, du vergötterst mich!«
Speichel tropfte auf sie herab, als er in sie eindrang und fest zustieß, aber auch das bemerkte sie kaum, denn ihr Verstand driftete davon.
»Du wirst mir dankbar sein, es gefällt dir, so von mir genommen zu werden.«
»Ja.« Sie sah zur Seite, während er sich in ihr bewegte und über ihr grunzte. Es kam ihr jedoch so vor, als würde sie unterhalb der Zimmerdecke schweben und alles von oben betrachten. Als hätte sie sich von ihrem Körper gelöst und gehörte nicht mehr dazu. Was er dort unten mit ihrem Körper tat, war ohne Bedeutung, denn sie war nicht mehr ein Teil dessen.
»Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du wissen, dass du dich nie wieder so fühlen wirst, wie du dich vorher gefühlt hast, ist das klar?«
Er hatte recht, das spürte sie. Dort, wo sich vorher ihre Liebe, Freude und Hoffnung befunden hatte, entstand ein Loch. Ein großes, leeres Loch.
»Sobald ich mit dir fertig bin und gehe, wirst du dich allein und verlassen fühlen. Nicht nur von mir, von jedem«, sagte er, während seine schnellen, unerbittlichen Stöße sie wund rieben, bis ihr Unterleib brannte. Sie ignorierte die Schmerzen. Ihm schien es zu gefallen.
Etwas stimmte nicht. Das war ihr klar, doch ihr Verstand weigerte sich, den Gedanken weiter zu verfolgen. Bald war es vorüber. Bald.
»Verdammtes eigensinniges Menschenmädchen.« Er schlug sie wieder. Ihr Kopf flog zur anderen Seite. »Nie wieder wird dich jemand lieben, weil du dich nie wieder lieben wirst. Du wirst dich verabscheuen, so sehr, dass du dir wünschst, tot zu sein. Aber du wirst dich nicht umbringen. Nicht, solange ich mit dir spielen will. Hast du verstanden?«
Sie nickte. Ja, sie hatte verstanden, und sie wusste mit schrecklicher Gewissheit, dass es so sein würde, wie er sagte. Als sich sein Gewicht von ihrem Körper hob, er seine Hose hochzog und den Gürtel schloss, war der letzte Funken Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Worte ausradiert.
»Du wirst hier auf mich warten und mir dienen, klar? Ganz gleich, was ich von dir verlange, wirst du mir geben.«
Sie nickte wieder.
»Beim Síd!« knurrte er. Offenbar war er wütend. Weshalb war er wütend? Gefiel sie ihm nicht? Hatte sie nicht alles getan, um ihn zufriedenzustellen? »Wenn ich gewusst hätte, dass du dermaßen leicht zu brechen bist, wäre ich die Sache langsamer angegangen. So macht das Ganze ja überhaupt keinen Spaß.«
Er packte sie schmerzhaft beim Schopf, zog sie auf die Beine und warf sie dann auf das Bett zurück. Sie ließ es mit sich geschehen, was sollte sie auch machen, um ihn daran zu hindern?
Kopfschüttelnd betrachtete er sie mit einem angewiderten Blick. »Ich fürchte, dass du zu nichts mehr zu gebrauchen bist. Ein bisschen mehr Kampfgeist hätte mir gefallen. Aber so …« Schulterzuckend wandte er sich von ihr ab und verließ das Zimmer. Und etwas in ihr zerbrach.
Sie war der Liebe nicht würdig. Wie sollte sie noch irgendwer lieben können, nachdem sie das hier zugelassen, ja sogar gewollt hatte? Sie hatte das Recht auf Liebe verwirkt. Warum sollten andere Achtung für sie empfinden, wenn sie die nicht einmal für sich selbst aufbringen konnte?
Nachdem er sie verlassen hatte, lag sie zusammengerollt auf dem Bett und starrte in die Laken. Irgendwann kehrte er zurück und zerrte sie fort. Weg vom Bett, raus aus dem erhabenen Zimmer. Stattdessen verfrachtete er sie in eine Ruine, grau, verkommen und trist. Wie sie selbst.
Sie kauerte sich mit dem Rücken gegen eine Wand, schlang die Arme um ihre Beine und wiegte sich vor und zurück. Vor und zurück.
Ihr Geist schwebte neben ihrem Körper, Zeit und Raum wurden bedeutungslos, bis jemand sie fand und fortbrachte.
2
Kalt. Ihr ist unendlich kalt. Sie friert unter den dicken Decken, friert immerzu. Nichts kann sie wärmen. Nie wieder.
Die Wände, Decke und Möbel ihres Zimmers sind blütenweiß, doch auf sie wirken sie dunkel und trostlos. Wie alles andere auch.
Sie bekommt oft Besuch. Die junge Frau, die mit der hellen Haut und den dunklen Haaren wie Schneewittchen aussieht, erzählt ihr etwas über eine Welt, die sie nicht kennt, eine Welt, die sie nicht versteht. Die Welt ›da draußen‹. Davon will sie aber nichts hören. Wenn Schneewittchen sonst nichts zu sagen hat, redet sie über das Wetter. Es ist kalt geworden, vielleicht wird es diesen Winter schneien, sagt sie heute.
Doch Emma hat vergessen, was Schnee ist. Ihre Welt besteht nur aus Finsternis.
Irgendwann kommt Schneewittchen nicht mehr allein. Sie hat einen Mann dabei. Nein, keinen Mann. Ihre Sinne erwachen zum Leben, blitzen durch ihr Gehirn wie schmerzhafte Stromschläge. Sie schreit, als das Wesen näher kommt. Es ist groß, mit silberweißer Haut und monströsen Schwingen, die bis zur Decke reichen.
Er ist einer von ihnen!
Seine Anwesenheit verursacht das Gefühl von brennender Säure, die durch ihre Adern rauscht, sie vergiftet und von innen aufzehrt.
Sie sehnt sich nach ihrem Prinzen. Ihre Existenz hätte wieder einen Sinn und sie eine Bestimmung zu existieren. Die unendlich andauernde Trostlosigkeit fände ein Ende. Nur dafür ist sie gut. Ihrem Fay-Prinzen zu dienen. Dunkel schwebt der Begriff durch ihren Verstand. Fay.
Sie streckt ihre Hand nach dem silberweißen Monster aus. Und verbrennt sich. Es fühlt sich an, als würde sie neben einem Lavastrom stehen, der sie bei lebendigem Leib brät. Sie schreit. Versucht zu fliehen, doch sie ist in dieser kleinen, blütenweißen Zelle gefangen. Dieses Monster darf ihr nicht näher kommen, darf sie nicht kriegen, während sie sich gleichzeitig nichts sehnlicher wünscht, als die Nähe zu ihm und allem, was er verkörpert. Nicht er ist es, den sie will. Sie will ihren Prinzen.
Sie sehnt sich nach dem Fay. Nach der Magie.
Sie will das, was er zu geben fähig ist. Sie braucht den Rausch.
»Verschwinde!«, schreit sie und streckt doch sehnsüchtig die Hände nach ihm aus. Schneewittchen hält sie mit aller Kraft zurück, verhindert, dass sie zu ihm gelangt. Sie braucht die Magie, braucht sie.
»Cathal! Ich glaube, dass sie deine Magie fühlen oder sehen kann«, ruft Schneewittchen, während sie versucht, sie an den Schultern gegen die Wand zu drücken. Das silberne Monster antwortet. Mit einer betörenden Stimme, die prickelnde, schmerzhafte Schauer über ihre Haut sendet, redet es von ›Blendzauber‹ und ›komplett hochgefahren‹, doch sie versteht nicht, was das bedeutet. Es spielt auch keine Rolle. Sie hält es nicht mehr aus. Qual, Schmerzen und Sehnsucht zugleich, so stark, dass es sie fast zerreißt. Heiße Tränen laufen über ihre Wangen.
Schreiend krümmt sie sich, doch nichts lindert das Verlangen nach diesem Geschöpf. Sie schlägt sich den Kopf gegen die Wand, damit es aufhört, endlich aufhört. Menschen in Weiß strömen wie eine Lawine in ihr Zimmer, halten sie davon ab, sich den Schädel weich zu schlagen, fesseln sie an ihr Bett und geben ihr Mittel, die sie in erlösendes Nichts befördern. Bald ist sie wieder allein. Schneewittchen und das Wesen sollen gehen, sagen die Menschen, sie bräuchte Ruhe. Schneewittchen weint.
»Ist sie faysüchtig?«, fragt Schneewittchen leise, bevor sie das Zimmer verlassen.
»Schlimmer«, antwortet das silberne Monster. »Sie ist gebrochen.«
Dann gleitet sie in die Leere.
3
Neue Zelle. Sie ist ebenfalls blütenweiß, aber die Wände, Möbel und die Tür sind gepolstert. Keine Möglichkeiten mehr, den Kopf dagegenzuhämmern und sich in Bewusstlosigkeit zu schlagen. Sie driftet davon, an einen anderen Ort in ihrem Kopf. Einen Ort, an dem nichts ist.
Nur wenn Schneewittchen und das silberne Monster kommen, schleudert ihr Verstand sie in die Realität zurück. Weil ihr Schneewittchen von Dingen erzählt, die sie nicht hören will. Schneewittchen packt sie an den Schultern, schüttelt sie und spricht von Menschen, die sie lieben und vermissen. Ihre Familie, ihre Freunde.
»Ich habe keine Freunde!«, schreit sie und heult. Sie zerrt an ihren Haaren, bis sie diese büschelweise ausreißt. »Niemand liebt mich, ich bin es nicht wert.«
»Blödsinn!«, sagt Schneewittchen und hält sie davon ab, weiter an ihrem Haar zu reißen.
Das Monster, das sonst mit verschränkten Armen bei der Wand stehen bleibt, kommt näher und droht ihr, sie festzuhalten, wenn sie nicht aufhört. Weinend hält sie sich die Hände über die Ohren. Der Klang seiner Stimme weckt Gelüste und Sehnsüchte in ihr, die sie nicht fühlen will, die sie hasst und sie anwidern. Erst als das Monster wieder zurücktritt, beruhigt sie sich, nimmt die Hände von den Ohren und hört zu, als Schneewittchen von der anderen Welt erzählt.
Eine Welt voll von diesen Monstern, von den Seelie – den Schönen – und den Unseelie – den Grausamen. Ihr fällt auf, dass Schneewittchens Augen so rein und leuchtend blau sind wie bei keinem der anderen Menschen, mit denen sie hier zu tun hat.
»Bist du eine Seelie?«, fragt sie Schneewittchen.
Schneewittchen wirkt überrascht. »Nein, ich bin ein Mensch. Wie kommst du darauf?«
Das Monster räuspert sich.
»Na ja, nicht wirklich jedenfalls«, korrigiert sich Schneewittchen. »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.« Das silberne Monster mit den Schwingen sei auch ein Fay, fährt Schneewittchen fort, doch er sei nicht hier, um ihr zu schaden, sondern um zu helfen.
Sie blickt zum silbernen Monster. Sie traut ihm nicht.
Aber sie vertraut Schneewittchen. Weshalb, weiß sie nicht, nur dass es so ist. Die Unseelie könnten nicht zu ihr gelangen, erklärt Schneewittchen, weil sie die Zelle mit Schutzzauber gegen sie versiegelt hat. Nur wenn sie sie besuchen kommt, öffnet sie die Siegel, damit das silberne Monster die Zelle betreten kann.
»Ist er einer von ihnen?«, fragt sie. »Ist er auch ein Unseelie?«
»Er ist ein Mischling«, antwortet Schneewittchen. »Von beiden Welten.«
»Ich will ihn aber nicht hier haben«, jammert sie. »Mach, dass er weggeht. Es tut so weh.« Sie fängt an zu weinen. »Es tut so weh.«
»Ich weiß, Emma«, erwidert Schneewittchen sanft und streicht über ihr Haar.
»Mach, dass er weggeht. Mach, dass er von hier verschwindet!«
»Er muss hierbleiben, Emma. Durch ihn wissen wir, wie es dir geht und ob du«, kurz zögert sie, »gesund oder noch süchtig bist. Kein Fay würde das normalerweise tun.«
Das Monster seufzt gelangweilt. »Glaub mir, mir bereitet das auch keine Freude.«
Sie ignoriert ihn. »Aber es tut so weh. Er könnte mir doch geben, was ich brauche, aber er tut es nicht. Es tut so weh.«
»Du wirst dich daran gewöhnen. Du reagierst schon viel besser als am Anfang, weißt du?« Dann schaut Schneewittchen hoch zum Fenster, das weit oben und unerreichbar in die Wand eingelassen ist. »Draußen blüht alles. Es ist Frühling.« Jetzt redet Schneewittchen wieder über das Wetter, wie immer, wenn sie nicht weiterweiß.
Emma wippt vor und zurück und summt, um nichts mehr zu hören.
»Meinst du, dass sie es schafft, die Sucht zu überwinden?«, fragt Schneewittchen das Monster, als sie in der Tür stehen.
Kurz hört sie auf zu wippen. Sucht? Lange hält sie sich mit diesem Gedanken nicht auf. Sie verfällt wieder in ihr Wippen und Summen, flüchtet in das Nichts ihrer Gedanken.
»Schwer zu sagen«, antwortet das Monster.
»Bye, Emma. Bis bald«, sagt Schneewittchen, bevor beide gehen.
4
Sie kauert, nackt, auf dem Fußboden ihrer gepolsterten Zelle.
Einsam.
Nachts ist es ruhig.
Sie starrt auf ihre Hände und sieht, dass sie blutbesudelt sind. Sie hält ihr herausgerissenes Herz in ihnen.
Es schlägt schwach, noch ein- oder zweimal, bevor es für immer verstummt. Und in ihrer Brust ist ein klaffendes Loch.
Ihr Prinz steht neben ihr und beobachtet sie.
»Keine Sorge«, sagte er. »Du wirst nicht sterben. Nicht, solange ich mit dir spielen will.«
Ihre Brust bleibt leer und still. Innerlich ist sie längst gestorben. Das Blut ihres toten Herzens tropft von ihren Händen auf den weißen Boden. Einen Tropfen fängt sie auf und leckt ihn vom Finger.
»Wie schmeckt es?«, fragt er.
»Bitter«, antwortet sie. »Nach Schmerzen und Trauer.«
Ihr Prinz grinst und entblößt die ganze Reihe seiner monströsen Fangzähne. »Reizend.«
5
Nur Träume, sagen die Ärzte. Doch was spielt es für eine Rolle? Für sie sind sie echt. Jedes Mal. Jede Nacht.
»Schau mal, Emma«, sagt Schneewittchen. »Ich habe dir Halloween-Deko mitgebracht.« Sie fängt an, ihre blütenweiße Zelle mit dummen orangenen Plastikgirlanden zu dekorieren. Das silberne geflügelte Monster steht mit verschränkten Armen in der Ecke und beobachtet sie. Sie starrt zurück, doch nicht mehr aus Sehnsucht. Sie spürt Feindseligkeit in sich aufsteigen. Sie faucht ihn an. Überrascht hebt er eine Augenbraue.
Allmählich gewöhnt sie sich an seine Anwesenheit. Die Schmerzen, die seine bloße Präsenz in ihr verursachen, werden jedes Mal erträglicher. Es hat sich wie eine Sucht nach einer Droge angefühlt. Jetzt aber nicht mehr.
»Schöne Dekoration«, sagt sie zu Schneewittchen und lächelt. Es kostet sie Kraft, ihren Blick von dem silbernen Monster abzuwenden. Wenn auch schwächer als ganz am Anfang, geht von ihm noch immer ein starker, zerstörerischer Sog aus. Sie hasst dieses Gefühl. Verdammter Fay.
Während der letzten Monate hat sie gelernt, damit umzugehen. Sie befindet sich noch immer in der Zelle mit den gepolsterten Wänden, doch ab und zu darf sie diese in Begleitung verlassen. Sie war sogar schon in dem großen Aufenthaltsraum mit anderen Menschen, wo sich alle aus den unterschiedlichen Stationen treffen können. Dort hat sie es geschafft, einer anderen Patientin unbemerkt ein kleines Parfümfläschchen abzuluchsen.
Schneewittchen und das Monster verabschieden sich, nachdem sie die Zelle fertig dekoriert und ihr wieder unnützes Zeug von der Welt da draußen erzählt haben. Wie das Laub von den Bäumen fällt und es allmählich kälter wird. Dass sich Schneewittchen an der Uni eingeschrieben hat und jetzt studiert. »Aha« und »toll« hat sie gesagt, weil das gut ankommt. Lächelnd winkt sie ihr zum Abschied. Nur ihr. Den Fay mag sie nicht.
Lächeln. Menschen reagieren positiv auf dieses Zähne zeigen und inzwischen hat sie die Bewegung perfektioniert.
Endlich allein. Sie holt das Fläschchen hervor, zerbricht es und … die rechte Hand mit der Scherbe schwebt über ihrem linken Handgelenk. Sie zögert.
Er hatte es ihr verboten. Sie darf das nicht tun, nicht, solange er noch mit ihr spielen will, hatte er gesagt.
Wieder brennen ihre Wangen von salzigen Tränen. Sie will endlich frei sein. Frei von seinem zerstörerischen Einfluss, frei von der Leere, die er in ihr hinterlassen hat. Er hat ihr mehr als nur ihren Willen genommen, er hat ihr ihre Freiheit geraubt. Selbst jetzt, obwohl sie sich nicht mehr in seiner Gefangenschaft befindet, ist sie noch immer seine Sklavin.
Sie will das nicht mehr. Es hat doch auch mal eine Welt ohne ihn gegeben.
Und auf einmal erinnert sie sich.
An alles.
An ihre Welt von früher, bevor sie von den Fay wusste. An den Moment, als sie aus ihrem Leben gerissen und in seine Welt gezogen wurde. An die Spiegel. An die letzten Monate. An alles, was Nessi ihr in den Momenten des Deliriums von der Welt der Fay erzählt hat.
Nessi. Schneewittchen.
Schneewittchen heißt in Wirklichkeit Nessi.
Alles ist zurück.
Die Erinnerungen sind wieder da. Woher so plötzlich? Spielt es eine Rolle?
»Du hast keine Macht mehr über mich, du hässliche Kreatur«, flüstert sie, bevor sie sich die Scherbe in ihren Arm rammt und durch die Haut zieht. Endlich frei.
Es fließt nicht gleich, zunächst bildet sich bloß eine dünne rote Linie. Doch als das Blut anfängt, aus der Wunde zu treten, strömt es unaufhörlich, sodass sich innerhalb kürzester Zeit eine dunkelrote, nass glänzende Lache auf dem weißen Boden bildet. Auf einmal begreift sie, von welch kurzer Dauer ihre Freiheit sein wird.
Nein!
Sie will nicht sterben.
Gerade noch rechtzeitig schafft sie es, den Notfallknopf zu drücken. Mit dem letzten Atemzug flüstert sie in die Leere ihres Zimmers: »Du hast keine Macht mehr über mich, mein Prinz.«
Als Menschen in das Zimmer stürmen und Schritte sowie lautes Rufen den Raum erfüllen, wird die Leere verbannt.
Sie lächelt, bevor Dunkelheit sie umgibt.
6
Frei.
7
Das geheime Treffen fand im Val Todir, dem Reich der Kobolde tief in den Bergen, in der großen Halle des K’vrogs statt.
Tadhg war bisher noch nie hier gewesen. Wozu auch, was gingen ihn die Kobolde an? Dennoch gehörte es zu seiner Pflicht, darüber auf dem Laufenden zu bleiben, was in den Reihen der Unseelie vor sich ging. Unzählige Fackeln und Kerzen erhellten den schmucklosen Raum, in dem lediglich eine Tafel stand. Diese war jedoch so groß, dass eine kleine Streitmacht daran hätte Platz nehmen können. Ansonsten befanden sich keine Möbel, Teppiche oder Dekorationen hier. Die Kobolde bevorzugten es offenbar schlicht und mittelalterlich. Der Fußboden bestand aus grob gehauenem Granitstein, ebenso die Wände, die in den durchgehenden Stein der Höhle übergingen. Auch die hoch über ihren Köpfen gelegene Decke, unter der gerade vier vergessene Schatten ihre Kreise drehten, erinnerte mehr an die einer natürlichen Höhle als an ein gebautes Zimmer.
Ihm schauderte beim Anblick der vergessenen Schatten. Einstige Götter, denen nach der Niederlage gegen die Seelie in der großen Schlacht des Síd ihre Macht geraubt worden war. Wie er hatten sie es abgelehnt, aus dem Becher des Vergessens zu trinken, und dafür hatte Siobhánn sie umgebracht. Oder es zumindest versucht. Wer hätte ahnen können, dass Götter nicht einmal durch die Klinge EaglaBás den wahren Tod fanden, sondern buchstäblich zu Schatten ihrer selbst wurden. Doch ob wahrhaft tot oder nicht, in dieser Form konnten sie der Königin der Seelie nicht länger schaden. Ihm hätte das gleiche Schicksal geblüht, wenn er hätte sterben können. Doch er selbst war der Tod und wahrhaftig unsterblich. Dass nicht einmal EaglaBás ihm etwas antun konnte, hatte alle ebenso überrascht wie verstört.
Etwas, das Königin Siobhánn ein gewaltiger Dorn im Auge war. Ihr Verhältnis zueinander hatte sich – um es milde auszudrücken – über die Jahrhunderte immer weiter verschlechtert.
Tadhg sah hoch und spürte einen Stich, weil er seinen einstigen göttlichen Brüdern und Schwestern nicht helfen konnte. Ganz abgesehen von all der Magie, die dadurch verloren war.
Die anderen Fay im Raum ignorierten die vergessenen Schatten oder sie bemerkten sie nicht. Für einen Gott gab es nichts Schlimmeres, als vergessen zu werden. Seine Mächte hatte Tadhg zwar nicht wieder – die befanden sich noch bei Siobhánn –, aber, verdammt, es war besser, als in diesem deliriösen körperlosen Schattenzustand zu stecken.
Obwohl die Zusammenkunft im Reich der Kobolde stattfand, waren überraschend viele Unseelie gekommen. Die Kobolde stellten die größte reinrassige Gruppe unter den Unseelie dar, daher bot sich ein Treffen bei ihnen an. Doch die anderen Fay fühlten sich innerhalb des Berges, in dem es kaum Fluchtmöglichkeiten gab, umgeben von Massen an Gestein, sichtlich unwohl. Das dunkle Volk neigte nicht unbedingt zum Vertrauen. Unruhiges Gemurmel erfüllte den Raum. Ihm machte der Ort nichts aus, er fürchtete weder den Berg noch die Kobolde selbst.
Schließlich war er ein Gott.
Vermutlich einer der Gründe, weshalb zu ihm ein respektvoller Sicherheitsabstand eingehalten wurde. Ohne seine Magie fiel man bei seiner Berührung zwar nicht mehr tot um, doch die anderen schienen das Risiko trotzdem nicht eingehen zu wollen. Ihm war es nur recht.
Mit verschränkten Armen lehnte er gegen die Wand und beobachtete das Geschehen. Normalerweise waren die Kreaturen des dunklen Hofes zu unorganisiert, zerstreut und individualistisch geprägt, um ein Treffen von dieser Größe auf die Beine zu stellen. Dass so viele gekommen waren, kam einer kleinen Sensation gleich. Die Zeiten änderten sich offenbar. In dem Trubel entdeckte er überraschend viele Vertreter der verschiedensten Unseelie-Arten. Natürlich unzählige Kobolde, die sich wie Erdmännchen in eine Ecke gepfercht hatten und mit gereckten Kinnen versuchten, so viel wie möglich zu erspähen. Aufgrund ihres kleinen Wuchses sorgte das für ein paar Lacher, doch davon ließ er sich nicht beirren. Die Kobolde mochten zwar kurz sein, waren dafür aber so zäh wie alte Schuhsohlen.
Im Getümmel erblickte er außerdem den Anführer der Frost-Fay, die drei Alben, Mac-Néamh – der dem Aussehen nach als hoher Elfenlord hätte durchgehen können, wäre da nicht sein hässlicher Schatten gewesen – und natürlich die drei Prinzen, Nassaïr, Uisdean und Krystal. Auch einige Unseelie, die nach dem Raub der Magie geboren worden waren, nahmen an dem Treffen teil. Es wäre spannend zu sehen, welche Magie sich in ihnen manifestieren würde, sobald die Macht an den Unseelie-Hof zurückkehrte. Aus dem Grund waren sie alle hier. Es war an der Zeit, dass die Unseelie ihre Magie wiederbekamen.
Genau in diesem Moment betrat die wohl außergewöhnlichste Kreatur, die der Unseelie-Hof je hervorgebracht hatte, in Begleitung eines Sluaghs die Halle. Selbst die furchtlosesten Unseelie wichen wie das Meer bei Ebbe vor dem Seelenfresser und dessen Machthaber Cathal zurück. Eine Mischung aus Elfe und Sluagh. Unterschiedlicher ging es kaum.
Tadhg kannte nicht die genauen Hintergründe, doch es hieß, dass die Mutter des Sluagh-Fürsten nach seiner Geburt des leuchtenden Hofes verwiesen worden war und deswegen Selbstmord begangen hatte. Seelie rümpften über deformierte Nachkommen die Nase und sahen es als unverzeihlichen Frevel an, sich mit einem Unseelie – einem Sluagh, ausgerechnet – zu paaren. Tadhg vermutete jedoch, dass sie es vielmehr als Kränkung empfanden, wenn der Ruf des Síd eine hohe Elfe mit einem der dunklen Kreaturen zusammenbrachte, statt mit einer anderen hochwohlgeborenen Elfe.
Der Síd scherte sich einen Dreck um Königin Siobhánns Trennung in die beiden Höfe. Früher einmal hatte es das nicht gegeben, sie waren in ihrer ganzen Vielfalt alle schlichtweg Fay gewesen. Daran erinnerte sich jedoch niemand mehr – dafür hatte Siobhánn gesorgt.
Er war dem Heerführer der Sluaghs, Fänger von Seelen, Hüter dunkler Geheimnisse, noch nie persönlich begegnet, doch als er ihn jetzt sah, verstand er den Lärm nicht, der um ihn herum gemacht wurde. Auf den ersten Blick sah er wie ein hochgewachsener Elf mit Sluagh-Flügeln aus, der zufälligerweise einen heißen Draht zum Wilden Heer hatte. Andererseits war Tadhg zu alt, um sich rein von äußeren Erscheinungsbildern beeinflussen zu lassen.
K’vrogs kletterte auf ein Podest, woraufhin der Geräuschpegel im Saal deutlich absank. Seine Gattin stellte sich hinter ihn und legte ihre Hand auf seine Schulter. Sie trug ein feines Gewand. Es wirkte deplatziert und lächerlich. Offenbar versuchten sie das Seelie-Gebaren zu imitieren. Ein typischer Unseelie-Komplex. Selbst wenn sie es nie zugeben würden, so eiferten sie doch dem leuchtenden Hof nach.
Hoffentlich war es keine verfluchte Fehlentscheidung gewesen, hierherzukommen.
K’vrogs wartete noch einen Moment und blickte in die Runde, bis es ruhig genug wurde.
»Meine lieben Kameraden«, begann er dann. Das restliche Getuschel verschwand zu kaum wahrnehmbaren Hintergrundgeräuschen, die meisten sahen interessiert zum Kobold-König auf. »Wir Unseelie sind Freidenker, Individualisten«, aus der Menge erklangen zustimmende Laute, »trotzdem halten auch wir uns an einen Ehrenkodex, und der lautet erstens: Veränderung ist die treibende Kraft. Für uns gibt es keine Sicherheit, keine Gewohnheit. Sicherheit ist eine verdammte Illusion. Chaos«, er schwang seine Faust, »ist die Energie des Universums!«
Aus der Menge dröhnten begeisterte Zurufe.
»Zweitens: Magie ist Freiheit! Die Seelie haben uns unsere Magie geraubt. Das bedeutet, dass sie uns auch unsere Freiheit genommen haben!« Mehr Zurufe aus der Masse. Immer aufgeregter und lauter wurden die Beipflichtungen der anderen Unseelie. »Und drittens: Leidenschaft ist die einzig wahre Daseinsform. Unsere Leidenschaft«, inzwischen brüllte er fast, »wird uns unsere Magie von den versnobten, sich für etwas Besseres haltenden Seelie wiederbringen!«
Die Menge fing an, lautstark zu jubeln.
»Krieg den Seelie!«, rief K’vrogs. »Krieg den Seelie! Krieg den Seelie!«
Eines musste Tadhg ihm lassen, der Koboldkönig verstand es, die Menge anzuheizen, die sich von seiner Rede sichtlich mitreißen ließ. Die Masse wiederholte den Schlachtruf, jubelte und steigerte sich weiter in die Euphorie hinein.
Verdammte Idioten. Siobhánn hatte sie nach der Niederlage alle genötigt, vom Becher des Vergessens zu trinken, jene, die sich geweigert hatten, waren mit EaglaBás’ Klinge durchbohrt worden und gestorben. Sie hatten keine Ahnung, wie die Seelie kämpften. Er schien der Einzige zu sein, der sich noch genau an die Schlacht erinnern konnte, wie es zu dem Komplott und Siobhánns Alleinherrschaft gekommen war. Allerdings vermutete er, dass es mehr gab, die etwas darüber wussten, jedoch aus Angst, dafür exekutiert zu werden, nicht wagten, es zuzugeben.
Doch K’vrogs stellte es so dar, als wären die Seelie ehrenhaft und ritterlich. Überraschung, ihr Anfänger, die Seelie kämpfen dreckig. Sollte er ihnen ihre Illusion rauben oder sich einfach unauffällig zurückziehen und sie es selbst herausfinden lassen? Noch während er darüber nachdachte, erhob Prinz Uisdean das Wort.
»Und wie wollt ihr den leuchtenden Hof besiegen?«, rief der zweite Anwärter auf den dunklen Thron, Prinz des Westens, Zehrer der Freude, über das laute Gegröle hinweg. Die Menge verstummte. »Womit wollt ihr sie besiegen?«
»Mein Prinz, wir haben zahlreiche Waffen«, rief einer und hob sein Schwert in die Höhe.
»Aus Eisen«, rief ein anderer, der stolz einen Morgenstern präsentierte. »Über die Jahrhunderte hinweg geschmiedet, von den besten Schmieden aus dieser und der anderen Welt.«
Tadhg hatte schon beim Eintreten bemerkt, dass die meisten hier bis an die Zähne bewaffnet waren. Mit Waffen aus Eisen vermochte man zwar keinen Fay zu töten, doch man konnte ihnen das Leben verdammt schwer machen. Ob das genug war, wagte er stark zu bezweifeln. Gegen Sterbliche auf jeden Fall, vielleicht auch gegen andere magielose Unseelie, aber niemals gegen die Magie der Seelie. Als Vorgeschmack würde Königin Siobhánn sie alle mit einer Handbewegung erblinden lassen, und sie zu töten würde ihr ebenso wenig Mühe bereiten wie ihm, als er noch seine Magie besessen hatte.
»Wir haben Euch«, rief einer aus den hinteren Reihen. »Und Prinz Nassaïr und … auf jeden Fall Euch und … Euern Bruder.«
Tadhg lachte in der darauffolgenden befangenen Stille laut auf, sodass sich einige Köpfe ihm zuwandten.
Was für ein Dummkopf, einen der Prinzen auf diese Weise zu beleidigen. Jeder wusste, dass Krystal in anderen Sphären schwebte, doch niemand wagte das in seiner Anwesenheit so offensichtlich anzusprechen. Vermutlich hatte der Rufer versucht, die Kurve zu kriegen, als er das zweite Mal neutral ›Bruder‹ sagte. Er könnte behaupten, dass er Krystal gemeint hatte.
Gerade als sich Krystal erhob, anfing, seine Gestalt zu wandeln und alle vor Schreck den Atem anhielten, legte Uisdean beruhigend die Hand auf die Schulter seines Bruders.
»Wie ihr alle wisst, war es mit Auflagen verbunden, unsere Magie behalten zu dürfen«, sagte Uisdean. »Wir mussten der Gattin unseres Vaters versprechen, diese Magie niemals gegen einen Seelie zu benutzen. Nur deshalb gestattete Siobhánn uns, sie zu behalten.«
Krystal setzte sich wieder, der Blick entrückt. Wahrscheinlich hatte er bereits vergessen, weshalb er überhaupt aufgestanden war. Der jüngste der Prinzen war ebenso verrückt wie gefährlich.
»Gut, aber wir haben die Sluaghs«, grölte jemand anderes, »die Herde des dunklen Hofes. Unsere Streitmacht!«
Wieder schwoll die Lautstärke in der Halle zu einem ohrenbetäubenden Krach an.
»Was sollen die Sluaghs schon für die Unseelie erreichen?«, erwiderte Uisdean, als wäre Lord Cathal nicht anwesend. »Ihr Heerführer hat mit Königin Siobhánn einen Pakt geschlossen, der ihm einen Angriff auf den leuchtenden Hof verbietet.«
Schlagartig wurde es wieder still und alle Augen waren auf den Heerführer und seinen Sluagh gerichtet. »Unmöglich« und »Das kann nicht sein«, hörte Tadhg aus der Menge heraus. Auch für ihn waren diese Informationen neu. Der anwesende Sluagh schien die wachsende Anspannung zu spüren, das Vieh duckte sich, fauchte und schnappte nach jedem, der ihm und seinem Meister zu nahe kam. Die Fay wichen ehrerbietig zurück.
»Wie, das wusstet ihr nicht?«, fragte Uisdean mit gespielter Überraschung und wandte sich an den Seelenfänger. »Mein lieber Cathal, das tut mir leid. Da ist zur Abwechslung mal eines Eurer kleinen Geheimnisse aufgedeckt worden.«
Cathals Miene verdunkelte sich. Was zum Henker hatte der Prinz vor, wozu dieses Theater?
K’vrogs ergriff von seinem Podium aus wieder das Wort. »Ist das wahr, Fürst Cathal?«
Was auch immer in dem Seelenfänger vorging, versteckte er unter einer ausdruckslosen Maske. Eine typische Seelie-Angewohnheit. Interessant.
»Es ist wahr«, antwortete der Heerführer schließlich. »Ich habe mit Königin Siobhánn ausgemacht, dass sich meine Sluaghs für ein Jahrhundert aus Streitigkeiten heraushalten, sollten die Unseelie beschließen, gegen die Seelie in den Krieg zu ziehen.«
»Und nicht nur das«, ging Uisdean dazwischen und richtete sich an die Menge. »Wie ihr wisst, hat er mich bedroht – euren Prinzen –, doch nicht für einen Seelie, was aufgrund seines Erbes noch halbwegs nachvollziehbar gewesen wäre. Nein, für einen der Magielosen von der anderen Seite!«
Empörte Rufe erfüllten die Halle. Die Emotionen kochten ohnehin schon, der Prinz brachte sie zum Sieden.
»Der Heerführer der Sluaghs stellt diese primitiven, minderbemittelten Sterblichen über seine eigenen Leute.« Uisdean blickte wieder zum Fürsten. »So dankt Ihr es uns, dass wir Euch einen Ort zum Leben gegeben haben, Cathal, nachdem die Seelie Eure Mutter und Euch ausgeschlossen haben?«
Der Sluagh-Fürst verschränkte die Arme vor der Brust. »Erstens habt Ihr uns bei den Sluaghs hausen lassen, nicht am Hof, doch das spielt jetzt keine Rolle. Zweitens hatte ich einen guten Grund für das Bündnis.«
»Und der wäre, Elfenbrut?« Prinz Uisdean spie das Wort geradezu aus.
»Geht Euch nichts an, Prinz Uisdean.«
»Weshalb so verschlossen, Fürst Cathal? Verdienen wir nicht, den Grund für Euren Verrat zu erfahren?« Dafür erntete er aus dem Publikum Zustimmung. »Ja, wir besitzen unsere Magie und mussten damals mit Stiefmutter ein Abkommen eingehen. Ihr aber«, er zeigte auf den Heerführer, »denkt, Ihr wärt etwas Besseres. Ein Halb-Seelie. Und als wäre das nicht genug, bevorzugt Ihr jetzt sogar die Gesellschaft von Menschen vor der Eurer eigenen Leute. Ihr seid eine größere Last für uns, als Ihr uns von Nutzen seid. Die Sluaghs gab es schon lange vor Euch, und es wird sie auch noch ohne Euch geben, Cathal.«
Die Miene des Fürsten blieb undurchdringlich. »Verunglimpfungen und Verleumdungen, Uisdean. Nichts von dem, was Ihr sagt, entspricht der Wahrheit. Und was die Sluaghs betrifft, so sorge ich dafür, dass sie nicht wild über euch alle herfallen.«
»Jaja, Ihr kontrolliert sie«, brüllte Uisdean, »Ihr sorgt dafür, dass sie uns ein Jahrhundert lang im Krieg gegen die Seelie nicht helfen werden. Würdet Ihr sie nicht kontrollieren, würden sie sich dem allgemeinen Chaos bei einer Schlacht einfach anschließen.«
»Von Kontrolle kann keine Rede sein. Die Sluaghs lassen sich nicht kontrollieren«, zischte der Heerführer, dessen gleichgültige Fassade langsam zu bröckeln schien. »Sie würden zwischen Seelie und Unseelie keinen Unterschied machen.«
Tadhg spürte das Unbehagen, das durch die Menge ging. Obwohl sich die meisten aufgrund des Vergessen-Trunkes nicht mehr an die Zeit vor der großen Schlacht erinnern konnten, waren sie dennoch sehr viel älter als der knapp dreihundert Jahre junge Sluagh-Fürst. Sie erinnerten sich sehr wohl an die unberechenbaren Angriffe und den Schrecken, den das Wilde Heer verbreitet hatte, als sie noch zu sechst waren und unter der Herrschaft des alten Anführers gestanden hatten. Bevor es den Fürsten gab.
Der Prinz winkte wieder ab. »Ein kleines Opfer, dafür, dass das Unseelie-Volk seine Magie zurückbekäme. Aber dank Euch und Eurer kleinen Abkommen, die Ihr hinter unserem Rücken mit den Seelie schließt, ist das für mindestens ein weiteres Jahrhundert nicht möglich.«
Bevor der Sluagh-Fürst die Möglichkeit bekam, etwas zu erwidern, brach Chaos aus. »Verräter!« wurde gerufen und »Seelie-Geck«, »Überläufer«, »Feind«. Sogar »Tod dem Fürsten!« riefen einige. Einer der Fay trat mit gezücktem Schwert aus der Menge und stellte sich vor den Heerführer, der seinerseits ein Schwert aus einer Rückenscheide zog.
So langsam wurde es interessant. Obwohl der Sluagh-Fürst noch recht jung war, parierte er den Angriff ausgezeichnet und schien dem anderen im Schwertkampf überlegen zu sein. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich für die beiden Kämpfer eine freie Stelle gebildet, in der sie sich gegenseitig in die Mangel nahmen. Die aufgeheizte Menge stand um sie herum und feuerte den Favoriten an. Nicht der Heerführer war Favorit, so viel stand fest. Die Meute wollte sein Blut.
Statt sich wie alle anderen auf den Kampf zu konzentrieren, beobachtete Tadhg den Prinzen, der zufrieden vor sich hin grinste. Mit seiner Fresse grinste Uisdean ständig, doch er wirkte auch sonst mit der Entwicklung zufrieden. Offenbar hatte er genau das gewollt. Was lief zwischen den beiden Männern ab? Weshalb wollte der Prinz den Tod oder zumindest die Verstümmelung des Heerführers?
Ein Raunen, das durch die Menge ging, lenkte Tadhgs Aufmerksamkeit zurück auf den Kampf. Inzwischen hatte sich der Typ mit dem Morgenstern dem Gefecht angeschlossen, und während der Sluagh-Fürst ihn abwehrte, erwischte ihn der andere mit dem Schwert an einem der Schwingen. Der Sluagh-Fürst zischte, als das Blut an dem Flügel hinabfloss. Bevor der andere Unseelie jedoch erneut mit seinem Schwert ausholen konnte, sprang der Sluagh hervor, pinnte ihn am Boden fest und schlug mit der messerscharfen Kante seines Schädels auf seinen Körper ein. Knochen brachen, Blut spritzte, Eingeweide verteilten sich auf dem Boden.
In der Halle wurde es totenstill. Der Kerl mit dem Morgenstern stand wie eine Elfenjungfrau inmitten einer Horde Koboldmänner und versuchte sich unauffällig in die Menge zurückzuziehen. Der Sluagh ließ kurz von dem Gemetzel an seinem Opfer ab, sah zum anderen auf und fauchte. Wenn er ihn nicht jetzt tötete, dann irgendwann in naher Zukunft. Diese Gewissheit spiegelte sich auch auf den Zügen von dem Kerl mit dem Morgenstern, den er jetzt nur noch schlaff neben sich herunterhängen ließ.
Außer den schmatzenden Geräuschen des Sluaghs, der gerade dabei war, die Seele seines Opfers zu verspeisen, hörte man keinen einzigen Laut mehr, niemand wagte auch nur zu atmen.
Mit einem theatralischen Seufzen durchbrach der Sluagh-Fürst die Stille. »Da ich nun eure ungeteilte Aufmerksamkeit habe, erlaubt mir, die Umstände dieses Abkommens zu erklären. Nicht dass ich meine, mich vor euch rechtfertigen zu müssen, doch ich denke, dass es das Beste ist, um in Zukunft derartige Ausschreitungen zu vermeiden.«
Verdammt, in dem Kerl steckte mehr Seelie, als ihm vermutlich selbst bewusst war. Seine ganze Art roch nach dem leuchtenden Hof, und bei ihm wirkte es, im Gegensatz zum Koboldherrscher und seiner Gattin, authentisch.
K’vrogs nickte dem Heerführer knapp zu, eine stille Aufforderung, fortzufahren. Dass selbst dem Kobold die Worte fehlten, war außergewöhnlich. Der Flügel des Sluagh-Fürsten zitterte unkontrolliert, und Blut floss aus dem Schnitt in die dunkelrote Lache, die sich auf dem Boden gebildet hatte.
Cathal nickte K’vrogs knapp zurück. »Durch den Pakt mit Königin Siobhánn bin ich in den Besitz eines äußerst wertvollen Artefakts gekommen.« Er machte eine dramatische Kunstpause. »Eines der vier Heiligtümer der Fay. Gleichzeitig habe ich verhindert, dass die Seelie das Heiligtum an sich reißen und dessen Macht für sich missbrauchen können. Königin Siobhánn hat sogar Lord Vhandor ausgesandt, doch glücklicherweise sind den Seelie die Hände gebunden. Das Heiligtum bleibt für sie derzeit unerreichbar.«
Wieder erfüllte Raunen die Halle, anerkennendes dieses Mal.
»Das leuchtende Schwert der Seelie«, sagte K’vrogs.
Von den Gerüchten, dass der Heerführer der Sluaghs in den Besitz des Schwertes gekommen war, hatte Tadhg gehört, dem jedoch nie viel Bedeutung beigemessen. Als Königin Siobhánn letzten Winter eine offizielle Rede an ihr Volk gerichtet hatte, hatte sich das Schwert jedenfalls in ihrem Besitz befunden. Doch K’vrogs war für gewöhnlich gut informiert.
Der Sluagh-Fürst schüttelte dennoch den Kopf. »Nein, nicht das Schwert. Es befand sich für kurze Zeit in unserem Besitz, doch wir mussten es aus diplomatischen Gründen zurückgeben.«
Laute Pfiffe und Protestrufe ertönten, bevor der Sluagh zur Menge aufsah und seinen drachenartigen Schwanz wie eine angriffslustige Raubkatze unruhig hin- und herbewegte. Unter seinen Klauen lag noch der massakrierte Körper des ersten Kämpfers wie eine blutige Warnung an alle.
Die Menge verstummte wieder und der Heerführer fuhr fort: »Die Seelie schickten wie gesagt Lord Vhandor, um den vermeintlichen Dieb des Schwertes zu finden und ihn mitsamt dem Schwert auszuhändigen. In Wahrheit war das Schwert jedoch von selbst entschwunden.«
»Wie ist das möglich?«, fragte K’vrogs. »Etwas Derartiges ist noch nie vorgekommen.«
Der Sluagh-Fürst lächelte verschlagen. »Wie Ihr wisst, fühlen sich die Heiligtümer zueinander hingezogen. Nachdem mein Heiligtum in den Síd gekommen war, ist ihm das Schwert in die Welt der Menschen gefolgt. Leider musste ich dadurch offenbaren, dass sich dieses andere Heiligtum in meinem Besitz befindet, da die Seelie die Exekution sonst an den vermeintlichen Dieb vollzogen hätten.«
»Ihr sprecht in Rätseln, Fürst«, sagte K’vrogs und schien damit im Namen aller zu reden. Auch Tadhg blickte noch nicht ganz durch. Der Koboldherrscher schüttelte verwirrt den Kopf. »Wie kam das zweite Heiligtum überhaupt in die Menschenwelt? Wurde es ebenfalls gestohlen? Und weshalb solltet Ihr nicht wollen, dass der Dieb seine gerechte Strafe erhält?«
»Ah, ich bin froh, dass Ihr das fragt, mein Freund«, erwiderte der Fürst. »So komme ich endlich zu dem Part, in dem ich erklären kann, weshalb ich angeblich einen Menschen bevorzuge und bereit bin, für das Wohl dieses vermeintlichen Menschen Abkommen mit Königin Siobhánn zu schließen, wie Uisdean vorhin angedeutet hat.« Wieder eine Kunstpause. »Das Heiligtum, der mutmaßliche Dieb des Schwertes und der von Uisdean erwähnte Mensch sind ein und dieselbe Person.«
Alle Blicke richteten sich auf Prinz Uisdean, doch seinem Gesichtsausdruck nach schien er ebenfalls noch im Dunkeln zu tappen und nicht zu wissen, wovon der Fürst sprach.
Weniger verwunderte Tadhg jedoch die Tatsache, dass eines der Heiligtümer zur Tarnung die Form eines dieser Menschen-Fay-Mischlinge angenommen hatte. Es war bekannt, dass die Heiligtümer manchmal verschwanden und irgendwann mit neuer Hülle wieder auftauchten. Und wo konnte man sich vor den Augen der Fay besser verbergen als in einem Menschen?
Bevor K’vrogs die Fassung zurückerlangte, stand ihm einen Moment lang der Mund offen.
»Und …«, fragte er schließlich, »um welches Heiligtum handelt es sich, Fürst Cathal?«
»Um das Gefäß der Macht.«
Erneut brach Aufregung aus, dieses Mal allerdings keine, die sich gegen den Sluagh-Fürsten richtete.
Das waren in der Tat interessante Neuigkeiten. Äußerst interessante. Tadhg richtete sich auf und löste seine Arme aus der Verschränkung. Mit dem Gefäß der Macht könnte er endlich seine Magie zurückerlangen. Es war kurz nach dem Verbrechen, das die Seelie durch den Magieraub an den Unseelie begangen hatten, spurlos verschwunden und galt als verloren.
Verdammt, der Sluagh-Fürst war ein durchtriebener Kerl. Wenn er tatsächlich im Besitz des Gefäßes war, lag es in seiner Hand, für wen er es verwendete. Trotz allem war er ein Halb-Seelie, und Tadhg konnte seine genauen Absichten nicht abschätzen. Auf wessen Seite stand er? Wie viel bedeuteten ihm die Unseelie? Wie sehr wollte er tatsächlich ins Seelie-Territorium zurückkehren?
Diese ungewissen Faktoren gefielen ihm nicht.
Uisdean wirkte ebenfalls unzufrieden, obwohl er nicht auf die Laune des Sluagh-Fürsten angewiesen war. Er hatte seine Mächte, er benötigte das Gefäß nicht.
»Und wo ist es?«, rief Uisdean in die Menge und breitete die Arme aus. »Wo ist das Gefäß, Fürst Cathal?« Er betonte den Titel äußerst abfällig. »Ich sehe es nirgendwo. Seht ihr es etwa?«
Wieder lächelte der Sluagh-Fürst. »Ich habe ihr angeboten, heute mitzukommen und ebenfalls an diesem Treffen teilzunehmen. Doch aus mir absolut unerfindlichen Gründen wollte sie nicht.«
Uisdean verengte seine Augen zu Schlitzen. »Sie?«
»Ja, sie«, erwiderte Cathal. »Sie hält nicht besonders viel von den Fay. Gerade als ich anfing, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihr zeigen konnte, dass der Unseelie-Hof nicht so schlimm ist, wie sie dachte, musstet Ihr, Prinz Uisdean, ihre menschliche Freundin entführen und zu einem seelischen Krüppel machen. Gut gemacht, Uisdean, wirklich gut gemacht. Jetzt sind ihre Vorbehalte größer denn je.«
Nach einigen Augenblicken zeichnete sich endlich Verständnis auf Uisdeans Zügen ab. »Die Dunkelhaarige«, murmelte er.
Cathal nickte. »Aye, die Dunkelhaarige. Der besagte Mensch, den ich angeblich über die meinen stelle.«
Tadhg hatte zwar keine genaue Ahnung, was zwischen den beiden Männern abgelaufen war, doch so langsam formte sich ein Bild. Es ging um eine Frau. Das Gefäß der Macht war … eine Frau?
»Ich werde einiges an Arbeit leisten müssen«, sagte der Seelenfänger verärgert, »um sie auf unsere Seite zu bekommen. Im Moment sieht es nicht gut aus.«
»Wir können sie einfach zwingen«, zischte Uisdean.
K’vrogs mischte sich ein. »Das wäre unklug. Das Gefäß der Macht ist ein Heiligtum, man kann es zu nichts zwingen. Sie muss sich freiwillig auf unsere Seite schlagen und für unsere Sache kämpfen wollen«, sagte er ehrfürchtig. Andere Unseelie stimmten ihm zu.
»Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, Prinz Uisdean, doch abgesehen davon steht sie unter meinem Schutz«, fügte der Sluagh-Fürst nonchalant hinzu, als wäre es eine unbedeutende Nebensächlichkeit, was nicht der Fall war. Niemand würde es wagen, sich mit den Sluaghs anzulegen.
Uisdean spuckte neben sich auf den Boden. »Dann frage ich, wo Eure Loyalitäten liegen, Fürst Cathal?«
»Vorsicht, Uisdean«, zischte der Sluagh-Fürst. »Ihr habt mich heute schon genug gereizt und meine Geduld mit Euch neigt sich allmählich dem Ende zu.«
Obwohl sich Nassaïr, erster Anwärter auf den dunklen Thron, Schlangen-Lord, bisher aus den Streitigkeiten zwischen seinem jüngeren Bruder und dem Sluagh-Fürsten herausgehalten hatte, baute er sich jetzt neben Uisdean auf. Seitdem Tadhg denken konnte, hatte es niemand gewagt, die Prinzen zu bedrohen. Die Prinzen hielten zusammen, das war schon immer so gewesen. Der Seelenfänger konnte sich einiges herausnehmen, weil er das Wilde Heer im Rücken hatte und dank seines Seelie-Sluagh-Erbes mit Magie geboren worden war. Die Sluaghs waren die einzigen Kreaturen des Unseelie-Hofes, denen die Magie damals aus naheliegenden Gründen nicht genommen worden war. In der Tat gehörte das Wilde Heer nicht einmal wirklich zum Unseelie-Hof. Es stand für sich selbst.
Doch auch die Prinzen hatten ihre Magie. Der Heerführer durfte es nicht zu weit treiben. Niemand würde es sich mit allen dreien auf einmal verscherzen wollen, nicht einmal ein Heerführer der Wilden Jagd.
Nicht einmal Tadhg selbst.
K’vrogs räusperte sich. »Und wie stehen die Chancen dafür, dass sich das Gefäß der Macht auf unsere Seite schlägt, Fürst Cathal?«
Die Miene des Seelenfängers wurde wieder ein wenig freundlicher, als er sich dem Kobold-Herrscher zuwandte. »Schwer zu sagen, K’vrogs. Unser Glück ist, dass sie sehr misstrauisch ist und auch den Seelie nicht über den Weg traut. Seit die Seelie wissen, was sie ist, umgarnen sie sie mit all ihren Mitteln, doch sie bevorzugt es derzeit, in der Menschenwelt zu bleiben. Wir sollten sie nicht drängen. Ich arbeite daran, langsam ihr Vertrauen zurückzugewinnen.«
K’vrogs nickte. »Tut, was Ihr tun müsst, Fürst Cathal, und hoffen wir auf das Beste.«
Anschließend wurden noch einige unwichtige Themen besprochen, bevor sich die Menge allmählich auflöste und jeder seiner Wege ging.
Tadhg verließ die Halle der Kobolde mit gemischten Gefühlen und ließ sich alles genau durch den Kopf gehen. Wenn dieses Treffen eines gezeigt hatte, dann, dass die Unseelie noch nicht bereit dafür waren, die Seelie herauszufordern. Das dunkle Volk war zu zerrüttet und zweifelte, nicht zu Unrecht, die Loyalität ihrer einzigen wahren Waffe an. Abgesehen davon fiel die für die nächsten hundert Jahre sowieso weg. Tadhg traute dem Sluagh-Fürsten zudem nicht, er schien seine eigenen Ziele zu verfolgen.
Er würde sich etwas anderes überlegen müssen, um an seine Magie zu kommen. Vielleicht sollte er das Gefäß selbst einmal aufsuchen? Doch das würde der Sluagh-Fürst erfahren. Verflucht.
»Auf ein Wort, Crom Cruach?«
Am Ausgang des Berges, der Grenze zum Reich der Kobolde, drehte sich Tadhg nach der Stimme um. Prinz Uisdean näherte sich ihm, blieb jedoch in einem respektvollen Abstand vor ihm stehen und neigte seinen Kopf zu einer angedeuteten Verbeugung. Seine Brüder standen nahe genug, um zur Not eingreifen zu können, doch gleichzeitig so weit entfernt, dass sie nicht von einer Gefahr auszugehen schienen. Uisdean hatte ihn mit seinem Götternamen angesprochen. Er wollte vermutlich keinen Streit anfangen – aber bei den Prinzen wusste man nie.