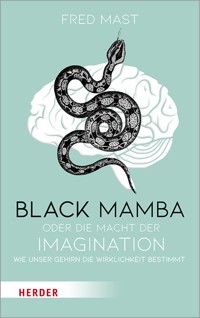
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alles nur Einbildung? Oder wie wirklich und überlebenswichtig ist die Imagination? Der renommierte Psychologe und Kognitionsforscher Fred Mast führt durch die Wunderwelt des Gehirns und dessen Fähigkeit zur Imagination. Fantasie und Imagination sind die wichtigsten Eigenschaften der menschlichen Psyche. Sie sind nicht nur der Motor von Kreativität und der Ursprung von Traumwelten, sie bilden die Basis der Wirklichkeit. In diesem fulminanten Buch präsentiert Fred Mast das Reich der Imagination in all seinen überraschenden und faszinierenden Facetten. Und nicht zuletzt verrät er das Geheimnis von Black Mamba. "Als Schnittstelle zwischen Geist und Körper ermöglicht die Imagination nicht nur sinnvolles Wahrnehmen, sondern sie ist auch das wichtigste Werkzeug des Denkens, kann Schmerzen bezwingen und lässt den eigenen Tod erkennen. Imagination macht den Mensch zum Menschen." Mithilfe der Fantasie kann der Mensch bessere Entscheidungen treffen und sich auf die Konsequenzen von Entscheidungen vorbereiten. Die Fantasie dient der effizienten Erfassung der Realität. Sie ist nicht ihr Gegenspieler, sondern sie ist auf die Fantasie angewiesen und von ihr geprägt. Fantasie ist dazu da, Probleme zu lösen. Sie ermöglicht, in Gedanken Szenarien zu entwickeln und abzuschätzen, ob sie funktionieren. Und es ist möglich, dass die Fantasie auf Irrwege führt. Im Dreieck von Kognitions-, Neuro- und Computerwissenschaft eröffnet Mast ein Terrain, das aktuell hochinteressant und forschungsmäßig zukunftsweisend ist. Er stellt Fragen und skizziert forschungsbasierte Antworten, die zu neuen Fragen Anlass geben. Er zeigt Sichtweisen, die sich abseits gängiger Denkgewohnheiten bewegen und die das Potenzial zu neuen Einsichten in sich bergen. Dabei legt er einen humorvollen und unterhaltsamen Ton an den Tag. Unter Überschriften wie Begegnung mit Sonny Crockett, Schneewittchen entwischt Spiderman oder Kekse, Kekse, Kekse berichtet er von der Psychophysik des Alltagslebens über mentale Repräsentationen, von der Funktion der Träume über die Halluzinationsmaschine, von den Verirrungen der Imagination bis hin zur Frage, ob auch Maschinen Fantasie haben: Fred Mast gelingt ein einzigartiges Buch über die Macht der Imagination, dem evolutionären Jackpot des Menschen. Wissenschaftlich fundiert und mit Witz!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Fred Mast
Black Mamba
oder
die Macht der Imagination
Wie unser Gehirn die Wirklichkeit bestimmt
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Tanja Geier, NiceDay Advertising
Umschlagmotiv: © marina_ua/iStock/Getty Images
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN E-Book 978-3-451-81688-8
ISBN Print 978-3-451-60087-6
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1: Welche Realität hätten’s denn gern?
Facts first
Schein oder Realität
Kapitel 2: Heilen mit nichts
Identität von Geist und Gehirn
Kapitel 3: Ohne Balance keine Chance
Begegnung mit Sonny Crockett
Ruf doch mal nicht an
Im falschen Film?
Alles im Lot?
Völlig losgelöst
Seele und Körper im Gleichgewicht
Kapitel 4: Sie verkannten die Mücke – Grüße aus dem Kambrium
Anatomie eines Augen-Blicks
Haltung bewahren
Entlarvt? Mach die Fliege!
Wiege der Kognition
Kapitel 5: Der Simulator im Kopf
Kognitiver Quantensprung
Wiggle your big toe
Ungewollt verwirklichte Vorstellung
Der evolutionäre Jackpot
Kapitel 6: Upgrade@Gehirn
Gäste aus Cybatron
Unterschätzte Kombinatorik
Mentale Repräsentationen
Empfang am Flughafen
Das Muttermal
Bildhafte Vorstellung
Kapitel 7: New York, New York
Psychophysik des Alltagslebens
So viele Entscheidungen
Nulltoleranz ist nicht fehlerfrei
Das Dr.-Silverman-Syndrom
Kapitel 8: Das innere Auge sieht mehr
Das innere Auge untersuchen
It’s all virtual
Aphantasie
Kapitel 9: Sprachlose Gedanken
Neues entdecken
Mehr als tausend Worte
Subjektive Zeit
Kapitel 10: Das Ich und sein Selbst
Somatische Marker
Gefühlsansteckung
Das Ich im Bodybuilding-Körper
Heute, hier und jetzt
Böse Geister
Kapitel 11: Verirrungen der Fantasie
Der Feind im Körper des Freundes
Resident Evil
Vergnügung mit der Gummihand
Halluzinationen
Agency
Kapitel 12: Kinder denken anders
Naiver Optimismus
Imaginäre Freunde
Maiers Seilproblem
Schneewittchen entwischt Spiderman
Frei erfundenes Zeugs
Kapitel 13: Digitale Apokalypse und Killerfantasien
Über Auf- und Entrüstung
Die Gewalt aus der Konsole
Genie mit Schlagring
Neurogenese
Kapitel 14: Sind Träume nur Schäume?
Die Halluzinationsmaschine
Träume entschlüsseln
Freuds Vermächtnis
Weitere Traumfänger
Kapitel 15: Haben Maschinen Fantasie?
Agent Smith
Technologieskepsis
Digitale Komponisten
Die Sache mit der Ethik
Experten – was nun?
Fakt oder Fiktion?
Alles ist virtuell
Die neue Partnerschaft
Kapitel 16: Kreativität – das neue Kapital
Langweiliges Experiment
Das kreative Gehirn
Stilmittel Metapher
Kapitel 17: Hunde, wollt ihr ewig leben?
Motivmanagement
Kekse, Kekse, Kekse
Endspiel
Der Gotteswahn
Vaterkomplexe
Terror Management
Kapitel 18: Mehr Fantasie
Fantasiefixierung
Die dunkle Seite der Fantasie
Flexibilität
Fantasie und Innovation
Fantasie in der Businesswelt
Reality-Check
Betriebsanleitung
Referenzen
Danksagung
Über den Autor
Vorwort
Die Initialzündung zu diesem Buch geschah vor sehr langer Zeit. Als ich ein kleiner Junge war, fuhr meine Mutter mitten im Sommer auf einer lang ausgedehnten Asphaltstraße. Ich war mir sicher, in der Ferne auf der Straße Wasserpfützen zu sehen. Als wir die Stelle erreichten, war die Pfütze nicht mehr da. Wie konnte das sein? Alles nur ein Schein? Ich war mir doch so sicher, dass ich die Wasserpfützen gesehen hatte. Diese Luftspiegelung hat mich beschäftigt.
Ich wurde Wahrnehmungspsychologe. Mit der Zeit wurde mir klar, dass wir unsere Wahrnehmung nicht als Ergebnis der auf uns einwirkenden Sinnesreize verstehen können. Das ist die falsche Perspektive. Innere Prozesse, die sich durch Erwartungen und Vorwissen manifestieren, sind entscheidend, und sie erst machen unsere Wahrnehmung zu dem, wie wir sie erleben.
Eng an unsere Wahrnehmung ist auch die Fähigkeit zu Imagination und Fantasie gekoppelt. Mithilfe der Imagination planen wir unsere Zukunft und können in mentalen Simulationen mögliche Wirklichkeiten erproben oder von entrückten Welten träumen. Die Macht der Imagination ist ein evolutionärer Jackpot, und unsere Wahrnehmung ist der Schlüssel zu ihrem Verständnis. Imagination interagiert einerseits mit den Sinnesreizen, denn diese liefern unvollständige Daten. Andererseits setzen wir die Imagination davon ganz unabhängig als Simulator ein. Dieser kognitive Quantensprung lässt uns Künftiges antizipieren, wichtige Entscheidungen abwägen und Innovation und Fortschritt entstehen.
Als Schnittstelle zwischen Geist und Körper ermöglicht die Imagination nicht nur sinnvolles Wahrnehmen, sondern sie ist auch das wichtigste Werkzeug des Denkens, kann Schmerzen bezwingen und lässt den eigenen Tod erkennen. Imagination macht den Mensch zum Menschen. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir Vorstufen bereits bei Tieren bis hin zu den Insekten finden. In zunehmendem Masse sind auch Maschinen zu vergleichbaren Leistungen fähig, oder sie übertreffen uns sogar.
Dieses Buch ist thematisch im Dreieck von Kognitionswissenschaft, Neurowissenschaft und Computerwissenschaft situiert, einem Terrain, das aktuell hochinteressant und forschungsmäßig zukunftsweisend ist. Es stellt Fragen und skizziert forschungsbasierte Antworten, die zu neuen Fragen Anlass geben. Bei der Wahl der Inhalte legte ich Wert auf die Darstellung von Sichtweisen, die sich abseits gängiger Denkgewohnheiten befinden und das Potenzial zu neuen Einsichten in sich bergen. Am Schluss des Buches sind kapitelweise die relevanten Quellenangaben aufgelistet. Bei der Abfassung des Buches war mir eine gendergerechte Sprache ein großes Anliegen. Nicht aus strategischem Kalkül, sondern weil ich auch in der Sache daran interessiert bin. Ich habe mich dafür entschieden, die weibliche und männliche Form zu alternieren.
Erklärungsbedürftig ist wohl noch der eigentümlich anmutende Titel dieses Buches. Ich sollte darauf hinweisen, dass Black Mamba allfällig vorhandene biologische Vorkenntnisse in Herpetologie nicht erweitern wird. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Mein Anspruch ist, dass ich mit diesem Buch zum Nachdenken anrege. Wenn das gelingt, ist das Vorhaben geglückt.
Bern, 3. Januar 2020
Kapitel 1:Welche Realität hätten’s denn gern?
Was ist real und wo beginnt Fiktion? In meinen Kinderjahren lief die Serie »Raumschiff Enterprise« im Fernsehen, und ich war von den fabelhaften Abenteuern in fernen Galaxien sehr angetan. Mein Vater, ein promovierter Physiker, war für diese Science-Fiction-Serie weniger empfänglich. »Das ist ja alles frei erfundenes Zeugs. Einen Heisenberg-Kompensator, der beim Beamen die Unschärfe der Quantenpositionen ausgleicht, gibt es einfach nicht. Das ist Humbug«, meinte er. Gegen seinen Vorbehalt könnte ich heute einwenden, dass sich unrealistische Szenarien in Science-Fiction-Filmen Dekaden später als korrekte Vorwegnahmen der Wirklichkeit erweisen können. Dazu gehören zum Beispiel die Tarnkappentechnik (Stealth Technology) im Flugzeugbau, die eine Radarortung erschwert, ferner die automatische Sprachübersetzung oder die künstliche Schwerkraft (Artificial Gravity), die von der NASA zur Vorbereitung der Marsmission eingesetzt wird. All das konnten wir bereits vor seiner Umsetzung in Science-Fiction-Filmen bestaunen. Andere Ideen blieben »frei erfundenes Zeugs«. Die Antwort auf die Frage, ob etwas real ist, hängt also von dem Zeitpunkt der Fragestellung ab. Was heute Fiktion ist, kann morgen Realität sein. Zu einem gegebenen Zeitpunkt lässt sich aber eine klare Antwort geben: Entweder gibt es einen Heisenberg-Kompensator, oder es gibt ihn nicht. Darauf ist zum Zeitpunkt X nur eine Antwort möglich. Wenn heute dieser Tag X ist, dann lautet die Antwort darauf eindeutig: Nein. Aber ist die Frage danach, ob etwas real ist, somit erledigt? Mitnichten.
Realität hat mehrere Facetten. Es geht bei der Frage nach der Realität auch darum, wie wir Fakten bewerten. Wann halten wir bestimmte Informationen für wahr? Wieso halten wir andere Informationen für belanglos oder beliebig? Und wann halten wir Information für falsch? Wie fällen wir diese Urteile? Und worauf stützen wir uns, wenn wir bestimmte Quellen als vertrauenswürdig einschätzen und andere nicht? Diese Fragen sind keinesfalls einfach zu beantworten. Wie Menschen entscheiden, bestimmt über Krieg oder Frieden, über Leben oder Tod oder über wirtschaftliches Wachstum oder Bankrott. Trotz immenser Betonung von Fakten fließt bei der Beurteilung von Realität sehr viel Subjektives mit ein. Worauf stützen wir uns bei der Beurteilung von Realität? Was sind die Kriterien?
Naheliegend ist die Sinnfälligkeit. Real wäre demnach das, was wir sehen, hören, spüren können. Unsere Wahrnehmung erscheint uns zunächst eine sinnvolle Orientierung dafür zu geben, was wahr oder falsch ist. Zwei Drittel des Affengehirns sind mit der Analyse visueller Sinnesformationen beschäftigt. Und bei Menschen dürfte es ähnlich sein. Über unsere Wahrnehmung erfahren wir sehr viel über die Welt. Aber ist alles, was wir sehen, auch real?
Tauchen Sie einen Stab – etwa einen Kochlöffel – in klares Wasser und lassen Sie ihn ein Stück herausragen. Sie werden einen Knick im Stiel sehen, aber werden kaum glauben, dass der Stiel nun geknickt ist. Die Ursache für das Phänomen: Licht bricht sich in Luft und Wasser unterschiedlich. Schon Fischer in der Steinzeit haben diese Sinnestäuschung bei der Jagd nach Fischen berücksichtigt. Sie mussten mit ihrem Speer einen Punkt neben dem Fisch ins Visier nehmen, um Beute zu machen.
Eine angemessene Beurteilung des Wahrgenommenen war für den Jagderfolg und somit für das Überleben relevant, da die Fischer der Steinzeit weder beim Pizza-Service eine Bestellung aufgeben konnten noch viele andere Nahrungsquellen zur Verfügung hatten. Sinnesinformationen sind also für die Bestimmung des Realitätsstatus, ob etwas real ist oder nicht, nicht hinreichend. Menschen entscheiden von Fall zu Fall, ob eingehende Sinnesdaten die Realität abbilden oder nicht. Sinnfälligkeit kann nicht mit Realität gleichgesetzt werden kann. Manchmal sehen die Dinge eben nur so aus, als wären sie real.
In neuerer Zeit erfreut sich der Begriff virtuelle Realität einer gewissen Popularität. Virtuelle Realität im Computerspiel sieht real aus, und wir tauchen darin ein, letztlich bleibt sie aber Schein. Doch wir tun alles, um den Schein nicht auffliegen zu lassen, täuschen unsere Sinne ganz bewusst, um uns zu unterhalten und zu zerstreuen. Wir kapseln uns mit Datenbrillen von der Realität ab. Schon in der Steinzeit war nicht alles real, was Menschen sahen. Aber die technologischen Neuerungen unserer Zeit fordern uns in dieser Hinsicht noch viel mehr heraus. Überzeugend realistisch gestaltete, computeranimierte virtuelle Realitäten, in denen wir gleichzeitig auch agieren, fordern uns auf nie gekannte Weise, Reales von nicht Realem zu unterscheiden. Der Steinzeitmensch hatte es einfacher, weil er die Konsequenzen unmittelbar erfahren hat, wenn er den Schein nicht durchschaut hat. Hunger. In der virtuellen Realität ist diese Rückmeldung aber absichtlich ausgeschaltet, damit der Schein so real wie nur möglich wirkt.
Mit der Technik, virtuelle Realität herzustellen, lassen sich neben unterhaltenden auch praktische, nützliche Anwendungen entwickeln. So setzen Therapeuten etwa bei der Behandlung von Phobien die virtuelle Realität ein. Die Begegnung mit der virtuellen Spinne löst beim Angstpatienten die phobische Reaktion genauso aus wie eine reale Spinne. Therapeutinnen sprechen hierbei von der »Exposition mit dem angstauslösenden Stimulus«. Sie müssen also keine realen Spinnen besorgen, um ihre Patienten zu heilen, oder mit Patienten, die Höhenangst haben, auf reale Türme steigen, um die Höhenangst zu bekämpfen. Es spielt offenbar keine Rolle, ob die Spinne nur von einem Grafikprogramm erzeugt wurde. Obwohl die virtuelle Spinne, wenn der Patient die Augen schließt, verschwindet – anders, als wenn es eine reale Spinne wäre –, ist der Angstpatient bereit, sich auf den Schein einzulassen. Angstpatienten tauchen problemlos in die virtuelle Realität ein: Je nach Phobie schrecken sie vor einer virtuellen Spinne zurück. Oder sie fürchten einen Abgrund, verlieren nahezu das Gleichgewicht beim Blick in die virtuelle Tiefe. Oder sie schwitzen und erleben sozialen Stress, wenn sie vor einem virtuellen Publikum einen Vortrag halten müssen.
Offenbar können wir unser Erleben von Realität nicht daran festmachen, ob eine Spinne da ist oder nicht, da die Reaktion auf virtuelle und reale Spinnen gleich stark ausfällt. Eine Unterscheidung zwischen erfundenen und nichterfundenen Inhalten scheint demnach nicht ergiebig, wobei es natürlich schon eine Rolle spielt, ob sich tatsächlich eine Spinne im Raum befindet oder nicht.
Unserem Sinn für Realität haftet anscheinend etwas Subjektives an. Nur wie lässt sich dieses Subjektive festmachen, ohne sich dabei in uferlosem Assoziieren zu verlieren? Sprache ist ohne Zweifel eine wichtige Errungenschaft, die den Menschen auszeichnet. Als Vehikel für den Erkenntnisgewinn muss sie hingegen kritisch betrachtet werden. Viele Wissenschaften forschen mit empirischen oder gar experimentellen Verfahren, deren Ergebnisse nicht von der Art der Formulierung und sprachlichen Finessen abhängen. Forschungsergebnisse haben eine hohe Verbindlichkeit. Sprache hingegen ermöglicht Beliebigkeit. Und Beliebigkeit ist gefährlich. Es ist ja keineswegs so, dass wir unsere eigene Realität auswählen können. »Was bin ich?« hieß ein Quiz im Fernsehen mit dem Moderator Robert Lembke (bis 1989), in dem der Beruf eines Gastes von einem Rateteam ermittelt werden sollte. Nach einer sehr kurzen Vorstellung stellte Lembke jede Woche und über Jahre hinweg stets die gleiche Frage: »Welches Schweinderl hätten’s denn gern?« Es gab mehrere Farben zur Auswahl, und nach jedem erfolglosen Ratedurchgang wurde eine Fünf-Mark-Münze in das vom Gast gewählte Sparschwein gesteckt. Robert Lembke stellte seine Frage stets mit ernster Miene, was in Anbetracht der absoluten Belanglosigkeit der Antwort, die weder für den Ausgang des Ratens noch irgendwie sonst für den weiteren Verlauf der Sendung bedeutend war, einen subtilen Kontrast aufbaute und das Publikum erheiterte. Diese uneingeschränkte Beliebigkeit ist bei der Auswahl der Realität nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. Realität ist verbindlich. Schizophrene Patienten hören Stimmen und halten sie für real. Sie sind in ihrem Leben extrem beeinträchtigt. Sie haben keine Wahl.
Facts first
Ein ausgereiftes, brauchbares theoretisches Gerüst, wie wir die Realität erleben, hat der Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger (1940) in seinem Buch Psychologie entwickelt. Es ist einerseits bedauernswert, dass seine Ideen heutzutage nicht weiter verbreitet sind. Andererseits erstaunt es nicht, denn seine Ausführungen sind sprachlich schwer verständlich abgefasst und setzen eine hohe Motivation der Leserschaft voraus. Metzger hat zuerst eine Unterscheidung zwischen der Wirklichkeit im ersten Sinn und der Wirklichkeit im zweiten Sinn getroffen. Was meint er damit? Erstere bezieht sich auf wissenschaftlich nachweisbare Fakten. Zum Beispiel die Beschaffenheit bestimmter Materien oder ihre chemische Zusammensetzung. Demgegenüber steht die für uns interessantere Wirklichkeit im zweiten Sinn, mit der eine Standortbestimmung und Ordnung der Phänomene vorgenommen wird. Dadurch wird dem subjektiven Erleben eine Eigenständigkeit zugesprochen. Phänomene gilt es ernst zu nehmen. Nehmen wir als Beispiel eine Halluzination von Stimmen, so wie in der Schlussszene von Alfred Hitchcocks Film »Psycho« (1959), in dem der Serienmörder Norman Bates die Stimme seiner internalisierten Mutter hört, die am Schluss des Films sogar vollständig von ihm Besitz ergreift. Eine Halluzination ist in der Wirklichkeit im zweiten Sinne real, weil aus der Sicht der betroffenen Person die gehörten Stimmen echt sind, als real erlebt werden und das Handeln massiv beeinflussen können. Aus der Perspektive der Wirklichkeit im ersten Sinne sind die Stimmen natürlich nicht real. Es sind keine messbaren Schallwellen vorhanden. Es gibt keinen physikalischen Reiz, die Stimmen entstehen im Kopf der halluzinierenden Person. Diese Unterscheidung scheint auf den ersten Blick trivial. Vermengungen von Wirklichkeit im ersten und zweiten Sinn halten sich hingegen hartnäckig und geben Anlass zu Missverständnissen, die sich manchmal sehr subtil in Diskussionen und Behauptungen einschleichen.
Der amerikanische Nachrichtensender CNN stellt sich neulich mit dem Motto Facts first dar. Damit soll ein exklusiver und unverfälschter Zugang zu Fakten nahegelegt werden, so wie sie Metzger der Wirklichkeit im ersten Sinne zuordnet. Dort gehören Nachrichten aber nicht hin. Die Inhalte von Nachrichten werden ausgewählt, durch die Häufigkeit ihrer Verbreitung erfolgt eine Gewichtung und ihre Auswahl ist von bewussten und unbewussten Interessen gesteuert. Nachrichten sind bestimmt nicht objektiv, weder in der westlichen Welt noch im abgeschotteten Nordkorea. Es sind Menschen, die Nachrichten erstellen, auswählen und verbreiten. Die Gültigkeit von Nachrichten basiert bestenfalls auf einer Konvention. Mit Facts first überhöht sich der Nachrichtensender in den Status einer Forschungsinstitution, die imstande ist, wissenschaftlich abgesicherte Fakten zu liefern. Ein Nachrichtensender schafft keine Fakten, sondern wählt diese aus und präsentiert sie. Natürlich gibt es gravierende Unterschiede, wie weit sich Nachrichten von Fakten entfernen und diese missachten.
Die Frage nach der Realität ist also keineswegs trivial und stellt uns vor große Herausforderungen. Die Wirklichkeit im zweiten Sinne ist in diesem Zusammenhang deswegen so interessant, weil sie das Subjektive aufwertet, unhinterfragt bestehen lässt und auf sinnvolle Weise ordnet. Es geht darum, wie wir mit Fakten umgehen. Ein in Wasser eingetauchter Stab sieht geknickt aus. Er sieht so aus, aber wir nehmen die gesehene Formveränderung nicht ernst. Wir sind uns des Scheins bewusst. Wir wissen, dass unsere sensorischen Daten nicht die Realität abbilden. Auch Gefühle können uns im Modus des Scheins begegnen. Gefühle sieht man nicht so direkt wie den Knick im eingetauchten Stab und man muss sie aus Äußerungen und der Körpersprache des Gegenübers erschließen. Erfahrung und Wissen helfen natürlich auch mit bei der Bewertung von Gefühlen. Die übertriebene Freundlichkeit der Bedienung in einem amerikanischen Restaurant nehmen wir als solche nicht ernst. Sie ist aufgesetzt, wirkt gespielt und durch das erwartete Trinkgeld gesteuert. Geheucheltes Mitleid erkennen wir oft als solches und nehmen es nicht ernst. Auch ein Vorgesetzter, der in seiner Führungsfunktion überfordert ist und dies zu überspielen versucht, wird von den Mitgliedern des Teams nicht wirklich ernst genommen, obschon er der Chef ist. Denn er tut nur so, als hätte er die erforderliche Führungskompetenz. Auch das ist ein Schein.
Schein oder Realität
Als real erleben wir die Objekte und Personen in der Umgebung sowie unseren eigenen Körper. Wir gehen davon aus, dass unsere Umgebung sowie unser Körper tatsächlich vorhanden sind. Real sind aber auch viele Gefühle. Die echte Anteilnahme und Trauer nach dem Verlust einer geliebten Person. Die Freude im Gesicht eines Kindes, wenn es eine schwierige Aufgabe erfolgreich gemeistert hat. Wie wir Anteilnahme und Freude erkennen, ist komplexer als die Wahrnehmung der Farbe Blau oder des Dufts von Rosen. Es beruht auf einer Mischung von verbalen und nonverbalen Informationen. Als soziale Lebewesen verfügen wir über ein sehr gut entwickeltes Sensorium, das uns empfänglich macht für Stimmungen, die sich in der Körpersprache des Gegenübers, in der Stimme, den Bewegungen und dem Blickverhalten äußern.
Wir beurteilen Erfahrungen auf der Dimension real – irreal. Real schätzen wir diejenigen Dinge und Situationen ein, von denen wir ausgehen, dass sie Substanz haben, verbindlich sind und uns Widerstand leisten. Der glühende Sand in der Mittagshitze beim Strandurlaub, die Säule, die man soeben beim Einparken touchiert hat, oder die Sturheit der eigenen Kinder bieten uns Widerstand. Sie fordern uns heraus und sind real. Wir hasten schnurstracks über den Sand zum kühlenden Meerwasser, wir verspüren nahezu physischen Schmerz beim Anblick des Kratzers im Heck des neu gekauften Wagens und wir perfektionieren unsere Überzeugungskünste bei schwierigen Verhandlungen mit den eigenen Kindern. Metzger spricht in diesem Sinne vom Angetroffenen. Diese Wortwahl mutet auf den ersten Blick eigenartig an. Wieso spricht man nicht einfach von Wahrnehmung? Das herkömmliche Verständnis von Wahrnehmung impliziert das Vorhandensein eines Reizes wie beim Sehen oder Hören, was beim Angetroffenen nicht unbedingt vorausgesetzt wird. Was ist bei Stimmungen und Gefühlen, die wir wahrnehmen, genau der Reiz? Und Halluzinationen und Träume zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie nicht auf einem Reiz beruhen. Die gehörten Stimmen können nicht aufgezeichnet werden. Die Traumbilder auch nicht. Das Angetroffene ist demnach die passendere Bezeichnung, weil sie unserem Erleben gerecht wird. Es ist die unmittelbar vorhandene subjektive Realität, die den Anspruch auf Wirklichkeit erhebt.
Metzger spricht in diesem Zusammenhang auch vom unwahrnehmbar Vorhandenen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass sich hinter uns (zum Beispiel gerade jetzt) bestimmte Objekte wie eine Mauer oder Tische und Stühle befinden, obschon wir diese nicht sehen. Wir gehen schlichtweg davon aus, dass sie da sind, und wären dementsprechend schockiert, wenn wir nach hinten schauen und diese Erwartung verletzt wird. Deshalb gehören auch nicht sichtbare Dinge zum Angetroffenen. In verschiedenen Ballsportarten ist sich die ballführende Person bewusst, wie andere Spielerinnen und Spieler hinter ihr positioniert sind, obschon sie sie nicht sehen kann. Diese Personen sind in dem Moment ebenfalls unwahrnehmbar vorhanden. Der Absatztrick im Fußball ist ein Zuspiel auf einen momentan nicht sichtbaren Mitspieler, den man zum Zeitpunkt des Abspiels an der entsprechenden Position wähnt. Dieser Mitspieler ist unwahrnehmbar vorhanden. Man ist davon überzeugt, dass er sich an einer bestimmten Stelle des Spielfeldes befindet, und wagt ein Zuspiel, ohne sich vorher mit den Augen von seiner tatsächlichen Position zu vergewissern.
Virtuelle Realität
Virtuelle Realität (VR) ermöglicht ein vollumfängliches Eintauchen in eine computergenerierte Welt. Die virtuelle Welt umspannt 360 Grad und ist in der Regel dreidimensional. Man kann sich in der virtuellen Welt bewegen und oftmals auch hören und taktil spüren und interagieren (z. B. mittels VR-Handschuhen). In der VR hat man das Gefühl, vor Ort zu sein, und die reale Umgebung tritt in den Hintergrund. Typischerweise verwendet VR Datenbrillen mit Stereoprojektion als Ausgabegeräte (z. B. Oculus Rift oder HTC Vive) oder ein CAVE (in Anlehnung an Platons Höhlengleichnis), einen realen Raum mit mehreren Projektionsflächen. Die Entwicklung leistungsstarker Computer hat der Technologie zum Durchbruch verholfen. Wie stark man in virtuelle Realität eintaucht, hängt auch von Persönlichkeitsfaktoren ab. Anwendungsmöglichkeiten liegen momentan im therapeutischen Bereich (z. B. Phobien, Neurorehabilitation), für Trainingsanwendungen (z. B. Flugsimulator, Medizinausbildung), Innenarchitektur, in Videokonferenzen oder in der Unterhaltungsindustrie (Videospiele).
Mentale Simulation
Dem Angetroffenen steht das Vergegenwärtigte gegenüber. Es verweist auf Geplantes, Gedachtes oder Geträumtes. Damit sind also Produkte unseres Denkapparates gemeint, die sich einer direkten Beobachtung weitgehend entziehen. Vergegenwärtigtes verweist auf konkrete Planungen, von deren Umsetzung man ausgeht. Wenn junge Leute planen, wie sie das anstehende Wochenende verbringen möchten, dann gehen sie davon aus, dass sie das Vorhaben auch umsetzen können. Dies unabhängig davon, ob es dann tatsächlich in der geplanten Weise stattgefunden hat. Auch wenn man ein Studium in Angriff nimmt, plant man in der Regel den Abschluss mit ein. Im Modus des Vergegenwärtigten kann man auch vorzüglich verschiedene Szenarien ausprobieren. Wie man den Vorgesetzten um eine Gehaltserhöhung bittet, wie man im Vorstellungsgespräch auf unbequeme Fragen antworten wird oder wie man mit einer attraktiven Person in Kontakt treten kann. Auf der Basis der entsprechenden Simulation entsteht eine bessere Entscheidungsgrundlage, bevor man die entsprechenden Schritte in Taten umsetzen will oder eben nicht. Dabei spielen auch die emotionalen Reaktionen eine Rolle, die bei der Simulation hervorgerufen werden. Je nachdem sprechen wir die attraktive Person eben nicht an, weil die Vorstellung eines peinlichen Einstiegs ins Gespräch oder die vorweggenommene eigene Reaktion auf eine mögliche Ablehnung zu viel Unbehagen auslöst. Man wartet auf eine bessere Möglichkeit, die sich vielleicht ergibt – oder eben vielleicht auch nicht. Vor Reiseantritt können wir das Verstauen der Gepäckstücke im Kofferraum mental simulieren, damit auf diese Weise eine möglichst optimale Konfiguration gefunden wird und wir uns mehrmaliges Ein- und Ausladen sparen können. Das geht zudem schneller, man schwitzt weniger und schont seine Bandscheiben. Dieser mentale Simulator ist für Menschen ein evolutionärer Jackpot. Bevor wir Handlungen in der Realität ausprobieren, simulieren wir sie und treffen auf der Basis der Simulation eine Entscheidung. Wir sind also auch in Gedanken motorisch aktiv und nicht nur dann, wenn wir Arme und Beine tatsächlich bewegen. Die Abkopplung motorischer Hirnareale von einer zwingenden Steuerung der Gliedmaßen ist für die kognitiven Fähigkeiten ein großer Vorteil. Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass bei vorgestellten Bewegungen Hirnareale involviert sind, die auch bei der Ausführung der entsprechenden Bewegungen eine Rolle spielen. Für realitätsnahes Simulieren aktiviert das Gehirn ähnliche Strukturen, wobei im Modus der Simulation keine Bewegungen ausgeführt werden sollen.
Aber was ist mit Tagträumen? Auch beim Tagträumen vergegenwärtigen wir uns gewisse Szenarien. Das trifft zweifellos zu, aber bei den Tagträumen denken wir nicht an ihre Realisierung. Die Inhalte von Tagträumen sind oftmals unwahrscheinlich oder gar unmöglich. In Tagträumen kann man sich vorstellen, ein professioneller Fußballspieler zu sein, der soeben im Endspiel das entscheidende Tor erzielt hat und jubelnd auf die Fankurve zuläuft und sich dort feiern lässt. Mit Sicherheit fühlt sich das gut an, aber man weiß zu jeder Zeit, dass es nicht real ist und nie real werden wird. Vage Gedanken, Luftschlösser und fantastische Szenarien begegnen uns im Modus des vergegenwärtigt Irrealen. Wir nehmen diese Gedanken in dem Sinne nicht ernst, weil wir nicht davon ausgehen, dass sie real werden. Das Tagträumen soll man sich deswegen allerdings nicht vermiesen lassen. Und nutzlos ist das Tagträumen gewiss nicht.
Die Dimension real – irreal kann also nicht nur auf das Angetroffene, sondern auch auf das Vergegenwärtigte angewendet werden. Die auf der nachfolgenden Seite in Abbildung 1 dargestellte Gliederung des subjektiven Erlebens ist ein notwendiger Schritt zu einem besseren Verständnis von Realität, Schein und Imagination und hilft, Gemeinsamkeiten von an sich sehr unterschiedlichen mentalen Vorgängen besser zu verstehen.
Abb. 1: Die Wirklichkeit im zweiten Sinne gliedert sich in vier Quadranten, die sich durch die Achsen Angetroffen – Vergegenwärtigt sowie Real – Irreal ergeben. Die Biegung eines in Wasser eingetauchten Kochlöffels begegnet uns im Modus des Angetroffenen und Irrealen. Eine Halluzination wird als real erlebt. Im Modus des Vergegenwärtigten unterscheiden wir ebenfalls zwischen Realem (z. B. ein fester Plan) und Irrealem (z. B. ein Tagtraum).
Die Wahrnehmung von Realität ist formbar, hängt von Einstellungen ab und auch davon, wie man sich Informationen besorgt. Fakten können gezielt diskreditiert werden, wie wir es aus den Debatten um Fake News kennen. Demzufolge verändert sich die Bewertung der Realität. Wird eine vormals als verlässlich eingestufte Information neu bewertet, kann sie an Glaubwürdigkeit verlieren und zum angetroffenen Schein werden. Man nimmt sie nicht mehr ernst. Die Nachricht wird dann so erlebt wie der Knick eines in Wasser eingetauchten Kochlöffels. Ein Fake. Oder eine vorerst unverbindliche Fantasie kann sich zu einer festen Überzeugung verdichten und wird als real erlebt. Werden wir im Gang auf dem Weg zur Kaffeepause von einer Arbeitskollegin nicht gegrüßt, dann stellt sich schnell das Gefühl ein, dass eine Absicht dahintersteckt. Wiederholt sich das sogar, dann ist das doch die Bestätigung. Man spürt eine bösartige Gesinnung. Diese Person hat etwas gegen uns. Man muss sich nun absichern, denn man weiß nicht, was sie vorhat. Läuft da etwas gegen mich? Werde ich demnächst beim Chef angeschwärzt? Sind allfällige Allianzen im Betrieb gefährdet? Ein anderer Arbeitskollege hat nun auch nicht gegrüßt. Dabei hat er doch immer gegrüßt. Was könnte mir vorgeworfen werden? Wie kann ich mich schützen, wenn es zu Vorwürfen kommt? Das alles könnte sich so zutragen, gemäß dem Slogan des amerikanischen Actionthrillers »Staatsfeind Nr. 1« (Enemy of the State, 1998), der lautete: »It is not paranoia if they are really after you.« In vielen Fällen ist es aber nicht so dramatisch, und die vermeintliche böse Gesinnung anderer Menschen wird massiv übertrieben oder ist schlichtweg nicht vorhanden. Wie kann so etwas passieren? Die Fantasie hat sich zu einer angetroffenen Wirklichkeit verdichtet. Die Bedrohung wird als real erlebt. Wie ist damit umzugehen?
In der Psychoanalyse spricht man von der »Rücknahme von Projektionen«. Dabei geht es genau darum, dass man den eigenen Anteil an einer vermeintlich böswilligen Haltung anderer Personen erkennt. Eine eigene Fantasie wird auf einen anderen Menschen projiziert und als real betrachtet. Dadurch erscheinen mögliche andere Interpretationen weniger wahrscheinlich. Vielleicht hat die nicht grüßende Arbeitskollegin finanzielle Probleme und ist deswegen gedanklich abwesend, eine schwierige Scheidung steht ihr bevor, oder sie macht sich Sorgen über die Drogenprobleme ihrer Tochter. Rücknahme von Projektionen eröffnet mehr Freiheitsgrade und schützt vor zu raschen Interpretationen, an denen man fälschlicherweise zu lange festhält. Fantasie ist zweifellos ein Jackpot, aber es gibt natürlich auch Kehrseiten und Nebenwirkungen.
Kapitel 2: Heilen mit nichts
Vor einigen Jahren habe ich an einem Kongress in New York teilgenommen und im Stadtteil Chelsea im gleichnamigen Hotel eine Übernachtung gebucht. Das war nicht ganz zufällig, denn ich wollte ein Gefühl für dieses Quartier kriegen, das insbesondere Kunstschaffende anzieht. Bevor ich den Schlüssel zu meinem Zimmer erhielt, fragte mich der Concierge, ob ich mir über die Besonderheit des mir zugeteilten Zimmers im Klaren sei. War ich nicht. Und er fuhr fort, dass in jenem Zimmer Arthur Clarke das Drehbuch zu »Space Odyssey 2001« verfasst hat. Zudem soll er das ganze Werk in einer Nacht geschaffen haben. Und das in meinem Zimmer. Der später entstandene Film von Stanley Kubrick hat in der Generation der Babyboomer einen gewissen Kultcharakter erreicht. Mein Hotelzimmer war für New Yorker Verhältnisse vergleichsweise geräumig, aber ansonsten eher karg und einfach eingerichtet. Ich habe in diesem Zimmer eine sehr ruhige Nacht verbracht. Weder erfasste mich ein Schub von Kreativität, noch fanden sonst irgendwelche anderen nennenswerten Ereignisse statt. Am Morgen danach konnte ich weder besondere Einsichten von mir geben noch über spontane Einfälle berichten, die sich von dem abhoben, was mir auch sonst so durch den Kopf geht. Und ein Drehbuch habe ich in jener Nacht schon gar nicht geschrieben.
Warum nicht? Es ist wohl schon so, dass Fantasie offenbar in den Köpfen der Individuen stattfindet und nicht etwa in den Räumen, in denen man sich aufhält. Das hört sich trivial an. Aber so ganz abwegig ist der Gedanke eben doch nicht. Menschen begeben sich bewusst an bestimmte Orte und erwarten, dass dort etwas mit ihnen passiert, wofür ihre physische Präsenz an genau diesem Ort Voraussetzung ist. Nun ist wohl Kreativität in diesem Zusammenhang eine besonders hartnäckige Fähigkeit, die sich nicht gezielt herbeiführen lässt.
Dennoch glauben viele Menschen an eine geradezu wundersame Wirkung von Orten. So suchen zum Beispiel Christen eine Grotte bei Lourdes am Fuß der französischen Pyrenäen auf. Der 14-jährigen Bernadette Soubirous soll dort im Jahre 1858 mehrmals die Mutter Gottes erschienen sein. Lourdes wurde zu einem der bekanntesten Wallfahrtsorte der Welt, und viele kranke Menschen glauben an die heilbringende Wirkung des Quellwassers. Über zahlreiche Spontanheilungen wird berichtet. Inzwischen umfasst die Liste 69 medizinische Wunder. Die Ursache der heilbringenden Wirkung wurde im Quellwasser vermutet. Ausgiebige Laboranalysen attestieren dem Quellwasser hingegen lediglich Trinkwasserqualität. Mehr nicht. Des Quellwassers wegen muss demnach niemand die anstrengende Reise nach Lourdes auf sich nehmen. Das Wasser unterscheidet sich nicht von dem, was in unserer Küche aus dem Wasserhahn fließt.
Ist es nun also völliger Unsinn, nach Lourdes zu pilgern? Müssen die Pilger über die Sinnlosigkeit ihres Tuns aufgeklärt werden? Gegen Skeptizismus ist an sich nichts einzuwenden, aber solche Anspielungen erzeugen nicht nur den Eindruck von Arroganz, sondern sie sind auch – und das mag an dieser Stelle vorerst erstaunen – wissenschaftlich wenig fundiert. Nur weil dem Quellwasser definitiv keine wundersame Wirkung nachzuweisen ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass eine Pilgerfahrt zur nutzlosen Zeitverschwendung wird. Es ist ja keineswegs zwingend, dass eine heilbringende Wirkung nur mittels Wasser von außen herbeigeführt werden kann. Der Pilger führt die Wirkung selber herbei. Mit seinem Glauben an die Wirkung macht er diese erst möglich. Man hört oft, dass der Glauben Berge versetzen kann. Können wir uns etwa selber heilen? Die Antwort darauf lautet: Ja, es gibt diese selbstheilende Kraft. Und es gibt dazu auch sehr fundierte Forschung.
Die selbstheilende Kraft des menschlichen Geistes liegt dem sogenannten Placebo-Effekt zugrunde. Der Glaube an eine Wirkung verstärkt die Wirkung eines Medikaments oder einer Behandlung. Oder der Placebo-Effekt kann sogar allein für die Wirkung verantwortlich sein. Selbstverständlich wird der Placebo-Effekt in der Medizin zur Kenntnis genommen und auch praktisch genutzt. Die Entwicklung eines neuen Medikamentes erfordert eine experimentelle Kontrolle des Placebo-Effektes. Von placebokontrollierten Studien sprechen Mediziner, wenn Personen, die den Wirkstoff, das sogenannte Verum, verabreicht bekamen, mit einer anderen Gruppe (oder zeitverschoben mit der gleichen Gruppe) von Personen verglichen werden, die ein Placebo-Präparat ohne Wirkstoff erhalten haben. Den Teilnehmenden an der Studie ist nicht bewusst, ob sie ein Verum oder ein Placebo erhalten. Der Wirkstoff hat den Test dann bestanden, wenn seine Wirkung den Placebo-Effekt übersteigt. Gegen dieses Vorgehen ist forschungsmethodisch absolut nichts einzuwenden. Es geht um den Nachweis eines statistisch signifikanten Unterschieds. Dennoch ist es erstaunlich, dass Mediziner den Placebo-Effekt als Störgröße mehr oder weniger unhinterfragt hinnehmen. Es ist zwar durchaus nachvollziehbar, dass die Pharmaindustrie dem Nachweis eines Wirkstoffes nacheifert, denn mit dem Placebo-Effekt allein lässt sich eben kein Geld verdienen. Die Unterschiede zur Verum-Gruppe fallen gelegentlich gering aus, und die Placebo-Effekte erklären einen verhältnismäßig großen Anteil des Effekts. Deswegen ist der Placebo-Effekt weitaus mehr als nur eine Störgröße. Der Placebo-Effekt ist ein sehr erklärungsbedürftiges Phänomen, das viel über den Menschen und seine kognitiven Fähigkeiten aussagt.
Warum gibt es denn überhaupt den Placebo-Effekt, und wie kommt er zustande? Wie kann es sein, dass sich der Schmerz verringert, obschon die Personen in der Studie kein Schmerzmittel erhalten haben? Wieso fühlen sich Pilger nach einer Fahrt nach Lourdes besser, obwohl ihnen dort nur Trinkwasser verabreicht wurde. An dieser Stelle könnte der Eindruck entstehen, dass es diesen Placebo-Effekt wohl schon gibt, aber an eine Erklärung ist vorab nicht zu denken, weil die zugrunde liegenden Mechanismen viel zu diffus sind und keine gezielte Untersuchung erlauben. Interessanterweise ist dem nicht so. Es gibt zum Placebo-Effekt fundierte Forschungen mit schlüssigen Ergebnissen. Wenn wir das Beispiel der Schmerzwahrnehmung nehmen, dann hinterlässt nämlich der Placebo-Effekt neuronale Spuren im Gehirn. Er beruht auf der Ausschüttung körpereigener Opiate, den sogenannten Endorphinen. Der eindrückliche Nachweis dafür zeigt sich daran, dass man den Placebo-Effekt pharmakologisch ausschalten kann. Der positive Einfluss von Gedanken auf die Schmerzwahrnehmung kann also pharmakologisch unterbunden werden. Das hört sich zugegebenermaßen sehr abenteuerlich an. Es geht so: Durch die Erwartung einer Schmerzlinderung werden körpereigene Endorphine ausgeschüttet, die sich an die Opiatrezeptoren binden und auf diese Weise die Schmerzen reduzieren. Wird hingegen ein Opiatantagonist1 verabreicht, so kann sich der Placebo-Effekt nicht mehr entfalten, und seine schmerzlindernde Wirkung bleibt aus. Die Opiatrezeptoren werden nämlich durch den Opiatantagonisten blockiert. Das körpereigne Endorphin wird zwar immer noch ausgeschüttet, aber es verliert seine Wirkung, da es sich nicht an die Rezeptoren binden kann. Folglich kann der Placebo-Effekt nicht zum Tragen kommen. Die Gedanken sind neurochemisch wirkungslos.
Agonisten und Antagonisten
Als Agonist wird eine Substanz bezeichnet, die sich im Gehirn mit Rezeptoren bindet und zur Weiterleitung von Signalen dient. Der Agonist kann eine körpereigene Substanz sein (z. B. Hormon oder Neurotransmitter) oder auch ein von außen zugeführter Wirkstoff (z. B. Nikotin). Nikotin imitiert die Wirkung von Acetylcholin, einem körpereigenen Neurotransmitter, der in cholinergen Nervenzellen gebildet wird. Antagonisten verhindern die Wirkung eines Agonisten. Kompetitive Antagonisten binden sich ebenfalls mit dem Rezeptor und blockieren dadurch – je nach Konzentration – mehr oder weniger die Wirkung des Agonisten.
Der Placebo-Effekt ist mit gängigen Methoden gut erforschbar. Er beeinflusst die Wirkung von Medikamenten und Behandlungen. Er ist immer da, kostenlos und rezeptfrei. Wann immer wir zu Medikamenten greifen, tun wir dies in der Erwartung einer heilbringenden Wirkung. Aber es gibt auch eine Kehrseite, nämlich den Nocebo-Effekt. Werden die Teilnehmenden an einem Versuch über die Nebenwirkungen des verabreichten Medikamentes informiert, dann können diese Nebenwirkungen auch in der Placebo-Gruppe auftreten. Der Wirkstoff kann in der Placebo-Gruppe aber nicht die Ursache für die Nebenwirkungen sein. In diesem Zusammenhang werden Packungsbeilagen zum interessanten Thema. Der gesetzlich geforderte Hinweis auf mögliche Nebenwirkungen kann dazu führen, dass der Nocebo-Effekt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen erhöht. Wäre es ratsam, wenn man den Abschnitt über die Nebenwirkungen einfach ignorieren würde? In diesem Zusammenhang kann auf eine interessante Fallstudie hingewiesen werden. Ein junger Mann hat im Zustand einer sehr starken Verzweiflung sämtliche Tabletten einer ganzen Packung eines Antidepressivums eingenommen. Daraufhin erfasste ihn die Angst und er bat seinen Nachbar, ihn in die Klinik einzuweisen. Dort angekommen gab er kurz Bescheid, dass er Tabletten eingenommen habe, und ist dann zusammengebrochen. Er war kaum ansprechbar und die Ärzte mussten ihn notfallmäßig versorgen. Als er zusammenbrach, ließ er die Packung mit den Medikamenten fallen. Anhand der Angaben auf der Packung war erkennbar, dass er an einer Studie teilnahm. Erwartungsgemäß enthielt die Packung keinerlei Angaben über den Wirkstoff der Tabletten. Es gelang aber, den Studienleiter zu kontaktieren, der umgehend die Entblindung vornahm. Zur großen Überraschung zeigte sich, dass der junge Mann in der Placebo-Gruppe eingeteilt war. Es lag also keine Überdosis eines Antidepressivums vor. Der junge Mann ist einzig und allein durch den Nocebo-Effekt in einen kritischen, fast lebensbedrohlichen Zustand geraten. Sein Glaube hätte ihn fast umgebracht. Zugegebenermaßen ist dieser Fall eine sehr extreme Manifestation eines Nocebo-Effektes. Aber er weist darauf hin, dass der Nocebo-Effekt eine sehr ernste Sache ist, der unser physisches Wohlbefinden beinträchtigen kann.
Warum tun wir uns mit den Placebo- und Nocebo-Effekten so schwer? Wieso nehmen wir sie nicht ernst? Placebo- und Nocebo-Effekte sind Produkte unseres Gehirns, dem kompliziertesten System, das die Evolution bisher hervorgebracht hat. Das Gehirn ist eine kompromisslose Überlebensmaschine und mit allen erdenkbaren fiesen, miesen und genialen Tricks ausgestattet, die das Überleben sichern. Wenn unerträgliche Schmerzen infolge einer gravierenden Verletzung eingedämmt werden können, dann sind körpereigene Opiate ein äußerst funktionaler Mechanismus. Soldaten können sich meilenweit schleppen, obschon Kugeln ihr Bein zerfetzt haben, Surfer verlieren nach einer Haiattacke viel Blut und retten sich ans Ufer, oder gewisse Fußballspieler sollen eine ganze Halbzeit lang mit gebrochenem Mittelfußknochen gespielt haben. Die Flucht vor Gefahrenquellen, das Aufsuchen eines geschützten Ortes oder die Warnung anderer haben trotz starker Schmerzen absolute Priorität. In solchen Momenten kommen die körpereigenen Opiate ins Spiel. Sie dämmen die Schmerzwahrnehmung vorübergehend ein, damit wir in einer Notlage das Überleben sichern, bessere Entscheidungen fällen und zusätzliche Kräfte mobilisieren können. Sich vor Schmerzen winden, verzweifeln oder aufgeben wäre fatal. Beim Placebo-Effekt sind die gleichen Mechanismen im Spiel. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Ausschüttung von Endorphinen kognitiv gesteuert wird. Dies ermöglicht, dass wir die Schmerzwahrnehmung ohne lebensgefährliche Verletzung oder enorme physische Anstrengungen kontrollieren können. Bei starken Schmerzen kann bereits die Vereinbarung eines Arzttermins in einer Woche lindernd wirken. Die bloße Erwartung einer künftigen Behandlung verringert die Schmerzen. Dies muss übrigens nicht in jedem Fall zielführend sein. Manchen Patienten fällt es in Anwesenheit des Arztes schwer, ihr Leiden präzise zu schildern, wenn es nicht mehr so fest wehtut. Sie verharmlosen ihre Beschwerden in Anwesenheit des Arztes.
Der Placebo-Effekt fordert unser Verständnis des Zusammenhanges von Geist und Körper heraus. Er wäre dazu prädestiniert, die Erforschung dieses Zusammenhangs anhand empirischer Forschung voranzutreiben. Unser Denken ist diesbezüglich aber immer noch vom Cartesischen Dualismus geprägt. Der französische Philosoph René Descartes (1596–1650) ging von einer strikten Trennung von res extensa und res cogitans aus. Mit res extensa sind körperliche und materielle Vorgänge gemeint, mit res cogitans unser Denken. Ein Grundproblem des Dualismus besteht darin, dass Interaktionen stattfinden müssen. Wenn ich die Entscheidung fälle, meinen Arm zu bewegen, dann nimmt res cogitans (durch meine Entscheidung) Einfluss auf res extensa (den physischen Arm). Wenn ich im Café sitzend das Geschehen in der Einkaufspassage mitverfolge, dann nimmt res extensa (die vorbeiziehenden Fußgänger) Einfluss auf res cogitans (meine Wahrnehmung der Situation, meine Gedanken). Da sie aber strikt voneinander getrennt sind, stellt sich die Frage, wie die beiden Substanzen aufeinander einwirken können. Descartes war sich dessen bewusst und musste wenig plausible Zusatzannahmen machen. Er glaubte, dass die Interaktion in der Zirbeldrüse (endokrine Drüse im Zwischenhirn) stattfindet, was im Hinblick auf die heutige Neurowissenschaft absurd erscheint. Wissenschaftlich ist der Dualismus ohnehin nicht haltbar. Es spricht nicht das Geringste dafür, dass es reines Denken (res cogitans) ohne jeglichen Bezug zu neuronalen Prozessen geben sollte (res extensa). Intuitiv ist der Dualismus im westlichen Kulturkreis als Denkmuster aber alleweil attraktiv. Denn nur allzu leicht verfallen wir in Zuschreibungen von Ursache und Wirkung, wie etwa: Die Scheidung hat ihm arg zugesetzt, und seitdem plagt ihn ein schweres Magenleiden. Oder: Das Magenleiden hat ihn so stark mitgenommen, dass letztlich auch seine Beziehung darunter gelitten hat. Wir bemühen uns um die Zuschreibung von Ursache und Wirkung. Ereignisse als kausal verknüpft zu sehen ist eine hervorragende Strategie, mit der wir den Alltag erfolgreich meistern. Für die Behandlung wissenschaftlicher Fragestellungen hingegen leistet unser Alltagsverständnis zuweilen keine brauchbaren Dienste.
Wie aus einem Gedanken ein Molekül entsteht, ist im Zusammenhang mit dem Placebo-Effekt eine oft gestellte Frage. Aber auch dahinter verbirgt sich streng genommen eine »Cartesische Kontamination«, eine Bezeichnung, die der Verhaltensforscher Norbert Bischof (2008) verwendet. Wie stark dieser Dualismus in uns verankert ist, zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass wir im Quellwasser von Lourdes nach heilbringenden Substanzen suchen. Damit würde das Quellwasser zum Medikament und wäre somit die Ursache heilbringender Wirkungen. Das Quellwasser enthält aber keinen nachweisbaren Wirkstoff. Auch die Homöopathie profitiert von der prägenden Wirkung eines Cartesischen Weltbildes. Das Heilmittel wird so lange verdünnt, bis der Wirkstoff nicht mehr nachweisbar ist. Damit würde das Präparat an sich zum Placebo. Dagegen wehren sich aber Vertreter der Homöopathie, die darauf hinweisen, dass der Wirkstoff zwar nicht mehr nachweisbar sei, aber durchaus seine Spuren hinterlassen hat. Es bräuchte für deren Nachweis so etwas wie eine modernere Quantenphysik, was irgendwie das Raumschiff Enterprise aus dem vorhergehenden Kapitel in Erinnerung ruft. Die Homöopathie versucht krampfhaft an der Existenz einer Substanz, eines Wirkstoffs, festzuhalten. Deswegen ist die Sichtweise der Homöopathie im Kern absolut materialistisch. Im Hinblick auf die gut erforschten Placebo-Effekte erscheinen vermutete homöopathische Wirkeffekte als ein zum Himmel schreiender Verhältnisblödsinn. Wir trauen offenbar schlichtem Wasser mehr Wirkung auf unseren Körper zu als Einflüssen durch das menschliche Gehirn, das ein direktes und mächtiges Interface mit dem Körper besitzt. Das ist sehr merkwürdig.





























