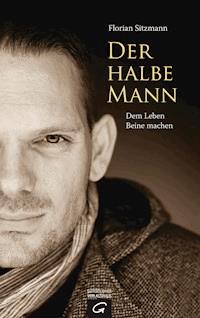18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Wie behindertenfreundlich ist Deutschland? Ein Praxistest
»Sie parken auf einem Behindertenparkplatz!«
»Ich hab ja auch keine Beine.«
Wie rollt es sich eigentlich durch Deutschland, wenn man keine Beine hat? In seinem zweiten Buch nimmt Florian Sitzmann die Leserinnen und Leser mit in seine Welt und lässt sie miterleben, was es heißt, als Mensch mit Handicap seinen Mann zu stehen – pardon: zu rollen …
In seinen Geschichten erzählt er von Freundschaft und Vatersein, von Glück und Unglück, Vertrauen und Misstrauen und vielen Dingen mehr, die ihm wichtig sind. Dies geschieht mal heiter, mal nachdenklich, bisweilen aber auch kritisch und voller Skepsis. Sitzmanns Suche nach Alltagshelden ist getrieben von dem Wunsch, Menschen in schweren Lebenslagen Mut zu machen und zu bestärken: Bitte niemals aufgeben!
- Ein kämpferisches Buch gegen Klischees und für eine etwas andere Form der Barrierefreiheit
- Das frech-witzige Mutmachbuch auf der Suche nach Alltagshelden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Wie kommt ein Komiker dazu, ein Vorwort für einen Behinderten zu schreiben? Was manch einem »unpassend« oder gar »geschmacklos« vorkommen könnte, ist wieder mal typisch für Flo: »Nur bitte ja keine Samthandschuhe!«
Nichts von dem, was man als Mensch »ohne« Handicap über jene »mit« zu wissen glaubt, hat noch Gültigkeit, wenn man sich einmal mit dem außergewöhnlichen Menschen Florian Sitzmann beschäftigt. In seinem neuen Buch geht es auch um Barrieren, um fehlende Kommunikation und um zwei Welten, eingeteilt in »normale« Menschen und Menschen mit Behinderung.
Für mich ist Florian Sitzmann mehr als nur eine Brücke zwischen diesen Welten. Er ist »der« Brückenbauer und deshalb ist dieses Buch so wichtig! Damit aus diesen beiden Welten eine wird, damit wir nicht mehr sprechen müssen über behindertengerecht, sondern nur noch über menschengerecht.
Einmal mehr hat er mit diesem Buch eine neue Brücke gebaut, der »Brückenbauer«, der »Sitzmann« ... der eigentlich »Fliegmann« heißen sollte.
Paul Panzer
Einleitung – Beinlos im Fußgängerdschungel
Vor drei Jahren erschien mein erstes Buch Der halbe Mann. Darin habe ich von meinem Unfall und meinem Leben danach erzählt. Wie ich von einem Riesen von einer Größe von 2.04 m zu einem Sitzmann auf zwei Rädern wurde. Nachdem das Buch auf dem Markt war und ich die ersten Lesungen und Fernsehauftritte hinter mir hatte, bekam ich jede Menge Post. Es waren Briefe von Menschen, die Anteil nehmen wollten oder sich Anteilnahme von mir wünschten. Darüber hinaus jede Menge Zuschriften von Lesern und Zuschauern, die froh waren, dass endlich mal einer vom Leben als Behinderter erzählt, ohne gleich in Selbstmitleid, Trauer oder Besserwisserei zu verfallen.
Viele Leser schrieben mir, dass es für sie gut war, ein Buch von einem Menschen mit Behinderung zu lesen, der sie – die Nicht-Behinderten – in diese Parallelwelt mitnimmt. Eine Welt, die mit Tabus belegt ist, obwohl Tausende von Menschen in ihr leben. Ich erzählte davon, wie es ist, und erlaubte den Blick über den Rollstuhltellerrand, denn ich weiß, wie rollstuhlgerecht Deutschland wirklich ist und dass das große Ziel der Inklusion von kleinen Teilzielen lebt, die aus Begegnungen, Aufmerksamkeiten und Gesprächen aller Art bestehen. Denn damit transparent wird, wie ein gemeinsames Leben funktioniert, ist Austausch nötig. Vielen »gesunden« Menschen mangelt es nicht an gutem Willen, sondern an Mut. Die Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Handicap ist nicht so ohne weiteres barrierefrei. Einen Hinkenden, einen, der im Rollstuhl sitzt oder nur einen Arm hat, fragt man nicht, wie er das macht. Mit »das« ist das Leben gemeint, das vielfältig und vielschichtig ist. Es gehört sich nicht, sich direkt zu erkundigen, das anzusprechen. Das gilt in vielen Köpfen als unhöflich. Und weil es unhöflich, merkwürdig und ungeübt ist, sprechen auch viele Behinderte nicht über sich und sorgen auf diese Weise dafür, dass vieles weiter unvertraut und mit Vorurteilen behaftet bleibt. So vertraute mir nach einer Lesung ein Zuhörer an, dass er nur auf einem Auge sehen könne, aber nie darüber spreche, um kein Mitleid bei seinen Kollegen zu erregen. Alle sollten denken, dass er ganz normal, also »gesund« wäre. Er wolle keinen Behindertenbonus, gestand er mir, und das schon drei Mal nicht, wenn es um die Karriereleiter geht.
Meine Erfahrung ist: Je öfter Menschen von ihren Beeinträchtigungen und Grenzen erzählen, desto geringer werden die Barrieren und desto greifbarer werden Lösungen. Sollten wir uns je begegnen, Sie und ich, dann fragen Sie mich also ruhig, was immer Sie interessiert oder bewegt. Was ich nicht sagen oder beantworten will, das behalte ich sowieso für mich, mögen Sie auch noch so freundlich und attraktiv sein.
Die Welt ist vielfältig und die Menschen, die darin leben, sind sehr verschieden. Menschen können einen begeistern oder einem auf die Nerven gehen. Welche Rolle spielt es da, ob jemandem zwei Füße, ein Auge oder ein paar Finger fehlen?
Ich bin froh, dass ich erzähle, auch ohne gefragt zu werden; das hat mein Leben sehr erleichtert und eine wirkungsvolle Art von Transparenz ermöglicht. Meine Behinderung ist für mich inzwischen etwas Natürliches. Meine Authentizität hat mir Türen geöffnet, und ich nutze diese Möglichkeiten jetzt für diejenigen, die noch keinen natürlichen Umgang mit Behinderten oder ihrer eigenen Behinderung haben. Ich betrachte es als meinen Auftrag zu berichten, und weil ich dies am besten vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen kann, drehte sich im ersten Buch alles Geschriebene um mich.
Dass das Interesse am Leben im Behindertenbereich so rege ist, bekomme ich ganz stark bei meinen vielen Besuchen in Schulen mit. Junge Menschen erleben Behinderungen oft nur als einen Schreckmoment. Es passiert etwas, man hört davon und dann ist der Klassenkamerad oder der Lehrer auch schon weg – in der Klinik oder in der Reha. Nach einem größeren Unfall können Jahre vergehen, bis ein Mensch in sein früheres Umfeld zurückkommt. Natürlich gibt es integrative Kindergärten und Schulen. Doch die meisten Kinder und Jugendlichen, die ich traf, hatten wenig Kontakt mit Menschen, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Das gilt nicht nur für körperliche Behinderungen. Auf einem Sommerfest konnte ich die Plauderei von zwei kleinen Mädchen belauschen. Die eine sagte zur anderen: »Du siehst aber komisch aus!«, worauf die andere entgegnete: »Weil ich ein Mongo bin!« Als wäre es das Normalste der Welt. Ich fand das großartig! Wie es formuliert wird, ist unwichtig, es geht allein um den natürlichen Umgang damit, so wie ihn dieses kleine Mädchen zeigte. Nach dieser Erklärung war alles geklärt und die beiden spielten eine Weile miteinander.
Die beste Integration beginnt für mich da, wo jemand sich traut zu fragen und jemand offen und gerne antwortet. Wenn jemand einen anderen Menschen als Gast mitnimmt und ihm dann auch zeigt, wo es schwierig wird.
Dies ist für mich das Ziel dieses Buches. Ich möchte Sie gern einladen und mitnehmen und Ihnen zeigen, wo es in Deutschland problematisch ist, sich als Behinderter normal zu fühlen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einem das Leben im Rollstuhl »zur Hölle« machen können. Oft genug ist es sehr bequem und komfortabel. Aber an anderer Stelle eben auch nicht – und darauf will ich aufmerksam machen. Denn noch mal: Nur so können Lösungen gefunden werden.
Es ist eine Illusion, wenn wir davon ausgehen, das Leben von behinderten und nicht-behinderten Menschen wäre gleich – eine Gleichbehandlung gibt es noch längst nicht. Wenn das so wäre, dann könnte ich an jeder Tankstelle tanken, die gute Preise hat. Kann ich aber nicht, denn auch hier kommt es auf Barrierefreiheit an. Achten Sie beim nächsten Tanken mal darauf, ob Sie mit einem Rollstuhl in den Kassenraum zum Bezahlen kommen. Von der Toilette wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Es sind oft kleine alltägliche Dinge, die mit dem Rollstuhl kaum zu bewältigen sind, dabei wäre Abhilfe ganz leicht zu schaffen. Zum Beispiel soll die Welt zwar kein Behindertenparkplatz werden, aber sie muss mir helfen, einen zu finden! Der Berater im Reisebüro muss nicht wissen, welche genauen Bedingungen ich als Reisender benötige, aber er sollte wissen, dass auch Menschen mit Behinderung reisen, dass sie besondere Bedürfnisse haben und Auskünfte brauchen und dass es genau hierfür spezielle Anbieter gibt.
Nicht jeder Kindergarten muss für alle Kinder offen sein, aber es wäre für unsere Gesellschaft vorteilhaft, wenn sich mehr pädagogische Einrichtungen zu dieser Öffnung entschließen würden.
Mit diesem Buch will ich anstoßen, provozieren. Deutschland ist in Teilen barrierefrei, aber es geht noch viel mehr! Das Buch zeigt einige Bereiche auf, in denen es sich auch als Mensch ohne Behinderung lohnt, einmal nachzudenken, wie er oder sie dazu beitragen kann, dass Integration, oder noch besser Inklusion, in den nächsten Jahren fußfassen kann. Unser aller Ziel muss es sein, dafür zu sorgen, dass sich Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft bewegen können, ohne darin aufzufallen. Wir haben ja schon eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber es gibt immer noch viel zu tun. Also: Lassen wir’s anrollen!
KAPITEL 1
Erste Schritte ohne Füße
Menschen mit einer Beeinträchtigung sind in Deutschland gut versorgt. Ärzte, Krankenschwestern, Krankengymnasten, Masseure, Reha-Einrichtungen, Krankenkassen, Apotheken, die unterschiedlichsten Berater und nicht zuletzt die Forschung sorgen dafür, dass Heilung und Wiedereingliederung funktionieren und das Leben weiter gehen kann. Aber obwohl wir hier in Deutschland so gut aufgestellt sind, reicht das alles noch längst nicht aus, um wirkliche Gleichbehandlung und Inklusion zu erreichen. Inklusion beginnt für mich an dem Punkt, an dem du in der Öffentlichkeit nicht mehr als Zirkusfigur bestaunt wirst, bloß weil dir zwei Beine fehlen oder du irgendeinen anderen körperlichen »Makel« hast.
Nur wenn viele wissen, wie es ist, und die Scheu verlieren, kann sich etwas ändern und wirkliche Begegnung stattfinden. Kinder machen uns das vor, indem sie einfach fragen: »Wie is ’n das so?« Wären Sie ein Kind, würde ich Ihnen jetzt antworten: »Es ist nicht schlecht – es ist aber auch noch nicht so gut, wie es sein könnte.« Will heißen: Deutschland ist, vergleicht man es mit armen Ländern, ein gelobtes Land für Menschen mit Handicap. Vergleicht man es dagegen mit dem, was es sein könnte, fallen kleine Macken und große Mängel auf. Damit dies besser wird, sind alle Menschen gefragt, denn jene, die einen Unfall oder eine Krankheit erleiden, sind erst einmal auf die Hilfe von anderen angewiesen. Wir brauchen die Wahrnehmung und das Denken aller, damit wirkliche Barrierefreiheit und eben Inklusion erreicht werden können.
Ohne Beine aufzuwachen ist erst einmal ein Schock, egal wie schnell, gut oder schlecht man diesen anschließend verarbeitet. In einem Schockzustand kann man nicht planen und regeln, denn man hat mit Gefühlen und Ängsten zu kämpfen. Außerdem ist man meist erst einmal bewegungsunfähig – im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet auch, dass man nicht wie wild recherchieren oder sich umfassend erkundigen kann, welche Möglichkeiten es gibt, damit das Leben zwar verändert, aber doch gut weitergehen kann. Nicht selten brauchen sogar noch die Angehörigen die Hilfe des eigentlich Betroffenen, nach dem Motto: »Macht euch mal keine Sorgen um mich, ich schaffe das schon!«
Ich persönlich hatte das im Gefühl, dass ich es schaffe, aber beim Wie, bei dem Markt der Möglichkeiten benötigte ich die Navigation von Spezialisten – und das sind für mich Menschen, die sich mit Schockzuständen, Behinderungen, Rehabilitation und Hilfe bei der Gesundung auskennen.
Eine der vielen Definitionen, die ich zum Begriff der Behinderung kenne, lautet: Unter Behinderung versteht man landläufig eine dauerhafte körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die die gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe einer Person beeinträchtigt. Verursacht wird dies durch das Zusammenspiel ungünstiger Umweltfaktoren (Barrieren) und Eigenschaften der behinderten Person, die die Überwindung der Barrieren erschweren oder unmöglich machen.
Bei der Definition von Behinderung unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Begrifflichkeiten:
Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigung oder eines Unfalls als Ursache entsteht ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden – impairment. Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen – disability. Die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äußert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen – handicap.
Behindernd wirken in der Umwelt von behinderten Menschen sowohl Alltagsgegenstände und Einrichtungen (physikalische Faktoren) als auch die Einstellung anderer Menschen (soziale Faktoren).
In einer Tageszeitung las ich, dass rund 6,6 Millionen Deutsche amtlich als schwerbehindert anerkannt sind. Bei vier von fünf ist dabei eine Krankheit Grund ihrer Behinderung. Insgesamt gelten rund zehn Prozent der Deutschen als behindert. Das zeigt, dass wir Menschen mit Beeinträchtigung keine Randgruppe sind. Wir sind sogar ein Markt, was viele, aber doch noch zu wenige Unternehmer längst erkannt haben.
Jeder Mensch, der in eine Extremsituation kommt, braucht andere, die ihn auffangen und ihm zeigen, was er trotz seiner neuen (scheinbaren) Immobilität alles anfangen kann. Menschen, die mitdenken und die sich für das Thema interessieren, nachdem man die Räume der Reha-Klinik hinter sich gelassen hat. In der oben erwähnten Definition lese ich dies ganz besonders im ersten Abschnitt. Das Zusammenspiel Behinderung – Unfall – Leben und damit auch Austausch beginnt für mich bereits in den ersten Stunden.
Ich hatte großes Glück. Familie, Freunde und Ärzte unterstützten mich in vollem Maße. Mit Georg Adamidis, dem Arzt, der mir 1992 das Leben rettete, bin ich bis heute eng befreundet. Einsam wurde ich erst, als ich in die Reha kam, also an dem Ort, der mich in meiner neuen Situation auffangen und wieder mobil machen sollte. Für die Leser, die mein erstes Buch nicht kennen, möchte ich auf diese Situation noch einmal eingehen und damit gleich die erste Anregung geben, die für mich Inklusion und Gleichheit erleichtern würde:
Holt die Reha-Kliniken aus dem Wald und packt sie dorthin, wo das Leben pulsiert!
Waren Sie schon mal in einer Reha-Klinik, als Patient oder als Besucher? Viele Reha-Kliniken sind für mich ein Ort des Grauens. Man hängt aufeinander, die Rollstühle stehen in den Gängen herum und man will dem gern mal für eine Weile entfliehen. Leider kann es passieren, dass man sich dabei noch mehr Blessuren zuzieht, denn diese Kliniken liegen bevorzugt im Wald oder auf Hügeln, und das heißt, dass man auf seiner Flucht unter Umständen mit Seifenkistengeschwindigkeit dem Tal entgegenrast. Und was den Rückweg angeht, da lasse ich Sie gern mal in meinem Rollstuhl Platz nehmen und Sie zu meiner Reha-Klinik hoch-rudern. Um das zu schaffen, bräuchte man Arme wie Popeye. Die Menschen, die nach einem Unfall oder einer schweren Krankheit dort landen, haben die aber für gewöhnlich noch nicht. Im Gegenteil! Die Patienten, die ich traf und zu denen ich selbst gehörte, hatten alle Schlimmes erlebt. Ein Zustand, in dem man Aufmunterung, Motivation und Anregung braucht – und Zeit, um sich an das Leben mit Nicht-Behinderten wieder zu gewöhnen. Das ist schwer möglich, wenn man tagein, tagaus nur zusammen mit Behinderten und Pflegepersonal die Zeit in einer Klinik absitzt und niemals unter Leute in einer ganz normalen Fußgängerzone kommt. Jeder ist obendrein mit seinem eigenen Leid und dessen Verarbeitung beschäftigt. Es kann durchaus hilfreich sein, sich mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, auszutauschen, denn du kannst von den anderen Menschen lernen – zum Beispiel wie sie ihr Handicap in den Griff bekommen haben. Gemeinsam bekommt man den Hintern leichter hoch und gegenseitiges Mitleid kann manchmal Schmerzen lindern wie Opium. Was dich aber vor allem fit für das Leben macht, ist die Begegnung mit Menschen aus der »unversehrten« Welt. Die von sich erzählen und ein Stück altbekannten Alltag in die Reha-Klinik bringen. Je häufiger, desto besser.
Besuche sind aber ganz besonders bei diesen Kliniken oft mit einem immensen touristischen Aufwand verbunden, denn Reha-Kliniken liegen in der Regel etwas »ab vom Schuss«. Mal eben »Hallo« sagen, kannst du vergessen.
Um wieder auf die – vorhandenen oder nicht vorhandenen – Beine zu kommen, braucht es Begleitung und Menschen, die sich, während man selbst noch im Schock rumliegt, um verschiedene Sachen kümmern. Darauf stützt sich die Nachversorgung, die man auch als Patientenentlassungsnachsorgekonzept beschreiben könnte. Wer entlassen wird, weiß, ich kann jetzt hierhin oder dorthin gehen, und dort werde ich dann versorgt – mit einem Rollstuhl, einem Badewannenlift oder was auch immer benötigt wird. Dass es einen Anbietermarkt gibt, bedeutet aber nicht, dass alle, die in diesem Bereich arbeiten, etwas von der Sache verstehen oder sich die Mühe machen, sich einmal umzublicken. Vieles, was ich erlebt habe, empfand ich als dilettantisch. Als ich zum Beispiel meinen ersten Rollstuhl bekam, saß ich darauf wie auf einer Parkbank. Neben mir hätte prima noch jemand Platz nehmen können. Wenn Sie als Fußgänger in ein Schuhgeschäft gehen, dann möchten Sie doch auch kein Paar Schuhe kaufen, das drei Nummern zu groß ist, oder? Und wenn Ihnen dann die Verkäuferin trotz Ihrer Einwände das zu große Paar Schuhe andrehen will, dann kaufen Sie es nicht, sondern verlassen vielleicht sogar den Laden. Menschen, die erst seit Kurzem eine Behinderung haben, wissen aber noch gar nicht, wie sich ein Rollstuhl passgenau unter dem Hintern anfühlt. Sie denken erst einmal, das müsse so sein, weil der Experte es ja sagt. Und wenn schließlich die Krankenkassen den Handel aktivieren, weil sie den Kaufpreis von 3000 Euro für einen Rollstuhl drücken wollen – wer macht es mir billiger? –, dann beginnt der Reha-Fachhandel zu tanzen und zu argumentieren. Am Schluss kann es sein, dass der Rollstuhl 50 Euro günstiger ist, aber eben nicht passend. Und dann hat man den Salat.
Ich verstehe, dass auch Krankenkassen sparen müssen. In vielen Fällen passiert dies meiner Meinung nach aber leider an der falschen Stelle. Die fachliche Beratung im Vorfeld ist das Salz in der Suppe.
Ähnlich verhält sich die berufliche Rehabilitation. Hier muss sich ebenfalls noch einiges tun. Als ich mich 1996 im Alter von 20 Jahren wieder auf den Markt bewegte, da wurde ich ein zweites Mal behindert.
Mit 15 und mit Beinen wollte ich Schreiner werden, mit 16 ohne Beine war das vorbei. Was aber wird man ohne Beine? Irgendwas im Büro? Eine Schlüsselszene für mich war damals ein Besuch beim Arbeitsamt. Ich sollte dort einen Eignungstest machen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich, wenn schon nicht Schreiner, Bauzeichner werden wollte. Mit diesem Plan kam ich zuversichtlich zu meinem Termin und machte den Test, um meine Entscheidung zu untermauern.
Das Resultat erzeugte in mir eine Mischung aus Ratlosigkeit und Verblüffung, denn es kam etwas völlig anderes heraus als das, was ich erwartet hatte. Mit einem Bürojob, der offenbar allen Rollstuhlfahrern angeboten wird, lag ich zwar schon mal richtig, aber: »Bloß nix mit Zeichnen!«, erklärte mir mein Berater, da mein räumliches Denken dafür zu gering ausgebildet sei. Na, herzlichen Glückwunsch – wir haben einen Gewinner im Vorurteilskontest!
In § 33 SGB IX werden die Leistungen der beruflichen Rehabilitation, die nun Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben heißen, genannt. Zu ihnen gehören insbesondere:
Hilfen
zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, einschließlich Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen,Berufsvorbereitung, einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,Überbrückungsgeld.Sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.Diese Maßnahmen werden gewährt, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, (wieder-)herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.
So etwa kann man die Unterstützung nachlesen. Den Menschen, die behindert sind und die beraten werden, sollen Möglichkeiten eröffnet werden, die an ihre Behinderung angepasst sind. Möglichkeiten zu eröffnen, das bedeutet aber wohl kaum zu verbalisieren, was jemand nicht kann!
Unten behindert, oben behindert – dachte ich damals. Was nun? Ich weiß noch, wie mies ich mich fühlte. Was sollte ich denn mit dieser unqualifizierten Aussage anfangen? Heim rollen und heulen? Ich dachte in diesem Moment schon an die anderen Menschen, die nicht eine solche mentale Kraft in sich tragen, wie ich sie immer spüren durfte. Ich selbst erlebe mich als einen Menschen, der seinen Weg geht, obwohl er keine Beine hat, und der sich nicht von einem rücksichts- und obendrein ahnungslosen Schreibtischkasper abhalten lässt. Jemand, der eigentlich darauf geschult und getrimmt sein soll, konstruktiv anzuleiten und gemeinsam mit dem Kunden herauszuarbeiten, dass, wenn das Eine nicht geht, es doch noch andere Optionen gibt. Wie verlassen Menschen dieses Amt, dachte ich mir damals, die nicht so selbstbewusst sind wie ich? Menschen, die gerade frisch auf einem Rollstuhl rollen, der breit ist wie eine Parkbank. Menschen, die jemanden an ihrer Seite brauchen, der ihnen dabei hilft, sich im Leben und im Beruf zurechtzufinden.
Ich spürte damals eine Riesenwut. Mir wurde klar, dass man aufpassen muss, von wem man sich beraten lässt, wenn man keine Beine oder ein anderes Handicap hat.
Gute Beratung erkenne ich unter anderem, wenn mein Gegenüber:
erkennen kann, dass ich arbeiten WILL,seinen Angebotskatalog wie das Vaterunser herunterbeten kann und auch Querverweise auf verwandte Berufe anführt,mir das Gefühl gibt, dass man diese Aufgabe zusammen bewältigen kann – denn der Ratsuchende hat vielleicht niemand anderen, der sich auskennt oder ihn unterstützt, verbindliche Aussagen macht und mich dort abholt, wo ich stehe,aktiv ist und im Rahmen seiner Möglichkeiten zielstrebig und produktiv handelt.Um das zu beurteilen, braucht man ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbsterfahrung. Ich wusste bald, dass ich nicht alles glauben darf, was man mir erzählt, mag mein Gegenüber noch so kompetent wirken. Mir wurde klar, dass ich wach sein und die Dinge immer wieder reflektieren und auf meine Bedürfnisse hin überprüfen muss.
Ich habe Menschen getroffen, die nach solch einer Beratung kurz davor standen, aus dem Fenster zu springen. Menschen, die sich auf einmal völlig lebensunfähig fühlten und dachten, sie könnten rein gar nichts mehr mit sich anfangen. Nicht mehr laufen, nicht mehr arbeiten, nicht mehr leben, nichts.
Meiner Meinung nach sollten Behinderte bei ihrer Berufswahl grundsätzlich von Menschen mit Handicap beraten werden, weil die genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn man an seinem eigenen Nutzen und Können zweifelt, weil der Körper nicht der Norm entspricht. Solche Menschen können sich vorstellen, was es in einem auslöst, wenn man durch den Besuch beim Arbeitsamt registriert, dass es schön wäre, wenigstens eine Null zu sein, da man doch in Wirklichkeit eine -1 oder -2 ist. Das muss man selbst erlebt haben, um solche Beratungssituationen richtig einschätzen zu können. Wer hier aus eigener Erfahrung schöpfen kann, wird in der Lage sein, die Beratungsform entsprechend anzupassen.
Am meisten aufgebaut haben mich damals die Menschen, die mich akzeptiert haben, so wie ich jetzt bin. Die meine Behinderung ausblendeten oder in einer versachlichten Weise damit umgingen. Etwa als hätte ich nichts weiter als eine andere PS-Zahl oder eine andere Karosserie, wäre aber immer noch
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Coverfoto: © Thommy Mardo Photography, Mannheim Innenteilfotos: Daniel Sitzmann, Felix Müller-Stolz Bild 1 (© Karl Kübel Stiftung / Marc Fippel)
eISBN 978-3-641-08379-3
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe