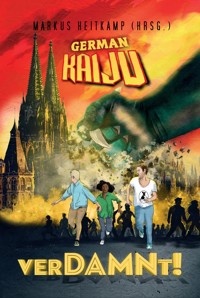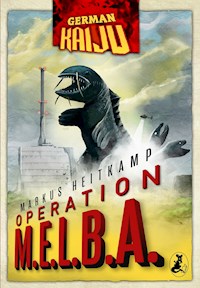Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leseratten Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Warnhinweis: Blutige Welten sollten Sie nicht anwenden, wenn Sie glauben, dass sich Halblinge und Elben nicht zur Neubesiedlung fremder Planeten eignen, Sie Engel, Vampire und Drachen für allmächtige Wesen halten, Angst vor Leichensäcken, Riesenpenissen und Kängbibern haben oder denken, David Bowie wäre kein Außerirdischer. Dosierung: Wir empfehlen Blutige Welten nur in kleiner Dosierung zu sich zu nehmen. Darum haben wir 13 Anwendungen von den besten Fantastik Autoren vorbereiten lassen, in denen Fantasy, Science-Fiction, Humor, Horror und Verschwörungstheorien in verschiedensten Anteilen vermengt wurden. Bei Überdosierung: Gehen Sie ins Bett und schalten Sie das Licht aus. Schlafen ist die beste Medizin … wenn Sie denn noch schlafen können. Mit blutigen Geschichten von T.S. Orgel, Vincent Voss, Ju Honisch, Torsten Scheib, Markus Heitkamp, Nele Sickel, Stefan Cernohuby, Wolfgang Schroeder, Sarah König, Thomas Williams, Jörg Fuchs Alameda, Marina Heidrich und Günther Kienle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hrg.
Günther Kienle
Blutige Welten
ISBN 978-3-945230-46-6
1. Auflage, Allmersbach im Tal 2020
Cover-Illustrationen: Holger Much
www. holgermuch.de
Satz und Layout: Tanja und Marc Hamacher
Lektorat: Günther Kienle, Tanja & Marc Hamacher
Fotografien: E. Schumm (Umschlagseite)
Birgit Mühleder (Seite 160)
Michael Seirer (Seite 68)
Sonstige Rechte bei den Autoren
© 2020, Leseratten Verlag, Allmersbach im Tal
www. leserattenverlag.de
Vorwort des Herausgebers
In der Regel beginnt der Weg zu einer Anthologie entweder mit einem Einfall und der Suche nach Mitstreitern, oder der Verlag spricht gezielt Personen an, ob sie denn nicht eine Idee hätten. Und manchmal läuft es ein bisschen anders. So besteht die Geschichte hinter dieser Anthologie aus einer Reihe verschiedener Dominosteinchen.
Nach dem BuCon 2018 (in Dreieich) saß ich in einer geselligen, mit diversen Kaltgetränken ausgestatteten, Runde. Wir trugen fast alle die Namen Thomas oder Günther. Im Scherz schlug ich vor, einen gemeinsamen Roman unter dem Pseudonym Thomas Günther zu verfassen. In der Geschichte sollten dann Fantasy, Horror und Science-Fiction gleichermaßen vertreten sein, da wir in den unterschiedlichen Subgenres der Phantastik unsere Schwerpunkte haben.
Es wäre die Anekdote eines amüsanten Abends geblieben, wenn ich nicht a) ein schlechter Zeichner wäre und b) den Inktober dazu genutzt hätte, fiktive Buchcover zu erstellen. Der Inktober findet – wie der Name schon andeutet – im Oktober statt. Nach einem vorgegebenen Stichwort wird von den Teilnehmern jeden Tag eine Zeichnung angefertigt. Das inspirierte mich zu einem persönlichen Covertober und alle paar Tage gestaltete ich aus verschiedenen Bildvorlagen fiktive Buchcover. Unter anderem das Genrecrossover Blutige Welten, von Thomas Günther.
Kaum hatte ich das Bild in einem sozialen Netzwerk geteilt, mehrten sich die Rufe, den Titel als Thema für eine Anthologie zu verwenden. Die Grafik gehörte sicher nicht zu den besten der Oktober-Cover, doch es war mit Abstand die, bei der die Muse am heftigsten über befreundete Autorinnen und Autoren hergefallen ist. Bald stellten sie die Frage nach einer geheimen Arbeitsgruppe in den Raum. Einen Tag später hatte ich diese Gruppe eingerichtet und im virtuellen Freundeskreis um weitere Mitstreiter geworben. Ziemlich früh hob auch ein Verleger seinen Finger – er hatte »Blut geleckt«.
Schnell waren wir komplett und ich schloss die Aufnahmephase ab.
Es folgten Licht und Schatten. Leider konnten aus verschiedenen Gründen nicht alle Gründungsteilnehmer einen Beitrag schreiben. Das ist sehr schade, aber es bleibt die Hoffnung auf zukünftige, gemeinsame Projekte. Dafür schlug das starke Interesse des Verlegers schließlich in eine Zusage um. Er half tatkräftig dabei, unseren Kader mit weiteren großartigen Autorinnen und Autoren zu ergänzen. Drei Monate nach der ursprünglichen Idee hatten wir das Team zusammen.
Nun, zumindest beinahe. Ein halbes Jahr später stieß Holger Much zu uns, der es wie kaum ein anderer versteht, die Ambivalenz der humorvollen und blutigen Geschichten dieser Anthologie in einem außergewöhnlichen Cover darzustellen.
Für die großartigen Beiträge und die tolle Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken! Es ist mir, ohne zu übertreiben, eine Freude und Ehre zugleich.
Nun aber viel Spaß, bei den mal mehr und mal weniger humorvollen Blutigen Welten!
Auf dem Linien-Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen, Februar 2020,
Günther Kienle
Markus Heitkamp
Markus Heitkamp ist ein relativ unbekannter Fantasy- und Jugendbuch Autor. Unter seinem Namen werden Fantasy-, Phantastik-, Hardcore-, Horror- und erotische Geschichten veröffentlicht, die den literarischen Wert eines Toiletten Pömpels haben. Ein Toiletten Pömpel ist übrigens ein sehr wertvolles und von der Gesellschaft stark unterschätztes Haushaltsgerät, welches auch zu vielen weiteren, eher zweckentfremdeten und bisher weitgehend unbekannten Vorgängen genutzt werden kann. Und mit dieser Eigenschaft, unbekannt, schließt sich wieder der Kreis zum Autoren selbst. Die vorliegende Geschichte basiert auf nicht näher geklärten Ereignissen, die in der Heimstatt des Autors und seiner Familie, maßgeblich beeinflusst vom jüngsten Spross und dessen Umgang mit diversen Apps und Spielen auf den elterlichen Handys, stattgefunden haben. Ein Pömpel kam auch darin vor, hat dann aber nicht den Weg in die Story gefunden. Das ist aber eine andere Geschichte.
Interview
Was war dein bisher blutigstes Erlebnis?
Ich habe mir mal als 4-jähriger beim Schälen einer Apfelsine in den Finger geschnitten und bin dann wild schreiend und mit der Hand stark winkend durch die frisch tapezierte Wohnung gerannt. Die war dann wieder renovierungsbedürftig.
Wie erklärst du deinen Eltern / Kindern / dem sozialen Umfeld, dass du SOLCHE Geschichten schreibst?
Brauche ich nicht. Ich behaupte immer, der damalige Schnitt in den Finger war ein traumatisches Erlebnis, welches ich versuche, mit diesen Geschichten aufzuarbeiten.
Welche Musik hast du beim Schreiben deiner Geschichte gehört und welche Musik empfiehlst du zum Lesen?
Beim Schreiben höre ich tatsächlich keine Musik. Zum Lesen empfehle ich Klassik.
Showdown im GoGo-In
Warum einer der Vulkane im Gebiet des Eyjafjallajökull auf Island im Jahr 2031 ausbrach, ob es eine Folge der globalen Erderwärmung oder aber an einem zeitgleich stattfindenden Meteoriteneinschlag auf dem Mond lag, interessierte keinen mehr. Genau so wenig, wie es irgendjemanden interessierte, dass im Rahmen dieser globalen Katastrophen und deren verheerenden Folgen Millionen von Menschen starben, große Teile der weltweiten Fauna und Flora über den Jordan gingen und der verbliebende Rest der Menschheit führungslos und über weite Teile der Welt orientierungslos vor sich hinvegetierte und in ein Zeitalter des Lowtechs und der Barbarei zurückfiel. Jegliche Forschung war zum Erliegen gekommen. Mechanische, elektrische und viele Formen von anderen Errungenschaften waren vorhanden, aber jegliche Infrastruktur die für eine Produktion, Reproduktion oder Weiterentwicklung sowie zum großen Teil auch für den Betrieb und die Reparatur eine Notwendigkeit darstellte, war unwiederbringlich zerstört. Fossile Brennstoffe waren wertvoller denn je zuvor. Menschen, die in der Lage waren, die wenigen vorhanden Generatoren oder Werkstätten zu bedienen, wurden als gottgleiche Geschöpfe angesehen, die sich nicht selten als eben solche aufspielten und ganze Landstriche als Warlords, Sektenführer oder religiös angehauchte Despoten beherrschten. Es galt das Gesetz des Stärkeren und eine funktionierende Waffe sicherte nicht selten das Überleben von einem auf den anderen Tag.
Hamburg, Januar 2038
Eines hatte sich an Hamburg seit der Katastrophe von 2031 nicht geändert. Es war regnerisch, es fegte ein kalter Nordwind über die Fluten und scheinbar der gesamte Abschaum der Menschheit versammelte sich dort, wo er es schon immer getan hatte: auf der Reeperbahn. Von der war zwar nicht mehr viel über, genauer genommen über Wasser, aber die wenigen bewohnbaren Gebäude waren Anlaufstelle für Menschen, die mit ihren Hausbooten und Wohnflößen auf der Suche nach ein wenig Entspannung, Unterhaltung und Abwechslung waren. Kurz, es gab Sex and Drugs and Rock’n Roll – solange man entsprechende Tauschmittel hatte und diese auch an den richtigen Mann oder die richtige Frau bringen konnte, ohne bereits als Fischfutter zu enden, bevor eine passende Gegenleistung erbracht wurde.
Mark G. Rummel hatte genau diese Tauschmittel. Nicht irgendwelchen Mist, sondern das ganz heiße Zeug. Aber er war nicht auf ein schnelles Vergnügen aus, als er sein Paddelboot am Anleger des GoGo-In festmachte. Er plante ein ganz großes Ding und der Deal mit seinem Interessenten sollte hier in der unscheinbaren Kaschemme inmitten der Kloake des menschlichen Abschaums stattfinden. Für ihn sollte es das große Los werden. Raus aus Hamburg, raus aus Deutschland, auch wenn es territoriale Grenzen eigentlich gar nicht mehr gab.
»Na Grummel?« Der Türsteher sprach den Ankömmling mit seinem Spitznamen an. »Dich hab ich ja lange nich mehr gesehen.«
»Moin Hörni.« Mark schüttelte dem alten Mann in dem klassischen gelben Südwester die Hand. »Hätte nicht gedacht, dass du hier immer noch abhängst.«
Der Greis lüftete kurz seine Öljacke und zeigte den Patronengurt und die schwarze Pump-action Schrotflinte. »Meine Olle hat mich bisher vor Schaden bewahrt.«
Grummel musste schmunzeln. Eine ähnliche Schrotze hatte er unter der Achsel. Sie machte neben dem großkalibrigen Revolver im Gürtelholster und dem Stiefelmesser seine Bewaffnung erst richtig vollständig.
»Und das soll auch so bleiben«, sagte Mark und drückte dem Alten ein paar Schrotpatronen in die offene Hand. Hörni öffnete erstaunt den zahnlosen Mund. »Alter, dafür würden andere töten.«
Marks Ausdruck verhärtete sich. »Glaubst du, ich hab sie geschenkt bekommen?«
Sein Gegenüber nickte verstehend.
»Halt mir einfach den Rücken frei, alter Mann.« Ohne weitere Worte öffnete er die Tür zur Bar und begann den Abstieg über die vor ihm liegende endlos erscheinende Wendeltreppe.
»Kanns dich auf den alten Hörni verlassen, mein …« Die letzten Worte des Türstehers verschluckte das Dröhnen der zuschlagenden Pforte. Er musste fast dreißig Meter in die Tiefe, bevor Mark erneut an einer aus massivem Stahl gefertigten Tür stand. Diese war im Gegensatz zur gesamten Treppe in ein leicht diffuses Licht getaucht, das aus einer Ölfunzel über dem oberen Rahmen stammte. Sogar die Lampe war durch einen metallenen Käfig gesichert, um einem Raub des Brennstoffes keinen Vorschub zu leisten. Auf der Tür stand in weißen Lettern »BITTE KLOPFEN« und Mark kannte den alten Witz. Man brach sich eher die Finger, als das im Innern der Bar jemand das Klopfen hörte. Er holte ein paar weitere Schrotpatronen aus einer seiner Manteltaschen und steckte sie in ein neben dem Rahmen kaum sichtbares Rohr. Er hatte das letzte Geschoss noch nicht losgelassen, da öffnete sich die Tür nach innen. Ein unglaublicher Gestank, ein Gemisch aus Urin, Erbrochenem, Schweiß und wer weiß was für weiteren Körperflüssigkeiten gemischt mit dem süßlichen Aroma unterschiedlicher Rauchwaren drang ihm entgegen. Er trat über die Schwelle und wurde von irgendjemandem sofort an der Schulter gepackt. Gleichzeitig spürte er einen leichten Druck in Hüfthöhe.
»Waffen?« Eine Stimme brummte ihn an. Wortlos hielt er die letzte Patrone hoch, die in einer von vier bemerkenswert großen Fäusten verschwand.
»Hab nix gesacht, schönen Abend der Herr.«
Ohne sich weiter um den zweiten Türsteher nach Hörni zu kümmern, durchquerte Mark den Raum, ging zielstrebig auf eine der kleinen Sitzecken zu und nickte den beiden Anwesenden zu.
»N’Abend, die Damen, hier ist besetzt.«
»Ja. Von uns.« Der Typ sah aus wie ein Banker, aber da es keine Banken mehr gab und Geld ebenfalls keinerlei Rolle mehr spielte, nannte Mark ihn in Gedanken den Schlips.
»Das muss ein Missverständnis sein, da steht mein Name auf dem Schild.« Mark wies auf einen Tischaufsteller.
Der zweite Mann, Mark hatte ihn bereits Fisch getauft, sah aus wie ein Fischer: dicker Wollpulli, weißer Vollbart, Pudelmütze. Er könnte schwören, wenn er unter den Tisch schauen würde, so hätte Fisch bestimmt Gummistiefel an den Füssen. Fisch betrachtete das kleine Pappschild auf dem Tisch.
»Tischeins… Tisch eins steht hier.«
Weder Schlips noch Fisch sahen seine Bewegung. Mark hielt plötzlich seinen Revolver in der Hand. Als der geschniegelte Möchtegern Banker in die Innentasche griff, zog Mark ihm den Lauf der Waffe quer über das Gesicht, um ihn dann sofort wieder auf Fisch zu richten, der sich daran gemacht hatte, ein Messer aus den Tiefen seines Pullis zu zaubern.
»Nix für ungut, sind schon wech.« Fisch zog den blutenden Schlips mit sich und die beiden verschwanden in einen anderen Bereich der Kaschemme.
Mark legte den Revolver griffbereit auf den Tisch, zog seinen Mantel im Sitzen von den Schultern und begann den Laden genauer zu inspizieren.
Im hinteren Bereich, gegenüber des stählernen Eingangs befand sich eine riesige Bar. Die Mitte des Raumes beherrschte eine kleine Bühne mit Pole-Stange, rundherum gab es kleine Sitzecken. Mark nahm eine davon in Beschlag. Die restlichen Plätze waren fast ausnahmslos besetzt. Direkt an der Theke gab es einige Stehtische und eine geraume Anzahl von Barstühlen. Überall in der Kneipe brannten Kerzen. Nur an der Getränkeausgabe spendeten wiederum zwei vergitterte Öllampen Licht. Die Musik kam von einem Klavier und zwei Gitarren links neben der Bar. Die Musiker selber waren kaum erkennbar und von Marks Position aus sah das Trio aus wie kleine Kinder. Dort lag auch der Eingang zu den Toiletten und zum privaten Bereich des Etablissements. Mark legte sich die Pump-action quer über die Beine, sodass er sie mit der Linken greifen konnte. Rechts neben ihm stand sein kleiner Rucksack auf der Sitzbank. Sein Heiligtum. Sein Tauschgut. Er warf einen kurzen Blick auf den zylindrischen Behälter in seinem Tornister und versicherte sich, dass am oberen Rand eine kleine grüne Lampe dauerhaft leuchtete. Als er wieder aufschaute, stand der Kellner vor ihm. Klein, gelb mit riesigen Kulleraugen und einem breiten Entenschnabel.
»Willse zu trinken?«, quakte die Gestalt.
»Du bist eines von diesen Dingern. Müsstest du nicht immer wieder ›ENTERICH oder so stammeln und …«
»Willse was zu trinken oder willse klugscheißen?«
»Bier.«
Die übergroße Ente drehte sich wortlos um und wackelte davon. Mark strich sich durch die grauen langen Haare. Dann kratzte er ausgiebig den ebenfalls langen grauen Bart. Genau so lange, wie die ältere Frau brauchte, sich neben ihn zu setzen.
»Lola, du alter Kupferstecher. Du hast echt eine Ente als Ober, dein Ernst?« Mark umarmte die alte Freundin, die eigentlich ein alter Freund war. Küsschen auf beide Wangen, kurzes Händchen drücken, noch eine Umarmung und dann grinsten die beiden sich einfach minutenlang an. Erst als die Ente zurückkam und ein Bier und ein Glas mit einer farblosen Flüssigkeit auf den Tisch knallte, räusperten sich beide, als hätte man sie bei etwas Verbotenem erwischt und sie begannen eine Unterhaltung.
»Ich hab nicht nur einen.«
Mark nickte. »Ah, an der Tür. Kam mir gleich spanisch vor, dass der vier Pfoten hat.«
»Jo. Und dann noch einen hinter der Theke. Und … ach, lass dich überraschen.« Lola, eigentlich Lars-Dieter, tatschte Marks Hand und kicherte. »Gleich geht’s los.«
Mark wollte noch fragen, was gleich losgehen würde, da setzte die Band ein und nun konnte er die Musiker erkennen.
Dort saßen gleich drei hasenähnliche Gestalten und zupften an den Gitarren, beziehungsweise hauten in die Tasten des Klaviers. Aber die drei kleinen Geschöpfe mit den großen Puscheln an den Ohren waren nicht die wirkliche Überraschung. Die kam, unter dem tosenden Beifall des anwesenden Publikums, aus dem privaten Bereich auf die Bühne. Und Mark traute seinen Augen nicht. Was sich da in lasziven Bewegungen an der Stange rekelte, langsam aber sicher ein Kleidungsstück nach dem anderen in die Menge warf und einen überraschend schönen und großen Busen und einen ebenso hübschen Hintern in die Gesichter schwitzender Menschen drückte, war definitiv einer dieser ehemals virtuellen Spielinhalte. Jetzt aber ein verdammt reales, genetisch verändertes und mit einer sexuellen Ausstrahlung versehenes Geschöpf, das definitiv nur und ausschließlich dazu da war, allen Anwesenden den Kopf zu verdrehen. Die Wirkung dieser Erscheinung machte nicht vor Geschlechtern halt und, wie Mark an den langen Sabberfäden, die dem Entenwesen aus dem Schnabel liefen, feststellen konnte, auch nicht vor unterschiedlichen Arten.
»Ja, die ist echt eine Wucht. Die Weiterentwicklung der knuffigen Typen von der Band. Ich nenne sie ja nur Plüschi und sie ist einfach fantastisch.« Lolas Stimme überschlug sich fast vor Begeisterung.
»Sie ist ein verfluchtes Ding!« Mark konnte nicht leugnen, dass der mit einem Plüschpuschel dekorierte Arsch des Wesens seine Wirkung auch bei ihm nicht verfehlte, aber er war sich auch der Gefahren im Umgang mit diesen Kreaturen bewusst.
»Wie hast du diese Dinger im Griff?«
Lola grinste ihn an. »Ich habe einen zentralen Neurodämpfer. War im Set mit der Rasselbande dabei. Und bevor du fragst, er wird mit einer winzigen atomaren Zelle betrieben und ist absolut störungssicher …«
Bei dem Hinweis auf die mit Kernenergie betriebene Batterie warf Mark einen unauffälligen Seitenblick auf seinen Rucksack.
»… und ist auch nur ein winzig kleines bisschen leck.«
»Du hast ein Strahlungsleck? Hier?«
»Ein winzig kleines. Und es ist im Tresor. Im Hinterraum. Wenn du den Zähler anschmeißt, wird er wahrscheinlich gar nix anzeigen.«
Mark würde es bei nächster Gelegenheit überprüfen, zunächst brannte ihm aber noch eine andere Sache auf der Zunge.
»Und der Dämpfer funktioniert? Auch bei ihr?« Er blickte auf Plüschi, die sich gerade mit gekonntem Hüftschwung und splitterfasernackt auf den Weg in die Privaträume machte. Dabei wich sie äußerst geschickt sämtlichen Annäherungsversuchen der Zuschauer aus.
»Du bist genauso misstrauisch wie andere Nörgler. Natürlich funktionieren die Dämpfer. Ganz hervorragend in beide Richtungen. Mein Gott, das hätte die Forschung des Jahrhunderts werden können.«
»Gott hatte da verdammt wenig mit zu tun. Und wenn doch, dann hat er mit der Katastrophe diesen Forschungen sinnvollerweise Einhalt geboten.« Mark erinnerte sich an die rasante Entwicklung von vor ca. zwanzig Jahren, als ein Spielekonzern mit zu viel Geld in der Gentechnik expandierte und aus virtuellen Spielgefährten plötzlich echte, lebendige Geschöpfe wurden. Bei den ersten Testreihen gab es unter ihnen Dutzende Tote. Genetisch waren die Wesen durchaus sinnvoll konstruiert und rein von der biologischen Form her lebensfähig. Sie waren sogar intelligent. Allerdings wiesen sie zwei Merkmale auf, die sie grundlegend gefährlich machten. Sie litten unter Alexithymie und Analgesie. Sie waren absolut gefühllos und empfanden keinerlei Schmerz. Beides konnte bei Menschen starke Psychosen auslösen, die in endloser Wut oder Selbstverzweiflung enden. Bei ihnen waren diese Psychosen der Normalzustand.
Um das in den Griff zu bekommen, entwickelte man die sogenannten Neurodämpfer, die zum einen kontinuierlich Psychopharmaka über eine implantierte Pumpe direkt in die Blutlaufbahn der Wesen beförderte und zum anderen auf die jeweilige Lebensform abgestimmte Gehirnwellen über einen kleinen Empfänger an der Hirnrinde sendeten. So wurde aus einem Entenwesen ein kleiner grummeliger Ober, und aus einem großen Hasen eine willenlose Sexbombe. Die gesamte Forschung mit all den zahlreichen Prototypen, keiner wusste genau, wie viele es wirklich gab, endete abrupt, als im Rahmen der weltweiten Katastrophen das Forschungszentrum des Konzernsdem Erdboden gleichgemacht wurde und auch sämtliche Forschungsergebnisse unwiederbringlich verschwanden. Und hier in Hamburg, in einer heruntergekommenen Kaschemme sollte plötzlich ein Teil dieser unglaublichen Entwicklung wieder ans Tageslicht gekommen sein? Seine Gedanken führten dazu, dass er Lola skeptisch anschaute.
»Wieso eigentlich DIE Dämpfer?«
»Was meinst du?« Lola sah ihn verwirrt an.
»Du sagtest gerade eben wortwörtlich: Natürlich funktionieren DIE Dämpfer. Hast du etwa mehrere?«
»Ich, Gott bewahre, nein. Ich habe gerade mal sieben von den Geschöpfen und ein Dämpfer reicht für maximal zehn dieser Viecher.«
Mark entspannte sich.
»Aber …«
Die Stahltür schwang auf und acht Gestalten in nachtschwarzer Körperrüstung verteilten sich fächerförmig im Raum. Die großkalibrigen Sturmgewehre waren mit Laservisieren ausgerüstet, deren kleine rote Punkte wie Insekten durch den Innenraum schwirrten.
»… die da haben wohl an die hundert Stück retten können.«
Mark blieb äußerlich ganz ruhig sitzen und verzog keine Miene. Eine einzelne Schweißperle lief ihm von der Stirn. Er warf einen traurigen Blick auf Lola.
»Aber die Dämpfer sind nicht einsatzbereit, richtig? Wo ich dann wohl ins Spiel komme.«
Lola nickte. »Tut mir leid.« Ihre Stimme klang ehrlich.
»Mir auch.« Er meinte es ebenso ehrlich, immerhin kannte er Lola noch als Lars-Dieter.
Was ihn nicht davon abhielt, der Frau eine Ladung Schrot in den Bauch zu pumpen. Lolas Körper wurde regelrecht in den Raum katapultiert und der Schuss wurde wohl allgemein als Aufforderung angesehen, eine nonverbale Diskussion zu starten. Mark war in die Falle gelaufen und schalt sich einen Narren. Eigentlich hätte er es wissen müssen. Ein klein wenig Uran in einer herunter gekommenen Kneipe gegen eine Transitreise mit einem U–Boot zu tauschen, war sogar für ihn eine ziemlich doofe Idee. Aber heutzutage wusste man nie. Die Typen waren definitiv so gut ausgestattet, dass Mark annahm, dass wirklich irgendwo draußen in der Elbe ein Tauchboot schwamm. Wahrscheinlich atomar betrieben oder, was den Tausch interessanter machte: atomar betreibbar. Allerdings schienen die hochgerüsteten Herren nicht daran interessiert zu sein – falls es das U-Boot gab – als Charterunternehmen solvente Kunden in die Südsee zu kutschieren, geschweige denn für ihren Treibstoff zu bezahlen. War ja auch viel preiswerter, sich etwas mit Gewalt zu nehmen, anstatt dafür zu bezahlen.
Ob sie nun seine Tauschmittel für ihr Boot oder für die Dämpfer der Spieldinger benötigten, war im gleich. Er verdrängte die Gedanken in seinem Kopf, als er den Tisch vor sich umstieß, hinter ihm in Deckung ging, mit dem Revolver ein faustgroßes Loch in das Vollvisier eines der Gegner zauberte und dann mit geschultem Blick die Lage sondierte. Die anderen Gäste hatten der eingedrungenen Truppe nicht viel entgegenzusetzen. Natürlich waren alle mehr oder weniger gut bewaffnet, doch die meisten funktionierenden Schusswaffen waren nicht in der Lage die Kevlarpanzer zu durchbrechen. Da eignete sich ein Revolver vom Kaliber 44 schon besser. Das Durcheinander hatte jedoch einen entscheidenden Vorteil. Mark, der zweifelsohne der Grund für die bleihaltige Diskussion bedeutete, war von den Schwarzgekleideten noch nicht in die Zange genommen worden. Dass sie allerdings kein Schwätzchen mit ihm halten wollten, sondern lediglich auf sein Tauschgut aus waren, zeigten sie, indem sie in die Menge schossen und dabei ein hohes Maß an Geschick an den Tag legten. Die typische Drei-Schuss-Combo: Zweimal Brust, einmal Kopf, aus den auf Einzelfeuer gestellten Sturmgewehren, zeugten von hoher Professionalität.
Mark suchte einen Ausweg. Ewig hinter dem Tisch kauern konnte er nicht. Sich bewegen bedeutete ebenfalls, entdeckt zu werden.
Einer der Eindringlinge nahm ihm die Entscheidung ab. Der Tisch vor ihm wurde plötzlich zur Seite geschleudert und direkt vor ihm wuchs die gepanzerte Gestalt in die Höhe.
Klick!
Mark konnte es natürlich nicht erkennen, aber er war sich sicher, dass sich das Gesicht hinter dem Visier ungläubig verzog. Er schaute natürlich nicht nach, sondern nutzte die Ladehemmung, um eine Ladung Schrot in ein Knie zu befördern. Die Wucht riss das Bein unterhalb des Gelenks ab und die vornüberstürzende Person, dem Schrei nach zu urteilen ein Mann, fiel auf Mark. Der setzte den Revolver seitlich auf und pulverisierte die Synapsen im Helm mit einem Geschoß Kaliber 44. Er griff nach seinem Rucksack, dann stemmte er den blutigen Leichnam hoch, hielt ihn sichernd vor sich und schleppte ihn als menschlichen Schutzschild Richtung Bar.
Gute Idee, schlechte Ausführung. Er kam ein oder zwei Meter und rutschte dann auf dem mittlerweile literweise vergossenen Blut aus. Mark schleudert im Fallen den leblosen Körper von sich und versuchte, hinter die Bar zu hechten.
Das klappte nur fast, an seinem linken Bein ruckte es kräftig. Leicht verzögert setzte der Schmerz ein. Das Projektil hatte seine Wade durchschlagen und ein fingergroßes Loch hinterlassen. Glatter Durchschuss, aber schmerzhaft. Mark griff nach dem erstbesten Stück Stoff, dass ihm in die Finger kam und zerrte daran. Die Kreatur, ein großes weibliches Ding, mit einem roten Kleid, ebenso roten vollen Lippen und wallendem blonden Haar, das als Barkeeper diente, schrie protestierend auf, während er an ihrem Rock nestelte. Sie reichte Mark stattdessen ein Trockentuch. Er wollte sich gerade bedanken, da platzte der blondbehaarte Kopf des Wesens auseinander. Die Angreifer schienen tatsächlich keine Freunde zu kennen und das einzige, was ihnen am Herzen lag, war wahrscheinlich der kleine Tank in Marks Rucksack. Allerdings hatte Mark nicht viele Trümpfe im Ärmel und erst recht keine Idee, wie er den verbleibenden sechs Widersachern entkommen, geschweige denn, gegen sie bestehen sollte. Schnell knotete er das Tuch um seine Wunde an der Wade.
Die Schüsse im Raum waren nicht weniger geworden, mittlerweile hing Brandgeruch in der Luft und Qualm durchzog die Kneipe. Hier und da schrie einer der Gäste eine wüste Beschimpfung in den Raum oder stieß einen Schmerzensschrei aus. Ansonsten hielt sich die Konversation stark in Grenzen.
»Willse trinken?«, fragte ihn der Enterich, der plötzlich neben ihm stand.
Mark lud die Pump-action nach und schüttelte den Kopf. »Danke, überleben ist mir momentan wichtiger.«
»Oh, sach das doch.« Die Gestalt klopfte gegen eine Holzverkleidung unter der Bar und wie von Zauberhand glitt diese zur Seite. Ein Zugang in die Privaträume wurde sichtbar und einer der drei Hasenartigen blinzelte ihn an.
»Hasiohr«, brabbelte das kleine Kerlchen und wurde sofort von einem seiner Kollegen in den Raum gezogen.
Ein zweiter Vertreter vom Typ Hase schaute von der anderen Seite durch die Luke. »’Tschuldigung, er hat nen Sprachfehler. Rettung gefällig?«
Mark ließ sich das nicht zweimal sagen und zwängte sich durch die Öffnung.
Gerade als das dritte Bandmitglied die Verkleidung wieder schließen wollte, griff Mark noch einmal hindurch und riss den Enterich am Kragen in den Hinterraum.
Das Kabuff, in dem sie sich nun befanden, war spärlich möbliert. Das Inventar bestand lediglich aus einem Sofa, einem Tresor, der warum auch immer offen stand, und aus nunmehr fünf lebendig gewordenen Spielfiguren. Als Mark einen Blick auf die sich auf dem Sofa rekelnde Plüschi warf, hatte er einen kurzen Moment das Gefühl, dass eigentlich alles jenseits dieses Raumes ohne Bedeutung wäre und …
Es hämmerte laut an der Tür.
Mittlerweile hatte sich eine ungewöhnliche Stille über die Kneipe gelegt. Keine Schüsse, keine Schreie. Nur das Klopfen an der Hintertür.
»Wir sind hier fertig.« Eine dumpfe Männerstimme. »Keiner der Toten ist unsere Zielperson.«
Die Wesen schauten Mark teilnahmslos an.
»Hier draußen lebt außer uns fünfen keiner mehr.«
Mark hatte nicht vor, sich zu verraten, indem er auf das Geplänkel einging.
»Ach, stimmt gar nicht. Etwas lebt noch. Kommt raus und es wird ihm nichts geschehen.«
Zwei der kleinen Hasenartigen bildeten eine Leiter und der dritte lugte aus dem Sichtloch in das Innere des Schankraums. Emotionslos meldete er, dass der Türsteher noch lebte.
»Wie viele?«, fragte Mark.
»Vier.«
Wahrscheinlich zusätzlich einer links und rechts an der Tür, waren wenigstens sechs. Und so professionell, wie die Truppe vorgegangen war, würde noch ein Kollege an der Treppe nach oben warten.
»Na, wie sieht es aus?« Wieder die Stimme von außen. »Ach egal …«
Ein Schuss fiel.
Die drei kleinen Hasen verließen ihren Standort an der Tür und setzten sich auf die Couch. Gleichmäßig im Einklang ließen sie die Beine baumeln.
»Sieht komisch aus.«
»So ohne Kopf.«
»Hasiohr.«
Plüschi stand nun direkt neben Mark.
Dieses Wesen faszinierte ihn und wenn die Situation es zugelassen hätte, wäre er nicht abgeneigt gewesen, eine wie auch immer geartete, aber auf jeden Fall körperliche, Beziehung mit ihr einzugehen.
»Wir können dir helfen.« Ganz beiläufig ließ sie die Worte fallen.
Er schaute sie fragend an.
»Wir sind gehemmt.« Sie schaute bedrückt.
»Ich will gar nicht wissen, wie du ungehemmt bist, wenn das hier dein gehemmter Zustand ist.« Er grinste sie an, aber sie schaute nur stumm Richtung offenem Tresor.
Mark zog seinen Geigerzähler aus dem Rucksack. Leichter Ausschlag und je näher er dem Tresor kam, desto stärker schlug der Zeiger aus.
»Was ist nun? Ich gebe euch zwei Minuten, dann werfen wir ein paar Granaten in euer Kabuff und holen uns, was über bleibt.«
Träumt schön weiter, dachte Mark bei sich. Wenn sie Granaten hätten, würden sie diese bestimmt nicht dreißig Meter und dem Meeresspiegel hochgehen lassen. Der Anzeiger des Strahlendosimeters war hoch, aber keinesfalls im bedenklichen Bereich. Da gab es Gegenden an der Elbe, die waren vor der Katastrophe schlimmer verstrahlt. Erstaunt stellte er fest, dass an dem vermeintlichen Dämpfer ein simpler On-Off Knopf war. Er drehte sich fragend um. Die verbliebenen fünf Kreaturen standen in einem Halbkreis von drei Metern Abstand vor ihm.
»Wir können es nicht bedienen.« Plüschi sprach eindringlich und mit lehrerhafter Stimme. »Wenn wir zu nahe an das Gerät kommen, brennt es unsere Implantate durch. Wir sterben.«
Sterben? Ein solch anmutiges Geschöpf? Er kam nicht umhin, sie sich in Schuluniform mit Nickelbrille und streng nach hinten verknoteten Hasenohren vorzustellen. Das war schon ein wenig …
»… abartig?«, fragte Plüschi.
Vor Schreck ließ Mark beinahe die Pump-gun fallen. »Du kannst …«
»Gedanken lesen? Ja.« Eine Feststellung.
Mark versuchte gar nicht erst, seine Gedanken zu verschleiern.
»Hätte auch keinen Sinn ergeben. Du willst wissen, was passiert, wenn du den Dämpfer ausschaltest. Wir wissen es auch nicht. Aber so wie wir im Moment sind, gehemmt durch das Teil, haben wir keine Möglichkeit dir zu helfen.«
Das Wesen nickte noch einmal, ohne dass Mark auch nur ein Wort gesagt hatte. »Richtig, uns zu helfen. Das eine schließt das andere nicht aus.«
Mark G. Rummel, Spitzname Grummel, hatte wenig Lust in diesem Loch unter der Elbe zu sterben. Er wandte sich dem Tresor und dem darin liegenden Gerät zu. Er legte den Schalter an dem Dämpfer um. Off. Kein Licht leuchtete mehr.
Als er sich umdrehte, sah er die Auswirkung seines Handelns. Die fünf, die bis vor wenigen Sekunden noch teilnahmslos und lethargisch wirkten, strahlten plötzlich eine Energie aus, die er fast fühlen konnte. Der Ententyp schaute ihn nicht mit ausdruckslosem Blick, sondern mit einem fast schon hinterhältigen Funkeln aus den großen Kulleraugen an. Die drei abgebrochenen Hasenartigen hüpften auf und ab wie Gummibälle und Plüschi schien mit ihrem hoch aufgestellten Lauschern die Situation wie mit Antennen zu sondieren. Eine Spannung lag in der Luft, und alles schien auf den sogenannten Tropfen zu warten, der das berühmte Fass zum Überlaufen brachte.
Der Tropfen kam. Die Tür wurde von außen aufgebrochen und ein Gegenstand rollte hinein. Dichter Qualm drang aus dem kleinen Zylinder hervor und Mark zog sich sofort das Halstuch über Mund und Nase. Kurz abgelenkt hatte er die schnelle Bewegung vor sich kaum bemerkt, plötzlich stand er ohne Schrotflinte da.
»Nicht bewegen, nicht reden, einfach gar nichts machen.«
Er wusste nicht genau, ob Plüschi wirklich gesprochen oder er ihre Stimme in seinem Kopf gehört hatte.
Die drei Musiker sausten durch den geheimen Gang in der Wand im Nebenzimmer. Plüschi hob das Gewehr an die Wand neben dem Türrahmen, drückte zweimal ab, überbrückte die Öffnung schneller, als man sehen konnte und pumpte zwei weitere Ladungen in die andere Wandseite. Die Schmerzensschreie aus dem Inneren der Bar verrieten Mark, dass er mit seiner Vermutung der beiden versteckten Angreifer an den Türseiten richtig gelegen hatte.
Mittlerweile war der Qualm der Gasgranate so beißend, dass er sich in eine Ecke kauerte, die Augen zusammen kniff und nur noch auf Geräusche achtete. Er vernahm ein freudiges »Entente«, gefolgt von einer ganzen Reihe Schüsse aus einem großkalibrigen Revolver. Ein Griff an seinen leeren Hosenbund beantwortet ihm die Frage nach der Art der Waffe. Vier Schüsse waren noch in seiner Kanone, sechs in seiner Flinte, bevor die Kreaturen sie an sich genommen hatten. Kaum hatte er den Gedanken beendet, knallte die Pump-action zwei Mal. Ein wildes Stakkato aus mindestens drei Sturmgewehren dröhnte an seine Ohren und dann … Stille. Kein Stöhnen, keine Kommandos. Nichts. Dann eine einzelne Stimme.
»Hasiohr, Hasiohr, Hasiohr, Hasiohr …«
Mark stand auf und spähte in den Nebenraum. Plüschi mit der Schrotflinte, Ente mit dem Revolver und zwei der Hasen mit Sturmgewehren, die größer als sie selbst waren, standen im Schankraum und schauten auf den dort liegenden vierarmigen Kollegen nieder. Der dritte Hase saß rittlings auf dem Brustkorb eines gepanzerten Angreifers und stach mit einem Armeemesser immer wieder auf dessen ungeschützten Hals und Kopf ein. Dabei rief er fortlaufend »Hasiohr«.
Der Enterich drehte sich um.
»Ignorier ihn einfach, manchmal tickt er ein wenig aus.«
Mark ignorierte den Hasenähnlichen und trat neben die Überlebenden. Er konnte aus dem Augenwinkel eine einzelne Träne sehen, die aus Plüschis Augen lief. Sie bückte sich zu dem toten Türsteher nieder, fuhr mit einer Hand über seine Augen und nahm mit der anderen die einzelne Schrotpatrone an sich, die Mark ihm zu Beginn des Treffens in die Hand gedrückt hatte.
»Du weinst?«
Sie sah ihn nicht an, aber in seinem Kopf formte sich die Antwort. Diese Wesen waren nicht gefühllos. Sie hatten nur keine Gefühle gegenüber Menschen. Und wenn er sich so umschaute, hatte er eine kleine Ahnung, warum das so war.
Ein paar Minuten später traten sie an die frische Luft am Ende der Wendeltreppe.
»Oh, damit hätte ich nicht gerechnet.« Hörni kam freudestrahlend auf die Gruppe zu und breitete die Arme aus.
Mark wollte dem alten Freund entgegengehen, doch Enton hielt ihn am Hosenbein fest und schüttelte den Kopf. Plüschi repetierte die Pump-action und jagte Hörni die Ladung der letzten Patrone ins Gesicht. Rückwärts fiel er in die Fluten der Elbe und versank im dunklen Wasser.
Mark wollte aufmucken, doch Plüschi sah ihn ruhig an und hob beschwichtigend die Hände.
»Was glaubst du, warum er noch lebte, während die Typen da unten alles massakriert haben?«
Mark stutzte.
»Siehst du.« Sie winkte ab.
Nach ein paar Minuten der Stille sah er die Kreaturen der Reihe nach an. Als sein Blick auf Plüschi fiel, wurde ihm die Veränderung bewusst. Ja, sie sah toll aus, aber er verspürte kein Verlangen mehr. Er konnte nicht richtig einordnen, was er verspürte, eigentlich spürte er außer dem schmerzenden Loch in seiner Wade nicht sehr viel, aber seine Nackenhaare stellten sich unter ihrem forschenden Blick auf.
»Was habt ihr nun vor?«
»Kannst du dir das nicht vorstellen?« Plüschi wies auf seinen Rucksack und da wurde ihm klar, was diese fünf Wesen über die verbliebene Menschheit bringen würden.
Sarah König
Unendliche Weiten und die Gefahren fremder Welten sind eigentlich gar nicht Sarah Königs Ding. Wer in einem 9000-Seelen-Dörfchen aufwächst, den verschlägt es mit Familie maximal in die nächstbeste Kleinstadt – und in der Pottbäckerhochburg ist jeder fame, der in den Elternrat des Kindergartens gewählt wird. Jetzt hat Sarah allerdings Blut geleckt – Blut, das aus dem Fleischwolf tropfte, den Günther Kienle angeschmissen hat, um die Genre Fantasy, Science-Fiction und Horror ordentlich durchzumischen. Um es ein wenig erträglicher zu machen, träufelt Sarah einen guten Esslöffel Humor in ihre Geschichte. Und wer weiß, welchen hormonellen Einflüssen die Geschichte ausgesetzt war, denn zum Entstehungszeitpunkt hatte eine Vertreterin der Rasse der Bauchzwerge bereits die beinahe vollständige Kontrolle über ihre Wirtin übernommen …
www. sarahkoenig.blogspot.de
Interview
Was war dein bisher blutigstes Erlebnis?
Meine kleine Schwester ist mit meinem Rad ohne Stützräder unsere Siedlung lang geheizt. Mit ungehörig viel Schwung ist sie die geschotterte Einfahrt eines Hauses rauf und ungebremst gegen das Garagentor gebrettert. Ich seh sie heute noch blutüberströmt vor mir und habe meine Mutter halb wahnsinnig gemacht, weil ich im Sekundentakt fragte, ob meine Schwester jetzt sterben müsste.
Ach, und dann natürlich die Geburt meiner ersten Tochter mit über einem Liter Blutverlust. Aber wer will das wissen.
Wie erklärst du deinen Eltern / Kindern / dem sozialen Umfeld, dass du SOLCHE Geschichten schreibst?
Ich bin ja doch eher eine harmlose Autorin, die SOLCHE Geschichten nur mit einer Messerspitze Horror oder einer Prise Grusel schreibt. Wenn ich jetzt erklären müsste, warum ich plötzlich die Helene Fischer des Horrors sein wollte, DAS wäre erklärungsbedürftig!
Welche Musik hast du beim Schreiben deiner Geschichte gehört und welche Musik empfiehlst du zum Lesen?
Ich höre ehrlich gesagt immer ganz schnöde Konzentrationsmusik. Ich muss ausblenden können. Seit wir den 3D-Drucker haben, kann ich auch bei dessen Geräuschkompositionen wunderbar arbeiten: brrr zzzt brrrr fiep brrr zzzt brrr …
Vendetta
Das Dröhnen der Alarmsirenen schreckte mich auf. Rauch stieg mir in die Nase und noch ehe ich feststellen konnte, wo ich mich befand, brannte meine Lunge von der rußigen Atemluft. Schwungvoll stemmte ich mich in eine halb sitzende Position, drehte mich, soweit ich konnte auf die Seite. Dort erbrach ich meine letzte Mahlzeit. Scheiße.
Ich keuchte. In meinem Brustkorb hämmerte ein unangenehmes Stechen. Ich sah an mir herab. Schürfwunden verunstalteten meine Arme, meine Bluse war an ein paar Stellen zerrissen. Meine Augen tränten und jede meiner Abschürfungen erwachte nach und nach zu schreiendem Leben und schmerzte.
Erst jetzt bemerkte ich, dass eines meiner Beine unter etwas festklemmte. Ich konnte es nicht richtig benennen, stellte aber mit wachsender Panik fest, dass ich mich nicht richtig bewegen konnte.
Vorsichtig ließ ich mich zurücksinken und rang die Furcht nieder. Trotz der dicken Luft versuchte ich, tief einzuatmen. Das zunehmende Stechen in meinem Brustkorb verhieß nichts Gutes. Ich hatte mir wohl einige Rippen geprellt, wenn nicht sogar gebrochen.
Langsam wurde meine Sicht klarer und trotz der Schmerzen gelang es mir, meine Umgebung deutlicher wahrzunehmen.
Was zur Hölle war passiert?
Ich erkannte nur Trümmer des Raubschiffes. Bruchstücke, wortwörtlich, von der einst prächtigen PWND. Angestrengt lauschte ich nach Geräuschen meiner Gefährten, doch der Alarm dröhnte noch schrecklich laut in meinen Ohren nach, übertönte alles. Bis plötzlich etwas in einiger Entfernung explodierte und Stille einkehrte.
Die Erkenntnis prallte in mein Bewusstsein, wie zuvor die PWND auf diesen Planeten: Wir sind abgestürzt!
Nein. Ich runzelte die Stirn. Wir wurden abgeschossen. Ein weiterer Adrenalinschub flutete meine Adern. Mit einem Satz setzte ich mich auf.
Die Einschläge, als das auf uns gerichtete Feuer unsere mickrigen Schilde traf, es wie ein glutrotes Spinnennetz durchzog und kurzerhand zerstörte, hatten uns völlig überrascht. Unsere Sensoren hatten uns kein anderes Schiff in unmittelbarer Nähe gemeldet. Der Kapitän, Leroy Rabbit Lang, hatte uns sofort in Alarmbereitschaft versetzt.
Rivers und Ambrose, beide nicht im Kampf ausgebildet, gingen auf Rabbits Anweisung sofort zu ihren Sitzplätzen, während wir übrigen Crewmitglieder auf unsere Positionen eilten und versuchten, die PWND von der Gefahr wegzubringen und das Feuer mit unseren wenigen Möglichkeiten zu erwidern. Wir waren kein auf Kampf ausgelegtes Schiff – wir konnten uns wehren und uns dann schleunigst aus dem Staub machen, in den meisten Fällen genügte das.
Der nächste Treffer erschütterte das Raubschiff jedoch so heftig, dass ich trotz meines Sicherheitsgurts nach vorn schleuderte und hart aufschlug. Dann sah ich nur noch Sternchen.
So wie es nun aussah, hatte die PWND den Kampf verloren. Mein Hals zog sich zu. Erinnerungen an lächelnde Gesichter, erste Begegnungen und gemeinsam verbrachte Momente überfielen meine Gedanken.
Jahre waren wir zusammen geflogen. Hatten miteinander die größten Schiffe geentert und leer geräumt … uns dadurch natürlich auch Feinde gemacht. Offensichtlich. Ich ließ mir einen Augenblick Zeit, bis die erste Welle der Trauer abebbte.
Angestrengt blinzelte ich vereinzelte Tränen weg und blickte zwischen den Trümmern durch all den Rauch und den Schmerznebel, um die Menschen auszumachen, die in den letzten Minuten meiner Erinnerung in meiner unmittelbaren Nähe gewesen waren.
Rabbit, dann der Navigator Hal Grayson und … da war noch jemand gewesen. Juniper Lewis. June …
Mit aller Macht riss ich an meinem Bein. Der Gedanke, dass June hier irgendwo lag und noch leben könnte, vielleicht um ihr Leben kämpfte …
Trotz des Schmerzes, der mein Bein hochschoss, gelang es mir, den festgeklemmten Unterschenkel unter dem Trümmerteil hervor zu ziehen. Eine lange, nicht sonderlich tiefe Wunde kam zum Vorschein. Für einen Augenblick sah ich noch frisch austretendes Blut, dann stoppte die Blutung.
Bebend richtete ich mich auf. Wenn ich die Zähne zusammenbiss, konnte ich mein verletztes Bein belasten. Unter meinen Schuhen erkannte ich weichen, gelben Sand.
Ich blickte über das Trümmerfeld. Gleißendes Sonnenlicht brannte in meinen Augen. An vielen Stellen sah ich Feuer. Langsam humpelte ich über die Absturzstelle.
Ich erblickte mehrere Körperteile, doch von keinem konnte ich sagen, zu welcher Person jener Finger oder jenes Bein gehört haben mochte. June konnte ich nirgendwo ausmachen. Auch nicht Teile von ihr, falls ich diese überhaupt eindeutig hätte zuordnen können. Aller Wahrscheinlichkeit nach lag sie zerschmettert unter den größeren Wrackteilen verborgen. Es fühlte sich an, als setzte mein Herz für die Dauer eines Schlages aus. Die Aussicht, Junes leblosen, zerschundenen Körper inmitten der Trümmer zu entdecken und ihre Leiche in den Armen halten zu müssen, bereitete mir so unfassbar viel Furcht, dass ich erschauerte. Ich blickte mich einmal mehr um, jedoch von dem Gedanken wie gelähmt, was wäre, würde ich June entdecken. Ich tat es nicht … sie musste einfach unter dem Wrack verborgen liegen.
Als ich meinen Mund öffnete, um ihren Namen zu rufen, entkam meinen Lippen nur ein tonloses Keuchen. Sie würde ja doch nicht antworten können.
Schwere und Dunkelheit legten sich auf meinen Körper und meinen Geist. Ich schluckte hart, schlang die Armen um mich und hielt mich krampfhaft aufrecht. Ich hatte June verloren, doch ich hatte jetzt keine Zeit, mich hier mitten im Nichts in den Schutt zu setzen und zu trauern. Ich musste herausfinden, wo genau ich war und schnellstmöglich einen Weg finden, hier wegzukommen.
Der Schmerz in meinem Kopf nahm bei jedem Gedanken, den ich zu unserer Route fassen wollte zu – ich konnte mir beim besten Willen nicht mehr zusammenreimen, in welcher Höhe wir uns befunden hatten, als uns der Angriff überraschte. Konnte das hier Islan sein? Oder waren wir schon näher an Zuhause gewesen? Mir entfuhr unausweichlich ein tiefes Stöhnen und ich vermied es, weiter in meinem malträtierten Gehirn eine Antwort zu suchen.
Ich ließ die Trümmer und den Geruch nach verbranntem Fleisch hinter mir. Je weniger Rauch um mich herum in die Luft stieg, desto lichter wurde mein Schwindel. Allmählich konnte ich klarer sehen. Ich hielt nach Merkmalen für eine Zuordnung des Planeten Ausschau. Brennende Hitze, gleißendes Sonnenlicht. Der spontane Wunsch, mehrere Liter Wasser zu trinken. In meinen Überlegungen machte ich einen Haken bei Wüstenplanet, so viel war klar.
»Hallo!«
Überrascht fuhr ich herum. Schmerz schoss mein Bein empor und ließ mich einen Augenblick taumeln.
Eine fremde, leicht bedeckte Stimme. Sie kam nicht aus den Trümmern. Sie kam von den Steinen in einiger Entfernung. Ein Wesen hockte dort und sah mich durch verdunkelte, sandverkratzte Brillengläser an. War das ein Mensch?
Als es sich den Schal von Nase und Mund zog und mit der anderen Hand die Brille auf die Stirn schob, erkannte ich menschenähnliche Züge auf dem meeresblauen Gesicht. Und als es erneut murmelte, hörte ich den leichten Akzent, mit dem es Dharati, die Sprache der Menschen, sprach.
»Ich wollte dich nicht erschrecken.« Ein Lächeln umspielte die Lippen des Wesens. Die dunklen Augen wirkten zu groß für den kleinen Kopf, die feingliedrigen Finger zu lang für die Hände.
Als es sich die Kapuze tiefer ins Gesicht zog, offenbar um seine Augen auch ohne Brille vor der gnadenlosen Sonne zu schützen, und schwungvoll von dem Stein heruntersprang, schüttelte ich den Kopf.
»Kein Problem.«
Kein Problem? Mein Verstand war offensichtlich noch nicht wieder in der Lage, die ganze Situation nüchtern einzuordnen. Mein Gegenüber wirkte nicht aggressiv oder feindselig, doch ich blieb argwöhnisch. Ich wusste schließlich weder, wo ich mich befand, noch wer diesen Planeten sein Zuhause nannte.
Nachdem das Wesen vor mir zum Stehen kam, wandte es den Kopf und betrachtete das rauchende Trümmerfeld. Ich bemerkte Kiemen, als es den Kopf drehte und der Schal um seinen Hals ein Stück verrutschte.
Ein Aquarianer! Beinahe wäre es mir laut rausgerutscht. Wie kam es, dass ein Wesen, das überwiegend im Wasser lebte, jetzt hier auftauchte?
»Ich stamme nicht von hier.«
Okay … und er kann Gedanken lesen.
Mein Gegenüber grinste schief.
Überrascht schnappte ich nach Luft, was sogleich von einem heftigen Stechen in meiner Rippengegend quittiert wurde. Einen gequälten Laut auf den Lippen ließ ich mich zu Boden sinken und starrte das Wesen von unten an. Nachdem es noch einen Moment seinen Blick über die Reste der PWND schweifen ließ, wandte es seine Aufmerksamkeit wieder mir zu und ging unmittelbar vor mir in die Hocke.
Ehe ich mich versah, hatte es einen seiner Handschuhe ausgezogen und betastete mit seinen schlaksigen Fingern mein Bein.
»Hast du Schmerzen?«
Ich keuchte, der Druck seiner Finger auf der Wunde nahm zu. »Ja«, brachte ich atemlos hervor.
Das Wesen nickte. »Wir könnten es abschneiden, dann tut es nicht mehr weh.«
Heftig schüttelte ich den Kopf. War das etwa ernst gemeint? Ich wusste natürlich aus Erfahrung, dass eine solche Wunde zwar lästig, nicht aber lebensbedrohlich war. »Nein«, antwortete ich abwehrend.
Mein Gegenüber legte den Kopf schief. »Kann doch nachwachsen. Gesund, kräftig.«
»Wir Menschen wachsen nicht nach!«, wandte ich ein.
Das Wesen tat es mit einem Achselzucken ab, tastete weiter und befühlte meinen Brustkorb.
»Entschuldige mal!«, rief ich aus und schob die fremden Hände von meinen Brüsten.
Wieder legte es nur den Kopf schief. Es schien keinerlei Schamgefühl zu besitzen, höfliche – oder besser menschliche – Zurückhaltung zu kennen.
Ich stellte mit leichter Verunsicherung fest, wie mich diese Situation etwas überforderte. Noch einmal zog ich den Stoff meiner Bluse enger um mich und beschloss, in die Offensive zu gehen. »Du sprichst meine Sprache gut. Wie heißt du?«
»Mein Name ist Padchuraghuri’ghal’na’shi.«
Ich formte stumm den Namen, um ihn möglichst nicht allzu falsch auszusprechen, hatte aber die letzten Silben bereits wieder vergessen.
»Pad«, bot das Wesen an und gab einen keckernden Laut von sich, der wohl ein Lachen sein sollte.
»Hallo Pad«, antwortete ich. »Ich bin Edith, Edi.« Ich streckte ihm die Hand entgegen, ohne weiter darüber nachzudenken.
Nach kurzem, irritiertem Zögern ergriff Pad mit schief gelegtem Kopf meinen Zeigefinger und drückte einmal kurz die Fingerspitze. Dann fasste er ohne weitere Erklärung unter meine Arme und zog mich auf die Beine. Es schien ihn nicht anzustrengen.
»Ich habe ein Lager. Wasser, etwas zu essen. Verbände.« Er deutete auf mein Bein und pikste mir kurz demonstrativ in die Seite, sodass ich mich vor Schmerz krümmte. Dann sagte er: »Komm.«
Unsicher sah ich zurück auf die Überreste der PWND.
»Ich spüre keine menschliche Wärmestrahlung außer deiner.«
Ich starrte Pad in die Augen. Ein Telepath und in der Lage, Wärmequellen zu lokalisieren.
»Ist überlebenswichtig«, erklärte Pad und bedeutete mir dann die Richtung, in der sein Lager lag.
June, Rabbit und all die anderen …
Die Aussicht, das Wrack mit all seinen verborgenen Schrecken hinter mir zu lassen, und mich der Erschöpfung und Trauer um meine Freunde hinzugeben, ließ meine Knie zittern.
Schließlich nickte ich und wandte mich ab.
Pad stützte mich und leitete mich zu seinem Lager unweit der Absturzstelle. Kein Wunder, dass er so kurze Zeit nach dem Aufprall bereits da gewesen war. Ganz wie ich in dieser Umgebung erwartet hatte, bestand das Lager aus zwei verbundenen Zelten. Pad führte mich in das erste und ließ mich kurz hinter dem Eingang auf einem Bett aus Kissen nieder, bevor er sich entschuldigte.
»Ich bin gleich wieder da.«
Das, was wie ein normaler Durchgang zum anliegenden Zelt aussah, erwies sich als metallene Schleuse. Er bediente einen Hebel und es zischte. Ein Hauch kühler Luft entwich aus dem hinteren Teil.
Ich erwartete, dass Pad für eine Weile fortbleiben würde, doch er kehrte bereits wenige Augenblicke später zurück. In den Händen eine flache Schüssel, in der etwas hin und her zu schwappen schien. Ich erkannte einfaches Wasser.
Pad verschloss den Zugang und das Geräusch einer einrastenden Verriegelung verriet mir, dass der gesamte hintere Teil zwar wie ein Zelt aussah, dabei aber Wesentliches verbarg. Vielleicht war es sogar Pads Raumkapsel, die ihm hier getarnt als Behausung diente.
Dankbar für die erfrischende Abkühlung streckte ich die Hand nach der Schüssel aus. Ein ungewöhnliches Trinkgefäß zwar, aber ich würde mich nicht beschweren.
Doch Pad setzte sich, scheinbar ohne meine nach Wasser lechzende Hand überhaupt zu registrieren. Dann zog er seine Stiefel aus und stellte seine Füße in das Wasser. Kurz darauf erklang ein wohliges Seufzen.
Perplex hob ich eine Augenbraue und konnte nicht verhindern, dass mir ein völlig erstaunter Laut über die Lippen entwich. Ich konnte mir ja vorstellen, dass es die Hölle für den Aquarianer sein musste, sich auf diesem Wüstenplaneten zu bewegen, aber mir erst etwas von Wasser erzählen und sich dann selbst ein Fußbad gönnen … Ich gab gerne zu, dass mich Pads Verhalten etwas irritierte.
Pad hatte die Augen geschlossen, gleich als seine Füße das Wasser berührt hatten, und schien ganz allmählich wieder zu sich zu kommen. Jetzt bemerkte er meinen Blick und lief tatsächlich unter seinem außergewöhnlichen Blauton leicht rot an.
»Verzeih mir, bitte – ich bin ein schlechter Gastgeber.« Noch während er sprach, erhob er sich, um aus einer massiv wirkenden Truhe neben sich etwas zu entnehmen. Ich erkannte die gläsernen Wasserflaschen, die es in jedem Raumhafen gab. Die Werbung für dieses Wasser fiel mir sofort ein. Seit ich ein Kind war, warb die Firma Éltsen damit, dass ihr Wasser eine ganz besondere Mischung sei, die von 97,3 % der den Weltraum bereisenden Rassen vertragen wurde.
Es würde mich gar nicht wundern, wenn es einfach aus dem nächstbesten Tiefbrunnen irgendwo auf Yevev abgepumpt und für das 300-fache mit schickem Fake-Siegel verkauft wurde.
»Nicht gut?«, fragte Pad, doch ich schüttelte nur den Kopf, öffnete die Flasche und trank gierig.
Pad stellte seine Füße zurück in die Schüssel und seufzte erneut, behielt mich aber dieses Mal im Auge und driftete nicht wieder ab. Er hatte sich offenbar akklimatisiert.
Unweigerlich fragte ich mich, was ihn hergeführt hatte, warum ausgerechnet ein Aquarianer auf einem der heißesten Planeten des Systems lebte. Zuhause war er hier nicht.
»Zuhause gibt es nicht mehr. Und hier auf Islan ist es warm. Sehr warm. Wir können die Wärme nutzen und unser Fortbestehen sichern.«
»Nutzen?«, fragte ich. Gedanklich machte ich einen Haken an meine Überlegungen zu meinem Aufenthaltsort. Islan, heißester Wüstenplanet des Systems.
Pad stimmte mit einem Nicken zu. »Solaröfen.«
Ich versuchte, mir aus seinen knappen Antworten einen Reim zu machen. Zuhause gibt es nicht mehr. Hieß das etwa, Pad und seine Familie, die gesamte Rasse, hatten ihren Heimatplaneten verlassen, um hier zu siedeln?
»Nicht alle.«
»Wie viele seid ihr?«
»Hunderte. Tausende. Wir mussten fort. Unsere Heimat wurde zu kalt. Wir starben. Unsere Jungen starben. Wir konnten nicht brüten.«
»Solaröfen«, wiederholte ich. »Ich dachte, ihr braucht vor allem das Wasser zum Überleben. Dabei benötigt ihr vor allem optimale Brutbedingungen. Ihr verstärkt die Hitze der ohnehin nahestehenden Sonnen. Anders könnt ihr euch hier nicht fortpflanzen?«
»Wir sind keine Pflanzen.«
Ich musste unweigerlich lachen und erntete nur einen verstörten Blick.
Pad beließ es dabei und erklärte dann: »Als es zu kalt wurde, machten wir uns in kleinen Gruppen auf die Suche nach einem Ort, an dem wir fortbestehen konnten. Wir sind nun eine Dekade hier und hatten fast jedes Jahr Erfolg mit der Nachzucht. Bald können wir wieder alle zusammen sein.«
Pads Beschreibung seiner Spezies klang wie die Beschreibung einer einzigen, großen Familie. Ich käme nie auf die Idee die gesamte Menschheit als meine Familie zu bezeichnen.
»Und was tust du allein hier?«
»Ich teste die Sonne. Ich finde die heißen Flecken, an denen wir die Solaröfen bauen.«
Ich verstand. »Wer beheimatet diesen Planeten?«
»Niemand. Niemand lebt hier, wir werden auch nicht bleiben. Der Planet ist nur ein Zwischenstopp für uns, auf dem Weg, das Überleben unserer Spezies zu sichern.«
»Kommen regelmäßig Schiffe her?«
Pad nickte. »Kleine, große.«
»Auch Menschen?«
Pad nickte wieder. »Manchmal.«
»Kommen sie regelmäßig?«
Jetzt ein Kopfschütteln. »Immer überraschend. Ich weiß auch nicht, was sie hier tun, wenn sie landen. Wir beachten sie nicht weiter.«
Es sei denn, sie stürzen ab. Verdrossen ließ ich mich in die Kissen zurücksinken. Es konnte länger dauern als erhofft, von diesem Planeten runter zu kommen.