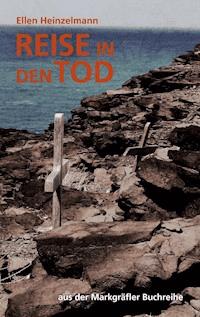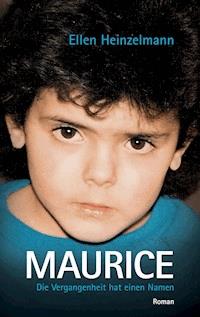Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Markgräfler Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Mit dreißig Jahren entdeckt der bei Waldshut lebende Boris Petrow per Zufall, dass Ilja, sein verstorbener Zwillingsbruder mit Down-Syndrom, gar nicht sein Bruder war. Sein wirklicher Zwillingsbruder mit Namen Eric, von dem er bei der Geburt getrennt wurde, wuchs 60 km entfernt in einer anderen Familie auf - und er lebt. Durch seine Recherchen gerät Boris in große Gefahr, denn Erics Vater, Adrian, will mit allen Mitteln ein Treffen zwischen den beiden Brüdern verhindern. Er setzt einen Berufsverbrecher auf ihn an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
›BLUTSVERWANDT‹ ist eine Kriminalgeschichte, nicht nach herkömmlichem Schema: Straftat, Opfer, unbekannter Täter, polizeiliche Ermittlung und Lösung des Falles.
In diesem Roman kennen wir die Täter. Wir lernen das Opfer und dessen Leben kennen. Von der Polizei wird der Fall jedoch nie vollends aufgeklärt.
Über den Inhalt
Mit dreißig Jahren entdeckt der bei Waldshut lebende Boris Petrow per Zufall, dass Ilja, sein verstorbener Zwillingsbruder mit Down-Syndrom, gar nicht sein Bruder war. Sein wirklicher Zwillingsbruder mit Namen Eric, von dem er bei der Geburt getrennt wurde, wuchs 60 km entfernt in einer anderen Familie auf … und er lebt. Durch seine Recherchen gerät Boris in große Gefahr, denn Erics Vater, Adrian, will mit allen Mitteln ein Treffen zwischen den beiden Brüdern verhindern. Er setzt einen Berufsverbrecher auf ihn an.
Die Autorin
Ellen Heinzelmann, Fachfrau für Marketing und Kommunikation, wurde 1951 im Kreis Waldshut geboren. Während ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit – zuletzt als Marketing- und PR-Verantwortliche in einer Organisation des öffentlichen Rechts in Basel – übersetzte sie Texte vom Deutschen ins Französische und Englische, wirkte als Dolmetscherin bei Vertragsverhandlungen in Paris. Sie schrieb viele Artikel in Fachzeitschriften und Heimatbüchern, war Redakteurin eines offiziellen, branchenbezognenen Vereinsorgans, entwarf Broschüren und Werbematerialien und organisierte umfangreiche geschäftliche Events. Sie lektorierte Fremdtexte und wirkte als Ghostwriterin. Die geschriebene Sprache hatte schon in früher Kindheit große Faszination auf sie ausgeübt. Heute, nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben, ist sie ihrer Berufung gefolgt. Mit ihrem Debütroman ›Der Sohn der Kellnerin‹, eine nicht alltägliche Geschichte, startete sie 2011 ihre Schriftstellerlaufbahn und nahm ihre Leser gleich mit auf eine emotionale Reise.
www.ellen-heinzelmann.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
10. September 1977
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Vorwort
In meinem Buch kommt neben dem Begriff Down-Syndrom auch immer wieder mal die veraltete Bezeichnung ›Mongoloide‹ oder ›mongoloid‹ vor. Obwohl dieser Begriff in der medizinischen Fachsprache heute nicht mehr verwendet wird, habe ich ihn insbesondere in der wörtlichen Rede angewandt, zumal sich der Volksmund immer noch dieses Wortes bedient. In der Umgangssprache wäre die korrekte Anwendung auch viel zu umständlich, zumal das Wort Down-Syndrom kein Adjektiv kennt.
Ich betone hier ausdrücklich, dass ich mit diesem im ursprünglichen Gebrauch angewandten Wort die Angehörigen des mongolischen Volkes nicht mit einer Rasse assoziiere, die aufgrund einer angeborenen Genmutation eine Störung der geistigen und körperlichen Entwicklung aufweist. Auf keinen Fall ist die Bezeichnung ›Mongolismus‹ abwertend gemeint und soll auch nicht als abwertend verstanden werden.
Ellen Heinzelmann
10. September 1977
Eigentlich hätte Dr. Christoph Kirchhofer an diesem Wochenende keinen Dienst gehabt. Da er aber der persönliche Arzt seiner Schwägerin war, und diese just am Freitagabend mit unregelmäßiger Wehentätigkeit ins Lörracher Krankenhaus kam, hatte er mit Dr. Hafner getauscht und übernahm den Wochenenddienst. ›Es wird schon nicht so viel los sein dieses Wochenende‹, dachte er, ›schließlich sind wir hier ja nicht in einer Großstadt, wo am Laufband geboren wird.‹ Das waren noch Zeiten, erinnerte er sich, als er in Hamburg am Klinikum sein Praktikum absolvierte. Da ging am Wochenende immer der Bär ab. Doch inzwischen war er auch hier an diesem kleinstädtischen Krankenhaus der Erschöpfung nahe, denn bei seiner Schwägerin ging es nicht vorwärts und im Kreißsaal daneben lag seit einer guten halben Stunde eine zweite Gebärende; eine Zwillingsgeburt, wie aus deren Unterlagen hervorging. ›Na, das hat mir gerade noch gefehlt‹, wurmte es ihn, zumal er die zweite diensthabende Hebamme, die sich krank fühlte, nach Hause geschickt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ja noch alles sehr ruhig und mit Komplikationen war nicht zu rechnen. Judith, seine um dreizehn Jahre jüngere Frau, die ihm nun alleine als Hebamme assistierte, hatte er zur Zwillingsgebärenden geschickt, da er sie im Moment hier nicht brauchte. Er blickte voll Mitgefühl auf seine Schwägerin, die seit gestern Abend schon kämpfte. Angelika war blass und wirkte erschöpft. Ihr schweißnasses rotbraunes Haar klebte an Stirn und Wange. Aus ihren grünbraunen Augen blickte die nackte Sorge: ›Dieses Mal muss es klappen. Es darf nichts dazwischen kommen. Jetzt haben wir es doch schon so weit geschafft.‹ Im Stillen betete sie: ›Bitte, lieber Gott, lass‘ es gut gehen. Bitte lass mein Kind leben.‹
Immer wieder hörten die Wehen auf und der Geburtsvorgang kam zum Stillstand. Immer wieder versuchte Christoph mit Oxytozin, einem Wehen fördernden Medikament, die Wehentätigkeit anzuregen. Sein Bruder, Adrian, saß am Kopfende bei seiner Frau und wischte ihr das nasse Haar aus der Stirn. Sein Gesicht wirkte aschfahl und er war müde und abgespannt. Er blickte sehr besorgt drein, denn es war bei seiner Frau die fünfte Schwangerschaft. Drei Mal zuvor verlor sie ihr Kind innerhalb der ersten sieben Schwangerschaftswochen und einmal war es eine Totgeburt fast am Ende der Schwangerschaft. Danach hatte er leider immer vergeblich versucht, sie zu einer Adoption zu überreden. Doch sie weigerte sich, ein fremdes Kind aufzuziehen. Auch er betete im Stillen. Diesmal durfte es einfach nicht schiefgehen. ›Angelika‹, so dachte er, ›würde es seelisch nicht verkraften.‹ Es war auch der letzte Versuch, denn seine Frau war inzwischen 38 Jahre alt. Christoph tätschelte seinem Bruder kurz auf die Schulter, nickte ihm Mut machend zu und sagte dann, dass er für einen Moment zum anderen Kreißsaal hinübergehe, um dort nach dem Rechten zu sehen.
»Wie geht es Ihnen Frau Petrowa?«, fragte er die ebenfalls erschöpft wirkende Kreisende. Judith nickte ihrem Mann zu, um zu signalisieren, dass es bis jetzt keinen Grund zur Besorgnis gab.
»Es tut särr viel weh, aber geht noch«, antwortete die bildhübsche, hochgewachsene schwarzhaarige Gebärende in gebrochenem Deutsch mit dem typisch für den russischen Akzent rollenden ›R‹. Tamara Petrowa kam vor drei Jahren als Frau eines so genannten Russlandsdeutschen, dessen Vorfahren einmal Peters hießen, nach Südbaden, wo sie sich in Bad Bellingen-Bamlach niederließen.
Christoph tätschelte ihren Arm, blinzelte ihr freundlich zu und meinte: »Morgen werden die Schmerzen vergessen sein. Dann überwiegt die Freude.«
»Nu, ich wäiß nicht. Ich glaube, habe ich märr Respekt vor große Aufgabe, als im Moment große Freude. Zwei Kinder auf einmal. Ist viel Verantwortung. Habe Angst, ob ich wärrde machen alles richtig.« Ihre dunkelbraunen, fast schwarz wirkenden Augen blickten gleichzeitig ängstlich und hilflos.
Erneut tätschelte Dr. Kirchhofer ihre Hand und sprach ihr Mut zu: »Es wird alles gut werden, Frau Petrowa. Glauben Sie mir, man hat sich schnell an eine neue Situation gewöhnt und vor allen Dingen, wenn sie die kleinen hilflosen Würmchen vor sich liegen haben, wird nur ihr liebender fürsorglicher Instinkt geweckt. Automatisch macht man dann alles richtig. Das hat die Natur so eingerichtet«
Frau Petrowa lächelte: »Danke, Doktor. Aber trotzdem wäre ich froh, mein Mann könnte sein hier bei mir. Leider kann ärr nicht. Musst arbeiten. Ist in Norddeutschland im Moment.«
»Sie packen es schon Frau Petrowa«, Christoph blinzelte ihr zu und lächelte. Es klopfte an die Tür. Christoph öffnete und Adrian stand kreidebleich davor. »Chris, es scheint weiterzugehen, komm schnell«, sagte er ganz aufgeregt.
»Judith, kommst du?«, bat Christoph, der es längst bedauerte, die zweite Hebamme nach Hause geschickt zu haben, seine Frau. Zu Frau Petrowa gewandt sagte er, dass sie den Klingelknopf neben sich auf der Liege betätigen solle, wenn etwas sein sollte. Er und die Hebamme seien nur nebenan und würden aber immer von Zeit zu Zeit bei ihr reinschauen und schon verschwanden sie in den angrenzenden Kreißsaal.
Angelika kämpfte, sie hechelte, sie presste, hechelte wieder. Beim Pressen unterstütze Adrian sie, indem er ihren Rücken stützte.
»Ein letztes Mal noch, Angelika, dann hast du's geschafft«, sagte Christoph und versuchte zu lächeln. Angelika presste und ein schwarzes Köpfchen wurde sichtbar. Der Rest war dann nur noch eine Kleinigkeit. Christoph griff den kleinen Körper, der noch mit Resten einer cremig-weißen Käseschmiere überzogen war. Feine Spuren von Blut vermischten sich mit der Schmiere. Vom Fruchtwasser noch ganz glitschig lag der, mit seinen nach erstem Augenschein geschätzten etwa 2000 g, etwas klein geratene Neugeborene in den Händen von Christoph, dessen Gesichtszüge sich in dem Moment verdüsterten, als er in das Gesicht des Kindes blickte.
Angelika, die nur einen kurzen Blick von ihrem Baby erhaschen und sich überzeugen konnte, dass es lebte, das war der Moment, als ihr Schwager den Kleinen hochhob und ihm den Rücken leicht klopfte, damit er den ersten Schrei tat, legte sich erschöpft zurück und Adrian strich ihr die schweißnassen Haare aus dem Gesicht. »Du hast es geschafft, meine Liebe. Wir haben einen Sohn«, lächelte er. Angelika schloss vor Erschöpfung aber dennoch zufrieden die Augen.
Adrian war Christophs düsterer Blick natürlich nicht entgangen und er blickte ihn besorgt fragend an. Christoph blickte auf den Kleinen und wieder zu Adrian. Auch wenn Adrian als Ökonom mit Medizin nichts am Hut hatte, so sah er doch die augenfälligen Gesichtszüge des kleinen Jungen: die Epikanthus-Falte über dem Augenlid, die flache Nase; unverkennbare Zeichen, dass sie soeben ein Kind mit einer Genommutation zur Welt gebracht hatten, ein Kind mit dem so genannten Down-Syndrom.
Er hatte sich mit dieser Anomalie eingehend befasst, weil er wusste, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom bei Spätgebärenden drastisch erhöht. Und er wusste auch zu gut, was dieser genetische Defekt bedeutete: verzögerte körperliche und geistige Entwicklung, schlaffer Muskeltonus, wahrscheinlicher Herzfehler, möglicherweise früher Tod. Dennoch kam eine Fruchtwasseruntersuchung bei Angelika nicht in Frage, da sie bei so vielen Fehl- und Totgeburten eine Risikoschwangere war. ›Wir müssen ja nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen‹, tröstete Chris ihn damals, als Angelika schwanger geworden war. ›Außerdem ist Angelika ja noch nicht so alt. Ich habe viele über Vierzigjährige entbunden, die alle ein gesundes Kind zur Welt brachten.‹
Und nun? Genau das war eingetreten. Adrian sah verzweifelt aus und er blickte mit flehend verzerrtem Gesicht zu Christoph als erwartete er, dass sein Bruder in dieser Situation helfen könne.
Zur Erschöpfung der vergangenen durchwachten Nacht gesellte sich bei Christoph nun auch noch der Druck, der durch Adrians Erwartungshaltung auf ihm lastete. Christoph war blass. Er blickte von Judith zu Adrian und wieder zu Judith. Der Blick schien fast beschwörend und gleichzeitig unruhig. Er kämpfte innerlich.
Die erschöpfte Angelika bekam von der ganzen lautlosen Kommunikation nichts mit. Dann reichte Christoph Judith den Jungen, blickte zur Tür zum nächsten Kreißsaal, doch er sagte nichts. Judith verstand und machte ein erschrockenes Gesicht. Doch auch sie sagte nichts, sie nahm den Winzling und verschwand, gefolgt von Adrian, in das ebenfalls angrenzende Untersuchungszimmer, um das Neugeborene zu versorgen.
Der Kleine brachte gerade mal 2200 Gramm auf die Waage. Dann legte sie das Kind zunächst einmal in Adrians Arme und verschwand in den zweiten Kreißsaal, wo bei der Russin sich nun die Wehen langsam in regelmäßigerem Turnus von fünf Minuten wiederholten, um ihr bei der bevorstehenden Geburt behilflich zu sein. Es ging auch nicht lange, bis Christoph, nachdem er Angelika abschließend versorgt hatte, zur Zwillingsgebärenden kam.
1
Dreißig Jahre später
Eric liegt auf seinem Sofa und ist eingenickt. Das Buch, das er gerade liest, ist auf den Boden gerutscht. Sein Atem geht regelmäßig und laut, sein ebenmäßig geschnittenes Gesicht zuckt von Zeit zu Zeit, ein Zeichen also, dass er träumt. Das plötzlich schrillende Telefon schreckt ihn auf. Sein Herz klopft wie wild. Er ist noch ganz benommen, als er den Hörer abnimmt. »Kirchhofer«, meldet er sich verschlafen.
»Oh, störe ich Eric«, vernimmt er eine Stimme, die er erkennt, auch wenn die Anruferin ihren Namen nicht nennt.
»Ich bin nur eingenickt und noch nicht ganz wach, aber du störst nicht Agnetha«, erklärt er, »was gibt's?«
»Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du Lust hättest, mich am Samstag zum Presseball in Freiburg zu begleiten? Ich weiß ja, dass du kein Freund großer Veranstaltungen bist, aber …«
»Wie könnte ich meiner liebsten aller Freundinnen einen Wunsch ausschlagen«, unterbricht er ihre Anfrage, »was muss ich denn da anziehen?«
»Nichts Besonderes. Komm einfach ganz schlicht, wie zu einer royalen Hochzeit«, witzelt Agnetha.
»Oh, dummerweise musste ich in Ermangelung passender, etikettgerechter, Kleidung meine Teilnahme an der letzten royalen Hochzeit absagen.«
»Okay, Dein einziger Anzug, den du besitzt ist passend genug. Such' im Nachhinein jetzt nicht nach Gründen, mir eine Absage zu erteilen, sonst …«, Agnetha legt bewusst eine Kunstpause ein und wie erwartet nimmt Eric den Faden des abgebrochenen Satzes auch prompt auf: »Sonst … womit willst du mir drohen?«
»Tja, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Kollegen Martin zu fragen«, versucht sie ihn zu reizen und hat Erfolg, denn sein Kommentar folgt auf den Fuß: »Der Schleimbeutel!«
»Wieso, der ist doch nett«, kontert sie amüsiert.
»Damit er dich wieder so ungalant schnöde anbaggern kann. Das ist doch ein richtig schlüpfriger Gockel«, erklärt er abfällig.
»Na ja Darling, ich bin ja schließlich noch zu haben, oder?«
»Nein, bist du nicht«, widerspricht Eric energisch.
»Erklär mir das doch bitte mal näher. Hat diese Feststellung etwas mit dir zu tun?«, fordert sie ihn heraus.
»Mit wem denn sonst?«
»So wie ich verstanden habe, bin ich bis jetzt ja nur die liebste all deiner Freundinnen«, foppt sie ihn.
Agnetha kennt Eric nun schon seit drei Jahren. Sie lernte ihn beim Uni-Abschlussball ihrer besten Freundin Nicole kennen. Er gefiel ihr, weil er alles andere als ein Aufschneidertyp ist. Er wirkte auf sie eher zurückhaltend und dennoch nicht schüchtern oder gar verklemmt. Er ist ein Realist mit trockenem Humor, also alles andere als ein Romantiker und doch ist er ein lieber, ehrlicher Kerl mit treuem Dackelblick. Man könnte dahin schmelzen, wenn er einen mit seinen dunklen, unergründlichen Augen ernst fragend anschaut, wenn man ihn mal eben mit einer unerwarteten vielleicht auch beißenden Bemerkung konfrontierte. Er ist so anständig, ohne Falsch und Tücke. Und Schleimerei ist ihm widerwärtig. Kein Wunder kann Eric mit einem Typen wie Martin nichts anfangen. Im Gegenteil, solchen Typen geht er gerne aus dem Weg.
»Eben genau, wie du sagst, die liebste aller … na ja. Also hör zu, ich begleite dich selbstverständlich gerne auf den Presseball am Samstag und ziehe eigens dazu meinen einzigen Ausgehanzug an«, eine mittelschwere Untertreibung, wenn man bedenkt, dass er als Unternehmensberater einen Schrank voller Anzüge besitzt, »und … hm, ich will nicht verhehlen, dass ich mich geehrt fühle, mit einer solch tollen, liebenswerten, klugen und schönen Frau auszugehen«, sagt er Agnetha definitiv zu und mit der Frage, »na ist das eine Antwort, mit der du dich für den Moment zufriedengeben kannst?«, beendet er seine leicht überspitzten Ausführungen zu Agnethas Frage, ob sie nun noch zu haben sei oder nicht.
»Ja«, schmunzelt Agnetha, »vollkommen zufrieden«, und ergänzt nach dem Bruchteil einer Sekunde, »… für den Moment«
Ja, sie kann sich tatsächlich damit zufrieden geben, denn was er hier eben bekannte, hat viel größere Bedeutung, als wenn Martin sagen würde, dass sie die Frau seines Lebens sei, die er über alles liebt und mit der er am liebsten auf einer einsamen Insel glücklich werden wolle. Erics Geständnis war wirklich im Moment, so von Telefon zu Telefon, das äußerste, was er an romantischen Gefühlen in Worten gefasst preisgab. Dass er diese Gefühle durchaus kennt, schließlich ist er ja nicht aus Holz, das bezweifelte Agnetha nie. Sie weiß aber, dass er kein Mann vieler Worte ist und wenn er einmal romantisch wird, braucht es für ihn schon auch die passende Umgebungsatmosphäre oder einfach einen bestimmten Moment und nicht von Telefon zu Telefon. Es ist eben genau das, was ihr an Eric so gefällt. Sie weiß, dass wenn er sich zu jemandem bekennt, man sich hundertprozentig auf ihn verlassen kann, und dass er auch ein treuer Freund ist.
»Holst du mich am Samstag um sechs Uhr ab?«, fragt sie zum Abschluss.
»Sehen wir uns vorher nicht mehr?«, fragt er leicht enttäuscht.
»Leider nein. Ich habe ziemlich zu tun diese Woche und Freizeit kann ich mir da abschminken«, bedauert sie ehrlich. Agnetha ist eine sehr erfolgreiche Journalistin und hat im Moment zwei wichtige, interessante Projekte. Das wichtigste dürfte wohl das Ganzjahresprojekt ›International Heliophysical Year‹ sein, bei dem es auch noch im 2008 einige Veranstaltungen geben wird. Über das IHY wird sie zusammenfassend berichten. »Eigentlich könnte ich gar nicht am Presseball teilnehmen, weil ich nämlich ursprünglich im Max-Planck-Institut in Garching zum Vortrag ›Die Sonne und das Weltraumwetter‹, der am gleichen Tag stattfindet, sein sollte. Aber ich kann ja nicht jedes Jahr beim Presseball absagen und so hat sich meine Kollegin Iris dieses Mal bereit erklärt, für mich nach Garching zu reisen und dem Vortrag im MPI beizuwohnen.«
»Okay, ich hole dich Samstag ab«, verspricht Eric und will das Gespräch beenden, als ihm plötzlich noch etwas einfällt: »Ach, nun fällt mir doch noch etwas ein. Agnetha, denkst du bitte daran, dass wir am Sonntag zum 70sten Geburtstag meines Vaters eingeladen sind?«
»Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss zugeben, dass ich nicht mehr daran dachte. Nicole hatte vorgeschlagen, am Sonntag mal einen Weibertag abzuhalten, das heißt wir vier Sandkasten-Freundinnen treffen uns bei Nicole und diskutieren über interessante frauenrelevante Themen, ohne durch nicht kompetente Zwischenrufe männlicher Wesen, unterbrochen zu werden«, sagt sie mit ihrem berühmt zynischen Humor. Eric kennt Agnethas Ansichten und auch ihre manchmal recht beißenden Kommentare, denn sie und Eric führen oft in ihren Diskussionen den kleinen, unbedeutenden Geschlechterkrieg. Zwar nicht tierisch ernst, dennoch, so meint Agnetha, gäbe es zu diesem Thema noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
»Ha – ha!«, kommentiert Eric das eben Gesagte, »… und hast du schon zugesagt beim Weibertag?«
»Nee, ich versprach Nicole, ihr bis Mittwoch, also morgen, Bescheid zu geben. Nun, müssen wir den Weibertag halt verschieben. Natürlich begleite ich dich zum Jubeltag deines Vaters. Wollte ihn sowieso einmal kennenlernen.«
Nachdem Eric das Telefon auf die Basis zurückgestellt hatte, holt er seine elektronische Agenda, um seine Termine nachzutragen.
Er schenkt sich ein Glas Wein ein, lehnt sich zurück und lächelt Gedanken verloren. Agnetha Hakonsen ist eine Frau, die er sehr bewundert. Sie ist mit ihrem platinblonden Haar und ihren strahlenden blauen Augen nicht nur eine deutsch-skandinavische Schönheit, ihr Vater ist Norweger und ihre Mutter Deutsche, sondern sie hat Charme, ist ziemlich intelligent, hat Humor, ist erfolgreich in ihrem Beruf und ist eine hervorragende Gesprächspartnerin mit Niveau. An ihr stimmt einfach alles – innen wie außen, vom Scheitel bis zur Sohle. In Gedanken spielt er durch, wie es wäre, wenn er und Agnetha zusammenzögen und vielleicht … na ja vielleicht in ein, zwei Jahren heirateten. Sie sind beide dreißig Jahre alt, also in einem Alter, in dem man nicht von Überstürzung reden könnte, und schließlich sind sie ja auch schon drei Jahre zusammen – na ja, mehr oder weniger. Er gesteht, dass er eigentlich von dreijähriger enger Freundschaft reden müsste. ›Du bist doch ein Idiot Eric‹, denkt er vorwurfsvoll, als er an das Gespräch dieses Abends zurückdenkt, ›Agnetha wartet doch nur darauf, dass du ihr mal ganz klar andeutest, dass ihr ein Paar seid.‹ Er überlegt sich, wann wohl der günstigste, für einen solchen Anlass würdige Moment da sei, ihr seine waghalsigen Ideen feierlich zu unterbreiten.
Es ist mittlerweile spät geworden. Er steht auf, stöpselt die halbleere Weinflasche, stellt sein Glas in die Küchenspüle und verschwindet ins Bad, um sich bettfein zu machen. Er blickt in den Spiegel und angesichts seines müden Anblicks sagt er kritisch zu seinem Spiegelbild: »also ich rate dir ernsthaft: morgen schaust du besser aus, sonst rasiere ich dich nicht und ich nehm' dich auch nirgendwohin mehr mit.« Er lächelt und sagt wieder laut: »Ach Eric, was bist du heute wieder ein närrischer Schäker?« Kurz später kuschelt er sich wohlig in sein Bett mit der Seidenbettwäsche. Es geht auch gar nicht lange und er befindet sich in Morpheus' Armen.
2
Eric steht pünktlich um sechs vor Agnethas Wohnung und klingelt. Er war am Morgen noch beim Friseur und hat sein dichtes dunkles Haar ziemlich kurz, aufgeräumt in Façon schneiden lassen, denn er will neben Agnetha schließlich eine gute Figur abgeben. Als er vor dem Spiegel letzten Augenschein von sich nahm, konnte er sich ohne Eitelkeit selbst eingestehen, dass er in seinem dunklen Anzug mit Fliege, seinem olivfarbenen Teint eine stattliche Erscheinung ist.
Agnetha, die gerade den Telefonhörer am Ohr hält, öffnet die Tür, macht mit der Hand eine einladende Bewegung und läuft voraus ins Wohnzimmer, während sie telefoniert: »Suzanne, beruhige dich, bitte! Nein, das habe ich nicht gesagt, zumindest nicht so, wie du es wiedergibst.« Sie hört in den Hörer und schaut zu Eric auf, rollt genervt mit den Augen, will gerade eine anerkennende Miene zu Erics Erscheinung machen, als sie wieder loslegt: »Suzanne, du schiebst deine Interpretation der Dinge anderen Leuten unter, stellst bewusst verfängliche Fragen und formulierst daraus ungerechtfertigte Vorwürfe und wenn deine Gesprächspartner richtigstellen wollen, klemmst du ab mit ›ach lassen wir das, für mich ist die Sache gegessen.‹ Ich glaube einer Journalistin nicht erklären zu müssen, dass diese Methode unter der Rubrik unfaire Dialektik rangiert.«
Während Agnetha wieder aufmerksam ihrer Gesprächspartnerin lauscht, beobachtet Eric sie und genießt ihre aparte Erscheinung. Sie trägt ein samtrotes Körper betonendes langes Kleid. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt zusammengenommen, der von einem Samtnetz im selben Rot wie ihr Kleid zusammengehalten wird. Plötzlich hebt sie ihre Stimme und in einem jetzt etwas schärferen Ton antwortet sie ihrer Gesprächspartnerin: »Suzanne, ich rate dir, einmal über deine eigenen Bücher zu gehen. Was du mir eben erzählt hast, ist nichts anderes als deine eigene Personenbeschreibung. Erkenne dich endlich selbst, bevor du für dich in Anspruch nimmst, andere zu kennen. So, ich muss gehen. Ich werde eben abgeholt. Vielleicht reden wir ein andermal weiter, wenn du nicht mehr so explosiv bist. Ich bin gerne dazu bereit, wenn du die Dinge wieder nüchterner siehst und dann das Ganze auch sachlicher beurteilen kannst. Schönes Wochenende, tschüss.«
Sie trennt das Gespräch, zieht die Luft tief durch die Nase ein, stößt sie ebenso geräuschvoll wieder aus, lächelt gewinnend und stellt mit dem ihr eigenen Charme bewundernd fest: »Gut schaust du aus. Mit dir gehe ich wirklich gerne zum Ball.«
»Danke. Jetzt bist du mir glatt zuvorgekommen. Ich wollte mich gerade schwärmend über dich auslassen. Das Kleid ist klasse, du bist klasse, einfach alles ist klasse«, bringt er sein Gegenkompliment hervor und umarmt sie, um ihr endlich den Begrüßungskuss aufzudrücken. Sie schmiegt sich für einen kurzen Moment an ihn und genießt diesen Augenblick der Nähe. Dann löst sie sich von ihm und meint: »Wir müssen los. Wir brauchen eine gute Stunde bis nach Freiburg.«
»Wer war das eben?«, fragt er, während sie ihre dunkle Stola vom Sofa aufnimmt.
»Ach, das war Suzanne Heller, eine Journalistin, die eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat. Wohl ist sie die einzige, die diese Meinung vertritt. Vielleicht bin ich jetzt auch ungerecht. Sie hat mich halt einfach genervt, tja und da ist man schnell mal dabei, abfällig über jemanden zu reden.«
»Und was wollte sie von dir?«
»Ich denke, es stinkt ihr noch immer, dass ich das IHY-Projekt habe, während sie sich mit Geschichten wie ›Knut der Eisbär‹, ›die Internationalen Jubiläums-Flugtage – 100 Jahre Flugplatz Freiburg‹ oder die Oscar-Verleihung für den Film ›Das Leben der Anderen‹ abgeben musste. Sie will einfach wichtigere, geschichtsträchtigere Ereignisse. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass diese Geschichten, insbesondere Letztere, uninteressant oder gar unwichtig sind.«
»Das finde ich auch, zumal gerade die Oscar-Verleihung für Furore sorgte, weil der Regisseur die Hauptdarstellerin nicht mit zur Oscar-Verleihung mitnahm und stattdessen seine Frau teilhaben ließ. Da konnte sie sich doch richtig ins Zeug legen.«
Agnetha ist überrascht über Erics genaue Kenntnis dieser Preisverleihungsgeschichte und antwortet: »Eben, das meine ich auch. Diese Sache war ihr wie auf den Leib geschnitten«. Sie macht eine kurze Pause, zieht ihre Augenbrauen hoch. »Aber sie wollte halt diese große Story des IHY. Und natürlich hätte sie gerne auch noch den G8-Gipfel in Heiligendamm vom Juni gehabt. Dummerweise habe ich diesen auch bekommen. Na ja, egal, jetzt lass' uns gehen«, will Agnetha das leidige Thema Suzanne Heller endlich beenden.
»Aber sag, was ich nicht verstehe. Macht sie dir jetzt deswegen Vorwürfe, weil du etwas erhalten hast, das sie wollte?«
»Nein, darüber verliert sie kein einziges Wort. Sie ist seither einfach nur stinkig und lässt keine Situation aus, sich mit mir und mit anderen anzulegen. Und jetzt ist sie auch noch krank und somit für eine gewisse Zeit aus dem Rennen und meint vom Krankenlager aus, ihre Fäden ziehen zu müssen. Sie ist eine streitsüchtige Nudel. Lass uns das Thema Suzanne jetzt endlich beenden. So wichtig ist sie nun wirklich nicht.«
Kurz darauf befinden sich beide auf dem Weg zum Auto. Mit einem Blick gen Himmel meint Agnetha, »das sieht ziemlich düster aus. Ich glaube wir kriegen heute noch Regen. Hast du einen Schirm dabei?«
»Ja im Auto«, beruhigt Eric sie und hält ihr die Beifahrertür zu seinem weißen Mercedes Benz E350 auf.
Eric und Agnetha betreten den festlich geschmückten und hell erleuchteten Ballsaal des Freiburger Konzerthauses.
»Stars mit Rang und Namen und alle fein herausgeputzt«, stellt Eric belustigt fest, »sehen und gesehen werden, die Devise.«
»Ja, und schau dort drüben, unser liebster Freund ist auch da«, sagt Agnetha, mit ihrem Kopf auf einen Mann in etwa zehn Metern Entfernung rechts von ihnen, weisend.
Eric folgt ihrem Blick und entdeckt den Anvisierten. »Oha, Martin! Wieder mal bei seiner Lieblingsbeschäftigung«, stellt er abschätzig fest. Ja da steht er, der gute alte Martin, mit brav gescheiteltem blondem Haar, wie ein überreifer Pennäler, der schon seine diversen Ehrenrunden gedreht hat, in hellem Sakko und dunkler Hose und baggert mal wieder, was das Zeug hält. »Aber Geschmack hat er, das muss man ihm lassen«, bemerkt Eric anerkennend beim Anblick der schönen Brünetten an Martins Seite.
»Das ist Jeannette, eine französische Kollegin. Was meinst du, sollen wir ein gutes Werk tun und sie vor schnöder Anmache retten?«, fragt Agnetha amüsiert, ohne es wirklich ernst zu meinen und schon im nächsten Moment: »Schau mal da drüben, Jochen und seine Frau. Lass uns hinübergehen.«
Jochen Altmann ist der Leiter der Nachrichten- und Presseagentur Südbaden und Agnethas Arbeitgeber, der sehr große Stücke auf sie hält. Er ist eine stattliche Erscheinung. Sein kurzes leicht lockiges, graues Haar und der ebenso gepflegt gestutzte melierte Bart geben ihm ein bisschen das Aussehen von Sean Connery. Die Frau an seiner Seite ist eine echte Lady. Hochgewachsen, mit edlen Gesichtszügen, kurzem, gewelltem, aus der Stirn gekämmtem, blondem Haar.
Im nächsten Moment sind sie, Agnetha und Eric, mit dem Ehepaar Altmann in ein angeregtes Gespräch verwickelt. Claire Altmann erzählt von ihrer Arbeit als erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung. Sie scheint sehr engagiert zu sein und ebenso scheint es, dass ihr diese Arbeit viel Freude bereitet. Aus- und Weiterbildung junger Menschen sind ihr ein echtes Anliegen.
Jochen gibt Agnetha ein erstes positives Feedback zu ihrem Zwischenbericht über das IHY. Dabei kündigt er schon die nächsten Pläne für das Jahr 2008 an:
»Es ist wieder einmal ein Ganzjahresprojekt, und zwar geht es um das äußerst brisante Thema ›Sprachen‹. Die UN-Generalversammlung wird – mit der UNESCO als die federführende Organisation der Vereinten Nationen – das Jahr 2008 vermutlich zum ›Internationalen Jahr der Sprachen‹ erklären. Es ist noch nicht offiziell, aber so wie es aussieht, steht es zu 99% fest. Es soll die Bedeutung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt hervorheben und mit weltweiten Projekten fördern. Dabei soll ganz speziell auf den Umstand hingewiesen werden, dass durch das zunehmende Verschwinden, insbesondere von Minderheitssprachen, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen bedroht sein wird.«
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht«, kommentiert Eric erstaunt dieses hochinteressante Thema.
»Eben, genau deswegen soll es zum Jahr 2008 gekürt werden, um die Menschen hellhörig zu machen. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es gegenwärtig rund 6000 Sprachen gibt und mehr als die Hälfte dieser Sprachen von weniger als 10'000 Menschen und ein Viertel von weniger als 1000 Menschen gesprochen wird?«
»Nein, das habe ich nicht gewusst«, staunt er stirnrunzelnd.
»Und nun stellen Sie sich vor, dass jedes Jahr etwa zehn Sprachen aussterben«, fährt Jochen fort, »dann können Sie sich ungefähr ausmalen, was der Untergang einer Sprache jeweils bedeutet, wenn damit ein unwiederbringlicher Verlust des Wissens einer Kultur einhergeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich dieser Sache annimmt. Regierungen und UN-Organisationen sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen sind dazu eingeladen ihre Anstrengungen für die Erhaltung der sprachlichen Vielfalt, also den Schutz gefährdeter indigener Sprachen, auszubauen.« Jochen scheint richtig in Fahrt zu sein. Schließlich zu Agnetha gewandt fragt er lächelnd: »Na, habe ich dich auf das Thema hungrig gemacht?«
»Und wie«, lächelt Agnetha zurück.
Plötzlich lauscht sie dem Orchester, denn eben spielt es den Tennessee Waltz, Agnethas Lieblingslied zu ihrem Lieblingstanz. Da hält es sie nicht mehr am Rand. Da braucht sie das Parkett unter ihren Füßen und nach einer kurzen Entschuldigung bei Jochen und seiner Frau, sieht man die beiden leichtfüßig übers Parkett schweben.
»Da wird deine Freundin Suzanne aber eine Freude haben, wenn du diesen Fisch ›Jahr 2008‹ wieder an Land ziehst«, sagt der hervorragend tanzende Eric neben ihrem Ohr.
»Sag nichts, Eric, daran habe ich auch gedacht. Aber soll ich ablehnen, nur um Suzanne nicht zur Feindin zu haben?«
»Nein, du schwimmst im Moment einfach auf einer guten Welle. Da empfiehlt es sich, mit den Schwimmzügen nicht aufzuhören, sonst gehst du unter.« Agnetha schaut ihn an und gibt ihm einen flüchtigen Kuss. Sie ist glücklich, unendlich glücklich. Im Moment stimmt einfach alles.
Als sie zur Getränkebar hinübergehen, um etwas gegen ihre trockenen Kehlen zu tun, werden sie von der Seite angesprochen. »Hallo, Agnetha«, wird sie von einer angenehmen sonoren Männerstimme begrüßt. Agnetha wendet sich in Richtung der Stimme und stellt erfreut fest: »Mein Gott, Stefan, bist du auch mal wieder im Land?« Sie begrüßen sich mit Küsschen links und Küsschen rechts und stellen sich gegenseitig vor.
»Eric, das ist Stefan Kiefer, seines Zeichens Auslandsjournalist, auf der ganzen Welt zu Hause und ein Wunder, wenn man ihn mal hier im Lande antrifft. Tja Stefan, und das ist Eric Kirchhofer, mein …«, sie stockt und schaut für einen Moment zu Eric hoch, der lächelt und das Wort aufnimmt, »Agnethas Freund, der es aber nicht lange bleiben will, …«, Agnetha schaut ihn überrascht mit gerunzelter Stirn an und Eric fährt fort, »… weil er sie demnächst fragen will, ob sie es sich vorstellen könne, seine Frau zu werden. Leider hat er bis jetzt noch nicht den Mut dazu aufgebracht und ist selbst erstaunt, über das soeben leichtzüngig Hervorgebrachte.« Mit einem Lächeln blickt er zu Agnetha, die dieses Lächeln erwidert.
»Wow, bin ich jetzt zufällig Zeuge einer Heiratserklärung geworden«, lächelt Stefan amüsiert, reicht Eric die Hand und begrüßt ihn mit einem »sehr erfreut«.
Er nimmt Agnethas Hand, haucht einen Handkuss darauf und gratuliert ihr zum eben ausgesprochenen Heiratsantrag. Agnetha bedankt sich zwar, widerspricht aber lächelnd: »Das war kein Heiratsantrag. Der kommt erst noch. Eric hat schließlich gesagt, dass er mich demnächst mal fragen will …«, und mit einem schelmischen Blick zu Eric fügt sie fragend hinzu, »hast du schon ungefähr eine Ahnung, wann ›demnächst‹ sein wird?«
»Soll ich euch mal eben alleine lassen?«, feixt Stefan, doch bevor er sich davonschleichen kann, wird er von Agnetha festgehalten. »Nix da, wir gehen jetzt an die Bar, um endlich unsere trockenen Kehlen anzufeuchten und du erzählst uns etwas über deinen letzten Auslandseinsatz. Der war ja nicht so ganz ohne. Warst du nicht im Irak?«
Mit dieser Frage nimmt das Gespräch eine Wende. Mit dem gebotenen Ernst, den dieses Thema erfordert, erzählt Stefan von seinem letzten dramatischen Auftrag, den er wegen der Gefährlichkeit vorzeitig abgebrochen hatte. Die Agentur hatte ihn zurückgepfiffen, denn die Zahl getöteter Journalisten und Medienassistenten, die sich per heute auf gut über 100 beläuft, rechtfertigt den Einsatz so nahe am Geschehen in einem Kriegsgebiet nicht mehr. Stefan berichtet von nächtlichen Bombenexplosionen in Bagdad und Kriegsopfern, deren Zahl beinahe täglich nach oben korrigiert werden musste. Zum Zeitpunkt seiner Ausreise, Anfang Oktober, ließen knapp 4'000 US-Soldaten ihr Leben. »Aber lass' uns heute Abend nicht von diesem Elend sprechen«, versucht Stefan seine Berichterstattung zu beenden, »es gibt bei weitem Schöneres heute Abend.«
»Du hast Recht Stefan. Es war schlimm genug für dich, den Tod so nah zu spüren«, stimmt Agnetha zu und so gehen sie in alltägliches Plaudern über.
Tanzen und Small Talk wechseln sich ab unter anderem auch mal kurz mit Martin, der jetzt eine Blondine an der Seite hat. Schließlich will Agnetha ja nicht unhöflich sein. Außer, dass er ein ewiger Baggerer ist, ist er ja eigentlich kein übler Kerl. Man kann ihm nichts Böses nachsagen. Er ist ein fairer Zeitgenosse, fügt niemandem böswillig Schaden zu und ist auch da, wenn man ihn braucht. Nur die Anmache geht einem mit der Zeit auf den Geist.
Gegen zwei Uhr in der Früh zeigen sich bei Agnetha dann doch allmählich erste Ermüdungserscheinungen und zwanzig Minuten später verlassen sie und Eric das Konzerthaus. Als sie ins Freie treten sehen sie Agnethas Wetterprognose vom frühen Abend bestätigt. Es schüttet aus Kübeln. Eric spannt den Schirm auf, doch vermag dieser den Wassermassen, die sich da über ihn entladen, nichts entgegenzuhalten.
»Warte hier, ich hole das Auto«, schlägt er vor und schon kämpft er sich durch die Wassermassen, die von oben und unten auf ihn einströmen. Ein paar Minuten später, steht der Mercedes beim Eingang des Konzerthauses und Agnetha steigt, im Schutz des Regenschirms eines Türstehers, ein.
»Übernachtest du heute hier bei mir?«, fragt Agnetha, als der Wagen vor ihrer Wohnung anhält.
»Ich hab …«, beginnt Eric und wird, kaum dass er mit seiner Rede begonnen hatte, von Agnetha unterbrochen: »Ich hab eine Zahnbürste, keine Sorge, und rasieren kannst du dich morgen auch. Habe immer Einwegrasierer hier.«
Er zieht die Augenbrauen hoch und grinst sie an, »für alle Eventualitäten gewappnet, wie?«
»Ja klar, ich kann auch mit einem Schlafanzug dienen. Martin hat seinen das letzte Mal bei mir vergessen«, spöttelt sie und korrigiert das Gesagte auch gleich wieder, denn Eric soll wissen, dass Martin das Letzte wäre, was sie bei sich über Nacht haben wollte: »Nicht ernst nehmen, war nur Spaß. Also kommst du nun?«
»Na wenn du so lieb und romantisch fragst, kann ich ja fast nicht nein sagen«, antwortet Eric ironisch und fügt in humorvollem Befehlston hinzu: »Also, komm schon, worauf warten wir. Würde gerne vor Sonnenaufgang im Bett liegen.«
»Das war nun aber auch äußerst romantisch«, lächelt Agnetha zurück, drückt ihm einen Kuss auf und schon öffnet sie die Beifahrertür, bevor Eric seiner Kavalierspflicht nachkommen kann. Auf Anstandsgepflogenheiten besteht sie im Moment überhaupt nicht, denn auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so stark regnet, beeilt sie sich, flugs durch den Regen zum Eingang zu kommen.
3
Kurz vor ein Uhr am Sonntagmittag erwacht Eric. Er blickt auf die Uhr und erschrickt.