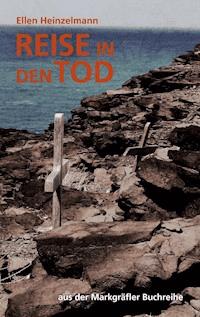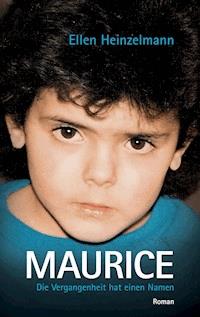Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Wir seh'n uns in der Hölle' ist eine Familiengeschichte, die auf wahrer Begebenheit beruht. Sie beschreibt die Geschichte des GCF-Clans, wie der Erzähler Kutazama die Familienkonstellation nennt. Sie zeigt, wie zerstörerisch Gier, die vor nichts zurückschreckt, sein kann. Mario der älteste und auch tüchtigste von insgesamt drei Söhnen der Galanisfamilie hat es mit seiner Steinmetzkunst zu Wohlstand gebracht. Gemäß italienischer Familientradition hat entweder der Älteste oder einfach der Bestverdienende für die Familie da zu sein. Beides trifft auf Mario zu und so lebt die Familie zwanzig Jahre gut und gerne von Marios Wohlstand. Doch im Hintergrund schwelt der Neid. Die unstillbare Gier führt zu Hass und blinder Zerstörungswut. Und die gierige Gesellschaft merkt nicht, dass sie am Ast sägt, auf dem sie selbst sitzt. Mario wird an den Abgrund seiner Existenz getrieben. Auf der Suche nach dem 'Warum', stößt Mario auf ein dunkles Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
›Wir seh'n uns in der Hölle‹ ist eine Familiengeschichte, die auf wahrer Begebenheit beruht. Sie beschreibt die Geschichte des GCF-Clans, wie der Erzähler Kutazama die Familienkonstellation nennt. Sie zeigt, wie zerstörerisch Gier, die vor nichts zurückschreckt, sein kann.
Über den Inhalt
Mario der älteste und auch tüchtigste von insgesamt drei Söhnen der Galanisfamilie hat es mit seiner Steinmetzkunst zu Wohlstand gebracht. Gemäß italienischer Familientradition hat entweder der Älteste oder einfach der Bestverdienende für die Familie da zu sein. Beides trifft auf Mario zu und so lebt die Familie zwanzig Jahre gut und gerne von Marios Wohlstand. Doch im Hintergrund schwelt der Neid. Die unstillbare Gier führt zu Hass und blinder Zerstörungswut. Und die gierige Gesellschaft merkt nicht, dass sie am Ast sägt, auf dem sie selbst sitzt. Mario wird an den Abgrund seiner Existenz getrieben. Auf der Suche nach dem ›Warum‹, stößt Mario auf ein dunkles Geheimnis.
Die Autorin
Ellen Heinzelmann, Fachfrau für Marketing und Kommunikation, wurde 1951 im Kreis Waldshut geboren. Während ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit – zuletzt als Marketingund PR-Verantwortliche in einer Organisation des öffentlichen Rechts in Basel – übersetzte sie Texte vom Deutschen ins Französische und Englische, wirkte als Dolmetscherin bei Vertragsverhandlungen in Paris. Sie schrieb viele Artikel in Fachzeitschriften und Heimatbüchern, war Redakteurin eines offiziellen, branchenbezognenen Vereinsorgans, entwarf Broschüren und Werbematerialien und organisierte umfangreiche geschäftliche Events. Sie lektorierte Fremdtexte und wirkte als Ghostwriterin. Die geschriebene Sprache hatte schon in früher Kindheit große Faszination auf sie ausgeübt. Heute, nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben, ist sie ihrer Berufung gefolgt. Mit ihrem Debütroman ›Der Sohn der Kellnerin‹, eine nicht alltägliche Geschichte, startete sie 2011 ihre Schriftstellerlaufbahn und nahm ihre Leser gleich mit auf eine emotionale Reise.
www.ellen-heinzelmann.de
Inhalt
Vorwort
Teil 1 Vorstellung der Familien, Stand Ende 2009
Die Galanis'
Die Clermonts
Die Faubourgs
Die Mullers
Teil 2 Die Familienstory
A: ab 1970 - Kutazama erzählt
Kapitel 1 bis 6
B: ab Mitte 2008 - Stéphanie erzählt
Kapitel 7 und 8
C: ab 2010 - Mario erzählt
Kapitel 9 und 10
D: ab Mitte 2010 - Stéphanie erzählt
Kapitel 11
E: ab April 2011 - Mario erzählt
Kapitel 12 bis 16
F: ab August 2011 - Kutazama erzählt
Kapitel 17 und 18
Danksagung
Bilder und Bildnachweis
Weitere Bücher von Ellen Heinzelmann
Vorwort
Ich lernte den 82jährigen Kutazama (Otfried W.) 2011 während meines Winteraufenthalts auf den Philippinen kennen. Er und seine 72jährige Ehefrau – sie heirateten zwei Wochen bevor sie hier ankamen – waren für vier Monate meine Nachbarn. Eines Tages kam unser Gespräch auf die Geschichte der Familienkonstellation, in die der damals Geschiedene als Vierzigjähriger in zweiter Ehe 1969 einheiratete. Die wenigen Episoden, die er mir in aller Kürze erzählte, waren so interessant, dass ich ihm vorschlug, ein Buch über die Geschichte zu schreiben. Er gab sein Einverständnis und in den folgenden Monaten seines Aufenthalts hier auf den Philippinen, saßen wir sehr oft zusammen und er erzählte mir seine Familienstory. Kutazama berichtete minutiös aus seiner Erinnerung. Er erlebte die Geschichte förmlich nochmals durch, mit all den dazu gehörenden Gefühlen wie Wut, Empörung und Traurigkeit. Manchmal kam er so in Fahrt, dass er, den Zeitfaktor ignorierend, spontan sprudelte, und ich alle Mühe hatte, einen folgerichtigen zeitlichen Ablauf in die Geschichte hineinzubekommen. Oft hatte er Ereignisse isoliert aus dem Zusammenhang gerissen geschildert und demzufolge fehlten der Sinn und teilweise auch die zusammenhängende Logik. Gewisse Dinge konnten in der erzählten Gedankenkette nicht geschehen sein.
Entsprechend war natürlich für mich die Niederschrift eine sehr große Herausforderung. Sie wurde zu einer anstrengenden, komplizierten Arbeit.
Die Geschichte als solches ist größtenteils wahr. Vieles, was der Hauptfigur Mario in seiner Familie zustieß, sei es auch noch so abstrus, entspricht der Tatsache und es ist noch kein Ende abzusehen. Kutazama hatte nämlich auch hier in seinem Winterdomizil einige handschriftliche Bestätigungen zu schreiben, mittels derer er seinem, wie von ihm genannt, ›behaltenen Ex-Schwiegersohn‹ den Rücken stärken will.
Ich betone, dass Kutazama mir nur das Gerüst für die Geschichte lieferte, während Füllwerk und Dialoge meiner Phantasie entsprangen, insbesondere, wenn die Familienmitglieder, die ich ja nicht persönlich kannte, zu Wort kommen. Ferner fehlten der mir vorliegenden Erzählung gänzlich die Schlussfolgerungen, die sowohl mich als auch den Leser auch nur ansatzweise hätten zufriedenstellen können. Daher wurden diese von mir frei erfunden, ebenso sämtliche Orte und Namen.
Dieser Roman soll eine hoffentlich gelungene Verflechtung zwischen Wahrheit und Fiktion sein und ich wäre zufrieden, wenn die Leser mir irgendwann bestätigten, dass es mir tatsächlich geglückt ist.
Kutazama danke ich für die interessante Geschichte, die auch meine Gefühle sehr in Bewegung brachte.
Die Story ging mir so nahe, dass ich Kutazama bei seinem Abschied am 15. März 2012, hinsichtlich der auf sein Ableben spekulierenden Adoptivtöchter, ein noch möglichst langes gesundes Leben wünschte.
Ellen Heinzelmann
Teil 1
Vorstellung der Familien
Stand Ende 2009
Die Galanis'
(erzählt von Mario Galanis)
Wo meine Familie ihren Ursprung hat, weiß ich nicht. Sie lebte zwar, bevor sie nach Frankreich übersiedelte, in Treviso, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz der Region Venetien, dennoch liegen ihre Wurzeln keinesfalls in Italien, denn der Familienname endet weder auf ›i‹ noch auf ›o‹, wie es bei italienischen Namen so üblich ist. Der Familienname Galanis dürfte eher in Griechenland seinen Ursprung haben. Wahrscheinlich haben im späten Mittelalter venezianische Dogen Steinmetzarbeiten von meinen Vorfahren aus Griechenland importiert. Doch Genaues weiß man nicht, zumindest sprach man nie darüber.
Meine Familie muss schon seit Jahrhunderten mit Steinen zu tun gehabt haben, denn der Beruf Steinmetz und später auch Bildhauer hatte schon seit jeher in unserer Familie Tradition.
Mein Großvater Loucas Galanis zog es 1925 nach Amerika, wo er als Steinmetz arbeitete. 1930 kam er wieder zurück nach Europa und zwei Jahre später heiratete er in Italien meine Großmutter Lucia, wo wiederum zwei Jahre später, nachdem der erste Sohn Loucas ein Jahr alt war, mein Vater Luciano geboren wurde. Bei der Namenswahl der ersten beiden Söhne schienen die Vornamen der Eltern maßgebend gewesen zu sein. Das war 1934. Es folgten dann nochmals ziemlich dicht nacheinander zwei weitere Söhne.
Wie mein Großvater ist auch mein Vater mit seinen 165 Zentimetern von kleiner, untersetzter Statur und ebenso von Beruf Steinmetz oder besser gesagt Bildhauer. Aus seinem blassen Gesicht stechen zwei wasserblaue Augen, die nicht gerade Vertrauen erweckende Wirkung auf das jeweilige Gegenüber haben. Er wäre gerne größer, stattlicher gewesen. Um so verwunderlicher ist es, dass er sich bei der Partnerwahl ausgerechnet auf eine hochgewachsene, hagere Frau festlegte, was seinen Komplex doch nur verstärken musste.
Tja und in dieser Familie erblickte ich dann 1961 das Licht der Welt. Ich kann mich nur aus den Erzählungen meiner Eltern erinnern, dass es immer nur Hänseleien in der Familie gab, insbesondere zwischen den Ehefrauen der jungen Galanis-Brüder. Worin diese auch immer bestanden haben mochten, ich erfuhr es nie. Auf jeden Fall waren es diese Fehden, die meinen Vater dazu brachten, woanders, erstmal ohne seine Familie, Fuß zu fassen, ganz einfach, um ruhiger leben zu können. Er selbst war immer schon ein stiller – ich sollte vielleicht eher sagen ein wortkarger, einsilbiger – Mensch. Er sprach stets nur das Allernötigste, sowohl mit seiner Frau als auch mit seinen Kindern. Wenn er zwei zusammenhängende Sätze an einem Stück sprach, war das schon sehr viel. Das hat sich bis heute nicht geändert.
So fand er damals Arbeit in Südfrankreich. Sein Arbeitgeber, Flaubert, war ein Künstler, der von Steinen und erst recht von der Kunst meines Vaters so viel verstand, wie eine Kuh vom Schlittschuhlaufen. Kein Wunder, er war Maler und kein Steinmetz. Entsprechend lief das Geschäft auch nicht gut und so kehrte mein Vater wieder zurück nach Italien. Erst dann begriff sein französischer Künstler-Arbeitgeber, welchen brillianten Mitarbeiter er in meinem Vater verloren hatte und holte ihn wieder zurück, damit er in seinem Berieb das Atelier übernehme. Das Leben in Frankreich war für meinen Vater nicht einfach, denn außer seines venezianischen Dialekts sprach und verstand er keine weiteren Sprachen. Er hielt es nicht für notwendig, die Sprache des Landes, in dem er lebte zu erlernen. Da war es für Behörden und vor allen Dingen seinen Areitgeber ein Leichtes, ihn über den Tisch zu ziehen. Man brauchte ihm nur ein Papier unter die Nase zu halten und ihm zu bedeuten, wohin er seine Unterschrift zu setzen habe, und er tat es, ohne zu wissen, wozu er soeben sein schriftliches Einverständnis gab. So unterzeichnete er auch den Arbeitsvertrag, der einerseits eine Exklusivitätsklausel, sowie eine auf fünf Jahre ausgedehnte Wettbewerbsverbotsklausel im Falle des Ausscheidens enthielt, die in dieser Form wider alle guten Sitten verstieß. Zum einen sicherte Flaubert sich alle Rechte an den von meinem Vater gefertigten Steinmetz- und Bildhauerarbeiten. Zum anderen verpflichtete mein Vater sich mit seiner Unterschrift, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die Dauer von fünf Jahren weder für eine Konkurrenzfirma noch in eigener Firma im Département Bouches-du-Rhône tätig zu werden. Bei Verstoß gegen das Wettberbsverbot, so die Vertragsformulierung, konnte Flaubert eine Vertragsstrafe in Höhe von 20'000 Francs beanspruchen, während er sich zudem die Geltendmachung weiterer Ansprüche sicherte.
Diese Klausel las sich folgendermaßen: ›Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt unbenommen.‹ Für meinen Vater hätte das der Ruin bedeuten können. Doch davon hatte er keine Ahnung und so ließ er meine Mutter und mich nach Aix-en-Provence nachkommen. Ich war gerade mal neun Monate alt.
Aus dem Atelier, das mein Vater innerhalb des Flaubert-Betriebes in heruntergekommenem Zustand in eigener Regie übernahm, machte er eine kleine Goldgrube. Er hatte goldene Hände, die aus jedem noch so rauhen Stein etwas hervorzauberten, und diese Kunst war natürlich Schwerpunkt seines Ateliers. Flaubert hingegen war und blieb ein hinterhältiger Tagedieb, der sich auf der Kunst meines Vaters ausruhte und dabei sehr gut lebte.
Mit einigen Ersparnissen, die meine Familie mitbrachte, kaufte mein Vater ein Stück Land in La Badesse, worauf er zusammen mit Freunden ein Haus baute. Im Haus hatte er dann sein eigenes kleines Geschäft aufgebaut, ohne zu wissen, dass er soeben gegen die Konkurrenzverbotsklausel seines Arbeitsvertrages verstieß. Da er aber als Ausländer in Frankreich kein Geschäft auf eigenen Namen führen durfte, ließ er es ganz einfach auf den Namen eines Gesellen laufen, was sich wiederum als sein Glück erwies, denn Flaubert versuchte meinen Vater wegen Vertragsbruchs zu verklagen. Da jedoch meines Vaters Betrieb auf den Gesellen lief, konnte man ihm nichts anhaben. Er selbst gab sich als Berater und Lehrer für den Gesellen aus und somit ging er keinem eigenen Geschäft nach, das mit Flauberts Firma hätte konkurrieren können. So raffiniert war er dann doch.
Allmählich wuchs auch unsere Familie. 1963 bekam ich ein Brüderchen Tiziano und nochmals zwei Jahre später erblickte Nesthäkchen Alessandro das Licht der Welt. Doch mein Vater, der nie aus seiner Ruhe zu bringen war, war kein Familienmensch, der sich mit seinen Kindern befasste. Er hatte seinen eigenen Lebensstil, der ausschließlich auf sich selbst gerichtet war. Das war erstens, aus jedem Stein ein Kunstwerk zu erschaffen und zweitens, sich im Bistro zu vergnügen. Mit der Zeit gab er mehr Geld aus, als er verdiente. Als körperlichen Ausgleich spielte er mit seinen Bistrokumpanen Boule. So war mein Vater damals und so ist er auch noch heute.
Was ich schon immer seltsam fand, ist der Umstand, dass mein Vater jeden Kontakt zu seinen Brüdern abgebrochen hatte. Mutter erklärte mir einmal, als ich sie fragte, dass die Brüder ihm so sehr zugesetzt hätten, dass er mit ihnen nichts mehr zu tun haben wolle. Somit lernten wir unsere Onkel und Tanten nie kennen.
Meine Mutter Concetta, Nonna, wie sie heute, nachdem sie eine Reihe Enkel hat, genannt wird, könnte gegensätzlicher nicht sein. Mit ihren 170 Zentimetern ist sie im Vergleich zu meinem Vater sehr groß. Sie ist trotz normalen Essens hager und alles andere als ruhig und still. Ihr extrovertierter Wesenszug ist seit jeher sehr bestimmend – sie kann gut und mit lauter, unangenehm hoher Stimme Leute, insbesondere ihre Kinder, herumkommandieren. Was sie mit meinem Vater gemein hat, das ist die Trägheit, die Sprache ihres Wahllandes zu erlernen. Doch zumindest konnte sie sich eher schlecht als recht, mit einfachen anspruchslosen Vokabeln artikulieren, währed meinem Vater sogar dieser Mindestwortschatz lange Zeit fehlte.
Meine Mutter ging nie aus. Dafür hatte sie innerhalb der Familie, nach italienischem Grundprinzip, ein Matriarchat errichtet und herrschte unbestritten zu Hause, während mein Vater, wie schon erwähnt, in Selbstbestimmung außerhalb der familiären Bande lebte. Ihr besonderes Merkmal, an das ich mich seit jeher erinnere, ist ihre aufgedonnerte Haartracht. Sie thronte wie ein aufgetürmter Wollknäuel auf ihrem Haupte, der sie noch größer erscheinen ließ. Ihre heute grauen Haare waren früher dunkelbraun, ebenso haben ihre Augen diese undurchdringliche dunkle Farbe. Die wasserblauen Augen und die rötlichbraunen Haare unseres Vaters konnten sich gegen das Dunkle unserer Mutter nicht behaupten, denn bei uns drei Söhnen hat sich ganz klar Mutters dunkler Farbtopf durchgesetzt.
Wenn man mich fragen würde, ob ich eine gute Kindheit genoss, würde ich diese, wenn ich nicht lange überlege, vielleicht erst einmal mit Ja beantworten, aber nur deswegen, weil ich es nicht anders kannte. Wie sollte es auch anders sein. Für Kinder sind die Eltern doch immer das Liebste. Heute jedoch weiß ich es besser. Eigentlich hatte ich eine traurige Kindheit und Jugendzeit. Nicht nur, weil mein wortkarger Vater für mich eigentlich wie ein Fremder war. Er interessierte sich für mich nicht im Geringsten, zumindest nicht so, wie für meine Brüder, und weil meine Mutter streng und unnachgiebig herrschte. Zum Beispiel wurde mir stets aufgetragen still und vor allen Dingen immer für meine jüngeren Brüder da zu sein. Nein, unsere Zeiten waren eben auch deswegen so hart, weil unsere Familie sich oft mit Beeren- und Schneckensammeln durchschlagen musste, wenn mein Vater ohne Arbeit war. Das war zumindest ein Vorzug meiner Mutter, dass sie immer darauf bedacht war, die Mäuler ihrer Söhne gestopft zu wissen. Mit unserem Vater war da nicht zu rechnen. Ihm war das egal, daher sorgte er sich auch nicht darum, ob es zu Hause für seine Buben genug zu essen gab. Doch auch daran gewöhnten wir Kinder uns und wir fanden es damals auch ganz normal. ›Es ist, wie es ist‹, sagte unsere Mutter immer. Sie zeigte dabei keine großen Gefühlsregungen.
Wenn ich aufgefordert würde, meine Eltern mit kurzen Worten, in einem Satz, zu beschreiben, würde ich sagen: meine Eltern sind emotionale Krüppel. Ja, genau so: emotionale Krüppel. Da ihnen jede soziale Kompetenz fehlt, konnten sie weder mir noch meinen Brüdern welche beibringen.
Meine harte Jugendzeit, in der ich wirklich nichts hatte, kompensierte ich später mit einem überschwänglichen Lebensstil. Ich kümmerte mich nicht darum, was morgen sein würde und ich lebte auf Kredit. Das wurde mir zum Verhängnis, denn ich war gezwungen, meine Villa, die ich selbst gebaut und mit Steinmetzarbeiten verziert hatte und den dazugehörenden Pool unter Wert zu verkaufen, damit ich meine Kredite abbezahlen konnte.
Dabei hatte mein Erwachsenenleben trotz der schlechten familiären Ausgangslage einen äußerst guten Start. Ich hatte die Vorzüge des guten Aussehens meiner Mutter geerbt. Ich bin mit meinen aus der Art geschlagenen 185 Zentimetern der größte von uns drei Buben, habe schwarze Haare, die heute leicht grau durchwirkt sind, und dunkelbraune Augen. Ich gelte als ruhig und ausgeglichen. Meine ruhige einfache Sprache kennt keine Vulgärausdrücke. Tja, und von meinem Vater muss ich wohl die Fähigkeiten eines guten Steinmetzes geerbt haben. Dazu, dass ich ein guter Geschäftsmann und Verkäufer bin, haben weder mein Vater noch meine Mutter beigetragen. Das sind meine ureigensten Vorzüge. Ich war es, der 1984 das ehemals florierende Geschäft meines Vaters für fünfzigtausend Francs übernommen und wieder erfolgreich aufgebaut hatte, nachdem mein Vater es verkommen ließ. Er besaß längst keinen Kundenstamm mehr, und er gab sich auch keine Mühe mehr, Kunden zu aquirieren.
Ich stellte hochwertige Steinmetzarbeiten, wie zum Beispiel Cheminees, Tische, Säulen etc. her und die Geschäfte liefen bestens. Nicht nur ich und meine 1982 mit Myriam gegründete Familie lebten über zwanzig Jahre sehr gut davon, sondern auch meine Eltern und meine beiden Brüder. Damit bin ich im Gegensatz zu meinen beiden Brüdern eigentlich der Sohn, der der Wunschvorstellung unserer Mutter am ehesten entsprach. Sie war nämlich der Ansicht, dass ihre drei Söhne nur auf die Welt kamen, um in erster Linie für die Familie da zu sein. Derjenige, der am meisten verdiente, hatte mit den anderen Brüdern zu teilen und natürlich erwartete sie auch, dass dieser Sohn den Unterhaltsansprüchen der Mama auch tüchtig gerecht wurde.
Doch mitnichten, hat sie mich als den Sohn gesehen. Da half auch nicht, dass ich ihrem Wunschbild von allen dreien am nächsten kam. Ich war trotz meines Erfolges nicht Mutters Lieblingssohn. Das war Tiziano, der mittlere ihrer drei Kinder. Aber dazu später.
Ich auf jeden Fall war, wie schon erwähnt, aufgrund meines aufwändigen Lebensstils irgendwann gezwungen meine schöne große Villa zu verkaufen, um meine Schulden zu bezahlen. Wenn ich auch den Gegenwert für die hochwertige Steinmetzkunst, die in diesem Hause überall anzutreffen war, nicht erzielen konnte, blieb mir trotzdem genug Geld übrig, um ein attraktives etwas kleineres zweistöckiges Einfamilienhaus in der Nähe eines Parks von Rognac zu kaufen. Und nicht nur das, ich hatte auch noch genug Polster, um zwei kleine Pavillons im Hinterland und ein Studio im Val d'Allos, einem schönen Skigebiet, zu erwerben, die ich nach Umbau vermietete. Dies vor allem vor dem Hintergrund, meine Altersvorsorge gesichert zu wissen.
Meine damalige Nochehefrau Myriam ist ein Fall für sich. Sie ist Französin, von großer Statur, ist ein Jahr älter und hat wie ich dunkles Haar und dunkle Augen. Sie behauptet von sich selbst, sehr selbstbewusst zu sein, was aber nicht wirklich stimmt. Es scheint wohl eher ein Wunschdenken von ihr zu sein, denn wäre sie selbstbewusst, hätte sie es nicht nötig, ihre Stimme zu erheben und hysterisch herumzuschreien, sobald sie sich in die Enge getrieben fühlt. Auf der anderen Seite lässt sie andere spüren, dass sie sie für Idioten hält. Vielleicht ist es dieser Charakterzug, den sie irrigerweise mit ›Selbstbewusstsein‹ umschreibt.
Myriam hatte Schwierigkeiten mit der italienischen Herkunft meiner Familie. Weiß der Teufel, wer oder was sie geritten hatte, ausgerechnet mich geheiratet zu haben, mich, der ich aus einer Familie stamme, in der die Eltern nicht nur italienischstämmig sind, sondern zudem zu faul waren, Myriams Muttersprache richtig zu sprechen. Doch diese Antipathie beruhte sehr auf Gegenseitigkeit. Weder meine Eltern noch meine Brüder hatten Myriam für voll genommen – das wiederum war abermals eine typisch italienische Mentalität.
Unsere Ehe driftete langsam aber sicher auseinander. Myriam nahm unseren Sohn, der schon in frühester Kindheit ein auffälliges Verhalten zeigte, total in Beschlag, mehr noch, hetzte ihn gegen mich auf. Sie hielt an ihren Erziehungsgrundsätzen fest und ließ sich da nicht reinreden. Das war ein Mitgrund für unsere spätere Scheidung, denn damals wussten wir beide schon nicht mehr so genau, wie wir unsere Ehe noch länger aufrecht erhalten sollten. Doch ihr Ehebruch machte die Entscheidung schließlich leicht. Ja, sie hatte mich schamlos, teilweise sogar mit gemeinsamen Freunden, hintergangen.
Nach unserer Scheidung habe ich ihr das Haus und das Studio im Val d'Allos überlassen. Doch das war ihr nicht genug. Sie ist unstillbar geldgierig. Sie will alles und ist wohl erst zufrieden, wenn sie mir den Atem abgedrückt hat. Solches Denken ist mir fremd. Wir hatten uns doch einmal geliebt. Was sind die Beweggründe, einen Menschen ruinieren zu wollen, sich erst zufrieden zu geben, wenn der andere am Boden liegt und nicht mehr aufsteht? Ich werde es nie begreifen.
Nun noch ein Wort zu meinen Brüdern. Mein jüngster Bruder Alessandro wurde, wie es bei Nesthäkchen so üblich ist, von unseren Eltern, insbesondere der Mutter, verhätschelt, das heißt, er wurde nie so streng wie die beiden älteren Kinder angefasst. Ihm wurde nicht nur alles erlaubt, sondern auch alles nachgesehen. Er blieb immer das Baby. Meist musste ich, als der Älteste von uns dreien, den Kopf für seine Sünden hinhalten.
Zugegeben, Alessandro war und ist noch ein recht gut aussehender Bengel, doch das half nicht darüber hinweg, dass er zu einem Nichtsnutz heranwuchs.
Kaum, dass er aus seinen Bubenhosen herausgewachsen war, ging es auch schon los mit Frauengeschichten. Die Frauen, ob jung oder alt, bekamen beim Anblick seines schönen Gesichts und Körpers, förmlich weiche Knie. Alle seine optischen Vorzüge summierten sich quasi zu einem Freifahrtschein in jeden weiblichen Slip, den er für eroberungswürdig hielt. Meist blieben seine sexuellen Eskapaden folgenlos … aber eben nur ›meist‹ … denn einmal hatte er Pech. Eine Araberin aus Tunesien, ihres Zeichens Kellnerin in einer Kaschemme im Spelunkenviertel von Aix-en-Provence, erwartete ein Kind von ihm. Die beiden lebten zusammen bis ihr Sohn Raymond sechs Monate alt war. Dann hatte er, wie er erklärte, die Schnauze voll von der Araberin, und so trennte er sich von ihr. Später lebte sein Sohn mit seiner Mutter unter dem Regime eines gestrengen Gatten und Stiefvaters, bei dem beide nichts zu lachen hatten.
Nach einer kurzen leidenschaftlichen Brunftzeit – Alessandro genoss seine neu gewonnene Freiheit wieder in vollen Zügen – zog er sich eine Neue namens Scarlett inklusive unehelichem Sohn an Land. Mit dem aggressiven Sohn hatte Alessandro seine liebe Not. Die beiden prügelten sich ständig und nicht nur einmal wurde die Polizei zur Schlichtung des Kampfes gerufen.
Alessandro heiratete diese Frau schließlich, nachdem ihr gemeinsam gezeugter Sohn Félipe, genannt Pépé, drei Monate alt war. Keiner verstand so richtig, wie er bei dieser rothaarigen, ekligen Französin mit hälftigem Anteil irischen Bluts hängen bleiben konnte. Sie war eine Friseurin, die sich mit ihren dreckigen Fingernägeln fast zwanghaft im Haar kratzte. Wir konnten nur vermuten, dass es in ihrer roten Wolle vielleicht ungebetene Gäste gab, die für den ständigen Juckreiz sorgten.
Den Namen Scarlett, der irischen Ursprungs ist, erhielt sie, wie wir später erfuhren, weil sie schon bei der Geburt scharlachrotes Haar hatte. Scarletts Vater war Ire und ebenso rothaarig. Na ja, kein Wunder, gibt es doch in Irland die meisten rothaarigen Menschen.
Alessandro hatte nicht nur das gute Aussehen, wie wir alle, von der Mutter geerbt, sondern zusätzlich noch ihren missgünstigen und raffgierigen Charakter, denn darin war sie eine wahrhaftige Hexe. Und zusätzlich zu dieser Eigenschaft ist er ein jähzorniger, aggressiver Typ, vor allem immer dann, wenn er seine Unzulänglichkeiten zu verbergen suchte. Da ihm schon als Kind nie Grenzen gesetzt wurden, hatte er auch nie gelernt, sein hitziges Temperament zu zügeln.
Vom Vater erbte er nur einen einzigen Wesenszug – leider nicht gerade das Beste, das dieser zu vererben hatte – nämlich den Hang zum Alkohol. Alessandro trank heimlich unterzog sich mehrmaligem, erfolglosem Alkoholentzug.
Ein Taugenichts, der mein Bruder nun mal war, hatte natürlich auch die Arbeit nicht erfunden. Mehrere Male hatte er versucht, ein Geschäft aufzubauen und jedes Mal ging er pleite, und das, obwohl ich ihm immer wieder unter die Arme griff, indem ich ihm unter anderem Kunden zuschanzte. Doch die Arbeiten für meine ihm überlassenen Kunden wurden schlecht und vor allen Dingen nie termingerecht ausgeführt. Die daraus resultierenden Verluste mit der nochmaligen Ausführung der Aufträge, gingen natürlich stets zu meinen Lasten. Somit überließ ich ihm keine Kunden mehr.
Mit Vorliebe nahm er staatliche Förderungen für berufliche Fortbildungsmaßnamen in Anspruch. So ließ er sich zum Beispiel als Ambulanzfahrer und -begleiter ausbilden. Das verdiente Geld hatte er jeweils gleich verjubelt. Regelmäßiges Fernbleiben von der Arbeit, angeblich wegen Krankheit – in Wirklichkeit strotzte er vor Gesundheit und Manneskraft – führte dazu, dass er seinen Job verlor. Lange Zeit bezog er Arbeitslosengeld und natürlich hatte er erdenkliche Mühe, seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinem mit der Tunesierin gezeugten unehelichen Sohn Raymond nachzukommen. Bei seinem zweiten ehelichen Sohn Pépé, den er mit seiner scheußlichen Rothaarigen zeugte, verließ Alessandro sich voll auf mich, den Paten.
Des Öfteren pumpte er sich Geld von unserer Mutter, was genau genommen mein Geld war, denn meine Mutter lebte auf meine Kosten. Natürlich zahlte er seine Schulden nie zurück und auch ich warte noch heute auf die versprochene Rückzahlung der 4000 Euro, die er sich von mir geliehen hatte.
Tiziano, der nach dem italienischen Großmeister Tiziano Vezellio aus dem 15./16. Jahrhundert benannt wurde, ist der mittlere von uns drei Brüdern. Er ist ein nicht ganz so verquerer Typ wie Alessandro, aber dennoch ein Sonderling. Von uns dreien ist er der Bestaussehende, ist sportlich – fährt regelmäßig seine sechzig/siebzig Kilometer mit seinem Fahrrad über hügeliges Gelände – und entsprechend ist sein Körper auch sportlich gestählt. Er ist mit 175 Zentimetern etwas größer als Alessandro. Mit seiner Rolle oder besser seinem Platz in der Familie war er nie zufrieden, denn er haderte damit, der Zweitgeborene zu sein, obwohl er eigentlich mir gegenüber nie benachteiligt wurde. Im Gegenteil er war der erklärte Lieblingssohn unserer Eltern, insbesondere unserer Mutter. Bei ihr wusste er sich gekonnt einschmeichelnd in Szene zu setzen.
Von unserem Vater hatte Tiziano die goldenen Hände geerbt. Ja, seine Fertigkeiten in der Bildhauerkunst sind wirklich herausragend. Vielleicht mag die Namensgebung, der Name eines grandiosen Künstlers, der gegen Ende des Spätmittelalters lebte, schon von Geburt an ein Omen gewesen sein, dass er ein Künstler par excellence wurde. Und wie ein Künstler lebt er auch.
Wenn ich den Charakter meines Bruders, der ein richtig verwöhntes Muttersöhnchen ist, beschreiben sollte … nun den hat er von unserer Mutter geerbt, das heißt, dass sich weitere Kommentare darüber erübrigen.
Alles in allem ist er ein ruhiger und undurchschaubarer nicht gerade Vertrauen erweckender Typ. Beziehungen zum anderen Geschlecht halten kaum länger als sechs Monate. Seine letzte Maitresse ist eine Dame im Alter unserer Mutter. Diese Dame hat einen ganz besonderen Vorzug, der darin bestand, meinem Bruder einen Mercedes geschenkt zu haben. Vielleicht ist es genau dieser Vorzug, der dafür sorgte, dass die Beziehung immer noch besteht, obwohl der Zenit von sechs Monaten längst überschritten wurde.
Also, das ist eine Kurzbeschreibung meiner Ursprungsfamilie. Bei dieser Konstellation ist es eigentlich erstaunlich, dass für mich Wertbegriffe wie Familie, Zusammenhalt, Teamwork und Vertrauen einen hohen Stellenwert besitzen und Basis für meine Entscheidungen sind. Vielleicht dank meiner jetzigen Frau Stéphanie, die mir eine starke treue Partnerin ist.
Stéphanie, eine brünette Französin, ist schnell beschrieben. Sie ist ein Jahr älter als ich, von zierlicher Gestalt und von ruhiger Wesensart. Als alleinerziehende Mutter von drei Töchtern aus der Ehe mit einem Chinesen hatte sie es bisher nicht einfach. Ihre tragische Geschichte begann damit, dass sie erst, als das dritte Kind schon unterwegs war, erfuhr, dass ihr Mann schon mit einer Chinesin verheiratet war, das heißt, dass die erste Ehe noch immer bestand.
Stéphanie hatte damals in Paris eine gut gehende Boutique. Nach der Trennung vom chinesischen Heiratsschwindler schlug sie erfolgreich die Beamtenlaufbahn als Administrativ-Angestellte ein und bildete sich in Abendkursen ständig weiter. Sie arbeitete sich hoch bis zur Redakteurin respektive Abteilungsvorsteherin in den städtischen Behörden.
2005, ein Jahr nach meiner Trennung von Myriam, lernte ich Stéphanie während eines Urlaubs in Südfrankreich kennen. Das heißt, sie machte Urlaub, und ich lebte da. Es war für mich Liebe auf den ersten Blick und nachdem wir über die Ferne – sie war mittlerweile längst wieder in Paris – steten Kontakt hatten, wollte ich natürlich gerne, dass sie zu mir in die Region von Aix-en-Provence kommt. Und zu meiner großen Freude kam sie.
Sie arbeitete eine Zeitlang in der städtischen Behörde von Aix-en-Provence. Doch sie hatte Ambitionen, sich selbständig zu machen. Von ihrem einstigen Aufenthalt in Asien brachte sie hervorragende Kenntnisse im Wellnessbereich mit und so nutzte sie ihre Chance, auf diesem Gebiet ihren Traum zur Selbständigkeit zu verwirklichen.
Stéphanie hätte ich gerne früher kennengelernt, bevor ich in die Ehe mit Myriam hineinschlitterte … doch ›hätte‹ steht leider nur stellvertretend für ›ein schöner Traum‹.
Doch ich will nicht klagen, denn aus heutiger Sicht, hat auch die Ehe mit Myriam, wenn auch noch so unglücklich, etwas Positives. Ich lernte Myriams Stiefvater, Zama, kennen, der für mich heute wie ein Vater ist. Zu ihm fühle ich mich mehr hingezogen als zu meinem leiblichen Vater, geschweige denn zu meiner ganzen Familie.
Die Clermonts
(erzählt von Myriam Galanis geb. Clermont)
Meine Familie stammt ursprünglich aus Mittelfrankreich, wo ich und auch meine um vier Jahre ältere Schwester Antoinette geboren wurden. Mein Vater, er ist der älteste von drei Buben, stammt aus einer gut bürgerlichen Familie … seine Eltern sprachen sich nach 50jähriger Ehe immer noch mit Sie an. Eigentlich waren sie über fünf Ecken miteinander verwandt.
Mein Großvater, man nannte ihn nur den alten Clermont, betrieb in Marokko eine Bäckerei und kam 1939 nach Frankreich zurück, wo er eine Konditorei eröffnete und damit während des Krieges gutes Geld verdiente, vor allem auch durch den sehr einträglichen Schwarzhandel.
Nach dem Krieg gründete er einen Betrieb im Büromaschinen-Handel und ließ alle drei Söhne bei sich arbeiten. Das Geschäft funktionierte und lief auch eine Weile ganz gut, bis mein Großvater dann aber seine Privatinsolvenz anmeldete, von der auch sein Geschäft betroffen war.
Mein Vater, Robert, heiratete nach langem Hin und Her mit seinen ›gut bürgerlichen‹ Eltern unsere Mutter Esther, eine Halbjüdin, die gerade ihren Vater verloren hatte. Vermutlich war die Auserwählte nach deren Ansicht wohl nicht vermögend genug. Der Dünkel meiner Großeltern war natürlich schon sehr ausgeprägt. Da war eine standesgemäße Heirat bei den Söhnen schon ein recht schwieriges Unterfangen.
Doch, wie schon erwähnt, schützte auch die gutbürgerliche Abstammung nicht vor Niedergang und so sah mein Vater nach der Pleite des elterlichen Betriebs keine Perspektive mehr und es zog ihn wegen des angenehmen Klimas in den Süden, in die Nähe von Aix-en-Provence. Diese Gegend hatte es ihm schon seit jeher angetan. Das war 1963, ich war also gerade drei Jahre alt, meine ältere Schwester war sieben. Aus seiner Tätigkeit im väterlichen Betrieb brachte er genug Erfahrung mit, so dass er schnell eine Anstellung fand. Er wurde Vertreter für den Vertrieb von Büromaschinen und war wegen seines Erfolgs auch bald aufgestiegen. Als Spross einer gutbürgerlichen Familie hatte er den Dünkel natürlich auch geerbt und der Erfolg stieg ihm sehr bald zu Kopf, so dass er wohl der Meinung war, er habe etwas Besseres als meine Mutter verdient. Er begann ein Doppelleben zu führen.
Meine kleine Schwester, Murielle, kam bald darauf im selben Jahr zur Welt. Sie war Legasthenikerin und hatte es besonders schwer, zumal Legasthenie damals noch nicht richtig erkannt wurde. Man betrachtete diese Kinder einfach als dumm. Bei Antoinette und mir hatte sie es natürlich auch nicht leicht gehabt. Wir waren ziemlich gemein zu ihr.
1965, gerade als Murielle mal 18 Monate alt war, machte mein Vater kein Geheimnis mehr aus seinem Doppelleben und machte sich schließlich mit seiner Geliebten – sie war seine Chefin – auf und davon. Er ließ unsere Mutter mit uns drei Mädchen einfach sitzen. Ich war damals fünf. Das konnte ich meinem Vater nie verzeihen und ich hasste ihn dafür. Meine ältere Schwester zeigte ihren Unmut dergestalt, dass sie ihre Spielchen auf ihre Art trieb, indem sie unsere Eltern gegeneinander auszuspielen versuchte.
Im Jahre 1967 verliebte sich unsere Mutter noch einmal und zwar in den um zwei Jahre älteren aus dem Elsass stammenden Paul. Zwei Jahre später, im Dezember, heirateten die beiden. Es hatte schon seinen Grund, warum die Hochzeit so zügig vorangetrieben wurde. Unserem leiblichen Vater, der seine Angebetete schon vorher heiratete – wir erfuhren dies auf Umwegen über gewisse Kanäle – sollte die Möglichkeit genommen werden, alleinigen Anspruch auf uns zu erheben. Das hätte nämlich dazu geführt, dass wir Kinder unserer Mutter hätten ganz weggenommen werden können. Papa lebte durch seine Heirat vor dem Gesetz in geordneten Verhältnissen, während die wilde Ehe zwischen Mama und Paul vor dem Gesetz nicht anerkannt gewesen wäre, um Kinder zugesprochen zu bekommen.
Paul hieß bei uns nur Kutazama, was in Swahili ›beobachten, zuschauen‹ bedeutet. Paul ist nämlich ein guter Beobachter und kann herrlich spannend erzählen. Swahili ist eine Bantusprache und die am weitesten verbreitete Verkehrssprache Ostafrikas. Von seinen vielen Afrikareisen kannte Kutazama ein wenig die Swahili-Sprache und er erklärte uns die Bedeutung seines Spitznamens, den er dort erhielt. Mit der Zeit hieß er bei uns nur noch kurz und simpel Zama.
2003 starb unsere Mutter nach langem Leiden an Krebs, worunter ich sehr litt. Dass sie Krebs hatte, war wohl schon lange zuvor bekannt, aber unsere Mutter