
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Am 13. Oktober 2016 hat Bob Dylan, der im Mai 2016 75 Jahre alt wurde, als erster Musiker den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen und damit seine einzigartige Karriere um eine weitere Besonderheit ergänzt. Leonard Cohen nannte ihn "the Picasso of Song"? Kein anderer Künstler hat die Entwicklung der Rockmusik und der Song-Poesie über die letzten fünf Jahrzehnte so nachhaltig, so ausdauernd und so einfallsreich bestimmt wie er. Heinrich Detering zeichnet das Werk des ›Song and Dance Man‹, der sich immer wieder neu erfunden hat, kenntnisreich und lebendig nach - von den Anfängen des Folksingers über die Elektrifizierung des Rock und die Wiederentdeckung amerikanischer Traditionen bis hin zu den noch einmal ganz neue Wege erschließenden Alben des 21. Jahrhunderts.Eine Literaturliste und eine Diskographie vervollständigen das Standardwerk. Aktualisierte Auflage Okober 2016.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Sammlungen
Ähnliche
Heinrich Detering
Bob Dylan
Mit 15 Abbildungen
Reclam
5., durchgesehene Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© 2007, 2016 Philipp Reclam jun. GmbH Co. KG, Stuttgart
Abbildung Umschlagvorderseite: Bob Dylan mit Mike Bloomfield in den Columbia Studios in New York, 1965; © Michael Ochs Archives / Getty Images. Abbildung Umschlagrückseite: Bob Dylan im Konzert 2011; © ChinaFotoPress / Getty Images
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2016
ISBN 978-3-15-960878-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011053-9
www.reclam.de
Inhalt
»Some people get born with the wrong names in the wrong periods. You call yourself what you want to call yourself. This is the land of the free.«
(Bob Dylan, Interview 2004)
»The only thing we knew for sure about Henry Porter was that his name wasn’t Henry Porter.«
(Bob Dylan / Sam Shepard, Brownsville Girl)
Alias
»Bob Dylan«: das ist der Name einer Kunstfigur, die der am 24. Mai 1941 in Duluth, Minnesota (»in the north country fair«) als erstes Kind einer jüdischen Mittelklassefamilie geborene, in Hibbing, Minnesota aufgewachsene Robert Allan Zimmerman um 1959 erfunden, deren Namen er 1962 offiziell angenommen und mit der er sich zeitweise identifiziert hat. »I’m Bob Dylan only if I have to«, hat er in einem Interview in den 1980er Jahren erklärt. Wer aber ist er, wenn er nicht Bob Dylan ist? Anstelle einer Antwort findet sich eine Kette von Namen, die teils aufeinander, teils auf diverse kulturelle Traditionen Amerikas verweisen. Seine Eltern gaben ihm den hebräischen Namen »Shabtai Zisel ben Avraham«. Als begleitender Mundharmonikaspieler im Tonstudio nennt sich der junge Dylan, nach dem Modell der bewunderten Bluesmusiker, »Blind Boy Grunt«; als versierter Produzent der späten Alben und Songs, die von jeder Art von Wärmeverlust handeln, figuriert ein kühler »Jack Frost«. Der Sänger und Studiomusiker tritt wie John Lee Hooker unter fortwährend neuen Pseudonymen auf: als »Elston Gunn« und »Elmer Johnson«, als »Bob Landy«, »Tedham Porterhouse« oder (eine selbstironische Verbeugung vor Dylan Thomas, dem Verfasser von Under Milk Wood) »Robert Milkwood Thomas«. Dass Dylan unter dem Namen »Lucky Wilbury« auf dem ersten Album der All-Star-Band The Traveling Wilburys (1988) zu hören war, ist Grund genug, auf dem zweiten Album das Pseudonym zu ändern; nun heißt der entsprechende Wilbury-Musiker (anspielend auf Dylans ausgebuhte Konzerte von 1966): »Boo«. Auch die Namen, unter denen er in seinen mehr oder weniger biographisch akzentuierten Filmen aufgetreten ist, lassen sich in dieser Linie sehen: Als allegorischen »Jack Fate« (›Hans Fatum‹) porträtiert sich der Untergangsprophet selbst in Masked and Anonymous, dessen Drehbuch er wiederum – zusammen mit dem Regisseur – verfasst hat, diesmal jedoch unter dem Pseudonym »Sergei Petrov«. In seinem monumentalen und monströsen Filmepos Renaldo and Clara tritt der wandernde Minstrel als »Renaldo« auf – dafür erscheint dann im Abspann der Rocksänger Ronnie Hawkins als Darsteller einer Figur namens »Bob Dylan«.
Dylans früher Weggefährte Liam Clancy vergleicht ihn in Martin Scorseses Filmporträt No Direction Home mit einer Gestalt der irischen Mythologie: »He was a shape shifter. It wasn’t necessary for him to be a definitive person.« Gerade so aber ist er der True Dylan, den der Dramatiker Sam Shepard in seinem gleichnamigen Einakter gezeigt hat (zuerst unter dem Titel A Short Life of Trouble, 1987). Die Kurzform und Grundformel dieser zwischen Pathos und Parodie changierenden Rollenspiele liefert der Name, unter dem Dylan als zweideutiger Gefährte des tragischen Helden in Peckinpahs Westernklassiker Pat Garrett and Billy the Kid auftritt. Er lautet »Alias«.
»Ich ist ein anderer«, hatte Arthur Rimbaud proklamiert, einer von Dylans literarischen Helden seit den 1960er Jahren. Dylan spielt in mehreren Texten auf diesen Satz an; in den Kommentaren zu Biograph und seinem autobiographischen Bericht Chronicles zitiert er ihn wörtlich. Wer in Dylans Werk nach einem Ich sucht, findet immer einen anderen: einen potenzierten Alias in fortwährender Metamorphose (»shedding off one more layer of skin«), einen Zwilling und Doppelgänger, der immer eins und doppelt ist (»I fought with my twin / the enemy within«), und einen bedrohlichen Verfolger seiner selbst (»keeping one step ahead from the persecutor within«), der sich in immer neue Namen flüchtet (»I needa new name … & break out of this place«, so auf einem Notizblatt in Writings and Drawings) und dessen wahrer Name niemals verraten wird. Denn was hier immer neu umschrieben wird, das ist eine »wahre Identität«: »was I a fool or not to protect / your real identity«. Der wahre Name bleibt das letzte Geheimnis des Menschen. Es ist das Mysterium der Person, das sich in Dylans biblisch getönter Sprachwelt auf genau dieselbe Weise der Sagbarkeit entzieht wie der Name Gottes: »I and I / One says to the other: No man sees my face and lives«, singt Dylan in ›I and I‹ 1983 (und zitiert damit das Buch Exodus, Kapitel 33, Vers 20).
Auch wenn sich hier ab etwa 2000 markante Änderungen abzeichnen – die Namensspiele liefern die Außenansicht eines Verfahrens, das Dylans Werk doch wohl im Innersten bestimmt und antreibt. Noch in scheinbar intimen Selbstenthüllungen hat der Alias immer etwas von einem ironischen Poseur, dessen Geradlinigkeit darin besteht, fortwährend Haken zu schlagen. Darum ist auch seinen Selbstdarstellungen und Selbstkommentaren in Interviews so wenig zu trauen wie seinen Chronicles, die eher einen kunstvoll aus eigenem und fremdem Textmaterial montierten Roman ergeben als eine Autobiographie. Selbst wo er für bildkünstlerische Arbeiten wie die Asia Series (2011) reklamierte, er habe sie nach eigenen Reiseeindrücken gemalt, konnten Kenner sehr bald und sehr leicht die Bildvorlagen aus dem Archiv des Photographen Henri Cartier-Bresson identifizieren. Wo Dylan sich als Person inszeniert, da agiert er zuweilen als Hochstapler und Hasardeur; da lügt er, wenn er will, das Blaue vom Himmel herunter – um dann wieder mit ungeschützter Aufrichtigkeit von seiner Kunst zu sprechen. Das bizarre Interview, das er dem Rolling Stone im September 2012 zum Erscheinen seines Albums Tempest gab, und das nüchterne und differenzierte Gespräch mit der Zeitschrift AARP zum Erscheinen des folgenden Albums Shadows in the Night zweieinhalb Jahre später geben einen Eindruck von der Spannweite dieser Gegensätze. Wenn Dylan in einem Interview vom April 1975 (mit der Folksängerin Mary Travers von dem Folktrio »Peter, Paul & Mary«) erklärt: »My stuff … has to do more with feeling than thinking. … When I get to thinking, I’m usually in some kind of trouble«, dann trifft das durchaus das Verhältnis zwischen den Ausdrucksformen seiner Kunst auf der einen und den manchmal verwirrenden Selbstkommentaren ganz gut. ›Never trust the artist, trust the tale.‹
In jedem Augenblick kann er so zum Renegaten werden. Wann immer die Nachfolgenden ihn erreicht zu haben glauben, ist er schon anderswo; wann immer er identifiziert zu sein scheint, ist er schon ein anderer. Als das sozialkritische Folk-Movement in den frühen 1960er Jahren zum Movement geworden war, trieb der junge Dylan Rockmusik; als endlich alle das mitbekommen hatten und an Dylans Wohnort das bis dahin größte Rock-’n’-Roll-Spektakel inszenierten, da hatte er selbst Woodstock längst verlassen (das er einen »neuen Markt für gebatikte T-Shirts« nannte) und spielte, unbegreiflich und unerhört, Country Music mit symbolistischen Texten. Sobald aber dieser Rückzug ihn mit einer mythischen Gloriole zu umleuchten drohte, sprang er vom Zug ab und präsentierte sich herausfordernd kommerziell wie Elvis in Las Vegas; eine Pose, in die er vorübergehend geschlüpft war, um die kubistischen Collagen seines Albums Blood on the Tracks zu komponieren, von wo aus er alsbald, sekundiert von Sam Shepard und Allen Ginsberg, zur »Rolling Thunder Tour« aufbrach, ein Minstrel der Post-Hippie-Ära mit Federn am Hut, elektrischer Gitarre und einer Bob-Dylan-Maske vor dem Gesicht. Als sich herumgesprochen hatte, dass er vom christlichen Fundamentalismus wieder Abstand genommen habe, konzertierte er beim Eucharistischen Weltkongress in Bologna vor Papst Johannes Paul II. (1997). Als ihn die Kulturkritik zur Ikone einer anti-kommerziellen Dekonstruktion erhob, sang er zu Frank Sinatras achtzigstem Geburtstag ›Restless Farewell‹. Als sein Spätwerk Time Out of Mind für seine vermeintlich todessüchtige Düsterkeit gerühmt wurde, überließ er den ersten Song des Albums als Werbe-Soundtrack einer Firma für luxuriöse Damenunterwäsche und trat in dem Spot selbst als dunkel-romantischer Liebhaber auf. Kurz darauf zeigte er sich auf »Love And Theft« abwechselnd als archaischer Bluessänger und swingverliebter Crooner. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts unternahm er ausgiebige archivarische Streifzüge durch die amerikanische Musik- und Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts – in seiner »Theme Time Radio Hour«, die selbst den Stil der 1940er Jahre adaptierte, und auf den Alben Modern Times (2006) und Together Through Life (2009). Drei Jahre, nachdem er sich mit seinem verspielten Weihnachtsalbum Christmas in the Heart (ebenfalls 2009), dessen Erlös den amerikanischen Obdachlosen zugedacht war, als fröhlich-frommer Menschenfreund gezeigt hatte, ließ er mit Tempest (2012) das blutrünstigste Album seiner Laufbahn folgen; auf seinem nächsten Album sang er dann zarte Sinatra-Lovesongs. Und so fort; und hinter jeder neuen Kehre gab es neue Schätze der Poesie und Musik zu entdecken. »He not busy being born is busy dying«, lautet die oft zitierte Devise aus seinem Song ›It’s All Right, Ma‹. »When asked to give your real name«, so ist in dem frühen Gedicht ›Advice for Geraldine‹ zu lesen, »never give it.« Es ist Dylans Version des Grundsatzes, nach dem ein weit entfernter trickster und shape shifter der modernen Weltliteratur sein Leben geführt oder jedenfalls erzählerisch inszeniert hat, der deshalb hier trotz seiner Ferne zitiert werden soll: der Einsicht nämlich, »dass im Gleichnis leben zu dürfen eigentlich Freiheit bedeutet« (so Thomas Manns Felix Krull).
Vielleicht erklärt diese Ambivalenz von Identitätspathos und Rollenspiel auch die Bedeutung, die »Bob Dylan« im Diskurs der Moderne und der Postmoderne seit den 1960er Jahren gewonnen hat, seinen geradezu ikonischen Status: noch einmal ein abendländisches Ich zu sein – aber im Pseudonym; noch einmal ein »Originalgenie« zu sein – aber in der Adaptation fremder Stimmen; noch einmal authentisch zu sein – im potenzierten Rollenspiel. Dylans Kunst wird im Sinne Schillers »naiv«, indem sie das »Sentimentalische« so sehr auf die Spitze treibt, dass es gezwungen wird, in sein Gegenteil umzuschlagen.
Sein Leben derart konsequent auf nichts gestellt zu haben als auf eine dann allerdings mit religiöser Inbrunst betriebene Kunst, die ständige Beweglichkeit als Lebensform: diese Radikalität ist von Beginn an ein Teil von Dylans Charisma gewesen. Die Faszination der ›großen Persönlichkeit‹ entspringt wesentlich jenem zutiefst romantischen Paradoxon, in dem diese Persönlichkeit nichts anderes ist (oder zu sein vorgibt) als die Stimme eines anonymen und kollektiven Überlieferungsgeschehens. Was in den Anfängen noch Landstreicher-, Hobo-Pose war, ist heute zum Ernstfall eines Lebens ohne festen Wohnsitz geworden: eine »Never Ending Tour« – auch wenn Dylan diese Bezeichnung längst wieder verworfen hat – oft am Rande der öffentlichen Selbstzerstörung und stets auf der romantischen Suche nach der Reinheit des (immer schon verlorenen) Ursprünglichen, nach dem native America der Songpoesie. Tatsächlich hat Dylan sich in bald fünfzigjähriger Anstrengung eine Unabhängigkeit erarbeitet, in der er unerreichbar scheint und aus der heraus er sich nun als souveräne Stimme von humoristischer Gelassenheit vernehmen lässt.
Kein anderer Künstler hat die Entwicklung der Rockmusik und der Song Poetry so nachhaltig und über so lange Zeit hinweg bestimmt wie Dylan. Aus unterschiedlichsten, in einen facettenreichen und endlos variierbaren Personalstil integrierten Traditionen der populären Musik, der Literatur und des Kinos hat er mit bis jetzt, je nach Zählung, vierzig bis fünfzig Alben, mit Filmen, Gedicht- und Prosabänden künstlerische Ausdrucksformen geschaffen, deren Auswirkungen unabsehbar sind. Er ist Dichter und Geschichtenerzähler, Komponist und Sänger, Filmemacher und nebenbei auch noch spielfreudig dilettierender Zeichner und Maler (auf diversen Albumcovers, in den Bänden Writings and Drawings, 1973; Drawn Blank, 1994; The Drawn Blank Series, 2008; und in mehreren weiteren Series-Ausstellungen und Katalogen seither). Längst ist Dylans umfangreiche Song Poetry ein Teil der Weltkultur geworden, auch dort, wo nicht viel mehr als sein Name bekannt sein dürfte, buchstäblich »the Picasso of Song« (so Leonard Cohen). In der Verschmelzung von Musik, Poesie und Performance, mit einem sicheren Gespür für Tonfälle, Phrasierung und Timing und mit einer Stimme von unvergleichlicher Ausdruckskraft, Wandlungs- und Modulationsfähigkeit hat Dylan bis heute die mündlich-magischen Ursprünge der Kunst unter den Bedingungen einer globalisierten technologischen Moderne vergegenwärtigt. (Ja, auch mit seiner Stimme – oder vielmehr seinen Stimmen. Denn wie alles in diesem Werk, so gibt es auch Dylans oft voreilig verspottete und sich allen vermeintlich simplen Parodierversuchen entziehende Stimme nur im Plural. Richard Klein hat in seiner musikwissenschaftlichen Analyse gezeigt, wie sie Dylans vielleicht am kreativsten gehandhabtes Instrument geworden ist.)
Wenn er bis heute neben den höchsten nationalen Auszeichnungen der USA (darunter der Freedom Medal, die Barack Obama ihm 2012 umhängte) auch zwei Ehrendoktorate erhalten hat, in Princeton und St. Andrews, außerdem den »Polar Prize« des schwedischen Königs und eine »Special Citation« zum Pulitzerpreis 2008, und wenn er nun auch den Literaturnobelpreis erhalten hat, dann nicht – oder jedenfalls nicht allein – als Musiker oder Poet, sondern eben als ein erklärter »song and dance man«, der die getrennten Kunstformen noch einmal souverän zusammenführt. Dylans performative Praxis zielt auf die Wiedergewinnung einer Kunst, in der Musik und Dichtung, Tanz und Theater, Bild und Film noch ein Kontinuum bilden – ein Gesamtkunstwerk der Popularkultur.
Die bisherige Geschichte dieses umfangreichen Lebenswerks zeigt sich einerseits als Abfolge ständiger Wandlungen, andererseits aber auch als Serie potentiell unabschließbarer Variationen eines Grundinventars von Themen, Figuren, poetischen und musikalischen Formen. Von Beginn an zeichnen sich Grundspannungen ab, die über Jahrzehnte durchgehalten werden: Spannungen zwischen den Polen von illiterater Popular- und avantgardistischer Bildungskultur, archaischer Einfachheit und avantgardistischer Komplexität, Autorschaft und Anonymität, zwischen konservativer Rückwendung und der Suche nach permanenter Innovation. Das gilt auch in politischer Hinsicht: Dylans Songwelt kann jederzeit – und auf eine Freund und Feind gleichermaßen verwirrende Weise – changieren zwischen fortschrittsoptimistischem Aktivismus und pessimistischer, gern zynisch formulierter Politikfeindlichkeit, zwischen konservativ-patriotischer Vergangenheitsverklärung und libertärer Utopie. Immer deutlicher tritt in diesen sehr produktiven Widersprüchen bis heute die Konstanz der Selbst- und Weltentwürfe hervor, die sich im Wechsel der Erscheinungsformen behauptet – derjenigen der Kunst, aber auch derjenigen des Künstlers selbst.
Bezeichnend für Dylans romantische (und romantisch reflektierte) Orientierung an einer mündlichen Volkskultur ist der Umgang des recording artist mit den technischen Möglichkeiten des Studios. Gerade hier hat er lange und energisch einen Dilettantismus verteidigt, der in der bewussten Selbstbeschränkung der technischen Mittel Spontaneität und Beweglichkeit ermöglichen, ›Authentizität‹ sichern, Kreativität und Produktivität erzwingen sollte. Sein erstes Album nahm der Zwanzigjährige in drei Sessions von jeweils rund drei Stunden auf; auch spätere Aufnahmen dauerten nur in wenigen, dann allerdings immer signifikanten Fällen länger. Immer wieder wird technische Perfektion ebenso offensiv sabotiert wie die Sicherheit der Routine; immer wieder wird mit einer verblüffenden narzisstischen Kessheit die eigene Improvisation über alle technischen Erfordernisse des Mediums gestellt (einschließlich der kleinlichen Forderung, nur in Richtung des Mikrofons zu singen) und ohne Rücksichten auf die doch von ihm selbst ins Studio geholten Begleitmusiker durchgesetzt.
Seit den 1960er Jahren gleichen sich die Berichte von Produzenten und Studiomusikern darüber, wie Dylan im Studio erscheint und wortlos zu musizieren beginnt, und wie er dann während laufender Aufnahmen unvermittelt Tempo und Tonart ändert, um die Begleitmusiker und sich selbst zu ›lebendigen‹ Improvisationen zu zwingen. (Während der ersten Phase der »Never Ending Tour« hat er das zuweilen auch auf offener Bühne getan: etwa den Anfang eines Songs intoniert, um in dem Augenblick, in dem die Band einfällt, in einen anderen zu wechseln.) »Are we making a record«, hat er seinen Produzenten Chuck Plotkin nach dessen Bericht während der Aufnahmen zu Shot of Love1981 gefragt, »or are we making music?« Nicht selten werden die Songs erst im Studio beendet – manchmal auch erst dort geschrieben, während der Aufnahmen, zum Beispiel deshalb, weil ein anderer Song nicht gelingt, oder einfach, weil noch ein Titel für das Album fehlt – und dann in einem einzigen Take aufgenommen, so das komplette Album Another Side of Bob Dylan oder noch Songs wie ›Man in the Long Black Coat‹ (1989).
Umgekehrt können brillante Einfälle, bei denen zufällig kein Aufnahmegerät lief, achselzuckend für immer verworfen werden. Bob Johnston, der Produzent der drei großen Rock-Alben, hat berichtet, wie er sich angewöhnt habe, die Aufnahmegeräte einfach pausenlos mitlaufen zu lassen, da Dylan manchmal ohne Ankündigung zu spielen begonnen, manchmal aber auch ebenso plötzlich eine gerade improvisierte Version für endgültig und unwiederholbar erklärt habe – so wie er auch in seinen Konzerten manchmal längst vergessene oder überhaupt noch nie aufgeführte Songs singt, die es nur dieses eine Mal und dann nie wieder zu hören gibt. Eine unbestimmte Zahl von Songs muss deshalb als verloren gelten. Während die veröffentlichten Alben oft eher zufällige, durch Glück und günstige Tagesform zustande gekommene Momentaufnahmen präsentieren, sind einige Meisterwerke bis heute nur in Form illegaler Aufnahmen zugänglich – oder müssen aus nach und nach erschienenen, disparaten Einzelveröffentlichungen auf Dylans Greatest Hits-Kompilationen, Sammlungen wie The Gaslight Tapes 1962, Biograph und der unentbehrlichen Reihe der vor fünfundzwanzig Jahren, aus Anlass von Dylans fünfzigstem Geburtstag, begonnenen Bootleg Series rekonstruiert werden. Manche der offiziellen Alben besitzen deshalb einen nie zusammenhängend veröffentlichten Doppelgänger (so das Debüt Bob Dylan und das Folgealbum The Freewheelin’ Bob Dylan in den Witmark Demos, den Minnesota- und Gaslight Tapes, so auch Shot of Love und Infidels), manche mussten erst durch nachträgliche technische Bearbeitungen in ihren ursprünglich gewollten Zustand gebracht werden.
»Call me any name you like, I will never deny it«
Kopenhagen, 1966
Diese lange währende Studiofeindlichkeit hat Dylan allerdings nicht gehindert, immer wieder auch das Verhältnis von Rockmusik und Medien neu zu definieren – in experimentierenden Verbindungen von Musik und dokumentarischem oder erzählendem Film (vom cinéma vérité in D. A. Pennebakers Dylan-Film Dont Look Back – der Schreibfehler ist zum festen Titel-Bestandteil geworden – über die potenzierten Fiktionen in Renaldo and Clara bis zur autobiographischen Erzählung in Scorseses No Direction Home), in der Hinzufügung von Gedichtzyklen und Prosadichtungen zu Schallplatten, im ersten Filmclip der Rockgeschichte (›Subterranean Homesick Blues‹ als Prolog zu Dont Look Back), dem ersten Konzeptalbum im strikten Sinne (Bringing It All Back Home), dem ersten Doppelalbum (Blonde on Blonde) – und natürlich im dramatischen Wechsel von der Elektrifizierung des Folk 1965 über die Rückkehr zur akustischen Folk- und Country-Musik gut zwei Jahre später bis zu einer geradezu fundamentalistischen Verwerfung der elektronischen Medien (im Essay zu World Gone Wrong), dem Versuch, sie während der Arbeit im Studio wenigstens unsichtbar zu machen (während der Aufnahmen zu Shadows in the Night) und zwischendurch gar einer kompletten Mono-Neuedition seiner ersten zwölf Alben als The Original Mono Recordings (2010).
Dylans im Wortsinne romantisches Leitbild ist immer eine der Anonymität angenäherte performing art gewesen, die von wandernden Sängern in einer mythisch verklärten Popularkultur ausgeübt wird (das kann das vorindustrielle Amerika des Westens oder der Südstaaten sein, das Schottland der Volksballaden, aber auch die Märchenbühne des Las-Vegas-Elvis) und in der die Grenzen zwischen Poesie und Musik ebenso verschwimmen wie die zwischen Originalität und Adaptation kollektiver Traditionsbestände, zwischen dem ›reinen‹ Kunstwerk und der einmaligen Aufführungssituation. »It all came out of traditional music«, hat er in seiner programmatischen Dankrede zur Auszeichnung als MusiCares Person of the Year bei den Grammys im Februar 2015 erklärt: »traditional folk music, traditional rock & roll and traditional big-band swing orchestra music. I learned lyrics and how to write them from listening to folk songs.« Ein wesentlicher Teil von Dylans Lebenswerk speist sich daraus, dass und wie er dieses archetypische Muster an unterschiedlichen Orten der Popularkultur wiederentdeckt und in veränderten Konstellationen inszeniert.
Soviel Dylan, der ebenso rastlos neugierige wie radikal unsystematische Leser, dabei zeitweise auch aus der europäischen Literatur und Musik übernommen hat, so beherrschend bleibt doch die Vergegenwärtigung spezifisch amerikanischer Mythen – und ihrer musikalischen Ausdrucksformen. Ohne die Bilder und Rollenmodelle der Frontiersmen und Lumberjacks, der Seefahrer und Hobos, der wandernden carnival und medicine shows, der Beatniks und Blues-Magier, ohne die Geschichten und Mythen des Bürgerkriegs und der Depression wäre sein Werk so wenig zu denken wie ohne jene Musiktraditionen, die Dylans eigenes Schreiben von Anfang an bestimmen und zu deren leidenschaftlichem Archivar er heute geworden ist. Es sind gleichermaßen die ›schwarzen‹ und die ›weißen‹, samt ihren Analogien, Überschneidungen und Mischformen, von den romantisierten Erinnerungen britischer Einwanderer an die minstrels des europäischen Mittelalters bis zur »blackface minstrelsy«, auf die »Love And Theft« anspielt, von Charley Patton bis zu Hank Williams, vom frühen Jazz bis zum Rock ’n’ Roll. »The folk and blues tunes«, erinnert sich Dylan in Chronicles an seine frühen Prägungen, »had already given me my proper concept of culture«. Das ist ein großes Wort, und es ist kaum übertrieben. Was immer Dylan im Laufe der Zeit an musikalischen und literarischen Einflüssen aufnimmt und verarbeitet, es wird integriert in dieses ursprüngliche »concept of culture«.
Weil die Musik dieser Songs Anfang und Ziel der Dylan’schen Kunst-Bewegungen ist, deshalb ist sein Werk zugleich so etwas wie ein Resümee der populären amerikanischen Musiktraditionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geworden, mit dem verzweigten Netz ihrer europäischen und afrikanischen, jüdischen und christlichen Wurzeln – und ein Laboratorium, in dem mit diesen unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksformen und neuen literarischen Ingredienzien einige der überraschendsten, kreativsten, wirkungsmächtigsten Experimente angestellt worden sind. Gospels und Worksongs, der frühe Jazz von Louis Armstrong und Jelly Roll Morton, Calypso und Polka, Fieldhollers, Honkytonk und Hillbilly, Talking Blues und Delta Blues, Rhythm and Blues, die Songs der Carter Family und die Tex-Mex-Musik von Los Lobos, Big Band Swing und Musicals, Bebop und Soul, Reggae und Ragtime: wer dem Poeten Dylan näherkommen will, muss auch diese Musik kennen.
Namentlich die religiöse Imprägnierung von Dylans Songwelt, die bei allen Glaubenswandlungen auffallend konstant bleibt, verdankt sich in erster Linie derjenigen des American Songbook selbst – den im engeren Sinne religiösen Traditionen von Gospel, Spiritual, Hymn Books, aber auch der Durchdringung der Country-Musik oder der Arbeiterlieder mit religiösen Bildern, Bibelzitaten und Moralbegriffen. Gleich nach diesen Song-Traditionen, aber erst dann, kommt die Bibel – deren Gestalten darum hier nicht selten in Kostümierungen des Western, des Delta Blues, der Folksongs erscheinen. (Das Gewerkschaftslied ›I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night‹ etwa wird bei Dylan zu ›I Dreamed I Saw Saint Augustine‹; beide beleuchten sich gegenseitig.) Wenn Dylan sich während seiner Konversionszeit (1979/80) intensiv dem Bibelstudium widmet, trifft er im Grunde auf lauter alte Bekannte.
Schon von Dylans Songs der frühen 1960er Jahre hat Mavis Staples gesagt, sie seien »inspirational music«. Auf dem zuerst 1969 (und 2014 erneut) veröffentlichten Cover-Album Dylans Gospel findet sich, das war die Pointe der Sammlung, kein einziger authentischer Gospel-Titel; die Brothers and Sisters haben vielmehr Songs wie ›The Times They Are A-Changing‹ und ›Cimes of Freedom‹ so als Gospels intoniert, dass ihre religiöse Herkunft unübersehbar hervortritt. Ein Mitglied dieses Ensembles war übrigens ebenjene Sängerin Clydie King, die zehn Jahre später, in der Bekehrungszeit, Dylans Partnerin wurde.
Auch Vorbilder aus der literarischen Bildungskultur rücken in Dylans Songwelt in größtmögliche Nähe zu den Rollenmustern dieser Traditionen, treten ein in die Reihe der »free spirits who took chances« (Interview, 1997): Rimbaud und Verlaine, der ins Exil gejagte Ovid, die poètes maudits des neunzehnten Jahrhunderts und die beat poets des zwanzigsten, Kerouac und Woody Guthrie (dessen Autobiographie Bound for Glory er als »the first On the Road« las), Ginsberg, Corso und Ferlinghetti, die Dylan bald als einen der Ihren betrachteten und die wie Ginsberg abwechselnd seine Lehrmeister und seine Lehrlinge waren, aber auch Tennyson und T. S. Eliot, Petrarca und der Dante der Vita nova, Byron und der Brecht der (wie Dylan schreibt) »Pirate Jenny« und in immer neuen Varianten Shakespeare, kostümiert als wandernder Minstrel, »with his pointed shoes and his bells«.
Die zentrale Figur dieser Mythenwelt ist der heilige Outlaw, der amoralische Moralist und Märtyrer (»there’s no success like failure«), der aufbegehrt gegen den universalen Verblendungszusammenhang von Macht, Korruption, Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit, ein Straßenkämpfer wider Willen, der seine Haut und seinen Frieden retten muss gegen eine gottlose »world of wolves and thieves«, wo »fools made a mock of sin« (›Trust Yourself‹, ›In the Summertime‹), ein Rebell in einer intriganten »political world [where] love don’t have any place« (›Political World‹), die korrumpiert ist von »propaganda / all is phoney« (›It’s All Right, Ma‹), von Gewalt (»this world is ruled by violence«, predigt er in ›Sundown On the Union‹) und zielloser Grausamkeit (Tempest), von der »politics of sin« (so in ›Dead Man, Dead Man‹), von der Sünde schlechthin.
Dieser zumeist unfromme Heilige verkörpert sich in unterschiedlichen Gestalten. Er kann als Rovin’ Gambler, drifter oder Hobo auftreten wie in den klassischen Folk-Balladen, als wandernder Sänger oder Beatnik on the road, als Westernheld wie Billy the Kid und John Wesley Hardin(g), als »joker« oder »thief«. Der von rassistischen Polizisten eingesperrte schwarze Boxer, der trotzdem eines Tages »champion of the world« sein wird, gehört in diese Reihe (›Hurricane‹) ebenso wie der erschossene Gangster, der einmal »king of the streets« war (›Joey‹); der an Trunksucht gestorbene Entertainer »Lenny Bruce«, der »sure was funny and sure told the truth« nicht anders als der namenlose Soldat, der im Bürgerkrieg fällt, »loyal to truth and to right« (›’Cross the Green Mountain‹), der hungernde Arbeiter (›Working Man’s Blues # 2‹) oder der Prophet, der den Sündern Buße predigt (›I Dreamed I Saw Saint Augustine‹). Bezeichnenderweise trägt selbst der Kirchenvater in Dylans Vision außer dem »coat of solid gold«, der zum Heiligenbild gehört, noch »a blanket underneath his arm«, ein heimatloser Hobo auch er. »To live outside the law you must be honest«, lautet eine von Dylans vielzitierten Devisen. Und »the law« bedeutet hier, wie fast immer in dieser Songwelt, sowohl das vom Sheriff repräsentierte Gesetz, gegen das der Outlaw das wirkliche Recht und die wahre Moral (und sich selbst) behauptet, als auch die jüdische Thora, hinter deren strenger Schönheit (»justice’s beautiful face«, so in ›I and I‹) die ›Saving Grace‹ des Neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen aufscheint. Die Parabel ›Drifter’s Escape‹ (auf dem Album John Wesley Harding) führt vor, wie das eine ins andere umschlägt, wie das himmlische Gericht das irdische entmachtet und so, in der Dialektik von Gericht und Gnade, den archetypischen »Drifter« in die Freiheit entkommen lässt.
So verwundert es nicht, dass auch Jesus Christus Dylans amerikanische Mythenwelt zunächst als ultimative Verkörperung dieses wandernden und im Scheitern siegreichen Outlaw betritt. Schon bei Woody Guthrie konnte der frühe Dylan diesem Bild begegnen (›Jesus Christ was a man who traveled through the land / A hard-working man and brave‹), und noch 1986, also Jahre nach seiner Konversion, wird er Jesus in Konzerten als »my hero« einführen. Spätestens seit ›Sign on the Cross‹ (Basement Tapes, 1967) gerät das bis dahin vergleichsweise unscharfe, den Song-Vorbildern entlehnte Bild Jesu in das Spannungsverhältnis jüdischer und christlicher Überlieferungen, in dem sich Dylans Religiosität zunehmend bewegt. In der Phase der Konversion 1979 bis 1981 – die sich bezeichnenderweise nicht in einer der großen Kirchengemeinschaften ereignet, sondern in der kalifornischen Vineyard Fellowship – erscheint Christus nicht nur als gekreuzigter Erlöser, sondern auch als der von den Juden verkannte König (›In the Garden‹). Entsprechend treten dann, in der Rücknahme des missionarischen Furors (nicht aber des Glaubensbekenntnisses) mit Infidels1983, »the book of Leviticus and Deuteronomy« wieder in den Vordergrund.
Bis ins Spätwerk hinein bleibt Dylans jüdisch-christliche Religiosität ein dominanter, wenn auch weniger plakativ hervortretender Grundzug seiner Kunst, bleibt als Sehnsuchtshorizont sichtbar (Oh Mercy) noch in seinem Rückzug auf den pessimistischen Sarkasmus der ›Things Have Changed‹-Periode um 2000 – in deren Livekonzerten er hingebungsvoll sein komplettes Gospel-Inventar rekapituliert. Noch immer, »like so many times before«, klopft das Ich dieser Songs an die Himmelstür (›Trying to Get to Heaven Before They Close the Door‹, 1997) und blickt »upward, beyond« (›’Cross the Green Mountain‹, 2003), wo »I’ll stand beside my king« (›Thunder on the Mountain‹, 2006); noch immer spricht Dylan von Christus selbstverständlich als von »our Lord« (Rolling Stone-Interview, 2012) und bekennt: »But there is no understanding / For the judgment of God’s hand« (›Tempest‹). Und das gilt nicht nur für die offenkundig religiösen Songs. Auch die politischen Lieder von ›When the Ship Comes In‹ bis zu ›Political World‹ sind nicht zu verstehen ohne die jüdisch-christliche Fundierung, ohne Sündenbewusstsein und Hoffnung auf Gnade, ohne apokalyptische Gerichts- und Erlösungsgewissheit, ohne die Ambivalenz von Geschichtstheologie und der Erfahrung einer Time Out of Mind, ohne prophetische Verkündigung und Gebet. Erst recht lassen sich in Dylans Liebesliedern an diverse precious angels und covenant women himmlische und irdische Liebe, sexuelle und mystische Vereinigung, religiös überhöhte Geliebte und ein in erotischen Metaphern umkreistes Gottesbild oft nur schwer voneinander unterscheiden. Aus den Tiefen des kulturellen Archivs kommt dieses Ineinander von erotischer und religiöser Liebe herauf, von Mystik und Minne (auf deren Vorbilder in der italienischen Poesie Dylan in ›Tangled Up in Blue‹ ausdrücklich hinweist: »an Italian poet from the thirteenth century«), und sie reicht bis in seine sensible Anverwandlung von Frank Sinatras Songs 2015. In den ersten Anfängen und dann wieder seit den daran neu anknüpfenden 1990er Jahren rückt schließlich die musikalische Tradition selbst in eine eigenartig religiöse Beleuchtung: »I find the religiosity and philosophy in the music«, hat Dylan 1997 in einem Interview gesagt. »The songs are my lexicon and my prayer book. I believe the songs.« –
Ein Überblick über Dylans Werkgeschichte muss der biographischen Falle ausweichen. Die Verwechslung von Person und Werk ist gerade hier so verführerisch wie riskant – als ließe sich die Aura dieser Kunstwerke dadurch erklären, dass man ihre manchmal allerdings mysteriösen und bizarren Entstehungsumstände offenlegt. Die Turbulenzen seiner Ehen und Scheidungen, seiner physischen und psychischen Krisen, seines zeitweiligen Drogen- und Alkoholgebrauchs (den zu überstehen allein schon eine erstaunliche Vitalität voraussetzt), der persönlichen Beziehungen zu Freunden, Konkurrenten, zu den Folkies und den Beat Poets, den Bands von den Hawks bis zu den wechselnden Besetzungen der »Never Ending Tour«, das Phänomen seiner charismatischen Autorität über Menschen, die ihm nahekommen: diese Geschichte ist seit Anthony Scadutos Bob Dylan. An Intimate Biography (1971) in einer Reihe von Biographien sehr unterschiedlicher Qualität rekonstruiert worden, am umfangreichsten und informiertesten, manchmal mit der Schärfe des bösen Blicks, in Clinton Heylins Behind the Shades (Neuausgaben 2003 und, als »20th Anniversary Edition«, 2011). Heylins Spurensuche liest sich aber gerade deshalb so überzeugend, weil sie Dylans Übernahmen poetischer und musikalischer Traditionen immer mit einschließt, ebenso wie seine eigenen, oft wagemutigen Experimente mit Autobiographie und Fiktion.
Wichtiger für das Verständnis von Dylans Songwriting ist Heylins detailreiche, ebenso meinungsfreudige wie kenntnisreiche Entstehungsgeschichte aller bekannten, auch der unveröffentlicht gebliebenen Songs in seinen beiden Bänden The Songs of Bob Dylan (Bd. 1: Revolution in the Air, 1957–73, Bd. 2: Still on the Road, 1974–2008). Diesen mehr als 1200 Seiten tritt ergänzend Derek Barkers fünfhundertseitiges Handbuch aller bekannten Coverversionen zur Seite, die Dylan je aufgenommen oder in Konzerten gesungen hat, The Songs He Didn’t Write: Bob Dylan Under the Influence – eine umso hilfreichere Ergänzung, als die Übergänge von Zitat, transformierender Aneignung und eigenen Schöpfungen bei Dylan ja notorisch fließend sind (und er folgerichtig schon den landläufigen Ausdruck »Cover« als für ihn unangemessen zurückgewiesen hat; es gehe ihm, hat er anlässlich seines Sinatra-Albums 2015 mit einem schönen Wortspiel erklärt, eher darum, »to uncover these songs«). Mit seiner produktiven Rezeption der literarischen und der Songtraditionen befassen sich Michael Grays umfangreiche und gelehrte Studie Song and Dance Man und seine Dylan Encyclopedia. Paul Williams schließlich erzählt in Performing Artist Dylans Geschichte überhaupt nur noch als diejenige seiner veröffentlichten und unveröffentlichten Aufnahmen, seiner Konzerte und Tourneen.
Unsere werkgeschichtliche Skizze orientiert sich an den in Speichermedien manifesten Werken, also vorwiegend an offiziellen Alben, Songs, Filmen und Büchern, fallweise auch an deren durch Bootlegs zugänglichen Varianten und Vorarbeiten. Das ist angesichts der Verflüssigung und Dynamisierung des Werkbegriffs in dieser performativen Kunst nicht mehr als eine pragmatische Reduktion. Entlastung schaffen allerdings die mit Recht gerühmten Editionen der bis jetzt zwölf Folgen umfassenden offiziellen Bootleg Series, die nach der Vorläufer-Anthologie Biograph (1985) seit 1991 einige der wichtigsten bislang unveröffentlichten Materialien in exzellenter Tonqualität zugänglich gemacht haben, darunter Beispiele der wichtigsten Konzertauftritte und -tourneen (fortan abgekürzt als BS). Gerecht werden kann ein Essay wie dieser dem Reichtum und der Vielgestaltigkeit dieses Werks ohnehin nur, insofern er zum eigenen Hören, Lesen, Sehen und Vergleichen anstiftet.
»The times they are a-changing«:
Dylan konzertiert im Weißen Haus, 2011
Ein Song für Woody
(1955–1964)
Der Anfang ist elektrisch. In der Schulzeit im provinziellen Hibbing musiziert Bob Zimmerman seit 1955 mit diversen Highschool-Bands, die The Golden Chords, The Shadow Blasters oder The Satin Tones heißen und möglichst lauten Rock ’n’ Roll veranstalten, nach dem Vorbild der Rock-’n’-Roll-Pioniere Gene Vincent, Chuck Berry, Fats Domino, Link Wray, BuddyHolly, früh schon auch nach dem Vorbild Elvis Presleys und all der Ekstatiker und Provokateure, in denen der Kleinbürgersohn Zimmerman seine eigenen Rebellionsträume verwirklicht sieht, wie etwa Jerry Lee Lewis und Little Richard (dem Bob Zimmerman seinen frühesten bekannten Song widmete). Im Jahrbuch seines Abiturjahrgangs ist als Berufswunsch vermerkt: »To join Little Richard«. Unter dem Namen »Elston Gunn« springt er nach der Oberschule für einige Konzerte als Pianist bei Bobby Vee ein, einem in Fargo konzertierenden Rock’n’Roller aus der zweiten Reihe, der gerade mit »Suzie Baby« einen regionalen Radio-Hit gehabt hat. Und er wäre nicht Bobby Zimmerman, gäbe er sich nicht umgehend selbst als »Bobby Vee« aus: man kenne ihn ja vermutlich aus dem Radio. Daneben aber gibt es schon in dieser Anfangszeit another side of Zimmerman: einen beinahe schüchtern sanften Tenor, rührend zu hören auf der in Minneapolis entstandenen frühesten Aufnahme, die ein Freund 1959 gemacht hat und die nun auf BS 7 zu hören ist. Er lauscht den alten und neuen Heiligen der Country Music: Jimmie Rodgers, dem er später ein Tribut-Album widmen wird, und Hank Williams; den Heroen des Blues von Robert Johnson und Charley Patton bis zu Blind Willie McTell und Big Joe Turner; den weißen und schwarzen Wegbereitern des Folk-Revival: Woody Guthrie, Leadbelly, Odetta. Und er liest, wahllos und gierig, was ihm in die Finger kommt, von Darstellungen des Bürgerkriegs bis zur englischen und französischen Poesie, von Niccolò Machiavelli bis zu Herman Melville.
Die Leidenschaft für das Folk-Revival aber wird erst 1959 mit dem Beginn des (bald wieder aufgegebenen) Studiums in Minneapolis beherrschend. Eine der Initiationsszenen, an die Dylan sich in Chronicles erinnert, ist der Tausch seiner elektrischen Rock- gegen eine akustische Folkgitarre. Jetzt erst mutiert der Rock’n’Roller zum Folksänger, der in Bars oder mit einer ziemlich virtuos beherrschten Blues-Harmonika als Begleitmusiker mit Big Joe Williams und John Lee Hooker, der Blues-Sängerin Victoria Spivey, aber auch dem jungen Harry Belafonte auftritt. Der Anachronismus ist charakteristisch: Woody Guthrie kommt für ihn nach Little Richard, Big Bill Broonzy nach Gene Vincent und der legendären Country- und Folk-Instanz The Carter Family. Von Sammlern und Aktivisten des Folk-Revival wie Jack Elliott, Paul Clayton, Richard und Mimi Fariña stiehlt er musikalische Ideen und alle Schallplatten, deren er habhaft werden kann; es sind seine ersten Diebstähle aus Liebe. Als er 1961 nach New York City kommt, um den Segen des bereits schwerkranken Woody Guthrie zu empfangen, trifft Dylans Mischung aus kindlich-chaplineskem Witz, satirischer Schärfe und abgeklärter Hobo-Attitüde die um diese Zeit zu neuem Leben erwachte und enorm empfängliche Szene der Folkies und der Beatniks wie rollender Donner. In der Boheme von Greenwich Village gilt er als hochbegabt und exzentrisch, von kindlicher Neugier, scharfer Intelligenz und gierig-schneller Auffassungsgabe, getragen von einem an Hochmut grenzenden Selbstvertrauen. Der namenlose Junge aus dem »north country fair« vagabundiert durch die Metropole wie ein urbaner Huckleberry Finn, halb Unschuldslamm, halb Picaro, ohne festen Wohnsitz und mit stabilem Selbstvertrauen. Er spielt Mundharmonika und singt die Songs der amerikanischen Traditionen, Folksongs, Country-Balladen, Bluesnummern, die irgendwie schon immer seine Atemluft waren. Als wanderndes Song-Lexikon, als lebendes Archiv einer romantischen Popularkultur gewinnt er lokalen Ruhm. Gelegentlich ertönen aus dieses Knaben Wunderhorn auch eigene Songs, frei improvisiert aus den Traditionsbeständen, »Love And Theft«. Und irgendwann findet sich der Hobo dann auch im Aufnahmestudio wieder.
Im September 1961 hört ihn John Hammond von Columbia Records bei einem privaten Treffen zufällig als Begleitmusiker der Folksängerin Carolyn Hester und lädt ihn überraschend zum Vorspielen ins Studio ein. Der jugendliche Tenor ist nun einer ganz anderen Stimme gewichen, die Dylan aus den unablässig abgehörten Plattenaufnahmen seiner schwarzen und weißen Vorbilder, aus Harry Smiths umfangreicher Anthology of American Folk Music und aus eigenen Konzerterfahrungen erlernt hat: der artifiziell heiseren, rauhen, aus der Tiefe großer Folk-, Country- und Bluestraditionen heraufklingenden Altmännerstimme eines kaum Zwanzigjährigen, deren exzentrische Phrasierungen durch alle folgenden Identitäts- und Stimmenwechsel hindurch sein akustischer Fingerabdruck bleiben werden. Im selben Monat beginnen Dylans nachmals legendäre Auftritte in den wichtigsten Musiklokalen von Greenwich Village, darunter dem »Café Wha?«, dem »Bitter End« und schließlich sogar dem renommierten »Gerde’s Folk City«, wo er zwei Wochen lang allabendlich im Anschluss an Liam Clancy und seine Greenbriar Brothers Coverversionen bekannter und entlegener Folksongs, gelegentlich auch eigene Kompositionen singt und spielt und nebenbei ein unerwartetes Talent als Entertainer an den Tag legt. Binnen kurzer Zeit sind seine Auftritte eine Sensation in der Szene; Robert Sheltons Rezension in der New York Times vom 29. September 1961

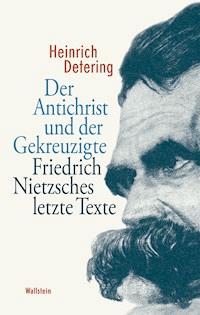

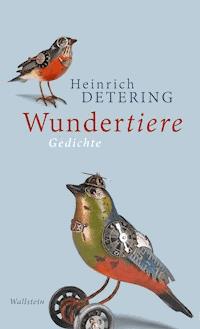



![Was heißt hier »wir«?. Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten. [Was bedeutet das alles?] - Heinrich Detering - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e18bb53ee47e2f9159a0bb0d1361479a/w200_u90.jpg)





















