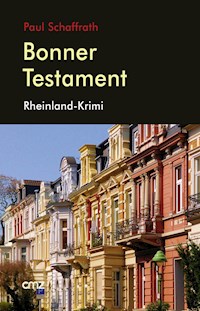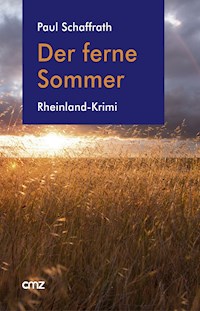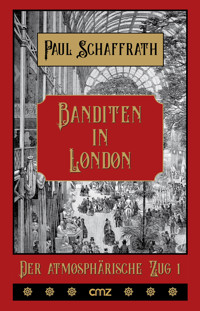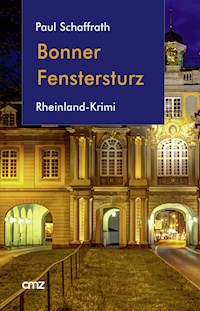
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krüger
- Sprache: Deutsch
Zwei Professoren sind tot – der eine in der Universität Bonn, der andere am St John's College in Oxford. Handelt es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter? Die Ermittler, Kriminalhauptkommissar Krüger in Bonn und Detective Chief Inspector John Blackmore in Oxford, sind ratlos. Ist die Lösung in einem Jahrzehnte zurückliegenden, bislang unaufgeklärten Mordfall am Rhein zu finden? Spannungsreiche Ermittlungen, farbige Charaktere, Wortwitz – ein gelungenes Krimidebut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoreninfo
Winrich C.-W. Clasen, Jahrgang 1955, schreibt unter dem Pseudonym Paul Schaffrath seit 2011 Kriminalromane. Seit einem Studium der Romanistik, Evangelischen Theologie und Kunstgeschichte in Bonn ist er als Verleger in Rheinbach tätig. An Bonner Fenstersturz, seinem ersten Roman, hat er drei Jahre gearbeitet.
Haupttitel
Paul Schaffrath
Bonner Fenstersturz
Rheinland-Krimi
Zweite verbesserte Auflage
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015–2016 by CMZ-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-9126-26, Fax 02226-9126-27, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagfoto (Koblenzer Tor, Bonn):Klaus-Oliver Welsow, Paderborn
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:rübiarts, Reiskirchen
ISBN Paperback 978-3-87062-161-2ISBN epub 978-3-87062-261-9ISBN mobi 978-3-87062-262-6
20160901
www.cmz.de
Motto
An’ I told you, as you clawed out my eyesThat I never really meant to do you any harm
Bob Dylan
Inhalt
Freitag, 21. Mai 2010 – Bonn
Freitag, 14. Mai 2010 – Oxford
Freitag, 21. Mai 2010, und Pfingstsamstag, 22. Mai 2010 – Bonn
Freitag, 14. Mai 2010 – Oxford
Pfingstsamstag, 22. Mai 2010 – Bonn
Freitag, 14. Mai 2010, und Samstag, 15. Mai 2010 – Oxford
Pfingstsamstag, 22. Mai 2010 – Bonn
Samstag, 15. Mai 2010 – Oxford
Pfingstsonntag, 23. Mai 2010 – Bonn
Samstag, 15. Mai 2010 – Oxford
Pfingstmontag, 24. Mai 2010 – Oxford
Montag, 17. Mai 2010 – Oxford
Pfingstdienstag, 25. Mai 2010 – Bonn
Montag, 17. Mai 2010 – Oxford
Pfingstdienstag, 25. Mai 2010 – Bonn
Donnerstag, 20. Mai 2010 – Oxford
Dienstag, 25. Mai 2010, und Mittwoch, 26. Mai 2010 – Bonn
Dienstag, 25. Mai 2010 – Oxford
Mittwoch, 26. Mai 2010 – Bonn
Dienstag, 25. Mai 2010, und Mittwoch, 26. Mai 2010 – Oxford
Mittwoch, 26. Mai 2010 – Bonn und Oxford
Donnerstag, 27. Mai 2010, vormittags – Oxford
Donnerstag, 27. Mai 2010, vormittags – Bonn
Donnerstag, 27. Mai 2010, nachmittags – Oxford
Donnerstag, 27. Mai 2010, nachmittags – Bonn
Donnerstag, 27. Mai 2010, abends – Oxford
Donnerstag, 27. Mai 2010, abends – Bonn
Freitag, 28. Mai 2010 – Bonn
Danksagung
1
Freitag, 21. Mai 2010 – Bonn
»Sie haben also wirklich nichts gehört?«
Wolfgang Schmidtbauer schwieg.
»Keinen Schrei, gar nichts?«
Immer noch keine Reaktion.
»Aber Sie müssen doch gemerkt haben, was draußen im Hof vor der Schloßkirche passierte.«
Schmidtbauer fingerte ein Päckchen Tabak aus seinem Jackett.
»Um neunzehn Uhr ist es doch draußen nicht mehr so laut. Und gestern hat es nicht geregnet; es war windstill – da hört man doch bei geöffnetem Fenster etwas.«
Schmidtbauers Finger waren dabei, eine Zigarette zu drehen.
»Wir können uns auch in meinem Büro weiter unterhalten«, sagte Krüger.
Das rief endlich eine Reaktion hervor.
»Ich konnte gar nichts hören, weil ich Musik gehört habe«, sagte Schmidtbauer.
»Im Dekanat? Gibt’s da eine Stereoanlage?«
»Nein, mit meinem alten Walkman und Kopfhörern.«
»Und Sie wollen nicht einmal die Studentin bemerkt haben, die lautstark schrie, als Professor Minski aus dem Fenster im zweiten Stock fiel?«
»Nein.« Schmidtbauer hatte inzwischen die Zigarette angezündet und inhalierte tief.
»Kein Rauchverbot?« fragte Krüger.
»Ich bin der Dekan!« sagte Schmidtbauer, der Krüger nach wie vor keines Blickes würdigte. Statt dessen stellte er einen Bilderrahmen auf seinem Schreibtisch wieder auf, der umgekippt war. Der Silberrahmen stand mit dem Rücken zu Krüger, der sich kurz über die Aufstellmechanik wunderte, ein einfaches Stück Pappe.
»Sie können also nichts zur Aufklärung des Geschehens beitragen?« Krüger stolperte innerlich über seinen Satz aus dem Lehrbuch.
»Nein.«
Krüger seufzte und stand auf. »Danke für Ihre Zeit«, sagte er und verließ das Dienstzimmer des Dekans der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn.
Krüger passierte die drei Flurtüren auf seinem Weg zum Innenhof der Universität, den er durch die »Blaue Grotte« wieder verließ. In diesem blau gestrichenen Raum – dem Durchgang zur Schloßkirche und weiter zur Innenstadt – hingen die Nachrichten aller Fakultäten in Schaukästen; Flyer jeglicher Art lagen in der Regel nicht mehr in den dafür vorgesehenen Halterungen, sondern auf dem Fußboden.Krüger bückte sich kurz, um einen Flyer mit der reißerischen Überschrift »Mord in Hörsaal V« aufzulesen, warf ihn aber wieder weg, da es sich um eine Aufführung eines Laientheaters handelte. Mit Laien hatte er so seine Schwierigkeiten; meistens wußten sie mehr als die Fachleute.
Draußen nickte er kurz den weißgekleideten Leuten von der Spurensicherung zu, die den Fundort der Leiche auf dem Schloßkirchenparkplatz rechts neben dem Eingang zur »Blauen Grotte« untersuchten. Glücklicherweise standen am Freitagabend keine Fahrräder vor den Fenstern im Erdgeschoß, so daß Minski direkt auf das Pflaster gestürzt war.
Die Spurensicherung war bereits in einem Plastikzelt beschäftigt, das vor neugierigen Blicken schützte und weitere Verunreinigungen und Spuren vom Fundort der Leiche fernhielt. Ein einsames Blaulicht flackerte nur noch; wahrscheinlich war demnächst die Autobatterie leer, dachte Krüger.
Die zahlreichen Schaulustigen hatten sich wieder verlaufen; nur zwei unentwegte Gaffer hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch etwas Sensationelles auf ihre Mobiltelefone speichern zu können.
Krüger kletterte über das Plastikabsperrband und überquerte die Straße vor der Universität in Richtung Marktplatz. Er ging schnurstracks zum neben dem Stern-Hotel liegenden Bistro Miebach, das erst in einer Stunde schließen würde, und steuerte seinen Stammplatz im hinteren Teil des Lokals an. Ungeachtet der fortgeschrittenen Uhrzeit bestellte er bei dem dienstältesten Kellner, den er seit langen Jahren kannte, wie üblich einen Cappuccino mit einem Glas Wasser und klappte dann sein kleines Moleskine-Tagebuch auf, das er sich zu Weihnachten gekauft hatte. Krüger schlug eine neue Seite auf und setzte mit seinem wie immer in der Brusttasche seines Hemdes steckenden Füller (eine Marotte, die er trotz der Gefahr von Tintenflecken von einem befreundeten Anwalt übernommen hatte) die Überschrift hin: 21. Mai 2010 – Professor Dr. Maximilian Minski †. Er rührte den Inhalt von drei länglichen Zuckertüten in den Kaffee und überlegte, was er bisher zu diesem ersten Mordfall im neuen Jahr erfahren hatte.
Minski war Jahrgang 1955, Professor für Sozialethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät, hatte sein Dienstzimmer im zweiten Stock des Ostflügels der Universität und war ein unauffälliger Wissenschaftler, bei seinen Studenten weder beliebt noch verhaßt. Er war nicht verheiratet, hatte wenig veröffentlicht und war nie sonderlich aufgefallen.
Krüger seufzte.
Ein Frauenschwarm war Minski wohl auch nicht gewesen; jedenfalls hatte er weder Bilder mit hübschen Studentinnen noch überhaupt irgendwelche Familienbilder bei seinem Besuch im Dienstzimmer des Professors gesehen. Nur ein verstaubtes Porträt einer längst vergessenen Theologengröße hing an einer Wand.
Die schnelle Erstdurchsicht der E-Mails im Professorenrechner war ohne Ergebnis geblieben – nur die üblichen Kollegenschreiben, ein paar Bestätigungen von Bestellungen bei Amazon und die Mahnung eines Zweitgutachters, ihm doch endlich sein Dissertationsgutachten zukommen zu lassen.
Krüger fuhr sich durch sein volles Haar, auf das er stolz war und das ihn erst seit einigen Wochen im Stich zu lassen schien, indem es an den Schläfen zehn Prozent Grau entwickelte und oben in der Mitte etwas schütterer wurde. Vielleicht lag es aber auch an seinen stets zu trockenen Fingern, deren Gefühl nicht mehr dem früherer Tage entsprach. Zuviel Papierarbeit.
Als weiteren Punkt notierte er: »Tod durch Gewalteinwirkung.« Komisch, daß ihm das für seine Liste erst jetzt einfiel. Wie immer interessierte ihn das eventuelle Motiv bei einem ungeklärten Todesfall mehr als die Art des Todes. Daß Professor Minskis Tod kein natürlicher war, war offensichtlich: In seinem Dienstzimmer war die einzige Blume, eine kleine Zimmerpalme, von der Fensterbank gefallen und enttopft worden; der Fußboden, immerhin Parkett, wies Schleifspuren durch die verstreute Blumenerde auf – als ob zwei Leute miteinander gerungen hätten.
Krüger gähnte. Immerhin hatte sein Dienst als Hauptkommissar um acht Uhr morgens begonnen, und jetzt war es schon nach zehn am Abend. Er riß sich zusammen und begann in seiner kleinen Schrift eine Liste zu erstellen, deren Punkte er morgen abarbeiten wollte. Er schaute noch einmal auf seine Uhr und entschied sich, doch seinem Gewissen zu folgen und zu versuchen, heute abend noch mindestens eine Zeugenbefragung durchzuführen. Er sah auf den Computerausdruck, den ihm Markus Schneider, ein Mitglied des hastig zusammengestellten Ermittlungsteams, zugesteckt hatte. Die Dekanatssekretärin hatte trotz des Schocks über den gewaltsamen Tod von Professor Minski in ihrer planmäßigen Weise eine Liste aller in der Fakultät arbeitenden Professoren, Angestellten, wissenschaftlichen Mitarbeiter und studentischen Hilfskräfte erstellt, sortiert nach Lehrstühlen.
Neben Minski standen drei Namen, Tobias Frölig, cand. theol., Carmen Rasche, Sekretärin, und Dr. Nicole Metzig, Privatdozentin am Lehrstuhl. Dahinter waren die Adressen vermerkt. Krüger bezweifelte, daß seine eigene Dienststelle ähnlich effektiv arbeitete wie die Dekanatssekretärin.
Krüger zahlte und holte sein Auto, das er vor der Schloßkirche geparkt hatte.
Schloßstraße 124, so lautete die Anschrift der studentischen Hilfskraft. Eine gute Adresse in der Bonner Südstadt, lag die Straße doch in der Nähe der von großen Kastanien beschatteten Poppelsdorfer Allee, die seit Jahrhunderten das gleichnamige Schloß mit der Universität verband. Krüger stellte sein Auto auf einem Anwohnerparkplatz ab, legte seine Parkerlaubnis (»Polizei im Einsatz«) hinter die Windschutzscheibe und stieg aus.
Das Haus aus der Gründerzeit war anscheinend in den siebziger Jahren zuletzt renoviert worden. Die mattgelb gestrichene Fassade wies an mehreren Stellen Risse auf; der Putz blätterte ab. In dem kleinen ungepflegten Vorgarten standen zwei wahrscheinlich ebenfalls seit den siebziger Jahren nicht mehr geputzte Fahrräder, ein Kinderwagen neueren Datums und die für Bonn inzwischen üblichen drei Mülltonnen, zu denen sich demnächst eine vierte für Plastik und Elektrokleinteile gesellen sollte. Krüger fragte sich, wo Reihenhausbewohner ihre vier Mülltonnen hinstellen sollten. Unter den Fenstern des Hauses waren Wappenreliefs zu sehen. Wie üblich bei solchen vom Eigentümer nicht gepflegten Häusern war die Eingangstür alt. Immerhin schien sie seit dem Erstbezug gehalten zu haben. Krüger ging die sieben Stufen zur Haustür hoch.
Die Klingelschilder boten das übliche Sammelsurium auf: ein paar sauber ausgedruckte Namen wie Barbara + Boris Schmidt, einige handschriftliche Namen wie Özdemir und Tukan, dann allen Ernstes ein kleines Keramikschild mit der kryptischen Inschrift »Hier wohnen Anna-Lena, Fynn, Ulrike und Thomas Hauser mit Fassmann« und der erhoffte Name, der auf einem mit Tesafilm befestigten kleinen Zettel stand: »Manu Brabert / Tobias Frölig«. Krüger fragte sich, wer hier die Hosen anhatte. Er klingelte.
Ungeachtet der Tageszeit rief jemand aus einem der oberen Fenster: »Tür ist offen!«
Krüger trat ein und überlegte, ob man der Tatsache, daß das Namensschild neben der untersten Klingel hing, entnehmen konnte, daß damit auch eine Wohnung im Erdgeschoß gemeint war. Oben waren die Wohnungen wohl preiswerter, zumal das Dach kaum isoliert sein dürfte. Er ging also die Treppe hinauf.
»Tür ist offen!« rief jemand noch einmal.
Krüger glaubte, zwei Stock höher eine weibliche Stimme zu hören.
»Wo bleibst du denn so lange!«
»Ich bin gleich oben«, rief Krüger. Er war dann doch etwas überrascht, als ein unrasierter Jüngling seinen Kopf durch die Tür steckte und freundlich sagte: »Oh, ich dachte, es sei Manu. Was möchten Sie denn?«
»Kriminalpolizei.« Krüger holte seine Dienstmarke heraus, die auch mal wieder poliert werden mußte. Messing lief immer so schnell an. »Mein Name ist Krüger. Wer sind Sie?«
»Tobias Frölig«, antwortete der junge Mann genauso freundlich wie eben, schwieg dann aber.
»Darf ich hereinkommen, oder sollen wir die Nachbarn gleich mit befragen?« Krüger grinste.
Frölig drehte sich um und ging voran.
Die Wohnung sah aus wie viele der Studentenwohnungen, die Krüger bisher gesehen hatte: vieles von IKEA, ein Langflorteppich, ein hinter einem Vorhang herausguckender Staubsauger, das alte Plakat von Che Guevara gegenüber dem runden Flurspiegel, eine aufgeräumte Küche, zumindest auf den ersten Blick, Blumen vor dem Wohnzimmerfenster, ein kleiner Eßtisch, eine Cordcouch mit niedrigem Glastisch davor, ein paar Bücherregale. In allem war eine weibliche Hand zu merken: ein paar künstliche, fast echt wirkende Rosen in einer Vase, Tageszeitungen ordentlich zusammengefaltet auf einem Stapel, eine Karaffe mit Wasser und zwei Gläsern auf dem Sofatisch.
»Ich habe gerade aufgeräumt«, sagte Tobias Frölig. »Manu mag es nicht, wenn man ihre Wohnung durcheinanderbringt.«
Soviel zu den Hosen, dachte Krüger.
»Setzen Sie sich doch bitte.«
Krüger nahm am Eßtisch Platz.
»Also, was gibt es?« fragte die studentische Hilfskraft.
Cool, der junge Mann, dachte Krüger. Er räusperte sich.
»Wann haben Sie Professor Minski zuletzt gesehen?«
Frölig sah überrascht aus. »Wieso, heute mittag während seiner Vorlesung. Und hinterher in seinem Dienstzimmer, als wir meine Aufgaben für die nächste Woche besprochen haben.«
»Sie wissen es also nicht?«
»Was?«
»Ihr Chef ist heute abend aus dem Fenster seines Dienstzimmers gestürzt.«
Tobias Fröligs Unterlippe zitterte, als wolle er gleich zu weinen beginnen.
»Ist er, ich meine, ist er …«
Krüger sah seinem Gegenüber direkt in die Augen. »Ich glaube nicht, daß man einen Sturz aus dem zweiten Stock der Universität überlebt.«
»Jaja, natürlich.« Frölig fuhr sich über die Augen. »Ich meine, was kann ich …« Er verstummte wieder und schien nachzudenken. Krüger unterbrach ihn nicht.
»Er war immer nett zu mir. Wissen Sie, wie es passiert ist?« fragte Frölig schließlich.
»Eigentlich stelle ich hier die Fragen.« Krüger versuchte, freundlich zu gucken. »Nein, wir haben keine begründete Vermutung. Und keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.« Bereiche der Wahrheit wegzulassen, war immer ganz günstig bei Befragungen. »Wissen Sie, ob er Neider hatte, Krach mit Kollegen, irgendetwas in der Art?«
Frölig schüttelte den Kopf.
»Nein, er ist, nein, war, muß ich jetzt ja leider sagen, einfach unauffällig, ein stiller, aber solider Wissenschaftler …«
»Hatte er Familie?«
»Er war mal vor vielen Jahren verheiratet, glaube ich, und seitdem …«
Frölig schien ein Talent für halbe Sätze zu haben.
»Freundinnen?«
Krüger konnte auch kurze Sätze.
»Weiß ich echt nicht. Ich habe ihn nie außerhalb der Uni getroffen.«
»Freunde?«
Und kürzere.
»Schwul, meinen Sie? Glaube ich nicht, nicht wie Professor Lauterberg aus der Germanistik, der noch zu Hause bei seiner Mutter wohnt.« Frölig grinste. Als er Krügers Blick auffing, blickte er zu Boden.
»Seit wann wohnen Sie denn hier?« Krüger konnte auch unfreundlich sein. Und er war müde.
Frölig wurde rot.
»Seit drei Wochen. Manu und ich kennen uns schon länger, aber sie wollte nicht so nahe sein. Erst als mein altes Zimmer plötzlich gekündigt wurde, mußte ich ja ein neues Dach über dem Kopf haben.« Er lächelte leise.
Du wirst noch manches Mal enttäuscht werden, dachte Krüger.
»Familie?«
Frölig guckte irritiert.
»Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, aber was hat das …«
»Entschuldigung – ich meinte Professor Minski.«
»Nur eine alte Tante in Berlin, soviel ich weiß, und eine Schwester, mit der er wohl keinen Kontakt hat, in England.«
Krüger stand auf.
»Sie haben mir sehr geholfen.«
Er drehte sich um. In der Tür stand eine junge Frau, langes, dunkelblondes Haar, eines dieser merkwürdigen Hängekleidchen in weißbunt, die jetzt Mode waren und nur bis knapp über den Po reichten, schwarze Strumpfhose, Ballerinas, schöne Figur, soweit man das sehen konnte. Sie schien schon länger zugehört zu haben.
»Wer sind Sie?« fragte die junge Frau.
»Das kann Ihnen Ihr Freund gleich erklären. Ich muß los.«
Krüger grüßte und schloß die Wohnungstür hinter sich. Er hörte nur noch mit halbem Ohr, wie Manu Brabert sagte: »Warum hast du ihm nichts von diesem komischen Typ erzählt, der vor zwei Wochen hier …«
* * *
Montag, 21. April. Es fühlt sich an, als ob ich schon ewig in Bonn bin. Dabei kenne ich die Stadt erst seit Oktober. Heute scheint endlich mal die Sonne, und man kann auf dem Marktplatz draußen sitzen, zumindest mit Jacke. Nur im Kleid wäre noch zu kalt. Die Leute sind vom »Bonner Kaffeehaus« hinübergewandert. Und ich sitze mittendrin, schreibe in mein neues Tagebuch, das ich für das Sommersemester gekauft habe, und freue mich, daß ich mein Leben schon seit Oktober alleine bestimmen kann. Im zweiten Semester Geschichte zu studieren, macht Spaß. Und Germanistik ist auch nicht so schlecht. Nur das Erziehungswissenschaftliche Begleitstudium ist blöd, die Pädagogik-Proseminare sind so was von langweilig, und Philosophie ist auch nicht ohne, obwohl mir das in der Schule immer Spaß gemacht hat. Aber ich habe gestern M. wiedergesehen!
2
Freitag, 14. Mai 2010 – Oxford
Die Sonne schien, und DCI John Blackmore freute sich auf seinen Feierabend. Seit einigen Wochen war er auf der Polizeiwache St Aldate’s in Oxford tätig, die nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt lag. Er genoß, hier zu arbeiten statt im Hauptquartier der Thames Valley Police in Kidlington zwischen Oxford und Woodstock. Man war irgendwie näher am Geschehen dran, fand er. Er blickte vom Schreibtisch auf, als es klopfte.
»Ein Todesfall«, sagte der diensthabende Constable. »Sir, geht Ihr Telefon immer noch nicht?«
Im Stillen war der Detective Chief Inspector dankbar für die Ruhe, aber laut sagte er: »Der Techniker war noch immer nicht da. Erzählen Sie.«
Der junge Mann räusperte sich.
»Zwei Mitarbeiter einer Gartenfirma, die die Anlagen im St John’s College pflegt, haben vor einer Viertelstunde im Rhododendrongebüsch im Innenhof des Hauptgebäudes eine Leiche gefunden. Wie es aussieht, ein Mitglied des Lehrkörpers, Sir. Sie haben dann die uniformierte Polizei gerufen, die alles abgesperrt hat und ihrerseits Verstärkung angefordert hat.«
Blackmore konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen – daß sie den Jungs und Mädchen auf der Polizeischule immer noch Lehrbuchtext beibrachten!
»Gut, ich fahre sofort los. Rufen Sie bitte DS Rosie Mannering; sie soll mitkommen.«
Blackmore schätzte die junge Kollegin, die vor zwei Jahren nach Oxford versetzt worden war, nachdem sie zum Detective Sergeant befördert worden war. Sie war pfiffig, schlagfertig und sah gut aus. Letzteres war ihm zur Zeit allerdings gleichgültig; seine jüngste Wunde war noch nicht allzu lange verheilt.
»Wir nehmen mein Auto«, sagte Blackmore hinter dem Gebäude der Polizeiwache zu seiner Kollegin. Sonst hatte er immer ein Auto der Fahrbereitschaft entliehen. Aber heute stand nur noch der tschechische Skoda draußen; die anderen Fahrzeuge waren wohl alle unterwegs.
Rosie Mannering hatte eine wundervolle Art, ihre linke Augenbraue hochzuziehen. Kannte sie sein Auto nicht oder hatte sie Vorurteile seiner Fahrweise gegenüber? Der DCI wunderte sich.
Er ging zum Mitarbeiterparkplatz hinter dem Gebäude, nahm den scheckkartengroßen und ebenso flachen Autoschlüssel aus der Hosentasche und drückte einmal darauf. Die Rücklichter eines etwas älteren dunkelblauen Mercedes der E-Klasse blitzten zweimal auf. Blackmore stieg ein und ließ den Motor an.
»Geerbt?«
Blackmore konnte ihr nicht ganz folgen.
»Das Auto, meine ich.« Rosie konnte ziemlich freundlich lächeln.
»Nein, das stammt noch aus meinem anderen Leben. Wir haben damals die uns jeweils wichtigen Dinge aufgeteilt«, sagte Blackmore in dem Bewußtsein, daß Rosie Mannering diesen Satz nur so verstehen konnte, daß er sein Herz an Autos und Technik, wie viele andere Männer auch, verloren hatte. Sie konnte nicht wissen, daß seine Ex-Frau das blaue Auto immer abscheulich gefunden hatte. Es war nicht britisch, es hatte ihrer Meinung nach die falsche Farbe, und es war teuer im Unterhalt. Außerdem war es ein Geschenk von Blackmores Mutter zu seiner Beförderung zum DCI. Aber das alles ging die junge Sergeantin nichts an.
Blackmore steuerte sein Auto aus der Floys Row auf die breite Straße, die vor der Polizeiwache verlief und gleichzeitig die A 420 stadtaus- und stadteinwärts war. Er schwieg während der Fahrt durch das Zentrum und hing seinen Gedanken nach.
Erst als sie St Giles passiert hatten, fragte Rosie: »Was soll ich machen?« Sie war wohl unsicher, zum ersten Mal neben einem der erfahrenen Detectives zu sitzen.
»Zuhören und lernen.« Blackmore versuchte, aus seinem linken Augenwinkel heraus eine Reaktion festzustellen.
Rosie war aber nicht auf den Mund gefallen. »Midsomer Murders habe ich zuhause bei meinen DVDs und schon zweimal gesehen. Aber ich bevorzuge doch das wirkliche Leben.«
»Fragen Sie nachher, was Sie möchten.« Blackmore versuchte, aufmunternd zu lächeln, und bog in die Einfahrt zum College ein. Dieses Mal war er vor der Spurensicherung da.
Der DCI war schon häufiger privat zu Gast gewesen im College. Die zweistöckige Fassade des Hauptgebäudes mit seinen unzähligen Erkern im Dachgeschoß und den zahllosen Kaminen nahm er längst nicht mehr wahr. Mittelalter und Neuzeit lagen so dicht beieinander in Oxford, daß einem erst nach längerer Abwesenheit aus der Universitätsstadt wieder bewußt wurde, in welcher besonderen Umgebung sein Arbeitsplatz lag, dachte er.
Der Hausmeister hatte den Fundort der Leiche notdürftig mit ein paar Wolldecken abgeschirmt und diskutierte aufgeregt mit einem der grün gekleideten Angestellten der Gartenfirma.
»Und wenn das hundertmal deine Schaufel ist – ich habe genügend TV-Serien gesehen: Hier wird nichts angefaßt, bis die Polizei kommt!«
Blackmore hielt seinen Ausweis hoch. »Laßt mich mal durch.« Er duckte sich unter den tiefgehängten Wolldecken weg und betrachtete den Toten aus der Entfernung, um nicht seinerseits Spuren zu verursachen: männlich, etwa fünfzig Jahre, dunkelgrüne Cordhose, brauner Strickpullover mit weißem Hemd darunter, nicht geputzte Schuhe. Ein Blick genügte ihm, um zu wissen, wie es passiert war. Allerdings war das auch nicht schwer. Der Tote lag auf dem Bauch, das Gesicht halb zur Seite gewandt, neben und auf ihm die Scherben einiger Blumentöpfe. Im zweiten Stock stand ein Fenster offen; eine Gardine hing halb heraus und wehte im Wind.
»Wissen Sie, was das für ein Zimmer ist?« fragte er den Hausmeister.
»Jenkins, Sir. Ich arbeite seit über zwanzig Jahren hier. So etwas ist hier noch nie passiert. Und so ein netter Herr.«
»Das Zimmer«, erinnerte ihn Blackmore.
»Ach so, ja, gehört zur Theologischen Fakultät.«
»Und der Tote?«
»Ist Deutscher. War auch nicht zu überhören, Sir.«
»Wissen Sie, wie er hieß?« fragte Rosie.
Jenkins guckte irritiert, weil die Frage jetzt von der anderen Seite kam.
»Schubert oder war es Schumann? Ich kann diese deutschen Komponisten nie auseinanderhalten.«
Ein musikalischer Hausmeister? Blackmore wunderte sich, aber auch über seine Vorurteile. »Ich dachte, er wäre bei der Theologie gewesen.«
»War er auch. Arbeitet seit fast zwanzig Jahren da«, sagte Jenkins. »Sir«, setzte er noch hinzu.
Mit quietschenden Bremsen bog der Wagen der Spurensicherung in die Einfahrt, bemerkte gerade noch rechtzeitig Blackmores Mercedes und kam knapp dahinter zum Stehen. Zwei Männer mittleren Alters sprangen heraus und rannten in den Innenhof.
Blackmore hatte das Bremsmanöver gehört und seufzte. Ausgerechnet Whitefriar und Nun, insgeheim auf der Wache The Monks genannt. Und Nun war auch noch schwul, was er bei jeder Gelegenheit betonte.
»Platz da. Weiträumig absperren«, herrschte Whitefriar den Hausmeister an.
Der blickte fragend zu Blackmore.
»Lassen Sie, ich mache das schon«, sagte Rosie Mannering und nahm Nun das Absperrband aus der Hand, der mit einer weiblichen Berührung wohl nicht viel anzufangen wußte und seine Hand unbewußt am Hosenbein abwischte. Rosie zog eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts.
Weitere Bremsmanöver folgten, die Blackmore mit einem Ohr verfolgte. Der Kleinbus brachte den Rest des Teams. Mit Schwung hörte er ein weiteres Fahrzeug in der Einfahrt ankommen, wahrscheinlich der alte Jaguar. Blackmore schmunzelte. Vor seinem inneren Auge sah er einen kleinen, fast kahlköpfigen Mann mit Kugelbauch aussteigen, einen schwarzen Koffer in der einen Hand, ein Tweedjackett in der anderen. Der Fahrer würde anschließend den Koffer abstellen, das Jackett anziehen und die Autotür umständlich abschließen.
Blackmore hatte ein Herz für Klischees – das hier war ein lebendes: das eines kurzatmigen Home Office Forensic Pathologist, der sein Fach bestens beherrschte und nun in den Innenhof kam. Blackmore kannte den Arzt schon so lange, daß er ihn als zu seiner Dienststelle gehörig betrachtete und nur als Polizeiarzt titulierte, was dem Pathologen immer etwas zu wenig war.
»Hallo, Dr Fortescue, wie geht’s?«
Fortescue ignorierte die Frage und wartete geduldig, bis die Spurensicherung mit den beiden Polizeikonstablern einen Zugangsweg zur Leiche angelegt hatten. Dann streifte er seine Schutzkleidung über. Blackmore und Rosie schlossen sich ihm an, inzwischen ebenfalls mit einem weißen Overall bekleidet.
»Seit wann ist er tot?« versuchte Rosie Mannering die Unterhaltung in Gang zu bringen.
»Grünschnabel«, brummte der Doktor und beugte sich über die Leiche. »Was ist passiert?« fragte er. »Und hat jemand den Coroner verständigt?«
Einer der Polizisten bejahte das.
Blackmore referierte kurz den Telefonanruf der Gartenfirma, die Fahrt hierher und seine Vermutung, der Tote sei aus dem zweiten Stock gestürzt.
»Worden«, sagte Fortescue.
»Wie bitte?« Blackmore kam nicht ganz mit.
»Er ist nicht freiwillig heruntergefallen«, sagte der Arzt. »Sehen Sie hier die Nagelspuren im Gesicht? Und hier an der Stirn das Hämatom?«
»Irgendjemand hat also nachgeholfen?« fragte Rosie.
»Scheint so. Ein Streit, ein Sturz, das Leben war nur kurz. Entschuldigung, das Letzte können Sie streichen.« Fortescue blickte auf. »Außerdem kenne ich ihn. Friedrich Schubert. Wir haben uns mal länger über Musik im Victorian Arms unterhalten. Was er allerdings beruflich genau gemacht hat, habe ich damals nicht verstanden.«
Blackmore seufzte. Ein absichtlicher Sturz bedeutete mindestens Totschlag, involvierte immer mindestens eine zweite Person und hatte mindestens ein arbeitsreiches Wochenende zur Folge. Er sah auf die Uhr. Wie üblich bei solchen Gelegenheiten war es Freitag kurz vor zwei, und er hatte für den frühen Abend Karten für eine Shakespeare-Aufführung, Open Air zu dieser Jahreszeit. Er sah Rosie an.
»Was machen wir zuerst?«
»Nun, Sir, ich würde vorschlagen, ich besorge eine Liste der Fakultätsmitarbeiter; Sie informieren die Familie.«
Blackmore nickte und überlegte, ob die Tatsache, daß das St John’s College eines der angesehensten Colleges der Universität Oxford war, die Aufklärung des Mordfalls verkomplizierte. Das öffentliche Aufsehen, daß der Mord verursachen würde, war sicher größer als bei einem Wald- und Wiesenmord in einer der großen Industriestädte des Nordens. Und die Universität von Oxford war weltberühmt, was die Pressewellen noch höher schlagen lassen würde.
»Wir telefonieren«, sagte der DCI noch und stieg in sein Auto ein. Nach kurzer Fahrt parkte er wieder hinter der Polizeiwache St Aldate’s und verschwand nachdenklich in seinem Zimmer. Er rief die Universitätsverwaltung an, die schon von dem tragischen Unglück gehört hatte, und ließ sich Näheres über den Toten berichten.
Friedrich Hugo Schubert war 1955 geboren, hatte in Bonn und Tübingen Geschichte, Philosophie und Evangelische Theologie studiert, war nach seinem Examen 1981 und seiner Promotion 1988 relativ schnell nach einigen Lehrstuhlvertretungen Professor geworden und lehrte nach zwei Jahren in Berlin seit 1992 in Oxford – wofür ein Deutscher ziemlich gut sein mußte, fand Blackmore. Schubert war unverheiratet und hatte seit fünf Jahren eine Kollegin als Freundin, wie die Dame von der Universitätsverwaltung etwas vorsichtig sagte. Margaret Dunwood war einige Jahre jünger als Schubert, lehrte ebenfalls Theologie und wohnte etwas außerhalb von Oxford in Woodstock. Soviel zur Familie, dachte Blackmore.
Ein weiteres Telefonat mit dem Sekretariat der Theologischen Fakultät, das erstaunlicherweise Freitagnachmittag noch besetzt war, ergab die gewünschte Adresse.
Blackmore setzte sich in sein Auto und fuhr los. Im Radio liefen die Vorberichte zum Wochenendspiel von Aldershot Town gegen Rotherham United aus der zweiten Fußball-Liga, weshalb er schnell auf seinen CD-Wechsler umschaltete, der seit Monaten mit den gleichen sechs CDs bestückt war, die er nicht oft genug hören konnte, darunter Dylans Blonde on Blonde, Springsteens The Ghost of Tom Joad und Johann Sebastian Bachs Kaffee-Kantate. Der Wechsler setzte die Wiedergabe bei dem Stück fort, das er vor der Umschaltung zum Radio gerade begonnen hatte, Dylans One Of Us Must Know, was Blackmore ziemlich passend fand.
Trotz des dichten Berufsverkehrs schaffte Blackmore es in vierzig Minuten bis nach Woodstock. Er durchfuhr das kleine Ortszentrum mit den wohl eher für Touristen interessanten Geschäften, die von ihrer unmittelbaren Nähe zu Blenheim Palace profitierten, ließ die alte Steinbrücke vor dem Black Prince mit den anschließenden kleinen Arbeiterhäusern den Hügel hinauf hinter sich und bog in dem moderneren Ortsteil nach rechts in eine kleine Seitenstraße. Er folgte ihr, bis er schließlich in einer Sackgasse vor einem der Backsteinhäuser hielt, in dem er selber auch gerne wohnen würde, obwohl er es wirklich nicht schlecht getroffen hatte.
Das Haus war eines in einer langen Reihe ähnlicher Doppelhäuser, etwa 1950, Ziegelstein, nicht der schöne Goldton des Cotswoldssteins, weiße Fensterrahmen, Rosen davor, eine kleine Sitzbank. Ziemlich viel Beatrix Potter, fand Blackmore. Irgendwie war hier wie auch andernorts im Vereinigten Königreich die Zeit stehen geblieben. Als im Nachbarhaus eine pakistanische Hausfrau den Müllsack herausbrachte, war er wieder beruhigt.
Blackmore stieg aus, öffnete die kleine Tür im weißen Holzzaun, die etwas schief in den Angeln hing, und klingelte. Eine kleine mittelalterliche Frau öffnete.
»Ja bitte?«
Blackmore hatte sich entschlossen, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Er sagte: »Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Entschuldigen Sie, ich habe vergessen, mich vorzustellen.« Er holte seinen Ausweis aus der Brusttasche seines Jacketts, wo er immer steckte. »DCI John Blackmore, Thames Valley Police. Ich wollte …«
Weiter kam er nicht.
»Ist etwas passiert? Ist etwas mit Friedrick?« Selbst fünf Jahre hatten anscheinend nicht gereicht, um den Namen ihres deutschen Freundes korrekt aussprechen zu können. Wobei das deutsche ch selbst ausgebildeten Sängern Schwierigkeiten machte, wie Blackmore vom Polizeiarzt wußte.
»Darf ich hereinkommen?«
»Ach ja, natürlich.« Margaret Dunwood trat zur Seite, und Blackmore folgte ihr ins Wohnzimmer, das auf den etwas tiefer gelegenen Ortskern von Woodstock blickte. Der Raum war liebevoll eingerichtet. Es gab einen echten Kamin, nicht bloß das übliche Gasfeuer, ein paar Bücherborde, Skizzen aus Rom an der Wand, kleine Beistelltischchen, kein Sofa, ein paar gemütliche ältere Sessel, eine Stehlampe. Eine Zeitung war aufgeschlagen; eine Brille lag darauf.
»Eine Tasse Tee?«
»Gerne«, sagte Blackmore und trat ans Fenster. Professor Dunwood beschäftigte sich nur kurze Zeit in der Küche; das Wasser hatte wohl gerade gekocht. Sie kam mit einem Tablett, zwei dampfenden Bechern Tee und einigen Keksen zurück.
»Bitte setzen Sie sich doch.« Sie nahm ihm gegenüber Platz, blieb jedoch auf der äußersten Sesselkante sitzen, die Knie zusammengepreßt, den Wollrock glattgestrichen, die ganze Haltung Angst ausdrückend.
Blackmore räusperte sich. »Wie lange kennen Sie und Professor Schubert sich schon?«
»Als Kollegen schon seit zehn Jahren, seit ich ans College gekommen bin. Befreundet sind wir seit etwa fünf Jahren, nach einer gemeinsamen Studenten-Lehrer-Exkursion nach Rom. Aber was ist eigentlich los?«
Blackmore sagte es ihr.
Margaret Dunwood senkte den Kopf; eine Träne rollte langsam ihre linke Wange herab. »Ich habe so etwas befürchtet, seit ich Ihr Auto draußen gesehen habe. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl. Aber daß ihn jemand …«
»Können Sie das genauer erklären?«
»Nun, Friedrick war seit einigen Tagen etwas seltsam, unruhig, geistesabwesend. Er hat sogar seine Vorlesung ausfallen lassen, weil er sich nicht wohlfühlte. Das hat er noch nie getan. Dann hat er oben alte Papiere durchgesehen, als ob er etwas suchte.«
»Oben?« fragte Blackmore.
Mrs. Dunwood errötete. »Wir haben mehr oder minder hier gelebt. Seine kleine Wohnung in Jericho …« Sie verstummte.
Blackmore war etwas irritiert. Wieso wohnte ein deutscher Professor im ehemaligen Arbeiterviertel der Stadt? Nur weil es inzwischen angesagt war? Oder weil er Abstand brauchte?
»Meinen Sie, ich dürfte mal sein Zimmer sehen?«
»Oh natürlich, kommen Sie.«
Die Professorin stieg vor ihm die kleine Holztreppe hoch, deren dicker Teppich jeden Schritt verschluckte. Oben öffnete sie die erste Tür und trat ins Zimmer. Blackmore folgte ihr.
Ein Bett, ein kleiner Schreibtisch, zwei Bücherregale, gefüllt mit deutschen und englischen Büchern, ein Stapel Zeitschriften, eine alte Stereoanlage, Schallplatten, ein Kassettenrecorder. Dabei war der Professor doch erst Mitte fünfzig gewesen. Anscheinend hatte er seine Studentenzeit nie wirklich beendet. Es roch nach Zigarre.
Auf dem Fußboden stand ein Koffer mit Aktenordnern, Briefen und Kladden. Tagebücher?
Keine Bilder an den Wänden, dafür ein altes Thermometer, das Fahrenheit- und Celsius-Werte anzeigen konnte. Ein gerahmtes Foto auf dem Schreibtisch. Blackmore trat näher. Vier junge Männer, eine junge Frau, vielleicht Studenten? Das Foto war farbig, etwa postkartengroß und ziemlich verblichen. Wahrscheinlich Kodak-Farben, dachte Blackmore, die wurden immer schnell grünstichig und verblaßten dann.
»Es tut mir leid, ich muß die Spurensicherung hierhinschicken«, sagte Blackmore.
»Natürlich. Wann denn?« Margaret Dunwood wirkte hilflos. Friedrich Schubert war wohl die bessere (und stärkere) Hälfte gewesen.
»Sofort. Ich rufe eben an.« Blackmore nahm sein Mobiltelefon aus einer Jackettasche, wählte die eingespeicherte Nummer, sagte ein paar Worte und beendete das Gespräch. »Wir können unten warten.«
Im Wohnzimmer stellte er die üblichen Fragen. Irgendwelche Feinde? Beruflichen Ärger? Schulden? Studentinnen, denen er zu nahe gekommen war? Diese letzte Frage beantwortete Professor Dunwood ziemlich unwirsch mit einem entschiedenen »Nein!«. Die anderen hatte sie höflich verneint.
Blackmore versuchte es nun anders herum.
»Freunde?«
»Ein, zwei Kollegen.«
»Alte Freunde?«
»Er hat wohl noch einen Kollegen in Berlin, dem er regelmäßig schreibt, aber zumindest wohl teilweise beruflich.«
»Familie?«
Blackmores Sätze waren wieder sehr kurz.
»Die Eltern sind schon in den neunziger Jahren gestorben. Ein Bruder lebt, glaube ich, in Bonn. Er hat wenig Kontakt zu ihm.« Sie machte eine Pause. »Hatte, muß ich jetzt ja sagen.« Wieder rollte eine Träne die Wange herab.
Blackmore versuchte, freundlich zu gucken. Margaret Dunwood tat ihm leid.
Es klingelte. Blackmore stand auf und ging zur Tür. »Bleiben Sie ruhig sitzen. Ich mache das schon.« Er öffnete. Draußen standen The Monks in weißen Plastikoveralls und grinsten.
»Die crime scene ist beim College, Jungs«, sagte Blackmore und betrachtete die knisternde Kleidung der beiden. »Aber da ihr nun schon mal da seid … Oben. Erste Tür links. Fotos, Fingerabdrücke. Den Koffer mit Papier bitte in mein Büro. Ich bin dann mal weg. Habt ihr übrigens alle Zimmer im zweiten Stock des College durchsucht?«
»Nein, Sir, nein! Machen wir, wenn wir hier fertig sind.«
Blackmore ging kurz ins Wohnzimmer und verabschiedete sich. Dann fuhr er zurück zum Revier.
Rosie Mannering versuchte zum wiederholten Male, dem Blick von Professor Watkins auf ihre Knie auszuweichen, und strich den Rock glatt. Watkins war Nr. 2 auf ihrer Liste der Fakultätsmitarbeiter, die sie von der völlig verweinten Sekretärin erhalten hatte. Nr. 1 war Professor für Biblische Studien an der Fakultät für Theologie und Religion, hatte ein Forschungsfreisemester und war nicht vorhanden. Wenn sie es richtig verstanden hatte, forschte er in Äthiopien. Sie hatte immer gedacht, daß Theologie in Rom entstanden war, aber Afrika?
»Können Sie das bitte noch einmal wiederholen?« fragte sie.
Watkins blickte sie wie eine unaufmerksame Schülerin an. »Professor Schubert war am vergangenen Dienstag krank; seine Vorlesung fiel aus; telefonisch war er nicht zu erreichen. Und den Bridgeabend mit mir und zwei Freunden hat er auch vergessen. Das alles ist ziemlich untypisch für ihn.«
»Wie haben Sie ihn denn sonst erlebt?«
»Pünktlich, zuverlässig, genau, fast pedantisch, möchte ich sagen – typisch deutsch eben.« Sein dazugehöriges Lächeln mißglückte.
Rosie Mannering hakte für die weiteren Fragen ihre Liste im Geiste ab: irgendwelche Feinde undsoweiter, erhielt aber keine befriedigende Antwort mehr. Sie seufzte und stand auf.
»Danke für Ihre Zeit, Herr Professor.«
»Gern geschehen.« Watkins sah wieder auf ihre Knie und ließ seinen Blick nach oben wandern.
Rosie drehte sich schnell um und verließ das Zimmer. Draußen studierte sie ihren Zettel, klopfte vergeblich an zwei weitere Türen und ging schließlich noch einmal ins Sekretariat zurück. Debbie Reyman sah noch genauso verheult aus wie vor einer Stunde.
»Ist schon schlimm«, sagte Rosie.
»Er war immer so nett zu mir, ein richtiger feiner Herr, auch wenn er von der falschen Seite des Kanals stammte.«
»Haben Sie in den letzten Tagen etwas an ihm bemerkt?« fragte Rosie.
»Nein, er war weder zerstreut, noch unfreundlich. Er hat mich all die Jahre, seit ich hier arbeite, und das sind jetzt schon zwölf, gleich freundlich behandelt, gefragt, wie mein Tag so war, was meine Katzen machen, wie es meiner Mutter geht, das Übliche eben.«
»Hat er viel Besuch gehabt?«
»Nur seine Sprechstunden für die Studenten, ab und zu eine Tagung mit auswärtigen Professoren. Doch, warten Sie mal.« Debbie Reyman überlegte. »Letzten Dienstag, also nicht diese Woche, sondern der Dienstag davor, da war ein etwas merkwürdiger Besucher hier.«
»Wieso merkwürdig?«
»Nun, er war viel besser gekleidet als alle hier: Maßschuhe, ein perfekt sitzender Anzug von Dolce & Gabbana …« Debbie errötete. »Mein Vater war Schuhmacher. Ich wollte mal auf die Modeschule, vor langen Jahren; seitdem versuche ich, auf dem Laufenden zu bleiben.«
»Wie sah er denn aus?«
Debbie wurde wieder rot. »Genau darauf achte ich nie. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, ob er einen Bart gehabt hat oder nicht. Kleidung, das war’s.«
»Und was wollte er?«
»Er hat sich nach Professor Schubert erkundigt, ist dann aber wieder gegangen, als er hörte, daß er Dienstagnachmittag nicht da ist. Ach ja, und er hinkte ganz leicht.«
»Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen«, bemühte Rosie diesen Lieblingssatz aller Kommissare und ging.
Vor dem Gebäude waren die Leute von der Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig. Der Polizeifotograf packte gerade seine Kameraobjektive ein. Die Wolldecken waren verschwunden, und den Leichnam hatte man augenscheinlich schon ins Leichenschauhaus verbracht. Vor dem Wochenende ging das alles schneller.
Rosie blickte noch einmal zum zweiten Stock hoch. Täuschte sie sich, oder hatte sich gerade eine Gardine hinter einem geschlossenen Fenster bewegt? Wenn sie sich nicht irrte, war das das Zimmer von Cornelia Stockport, der studentischen Hilfskraft und Tutorin von Professor Schubert.
Sie sah auf die Uhr. Spät genug. Sie würde ohnehin die Befragungen am Montag fortsetzen müssen. Zeit genug, um sich dann der wissenschaftlichen Mitarbeiterin zu widmen.
Rosie ging zur nächstgelegenen Bushaltestelle, um in die Stadt zur Dienststelle zurückzufahren. Im Bus sah sie ihre Notizen und die Liste der Mitarbeiter der Fakultät noch einmal durch. Andererseits – vielleicht konnte es der Karriere nicht schaden, Überstunden zu machen und Cornelia Stockport zu Hause zu befragen. Old Marston war keine schlechte Gegend zum Wohnen, und den Abend konnte man dann im Victorian Arms an der Isis ausklingen lassen. Auch wenn man alleine war.
3
Freitag, 21. Mai 2010, und Pfingstsamstag, 22. Mai 2010 – Bonn
Draußen stolperte Krüger und mußte sich fast von einer jungen Frau auffangen lassen. Sein Jackett verrutschte, und seine Visitenkarten fielen auf die Straße. Die junge Frau reagierte schnell, bückte sich und hob sie wieder auf.
»Hier, Herr Kommissar.«
»Danke«, sagte Krüger, »und mit wem habe ich die Ehre?«
»Carmen Rasche.«
»Dann arbeiten Sie für Professor Minski?«
Die junge Frau guckte irritiert. »Ja schon, aber Freitagnachmittag habe ich frei.«
»Dann wissen Sie also noch nichts?«
»Was soll ich denn wissen?«
Krüger schaute auf die Uhr. »Wenn es Ihnen trotz der vorgerückten Stunde recht ist, würde ich das gerne mit Ihnen bei einem Glas Wein besprechen.«
»Wein im Dienst?« fragte Carmen Rasche freundlich.
»Nun, streng genommen ist meine Dienstzeit seit zwei vorbei, außerdem kann ich diverse Überstunden abfeiern, und die Paragraphenreiter sind ja glücklicherweise nach Berlin umgezogen worden.«
Die junge Frau lachte. »Okay. In der Nähe ist Rietbrocks Weinhaus; wenn wir Glück haben, bekommen wir noch etwas zu essen.«
Krügers Magen knurrte. Ihm fiel wieder ein, daß das einzige feste Essen heute der Zucker zum Cappucchino im Bistro Miebach gewesen war. Erfreulicherweise war seine Müdigkeit verflogen.
»Einverstanden. Aber ich bezahle. Zeugenbefragungen gehen auf Spesen. Das Finanzamt soll leben!«
Der Kellner des Weinhauses in der Königstraße nickte Carmen Rasche zu; anscheinend war sie hier bekannt. Dann glitt sein Blick über ihren Begleiter, und er grinste, nun, fast schmierig, dachte Krüger. Wenn ihn seine Menschenkenntnis nicht täuschte, hatte sich der Mann in Frau Rasche wohl getäuscht.
Sie steuerten einen Tisch hinten links in der Ecke an, von der Theke und vom Eingang nicht direkt einsehbar. Krüger bestellte einen Chardonnay; die junge Frau schloß sich ihm an. Es gab noch eine Käseplatte; das mußte für heute abend reichen.
Krüger räusperte sich. »Seit wann arbeiten Sie eigentlich am Lehrstuhl?«
»Seit zwei Jahren. Ich bin selber Theologin, habe aber trotz Pfarrermangels in der Rheinischen Kirche vor einigen Jahren keine Anstellung bekommen. Ich könnte auch sagen: nicht haben wollen, denn Köln-Weidenbrück oder Prüm in der finstersten Eifel kamen nun wirklich nicht in Frage. So habe ich gerne die Stellung im Sekretariat angenommen, erledige die Korrespondenz für den Herrn Professor, redigiere ab und an wissenschaftliche Aufsätze, organisiere die eine große Tagung des Lehrstuhls im Jahr und und und.« Sie lächelte. »Aber warum sitzen wir eigentlich hier? Dienstlich, meine ich.«
Krüger machte ein ernstes Gesicht. »Es hat einen Unfall gegeben.« Die übliche Kunstpause, um die Reaktion des Gegenübers zu verfolgen.
Carmen Rasche tat ihm den Gefallen und wurde blaß. »Doch nicht Professor Minski?«
»Leider doch. Er ist heute abend gegen neunzehn Uhr aus dem Fenster seines Zimmers auf den Schloßkirchenplatz gestürzt.«
»Tot?« Carmen Rasche bemühte sich, ihre Fassung zu wahren.
»Leider ja. Und wie es aussieht, hat jemand nachgeholfen.«
Krüger biß sich auf die Zähne. Eigentlich hatte er nichts sagen wollen.
Die Sekretärin sah ungläubig aus. »Bei uns im Seminar ein Mord? Allen Ernstes?«
Krüger nickte. »Es sieht so aus. Aber jetzt stelle ich mal die Fragen, wenn Sie erlauben. Ist Ihnen heute, da haben Sie doch gearbeitet? Ist Ihnen heute etwas aufgefallen, was anders war als sonst?«
Carmen Rasche überlegte. Es dauerte etwas länger, während Krüger sie unverwandt ansah. Sie hatte dunkle schulterlange Haare, wohl echte Locken, und trug eine schwarze Jeans und einen bunten Pullover. Ihren Anorak hatte sie neben sich auf einen Stuhl gelegt. Ihre Finger waren außerordentlich gepflegt, die Nägel, wenn überhaupt, nur matt lackiert. Beide Mundwinkel besaßen ein kleines Grübchen, so daß es aussah, als ob sie sich ständig über etwas leise amüsierte.
Die junge Frau unterbrach seinen Gedankengang und sagte: »Er wirkte vielleicht etwas hektischer als sonst. Als müsse er pünktlich zu einer Verabredung kommen.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Und was für eine Verabredung?«
»Mein Dienst endete ausnahmsweise pünktlich um zwei. Und von einem Termin weiß ich nichts. Aber er schaute, während wir seinen letzten Aufsatz durchgingen, mehrfach auf die Uhr und fragte auch einmal, ob die Uhr über meinem Arbeitsplatz pünktlich gehe.«
»Hatte er irgendwelche Besucher während der Woche?«
»Nein, nur ein Treffen mit dem Fakultätsrat und eines mit dem Rektor in dessen Dienstzimmer wegen der Einwerbung von Drittmitteln.«
Ohne Sponsoring lief auch hier nichts mehr, da die Regierung ja lieber die ohnehin leck gelaufene Hypo Real Estate Bank subventionierte, statt den Schotter in die Bildung zu stecken, dachte Krüger. Von seinem Berufsstand ganz zu schweigen. Seine Dienststelle verwendete immer noch Aktenordner der längst verschiedenen Bonner Firma Soennecken aus den siebziger Jahren, mit zigfach neu beklebten Rücken.
Er räusperte sich. »Was können Sie sonst von Professor Minski berichten?«
»Nun, er stand mir nicht sehr nahe, wenn Sie das meinen. Wir haben keine social events zusammen verbracht, von Geburtstagen und Empfängen in der Fakultät mit dem obligatorischen Gläschen Sekt abgesehen.«
Sie hatte anscheinend die nötige Distanz zu ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsplatz, dachte Krüger.
»Er war ein ruhiger Wissenschaftler, nichts Besonderes. Aber, wenn wir schon in TV-Sprache reden wollen: Dunkle Geheimnisse hatte er wohl auch keine.« Sie lächelte.
»Meine Frage nach Leuten, die ein Motiv gehabt hätten, kann ich mir also sparen?«
»Ich wüßte niemanden. Selbst der Student, der seine Doktorarbeit zu großen Teilen aus Wikipedia bestritten hat, was ihm Professor Minski nachgewiesen hat, ist so harmlos, daß er keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Er arbeitet jetzt als Animateur beim Club Méditerranée und ist viel glücklicher als hier während seiner ganzen Studienzeit. Seine Eltern sind angesehene Mediziner, und deswegen mußte der Sohn wohl ebenfalls …«
Sie lächelte wieder, was sie ziemlich gut konnte und was sie noch hübscher machte, dachte Krüger.
»Ärger in der Familie?« fragte Krüger.
»Seine Schwester, meinen Sie? Die lebt in England, soviel ich weiß, und Professor Minski hat sie kaum mehr als ein- oder zweimal erwähnt.«
»Ach ja, der Form halber: Wo waren Sie heute abend zwischen achtzehn und neunzehn Uhr? Ich muß das fragen.«
»Schon klar«, sagte Carmen. »Schuhe kaufen.«
Krüger guckte ungläubig.
»Doch, echt. Ich kann Ihnen den Kassenbon zeigen. Da steht doch immer die Uhrzeit drauf. Und Schuhe anprobieren dauert.«
Daran konnte Krüger sich noch zu Genüge aus seinem früheren Leben erinnern. »Danke. Mehr fällt mir nicht ein«, sagte er. »Doch, noch eines: Wissen Sie, wo ich morgen Frau Dr. Metzig erreichen kann?«
»Den jungen Drachen? Entschuldigen Sie meine Offenheit, aber das wird Ihnen jeder in der Fakultät sagen. Die hat keine Haare auf den Zähnen, sondern Stacheldraht.« Dieses Mal lächelte Carmen Rasche nicht. »Ich weiß es nicht. Ehrlich. Sie hat zwar ein Zimmer in Bad Godesberg, aber gemeldet ist sie immer noch irgendwo in Brandenburg.«
Dieses Mal grinste Krüger. Wieso mußte er bei Brandenburg immer an das Lied von Rainald Grebe denken?
Er stand auf.
»Wie, Sie wollen schon gehen? Den dienstlichen Teil haben wir doch hinter uns, und den Käse haben Sie noch nicht einmal angefaßt.« Wieder dieses Lächeln.
Krüger setzte sich wieder. »Okay. Das ist nun wirklich außerhalb jeglicher Dienstzeit.« Er hob sein Glas: »Prost.«
Mühsam setzte Krüger sich auf. Das Zimmer kannte er nun wirklich nicht. Und wie er dahin gekommen war, wußte er ebenfalls nicht mehr. Ein weibliches Zimmer, zumindest ein Wohnzimmer mit weiblicher Note, worunter er in erster Linie frische Schnittblumen verstand. Seine vergammelten regelmäßig, weshalb er irgendwann auf Hydrokulturen ausgewichen war. Diese mußte man jedoch auch regelmäßig wässern, was er beim Kauf überhört hatte. Inzwischen besaß er einen täuschend echt aussehenden Rosenstrauß, den man wenigstens nicht gießen mußte.
Ein freundlicher dunkelhaariger Kopf erschien in der Zimmertür. »Kaffee? Oder lieber Tee? Aspirin habe ich auch, wenn du möchtest.«
Krüger rieb seine Augen und fragte sich, ob er noch träumte. Die junge Dame mußte Carmen Rasche sein, wenn ihn seine weinvernebelte Erinnerung nicht trog. Er hatte sein Herz vor langen Jahren an italienischen Chardonnay aus dem Trentino verloren, aber noch immer nicht gelernt, bei einer guten Unterhaltung die Zahl der Gläser im Auge zu behalten. Meistens rächte sich das am nächsten Tag.
Und an ein Du konnte er sich ebenfalls nicht erinnern. Immerhin lag er auf einer Couch unter einem schönen englischen Plaid und war voll bekleidet.
Krüger stand auf, zog seine Schuhe an und ging ins Bad.
Carmen rief aus der Küche: »Geh ruhig duschen. Frühstück ist gleich fertig.« Anscheinend war sie trinkfester als er.
Krüger kam zehn Minuten später deutlich erfrischt und mit reduzierten Kopfschmerzen in die Küche. Carmen hatte den kleinen Tisch hübsch gedeckt, es gab Servietten, frische Brötchen und Sekt.
Krüger stöhnte. »Nicht schon wieder Alkohol. Wußtest du, daß viel mehr Leute durch Al-Kohol als durch Al-Queida umgekommen sind?«
Carmen lachte. »Ein Gläschen, und dein Pegel ist wieder auf Normal-Null. Du wirst sehen.«
»Was ist denn überhaupt passiert?« Krüger gähnte.
»Überhaupt nichts.«
Das Lächeln sah heute morgen noch schöner aus.
»Wir haben die eine Flasche zum Käse ausgetrunken und dann eine zweite bestellt. Irgendwie war die dann auch alle. Und dann wolltest du noch einen Malteser und anschließend einen Grappa.«
Das erklärte natürlich einiges.
»Und weil ich um die Ecke wohne und du nicht mehr so ganz straight laufen konntest, habe ich mir die Freiheit genommen, dich hier aufs Sofa zu legen. Polizeikommissare sind in der Regel harmlos, glaube ich. Immer mache ich das nicht!«
Krüger sah sie freundlich an. Eine bemerkenswerte Frau, dachte er.
»Wie spät ist es überhaupt?«
»Kurz nach zehn. Was mußt du denn heute noch machen?«
Krüger antwortete mit vollem Mund. »Ins Präsidium, die Ergebnisse der Spurensicherung durchlesen und dann überlegen, wie es weitergehen soll. Außerdem muß ich mich nach meinem Kollegen erkundigen, mit dem ich sonst die Ermittlungen zusammen durchführe. Leider liegt er seit zehn Tagen in der Uniklinik, Hausarbeit und dann von der Leiter gefallen. Und ich muß meinen Chef anrufen. Wundert mich sowieso, daß er sich noch nicht gemeldet hat. Mein Mobiltelefon ist immer eingeschaltet.«
»Außer, wenn der Akku leer ist«, sagte Carmen und deutete auf das flache Gerät, das neben dem Brotkorb lag.
»Wenn das man keinen Ärger gibt!« sagte Krüger und stand auf. »Vielen Dank für alles. Ich versuche, mich mal zwischendurch zu melden, wenn ich darf.«
Carmen sah etwas traurig aus; vielleicht hatte sie insgeheim auf einen Vormittag zu zweit gehofft. »Geht schon klar.«
Früher war die deutsche Sprache etwas einfacher gewesen; »Gerne!« hätte durchaus gereicht, dachte Krüger und schloß die Wohnungstür hinter sich.
Hinter dem linken Scheibenwischer seines Autos steckte ein Knöllchen. Krüger nahm den Strafzettel, knüllte ihn zusammen und warf ihn in den nächsten Vorgarten. Die meisten Auseinandersetzungen mit dem Bonner Ordnungsamt hatte er bislang für sich entscheiden können. Nach dem Skandal um das WCCB war er sich aber nicht mehr ganz so sicher, was seine Erfolgschancen angingen. Die Stadt brauchte jeden Cent.
Krüger fuhr zu seiner Junggesellenwohnung in der Adolfstraße, parkte – es war samstags – die Einfahrt zum türkischen Supermarkt im Nachbarhaus zu, der merkwürdigerweise geschlossen hatte, und ging in seine Wohnung. Sie lag im zweiten Stock über einer Bäckerei. Wie immer roch es im Treppenhaus nach frischen Brötchen und anderen leckeren Dingen. Krüger liebte diesen Geruch; wahrscheinlich war er einer der Gründe, weshalb er nach zehn Jahren noch immer hier wohnte und noch nicht wie viele seiner Kollegen ins Bonner Umland gezogen war. Oben steckte er den leeren Akku des Mobiltelefons ins Aufladegerät, einen neuen ins Telefon und zog seine schwarze Lieblingsjeans von Jokers an. Dann wählte er die Nummer seines Chefs.
»Krüger hier.«
»Das sehe ich«, sagte die wie immer leicht gereizt klingende Stimme von Kriminaloberrat Walther »mit TH« Langenargen. »Wieso waren Sie nicht zu erreichen? Wir haben Sie heute morgen bei der Großen Lagebesprechung um halb neun vermißt.«
»Kein Strom vielleicht?« sagte Krüger.
»Schon wieder kein Saft in der Nordstadt?« versuchte sich Langenargen an einem Witz.
»Nein, der Akku war leer.«
»Und das Festnetz?«
»Die übliche Störung«, log Krüger. »Unten ist der Bürgersteig immer noch aufgerissen. Die suchen immer noch die Ursache, warum die alte Frau Schmitz von gegenüber kein Telefon hat.«
»Lassen wir das mal. Was haben Sie denn bis jetzt herausgefunden?«
Krüger informierte ihn über die Vernehmung der studentischen Hilfskraft und die der Sekretärin, verschwieg jedoch die Dauer der letzteren. »Und jetzt wollte ich versuchen, die Privatdozentin Dr. Nicole Metzig zu erreichen, falls sie nicht kurz vor dem Ural steckt.«
Langenargen war irritiert. »Was will sie denn in Rußland?«
Krüger amüsierte sich insgeheim. »Die Dame hat nur ein Zimmer in Bad Godesberg. Ansonsten muß ich zu ihrem ersten Wohnsitz eine Dienstreise nach Brandenburg machen.«
Langenargen pfiff den Refrain von »Brandenburg«.
Manchmal war sein Chef doch zu genießen, fand Krüger.
»Rufen Sie mich an, wenn es etwas Neues gibt.« sagte Langenargen und legte auf.
»Jawohl, Chef«, sagte Krüger in die leere Leitung. Fast hätte er salutiert.
Krüger entschloß sich, einen Umweg über das Polizeipräsidium in Beuel zu machen und erst danach nach Bad Godesberg zu fahren.
Die Parkplatzsuche heute morgen war nicht so langwierig wie sonst. In der Woche mußte man gefühlte zehn lange Minuten zusätzlich einkalkulieren, weil die Anwohnerstraßen rund ums Präsidium zugeparkt waren, gar nicht einmal von den Anwohnern, sondern von den Angestellten und Beamten der Polizei. An das Desaster bei der Fertigstellung der Tiefgarage inklusive Verletzten wollte er lieber nicht denken.
Er nahm die Treppen zu seinem Bürozimmer im Laufschritt, wo er – wenigstens das hatte er seinen Mitarbeitern beibringen können – auf seinem Schreibtisch bereits das Ergebnis der Spurensicherung und einen vorläufigen Bericht des Rechtsmediziners vorfand. Beides überraschte ihn nicht.
Professor Minski war vor seinem Tod gewürgt worden; daß es Streit und mindestens eine Rangelei gegeben hatte, war an Blutergüssen an den Handgelenken und am Hals sichtbar. Gestorben war er dann an den Folgen des Sturzes aus dem zweiten Stock: Schädelbasisbruch, mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen. Die Obduktion würde noch weitere Aufschlüsse bringen.
Die Spurensicherung hatte nichts Auffälliges finden können; die Auswertung der gefundenen Fingerabdrücke stand noch aus, ebenso die Untersuchung des dienstlichen Computers des Professors.
Krüger überflog die noch handschriftlich erstellte Liste der Kollegen bei der Mordkommission »Promi«. Es dauerte einen Moment, bis er begriff. Irgendein Witzbold hatte »Professor Minski« abgekürzt. Wahrscheinlich war es Farnschläger, der für seinen Humor oder das, was er dafür hielt, berüchtigt war. (»Wo Farnschläger hinhaut, wächst kein Farn mehr.« Dieser Satz eines Kollegen war allerdings auch nicht viel besser.) Dafür konnte Farnschläger sehr gut organisieren und war im Umgang mit dem Internet unschlagbar. Wie erwartet, lag der akademische Werdegang von Minski bei, am Ende versehen mit Farnschlägers Kürzel. Auch hier nichts Neues.
Weitere Namen auf der Liste der Mordkommission waren Kriminaloberkommissar Markus Schneider in Vertretung von Kriminaloberkommissar Dolf Mesmer; der Vermerk zu ihm lautete »leitersturzbedingt dienstunfähig« – manchmal war Behördendeutsch durchaus erheiternd. Kriminalhauptkommissarin Dr. Simone Winterthur, Kriminaloberkommissar Peter Paulsen (in Husum geboren und stolz darauf), Kriminalkommissar Manfred Schumacher, der erst seit dem ersten April in Bonn arbeitete, und Kriminalkommissar Harald Kaul waren die weiteren Mitglieder der Mordkommission. Was auch reichte, fand Krüger; mehr Leute behinderten sich nur gegenseitig. Er arbeitete am liebsten allein. Unten entdeckte er noch drei in einer anderen Handschrift hinzugefügte Namen von Kommissaren aus anderen Abteilungen. Professor Minski war wohl doch so wichtig, daß die Chefetage eine Mordkommission von zehn Leuten gegenüber den sonst üblichen acht beschlossen hatte.
Anscheinend waren alle schon wieder aus- beziehungsweise noch nicht eingeflogen. Das erfahrene Team kam auch ohne ihn klar. Und die nächste Dienstbesprechung war erst für heute nachmittag um vier angesetzt, wie er aus dem Vermerk seines Chefs ersah. Montag hätte durchaus gereicht, fand Krüger, aber wie man ja wußte, waren die ersten achtundvierzig Stunden bei einer Mordermittlung stets kritisch.
Krüger seufzte und ging zu seinem Auto zurück.
»Was machst du denn am Samstag hier?«
Krüger drehte sich um.
Polizeioberkommissarin Angelika Winterstein kam hinter ihm hergelaufen. Sie schob ihr Fahrrad, mit dem sie jeden Tag aus Mehlem nach Beuel fuhr. Sie hatte die Beine ihrer Stoffhose wie üblich mit zwei Wäscheklammern versehen, damit sie nicht an die Fahrradkette gerieten. Den schwarzen Pullover kannte er schon seit Jahren. Mit der Gehaltsstufe A 10 im Öffentlichen Dienst kam man eben nicht so weit. Krüger fand, daß jahrzehntelange Zugehörigkeit zu einer Dienststelle durchaus etwas mehr Geld bedeuten müsse. POK Winterstein war als Sachbearbeiterin eingesetzt – Akten-, nicht Wasserträgerin, dachte Krüger. Er versuchte, freundlich zu bleiben. Angelika Winterstein galt als das Schwarze Brett seiner Abteilung und des ganzen Präsidiums; man mußte vorsichtig sein, was man ihr sagte. Manchmal konnte man jedoch auch zügig über sie Informationen in Umlauf bringen. Desinteresse an allem konnte man ihr wirklich nicht vorwerfen; der gemeine Rheinländer kannte für sie und ihresgleichen den schönen Begriff »Schwaadlappe«.
»Post erledigen. Mein Notebook ist kaputt.« Wenn Krüger zuviel sagte, landete das manchmal sogar in der Lokalpresse.
»Bist du mit Minski befaßt?«
Woher wußte sie denn das schon wieder?
»Ja, aber wir haben noch nichts Brauchbares gefunden. Ich halte dich auf dem Laufenden.«
»Oh, das ist ja sehr nett von dir. Dann noch einen schönen Tag«, sagte sie und schloß ihr Fahrrad an.
Krüger kam eine Idee.
»Kannst du vielleicht rauskriegen, ob Minski in Bonn in irgendwelchen Vereinen, Verbänden und dergleichen war? Wäre hilfreich.« Mal sehen, ob Montag was in der Zeitung stand.
»Geht schon klar.« Aus Carmen Rasches Mund hatte das irgendwie netter und authentischer geklungen.
Krüger schlug die Fahrertür zu und fuhr los.
In der Lukas-Cranach-Straße in Bad Godesberg hatte Frau Dr. Metzig ein Zimmer zur Untermiete. Die Straße war eine Sackgasse mit Stichwegen zu Reihenhäusern aus den siebziger Jahren und etwas größeren Gärten, als es heute üblich war. Der Asphalt war aufgerissen, so daß Krüger vor der Einmündung parken mußte. Das kleine Stück zur Nr. 103 ging er zu Fuß. »Weber« und »Dr. Metzig 2x« las er auf dem Klingelschild.
Gehorsam klingelte er zweimal.
Keine Reaktion.
Krüger klingelte einmal.
Die Tür wurde aufgerissen, so daß Krüger beim unwillkürlichen Zurücktreten fast gestolpert wäre. Eine ältere Frau stand in der Tür und musterte ihn von oben bis unten.
»Frau Dr. Metzig ist nicht da. Zu der wollten Sie doch?«
Krüger verzichtete darauf, sich auszuweisen, und sagte stattdessen freundlich: »Wann kann ich sie denn erreichen?«
»Die läuft gerade unten am Rhein. Macht sie häufiger. Sie können gerne warten; sie müßte eigentlich um zwölf wieder hier sein. Eine Tasse Kaffee?«
»Danke«, sagte Krüger und folgte der Vermieterin in die Küche, die links vom Eingang lag. Er setzte sich an den kleinen Tisch, an dem zwei unterschiedliche Stühle standen. Die Küche selber war älter, aber gut gepflegt. Krüger bemerkte zwei Ringe am Ringfinger von Frau Weber und schloß daraus, daß sie wohl ihre Rente mit der Zimmervermietung aufbessern mußte.
»Seit wann wohnt Frau Dr. Metzig denn bei Ihnen?«
»Ich glaube, schon fast zwei Jahre.«
»Seit Antritt ihrer Stelle an der Uni? Zum Sommersemester 2008?«
»Das kann gut sein. Ich kann das aber nicht genau sagen.«
»Vielleicht steht es im Mietvertrag?« Krüger konnte gemein sein.
Frau Weber wurde rot, sagte aber nichts. Soviel zu Rentenanpassungen, dachte Krüger. Er nahm einen Schluck aus der Tasse und versuchte gleichzeitig, die Luft anzuhalten, so stark war der Kaffee. Der Löffel konnte fast darin stehen – Witwenkaffee, damit das Herz in Gang kam.
»Kommen Sie denn mit Dr. Metzig klar?«
»Sie ist immer nett zu mir. Ab und zu bringt sie Blumen mit. Manchmal essen wir zusammen.«
Die karikative Ader der Privatdozentin hatte man ihm bisher verschwiegen.
»Haben Sie Ihren Chef mal gesehen?«
»Nein, außer einem jungen Mann mit Locken und Ihnen war hier noch nie ein Herr.«
Frölig, dachte Krüger. Wahrscheinlich nur ein harmloser Botengang.
»Ist Frau Dr. Metzig jedes Wochenende hier?«
»Nein, sie fährt oft nach Hause, zu ihren Eltern. Aber – Sie fragen fast wie der Kommissar im Fernsehen.«
Allmählich wurde Frau Weber doch mißtrauisch.
Die Haustür wurde aufgeschlossen, und eine junge Frau kam in die Küche, blieb aber irritiert stehen, als sie Krüger entdeckte. »Oh, ich wollte nicht stören.« Sie drehte sich um, aber Krüger stand auf und sagte: »Ich bin Ihretwegen da.«
Frau Dr. Metzig sah hilfesuchend zu Frau Weber. »Ich muß erstmal duschen. Könnten Sie …«
»Der Herr kann gerne im Wohnzimmer warten«, sagte Frau Weber.
»Was wollen Sie überhaupt?« fragte die Privatdozentin ziemlich spitz.
»Krüger, Kriminalpolizei«, sagte er in seinem Dienstton.
Frau Weber wurde blaß.
»Keine Sorge«, sagte Krüger, »ich komme wegen Professor Minski, Frau Dr. Metzigs Chef.«
»Ich beeile mich.« Frau Dr. Metzig verließ die Küche und lief über die Treppe nach oben.
Krüger folgte der Vermieterin ins Wohnzimmer. Ihren fragenden Blick beantwortete er mit: »Es tut mir leid. Kein Kommentar.«
»Nehmen Sie doch Platz. Ich muß in die Küche, Essen vorbereiten. Ihren Kaffee bringe ich gleich mit dem von Frau Dr. Metzig.« Sie ließ ihn alleine.
Krüger sah sich im Wohnzimmer um. Alles war aufgeräumt und sauber. Der alte Ohrensessel hatte auf den Armlehnen Schondeckchen; auf dem Couchtisch stand eine Vase mit weißen Tulpen; der Teppich sah etwas abgelaufen aus. Er betrachtete gerade den Inhalt des einzigen schmalen Bücherregals, als die Wohnzimmertür energisch aufgestoßen wurde. Frau Dr. Metzig kam herein, gefolgt von Frau Weber mit einem Tablett, auf dem sich drei Tassen Kaffee befanden.
Krüger wartete, bis zwei Tassen auf dem Couchtisch standen, dann sagte er: »Vielen Dank. Wenn Sie uns jetzt bitte alleine lassen.«
Frau Weber verschwand etwas beleidigt. Krüger glaubte jedoch nicht, daß sie hinter der Tür stand und lauschte. Er musterte Frau Dr. Metzig: Kurze, fast schwarze, noch feuchte Haare, Strumpfhose, kurzer Rock, schwarzes T-Shirt, bunte Wolljacke, kein Schmuck. Dafür war sie etwas geschminkt und duftete dezent.
»Und?« Mehr sagte sie nicht. Sie machte auch keine Anstalten, sich hinzusetzen. Krüger bot ihr einen Platz über Eck an. Das hatte er bei der letzten Fortbildung zu Körpersprache gelernt: Man erfuhr mehr, wenn das Gegenüber neben oder schräg neben einem saß und nicht den Eindruck hatte, es würde noch über den Tisch gezogen werden im Laufe der Unterhaltung.
»Wann haben Sie Professor Minski zuletzt gesehen?«
»Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?« war die Gegenfrage.
Krüger holte seinen Dienstausweis aus seiner Brieftasche, den sie ausführlich durchlas.
»Aha, Jahrgang 1965. Dann sind Sie ja nur unwesentlich jünger als Professor Minski.« Sie lächelte nicht.
Zehn Jahre waren machmal ein ganzes Leben, fand Krüger, und Minski, Jahrgang 1955, sah auf seinem Paßfoto so alt aus, daß er durchaus sein Vater hätte sein können. Krüger hielt sich für jünger, als er aussah, aber wenn man jeden Morgen die Falten des Lebens und der harten Fälle im Spiegel sah, sah man irgendwann nur noch das, was man sehen wollte. Aber Krüger fühlte sich jünger als er war, und das zählte, glaubte er jedenfalls.
»Und Sie? Sie werden doch bestimmt noch von allen geduzt.«
Da hatte er ihren wunden Punkt entdeckt.
»Im Gegenteil«, fauchte Frau Dr. Metzig. »Seit ich den Doktortitel habe – und den habe ich, seit ich sechsundzwanzig bin –, hat mich niemand mehr geduzt. Schon gar nicht, seit ich mit knapp einunddreißig Privatdozentin geworden bin mit einer Arbeit zum Thema ›Die Gerechtigkeit des Theologen unter besonderer Berücksichtigung der evangelischen Fakultäten‹«.
Krüger fragte sich, ob sich seit 1944 bei Aufsatz- und Buchtiteln nichts geändert hatte. Schießlich war er Cineast und konnte »Die Feuerzangenbowle« auswendig. Einige Male war er sogar zu den inzwischen legendären Vorführungen des Films in Hörsaal I der Universität gegangen.
»Also noch einmal«, sagte Krüger. »Wann haben Sie Professor Minski zuletzt gesehen?«
»Freitag vor seiner Vorlesung. Wir haben meinen Aufsatz zur Ethik bei Facebook-Profilen besprochen und die Tagesordnung der Fakultätsratssitzung in der kommenden Woche.«
»Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen?«
»Professor Minski war müde. Aber wenn man auf die Sechzig zugeht …« Wieder kein Lächeln.
»Bedrückte ihn irgendetwas? War er geistesabwesend? Oder war er im Gegenteil aufgekratzt und fröhlich?«
»Nein. Nichts von allem«, sagte Dr. Metzig.
Krüger versuchte, sie bei ihrem Ehrgeiz zu packen. »Aber Ihnen als junger aufstrebender Theologin entgeht doch bestimmt nichts?«
»Auch wenn Sie versuchen, sich einzuschmeicheln: Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, nichts …« Sie verstummte.