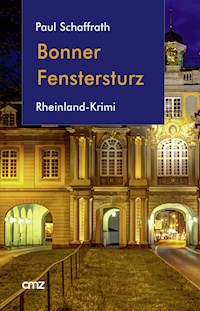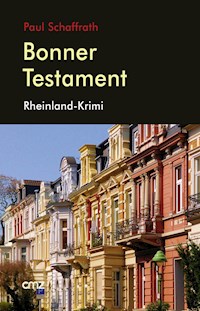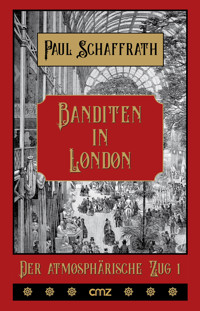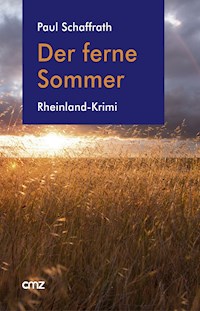
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tod, der Bauer und die Physik 1969. In einem Dorf bei Rheinbach verschwindet nach einem Feuerwehrfest ein junger Mann spurlos – zehn Jahre später ein zweiter. Beide Fälle bleiben ungelöst. Als aber 2016 im Rheinbacher Wald ein Landwirt ermordet wird und zeitgleich eine Bonner Buchhändlerin ihren Liebsten vermißt, überstürzen sich plötzlich die Ereignisse. Liefert der Landbesitz des toten Bauern zwischen Bad Münstereifel und Bonn des Rätsels Lösung? Und hat das Institut für Angewandte Physik der Bonner Universität etwas damit zu tun? In seinem vierten Fall ermittelt KHK Krüger auf dem Land. Noch immer hat er keinen Vornamen, und noch immer ärgert ihn die Schlunzigkeit seiner Mitmenschen. "Dem Rheinbacher Autor Paul Schaffrath ist es gelungen, seinen ebenso kauzigen wie scharfsichtigen Ermittler und dessen Umfeld auch beim vierten Mal aus neuer Perspektive zu zeigen, ohne dabei vom originellen Rezept der Vorgängerbände abzugehen." Bonner General-Anzeiger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Paul Schaffrath sind bereits folgende Krimis erschienen:
KHK Krüger
Bonner Fenstersturz
Bonner Testament
Der Nebel von Avignon
KHK Max Harmsen
Die Drei Könige
© Schafgans DGPh 2017
Winrich C.-W. Clasen, Jahrgang 1955, Studium der Romanistik, Evangelischen Theologie und Kunstgeschichte in Bonn; Verleger in Rheinbach. Seit 2011 schreibt er unter dem Pseudonym Paul Schaffrath Kriminalromane. Der ferne Sommer ist sein fünfter Roman.
Paul Schaffrath
Der ferne Sommer
Rheinland-Krimi
Zweite überarbeitete Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018–2019 by CMZ-VerlagAn der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-912626, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat:Beate Kohmann, Bonn
Schlußredaktion:Clemens Wojaczek, Rheinbach
Satz(Aldine 401 BT 11 auf 14,5 Punkt)mit Adobe InDesign CS 5.5:Winrich C.-W. Clasen, Rheinbach
Papier (Lux Creamy 90 g mit 1,8f. Vol.):Arctic Paper S.A., Poznań / Polen
Umschlagfoto (landscape-tree-nature-grass-outdoor-horizon):www.pxhere.com
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
Gesamtherstellung:Bookpress.eu, Olsztyn / Polen
eISBN 978-3-87062-322-7
501–1000 • 20190104
www.cmz.de
www.paul-schaffrath.de
Summer days, summer nights are gone
Summer days, summer nights are gone
I know a place
where there’s still somethin’ going on
Bob Dylan
Inhalt
Die Hauptpersonen
Der leere Gartenstuhl
Französisches Flair
Das Institut der verschwundenen Dinge
R2D2
Das Feuerwehrfest
Blinde Wut
Versuchsanordnungen
Das Riesenkaninchen
Schuppen und Angeln
Dasselbe Gericht
Das Personal
Die grüne Kladde
Schallplatten und Fusseln
Der Rasenmähermann
Die Delle
Das Traumhaus
Ich kannte ein Mädchen
Papas Liebling
Schnaps und Strohhalme
Verblaßter Glanz
Chinesische Medizin
Ein Knochen und sehr viel Blut
Auf das falsche Pferd gesetzt
Am Filmset
Versuch macht klug
Puzzleteile
Völlig aufgelöst
Die Wahl der Waffen
Chemische Verbindungen
Das große Rennen
Wetterumschwung
Pflanzenkunde
Zurück auf Anfang
Die Schriftsachverständigen
Quick man, I got to run – down Highway 61
Der Gebrauchtwagen
Über Temperamente
Vom Hasenfuß zum Hahnenfuß
Totgeglaubte leben länger
Asiatische Küche
Der kleine Überseekoffer
Nachbemerkungen
Die Hauptpersonen
Die Ermittler
Krüger, Kriminalhauptkommissar – weiß in jedem Fall Rat
Carmen Rasche, Universitätssekretärin – backt nach neuen Rezepten
Markus Schneider, Kriminaloberkommissar – kann sich nicht entscheiden
Die Kripo
Walther »mit th« Langenargen, Kriminaloberrat – gibt dem Nachwuchs eine Chance
Dolf Mesmer, Kriminaloberkommissar – versagt auf ganzer Linie
Andreas Farnschläger, Kriminaloberkommissar – hängt sein Mäntelchen nach dem Wind
Harald Kaul, Kriminalkommissar – entnimmt alle Weisheiten dem Computer
Peter Paulsen, Kriminaloberkommissar – macht endlich seinen Mund auf
Dr. Simone Winterthur, Kriminalrätin – kontrolliert die Polizei vor Ort
Kevin Beaumont, Kriminalkommissar – hat alles Zeug zum Polizeipräsidenten
Manfred Schumacher, Kriminalkommissar – ist ein braver Mitläufer
Roman Roselski, Polizeioberkommissar – verfolgt das Sportereignis des Jahres
Dieter Derenthal, Polizeikommissar – sollte etwas für seine Figur tun
Das Publikum
Katharina Markenbeck – betreibt eine Papierhandlung in Poppelsdorf
Jan Brockhoff – beschäftigt sich mit Rockmusik auf schwarzen Scheiben
Susanne Achter, Physikerin – versucht sich an der Teleportation von Kleinstteilen
Konrad Krawczyk, Physiker – verrennt sich auf dem Häusermarkt
Hans-Otto Wienand, Pfarrer – stirbt vor Ferienende
Der Arzt
Prof. Dr. Harald Altendorf, Rechtsmediziner – schätzt die Texte amerikanischer Rapper
Die Bauern
Josef Bachem – ist Großgrundbesitzer aus Leidenschaft
Elke Tersteegen, geborene Bachem – liebt das mondäne Leben
Hubert Schmitz – verteilt gerne Visitenkarten
Helmut Klein – überlebt ein ausgelassenes Fest nicht
Die Junkies
Thomas Reifferscheid, Immobilienmakler – beschäftigt sich mit weißen Linien
Pascal Waffenschmidt, Outlet-Center-Mitarbeiter – jagt sein Geld durch die Nase
Die Studenten
Manfred – versucht sich als Spion
Martin – macht den Hof
Johanna – vernachlässigt ihr Studium
Ursula – fällt keine Entscheidungen
Der leere Gartenstuhl
Samstag, 28. Mai 2016 – Bonn. Jan war weg. Eben hatte er noch im Liegestuhl im Garten gesessen, an seinem Lieblingsplatz vor der Buchenhecke, mit dem Rücken zum Gartentor, den Blick auf die von der großen Catalpa beschattete Terrasse gerichtet.
Der Liegestuhl war leer; auf dem Rasen lag die aktuelle Ausgabedes General-Anzeigers. Der Becher Tee, den Jan vorsichtig auf dem unebenen Boden abgestellt hatte, war umgestürzt und hatte die Bonner Tageszeitung durchnäßt.
Katharina stand auf der Terrasse und versuchte, mit zusammengekniffenen Augen zu erkennen, ob das Gartentor zum Gehweg vor der nächsten Häuserreihe hin abgeschlossen war. Der Schlüssel war jedenfalls nicht zu sehen. Also war das Tor zu. Sie trat wieder ins Wohnzimmer.
Im Haus war nichts zu hören. Kein Wasserrauschen aus dem Bad, keine Musik aus Jans Arbeitszimmer unter dem Dach, kein Rumoren aus dem Keller, in dem sie gerade noch gewesen war. Aber in diesem Haus konnte man durchaus auch aneinander vorbeilaufen, worüber sie sich schon mehrere Male amüsiert hatten.
Katharina ging nach vorne zum Küchenfenster und sah auf die Straße. Schräg gegenüber spielten einige Kinder auf dem Bürgersteig vor der geduckten Holzkirche mit dem roten Ziegeldach. Einmal war sie drin gewesen, aber für sie mußten Gotteshäuser immer hoch sein, am besten romanisch und nach Möglichkeit innen ohne viel Schmuck.
Vor dem Haus lagen die Parkplätze der Reihenhausbewohner. Ihr kleiner roter Mini Cooper stand an seinem angestammten Platz in Verlängerung des Gehwegs zur Haustür. Jans Auto, ein neuer dunkelblauer Audi Kombi, war dagegen weg.
Sie überlegte. Hatte sie vielleicht einen Termin übersehen? Auf dem Eßtisch im Wohnzimmer stand ihr Notebook. Sie hatte sich mit den letzten Umsatzzahlen ihrer kleinen Poppelsdorfer Buchhandlung befaßt – die Geschäfte stagnierten, und sie machte sich Sorgen. Der Kalender, in dem ihre und Jans Termine mit unterschiedlichen Farben eingetragen waren, war für das Wochenende leer. Also keine Verabredung mit einem seiner Musik-Afficionados, wie er das nannte.
Katharina seufzte.
Was hatte Jan vorhin noch gesagt, als sie sich wieder einmal über die mangelnden Perspektiven ihres Berufes gestritten hatten? »Du mit deiner Altpapierhandlung.« Das hatte schon weh getan. Sie liebte ihr Geschäft, die vielen interessanten Kunden und ihre Unabhängigkeit. Aber Jan hatte in den letzten Jahren immer wieder Geld zuschießen müssen – was ihm nie schwergefallen war, besaß er doch genug davon. Seine Eltern waren früh gestorben und hatten ihm aus ihrer alteingesessenen Bonner Firma ein Millionenvermögen hinterlassen, das ihm ein sorgenfreies Leben ermöglichte. Das Geld hatte er geschickt angelegt und sich dann wieder seinem Hobby zugewandt, der Pflege einer für ihren Geschmack viel zu großen Schallplattensammlung mit seltenen Aufnahmen bekannter und unbekannter Rockmusiker. Im Keller und in seinem Zimmer stapelten sich über zweieinhalbtausend Platten, sorgfältig katalogisiert und sortiert. Ständig war er auf der Suche nach fehlenden Exemplaren für seine Sammlung, studierte Fachzeitschriften und besuchte Schallplattenbörsen im In- und Ausland. Manchmal fuhr sie mit, ging dann aber doch wieder alleine ins Museum, während Jan irgendeine obskure Halle im Industriegebiet der Stadt nach Raritäten durchstöberte.
Vielleicht war er eingeschlafen? Jan konnte zu den unmöglichsten Tageszeiten ein Nickerchen machen. Dabei war er doch erst fünfunddreißig und arbeitete nicht wirklich, im Gegensatz zu ihr.
Katharina stand vom Eßtisch auf und ging einen Stock höher, ins Schlafzimmer. Im Flur betrachtete sie sich im Spiegel: fuchsrote Haare, blasser Teint, ansehnliche Figur; man sah durchaus, wo vorne war, jedenfalls – da war sie sicher – dachten das sicher die männlichen Besucher ihrer Buchhandlung, die immer etwas länger als eigentlich nötig bei ihr an der Kasse zubrachten. Außerdem ein winziger Bauchansatz – hier ein Stückchen Kuchen zuviel, dort ein Glas Mineralwasser zu wenig. Ihre morgendlichen Fahrradfahrten von der Fahrenheitstraße nach Poppelsdorf mußte sie dringend wieder aufnehmen – die knapp fünf Kilometer bis zur Buchhandlung waren doch mit links zu schaffen.
Jan war auch nicht im Schlafzimmer. Die Tagesdecke aus der Provence lag ordentlich auf dem großen Bett; das Rollo war leicht herabgelassen; Jans Hausschuhe sahen unter seinem Nachttisch hervor. An der Wand neben dem Bett auf ihrer Seite hing ein großes Foto, auf Leinwand gezogen, das sie und Jan zeigte. Jans dunkle Locken waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden; er hatte ein T-Shirt mit dem Logo einer seiner Rockgruppen an und grinste in die Kamera. Seinen rechten Arm hatte er besitzergreifend um ihre rechte Schulter gelegt, so daß sie leicht schief stehen mußte. Glücklich sahen sie beide aus. Das war allerdings inzwischen vier Jahre her.
Sie hatte ihn wirklich geliebt; vielleicht tat sie es auch immer noch, nur nicht mit der gleichen Intensität wie zu Anfang. Jan war so ganz anders als sie. Er hatte Humor, verrückte Ideen und sah gut aus. Sein Geld hatte sie nie interessiert. Jan hatte relativ spät von seinem Vermögen erzählt – erst als er sicher war, daß sie ihn nicht deswegen haben wollte. Sie waren nach drei Monaten zusammengezogen. Er hatte seine Wohnung in Bonn-Castell aufgegeben – die Rheinschiffe mit ihren Dieselmotoren waren ihm immer zu laut gewesen – und war zu ihr in ein ruhiges Reihenhaus auf dem Brüser Berg gezogen. Der Bonner Höhenortsteil war ab Mitte der siebziger Jahre aus dem Boden gestampft worden, und man merkte ihm an, daß er auf dem Reißbrett entstanden war. Aus den kahlen waren inzwischen allerdings grüne Wohnstraßen geworden, und Katharina hatte Glück gehabt, daß sie ein relativ preiswertes und zudem noch renoviertes Haus gefunden hatte. Ein vertikaler blauer Farbstreifen an der Fassade stützte gewissermaßen den Giebel und verlieh dem Haus eine fröhliche Note, außerdem bot ihr ein kleiner Garten sogar ausreichend Raum, ihrer gärtnerischen Neigung nachzugehen.
Bis Jan in ihr Leben trat. Danach gab es irgendwie weniger Zeit für alles.
Ganz allmählich war dann der graue Ehealltag eingekehrt, auch wenn sie nicht verheiratet waren: Aufstehen mit Wecker, Einkäufe im Supermarkt, Urlaub in den Ferien, wenn es am teuersten war und nur wenige Bücherkäufer in Bonn geblieben waren, denn nur dann konnte sie ihre Buchhandlung einer Mitarbeiterin übergeben, Familienfeiern … Katharina fragte sich, ob das immer so war oder ob es jemanden gab, mit dem zusammen das innere Feuer nie nachlassen würde.
Sie setzte sich auf die Bettkante.
Etwas knisterte.
Als sie die Bettdecke zurückschlug, entdeckte sie auf ihrem Kopfkissen einen zusammengefalteten Zettel, wohl mit Absicht dort versteckt, damit sie ihn erst abends finden konnte.
»Irgendwann reicht es. Ich wohne nicht hier, um mir meine Art zu leben vorhalten zu lassen. Ich brauche Abstand und eine Pause von Dir. Ich melde mich. J.«
Katharina mußte das Blatt zweimal lesen, um seinen Inhalt zu verstehen. Dann fing sie an zu weinen.
Unten klingelte es an der Haustür.
Katharina wischte sich die Tränen von den Wangen, strich ihren Rock glatt und ging hinunter. Sie öffnete. Draußen standen zwei Polizisten in Uniform.
Französisches Flair
Donnerstag, 19. Juli 1979 – Rheinbach-Neukirchen. Josef Bachem stand, auf die große Gabel gestützt, neben dem Misthaufen und sah den Neuankömmling mißtrauisch an. »Was willst du hier?« Bachem duzte jeden; manchmal verwendete er die veraltete Form »Ihr«, die auf dem Land aber immer noch zum Alltagssprachgebrauch gehörte, jedenfalls bei den Einheimischen.
Der junge Mann zögerte. Ihm war wohl bewußt, daß er hier eigentlich fehl am Platz war. Er sah an sich hinunter: Baumwollhemd mit grau-weißem Muster, die Ärmel hochgekrempelt, blaue Jeans, Jesus-Latschen, barfuß. Dazu kamen wahrscheinlich seine langen, bis auf die Schulter reichenden dunkelbraunen Locken, die sein Gegenüber abschätzig betrachtete. Immerhin war er sorgfältig rasiert; das hatte er heute morgen noch geschafft, bevor er Hals über Kopf das Haus verlassen hatte. Neben sich hatte er seinen alten Rucksack abgestellt. Er war den Weg von der Hauptstraße des kleinen Dorfes zu Fuß hochgekommen und hatte sich noch über einen Straßennamen gewundert. Meerkatz. Wo der wohl herkam?
Das kleine Anwesen des Bauern lag an einem Hang und bestand aus Wohnhaus, Schuppen und einer kleinen Scheune, alles aus Fachwerk. Bei gutem Wetter gab es bestimmt einen großartigen Fernblick, vielleicht sogar bis zum Kölner Dom. Der Weg zur Haustür an der Längsseite war nur geschottert. Wie man im Winter wohl hierhin gelangte? Na ja, die Bauern fuhren alle Traktor, und damit kam man überall hin, dachte der junge Mann. Er räusperte sich.
»Ähm, haben Sie Arbeit für mich?«
Der Bauer musterte ihn. »Du siehst aber nicht so aus, als hättest du jemals gearbeitet, mit den Händen, meine ich.«
»Doch, doch«, sagte der junge Mann. »Auf dem Bauernhof meiner Großeltern.« Er verschwieg allerdings, daß das schon Jahre her war.
»Arbeit jetzt, im Sommer? Die Ernte ist erst Ende August, Anfang September, hängt davon ab, wie das Wetter wird und wie heiß es ist. Und überhaupt, hast du denn keinen Beruf?«
»Semesterferien.« Er überlegte und hielt es für angebracht, eine Art Vertrauen herzustellen, damit dem Bauern eine Absage schwerer fiele, indem er erklärte: »In den Semesterferien gibt es in der Universität keinen Unterricht; man muß dann Referate schreiben und kann in der übrigen Zeit Geld verdienen.«
Das war die falsche Bemerkung. Sofort sagte der Bauer: »Geld habe ich keines, jedenfalls nicht für andere Leute.«
Der junge Mann führte seine Taktik fort: »Ich heiße übrigens Martin, aber alle nennen mich Matte, wegen der Haare.« Sein Grinsen wurde etwas schief.
Bachems Gesicht blieb ausdruckslos. »Josef Bachem«, sagte er und kratzte sich am Kopf. »Andererseits, wenn dir ein Bett und Essen reichen würden …«
»Klasse!« sagte Martin. »Wann soll ich anfangen?«
Der Bauer sah auf seine Armbanduhr. »Schon halb sechs. Morgen, würde ich sagen. Ich zeige dir dein Zimmer.« Er lehnte die Mistgabel an die Wand der Scheune und drehte sich um, ohne abzuwarten, ob Martin ihm auch folgte.
Im rechten Winkel zum Schuppen stand der alte Bauernhof, ein hübscher Fachwerkbau, der dringend renoviert werden mußte. Mehrere der schwarz gestrichenen Balken wiesen Risse auf, der Putz blätterte an vielen Stellen zwischen den Balken von den meist rechteckigen, weiß gekalkten Flächen ab, und zwei Fensterscheiben waren zersprungen. Eine Scheibe war notdürftig mit braunem Packpapier wieder zugeklebt worden.
Der Bauer stieß die Holztür zum Haus auf und verschwand nach drinnen. Martin beeilte sich, ihm zu folgen.
Drinnen war Bachem schon die halbe Holztreppe nach oben gestiegen. Eine Tür knarrte, dann rief er: »Wo bleibst du denn?«
Martin trat ins Zimmer, wobei Kammer der bessere Ausdruck war: ein kastenförmiges Bett, ein klappriger Tisch mit klapprigem Stuhl, eine alte Kommode, auf der tatsächlich altes Waschgeschirr stand, ein fleckiger Spiegel, wohl Mahagoni, ein Kruzifix mit vertrocknetem Zweig dahinter an der Wand, Dielen. Das Fenster mußte dringend geputzt werden, so undurchsichtig waren die Scheiben. »Hübsch«, sagte er.
Bachem sah erfreut auf. »Du bist der erste, der das sagt. Warte, ich hol’ dir Bettwäsche.«
Martin stellte seinen Rucksack ab. Neben der Flurtür stand noch ein alter Schrank, der beim Öffnen fürchterlich knarrte. Er war leer bis auf ein paar Bügel. Einer trug die hier in der Eifel völlig deplatziert wirkende Aufschrift »Ritz, Paris«.
Der Bauer kam zurück und warf die Wäsche aufs Bett. »Ums Abendessen mußt du dich selbst kümmern. Mit Besuch habe ich nicht gerechnet. Von wo kommst du überhaupt?«
»Aus Süddeutschland«, sagte Martin und verschwieg bewußt seinen Heimatort. »Ich studiere in Freiburg.«
Bachem musterte ihn. »Bist du dafür nicht schon ein bißchen zu alt?«
Martin wurde blaß. Mist, der Bauer beobachtete besser, als er gedacht hatte. »Nein, Abitur mit neunzehn, dann Bundeswehr, ich hatte mich für zwei Jahre verpflichtet, wegen der Abfindung, dann einen Sommerjob bis zum Wintersemester. Momentan arbeite ich an meiner Doktorarbeit.« Und an meinem Wortschatz, dachte er.
»Geht mich auch nichts an«, sagte Bachem, »warum du jetzt hier und nicht bei deiner Liebsten bist.«
Martin sah ihn verblüfft an. »Woher …?«
»Der Ringfinger mit dem fehlenden Ring.« Bachem deutete auf Martins rechte Hand. »Die Haut ist heller da.«
Ziemlich merkwürdig, dachte Martin. Sherlock Holmes auf dem Dorf? Um abzulenken, fragte er: »Gibt es hier denn ein Restaurant?«
Bachem lachte. »Das nächste ordentliche gibt es in Bad Münstereifel, aber die »Vier Winde« müßten offen haben. Du fährst«, er unterbrach sich, »du hast doch ein Auto?«
Martin nickte. »Einen alten R 4. Steht unten an der Hauptstraße.«
»Paß auf. Du fährst Richtung Scheuren, also durch unser Dorf. Nach ungefähr anderthalb Kilometern kommt eine Kreuzung. Links siehst du dann das kleine Gasthaus. Dort gibt es den besten Kartoffelsalat hier in der Gegend. Aber sag besser nicht, daß du von mir kommst.«
»Danke«, sagte Martin und wunderte sich. Wo er hier wohl gelandet war?
Eine halbe Stunde später saß der junge Mann hinter dem kleinen Lokal in einem kleinen Garten, vor sich ein kleines Bier und eine große Portion Kartoffelsalat mit zwei exquisiten Bockwürsten.
Die »Gaststätte zu den vier Winden« lag verkehrsgünstig am Schnittpunkt der Landstraße zwischen Rheinbach und der Eifel und der Verbindung zwischen Euskirchen und der Ahr. Martin hatte an der holzverkleideten Theke sein Essen bestellt und war über die beiden Stufen nach draußen gegangen.
Trotz des guten Wetters war absolut nichts los. Nur zwei Motorradfahrer aus Köln, wie den Nummernschildern der schweren Maschinen zu entnehmen war, hatten einen weiteren Tisch besetzt. Die hübsche Wirtstochter – denn das war sie wohl – hatte ziemlich lange an seinem Tisch zugebracht, bis Besteck, Serviette und Bierglas um den überladenen Teller herum zu ihrer Zufriedenheit arrangiert waren. Jetzt kam sie schon wieder.
»Alles recht?«
Martin zerkaute ein »Lecker!« mit vollem Mund. Der Bauer hatte nicht zuviel versprochen.
»Zahlen«, rief einer der Motorradfahrer.
Die junge Frau nickte Martin zu und ging nach drinnen. Gleich darauf kam sie mit einem Block zurück, addierte die Getränke und zwei Portionen Kartoffelsalat mit Würstchen – vielleicht konnte der Koch nur dieses eine Gericht, dachte Martin – und sagte: »Fünfzehn Mark achtzig.«
Der ältere der Motorradfahrer bezahlte, dann standen beide auf und gingen zu ihren Maschinen. Mit einem Höllenlärm verließen sie das Grundstück und verschwanden Richtung Schuld.
»Die waren ja noch harmlos«, sagte die junge Frau.
Martin warf ihr einen fragenden Blick zu.
»Nur zwei Bier, keine blöden Bemerkungen, etwas Trinkgeld«, sagte sie und lächelte. »Kann ich dir noch etwas bringen?«
Die Bevölkerung auf dem Land konnte auch sehr nett sein, dachte Martin. Aber dann fiel ihm wieder die letzte Szene zu Hause ein, und er seufzte unwillkürlich. Um das zu überspielen, sagte er schnell: »Gerne. Noch ein Kölsch, aber dieses Mal ein großes, bitte.«
Die junge Frau ging wieder ins Haus und kam so schnell wieder, als ob das gewünschte Getränk schon hinter der Tür bereitgestanden hatte. Sie hielt das Glas schräg und ließ das Bier aus der Flasche langsam hineinlaufen.
»Nicht gezapft?« fragte Martin.
»Ein Faß ist gerade leer, und ein neues machen wir erst am Wochenende auf. Unter der Woche ist bei uns nicht so viel los.« Sie betrachtete den jungen Mann prüfend. »Du bist aber nicht von hier?«
»Nein, aus Freiburg. Ich wollte ein paar Tage in der Eifel bleiben, ausspannen und dann wieder nach Haus.« Dieses Mal ging ihm die Lüge leichter von den Lippen.
Die Wirtstochter setzte sich ungefragt. »Es ist selten, daß wir hier Gäste von so weit weg haben.« Sie deutete auf den Renault. »Da steht aber BN drauf. Das heißt doch Bonn? Oder hat Backnang bei Stuttgart das gleiche Kennzeichen?« Sie lächelte und sah dabei sehr hübsch aus.
Martin mußte lachen. »Ist ein Leihwagen. Bis Bonn bin ich Zug gefahren und habe dann das Auto eines Freundes aus Freiburg bekommen, der nach Bonn gezogen ist.« Puh, das war knapp. »Und was treibst du so?«
Sie legte den Kopf schief: »Was glaubst du denn?«
»Studentin in Bonn. Oder Buchhändlerin in Rheinbach. Wie heißt du eigentlich?«
»Johanna. Und du?«
»Martin«, sagte Martin, »aber alle nennen mich Matte.« Er band seine langen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen.
Johanna lachte. »Das liegt ja nun gar nicht auf der Hand. Studentin stimmt übrigens. Englisch und Geschichte. In den Ferien arbeite ich meistens hier bei meinen Eltern. Was machst du denn überhaupt und was die nächsten Tage?«
Gar nicht direkt, dachte Martin. »Ebenfalls studieren. Und jetzt arbeiten. Auf dem Bauernhof.«
Johanna machte große Augen. »Hier in der Eifel?«
Martin nickte. »In Neukirchen.«
Johanna schüttelte sich. »In dem Dorf, wo alle paar Jahre jemand verschwindet?«
»Im Ernst? Wer denn?«
»Zuletzt ein junger Mann. Vor zwei Jahren. Hat bei einem Bauern gearbeitet und war von einem Tag auf den anderen weg. Wieder nach Aachen zurück, sagte der Bauer.«
»Welcher Bauer denn?«
»Josef Bachem.«
Das Institut der verschwundenen Dinge
Freitag, 27. Mai 2016 – Bonn. »Higgs«, sagte Krawczyk.
»Gesundheit«, sagte Professor Armin Bretten, der schon die Doktorarbeit seines Mitarbeiters betreut hatte.
»Danke, aber ich meinte eigentlich Higgs-Boson, wobei Higgs das doch eigentlich allein entdeckt hat, aber eigentlich …« Krawczyk verlor seinen Stil und den Faden, woraufhin er schwieg.
»Ist auch egal«, sagte Bretten, »steht sowieso alles bei Wikipedia. Wobei – die Higgs-Boson-Sache sollte Ihnen alleine deswegen gegenwärtig sein, weil sie auch die großen Feuilletons erreicht hat, Gottesteilchen und so. Ihr zweites Fach ist doch Theologie, oder?«
»Das hilft uns aber immer noch nicht weiter«, warf Susanne Achter ein. Die hübsche Studentin war eine hervorragende Physikerin und bei den Mitarbeitern wie Studenten am Bonner Institut für Angewandte Physik ausgesprochen beliebt. Sie kam zu allen Institutsfesten und war – ganz im Sinne der Emanzipation, fand Krawczyk – keine Kostverächterin. Allerdings hatte sie es in den ersten acht Semestern auf acht Kommilitonen gebracht, mit denen sie enger befreundet gewesen war. Als jemand das herausgefunden und sie als »Deutschland-Achter« bezeichnet hatte, war das Resultat eine blutige Nase gewesen. Krawczyk war nämlich der Meinung gewesen, es müsse Grenzen geben. »Alles platonisch«, hatte Susanne gesagt, »das meiste jedenfalls.«
»… im Raum zu teleportieren«, sagte die Physikerin gerade.
Krawczyk versuchte, ihrem Gedankengang zu folgen. Bestimmt hatte sie von Zeilingers Experimenten gesprochen. Der Wiener Wissenschaftler hatte es mit anderen zusammen vor kurzem tatsächlich geschafft, Quanten über eine Entfernung von 143 Kilometern von Palma nach Teneriffa zu versetzen. Wenn man das hochrechnete, war es in fünfzig Jahren bestimmt möglich, auch Gegenstände, zumindest kleinere, zu versetzen – falls man nicht vorher schon über eine entscheidende Entdeckung stolperte.
»Jetzt müssen wir seine Ergebnisse nur noch auf feste Materie anwenden und, schwups, können wir die Teleportation industriefähig machen.« Sie strahlte.
»Schwups«, sagte Professor Bretten und warf ihr einen strafenden Blick zu. »Können Sie sagen, wie lange Sie dafür in etwa brauchen?«
»Und was wird dann aus der Deutschen Post? Bei der Teleportation, meine ich«, fragte Krawcyk.
Alles lachte. Die Stimmung im natürlich auf Englisch stattfindenden Kurs »Advanced Topics in High Energy Particle Physics« war unter den elf Studierenden und dem Professor immer sehr locker.
»Jetzt mal im Ernst«, sagte Bretten. »Gibt es tatsächlich Fortschritte bei Ihren Experimenten, Fräulein Achter?« Bretten sagte tatsächlich »Fräulein«, allerdings sah ihm das jeder nach. Bretten war dreiundsechzig, klein, dick, hatte volle weiße, stets zu lange Haare und einen weißen Vollbart. Außerdem stammte er aus Wien und lag der Damenwelt zu Füßen – oder diese ihm, das wußte man nie so genau.
»Das weiß ich nicht so genau«, sagte Achter, was bemerkenswert unpräzise für sie war.
Bretten musterte sie. »Verschweigen Sie mir etwas?«
»Ganz und gar nicht, Herr Professor. Es ist nur so, daß ich nicht genau sagen kann, ob wir Fortschritte machen.«
Ein durchbohrender Blick von Bretten folgte diesem Satz. »Wer ist wir?«
Die Studentin wurde rot. »Ich dachte, das wüßten Sie. Konrad und ich arbeiten doch zusammen.«
»Unterstützt Herr Krawczyk Sie auch dabei?« Bretten konnte auch, wie es in Bonn hieß, fies sein.
»Professor Bretten«, Achter holte tief Luft, »Sie selbst haben die Genehmigung unterzeichnet, zusätzliche Drittmittel für die Einrichtung einer zweiten Doktorandenstelle und für das Equipment bei diesem Experiment zu beantragen.«
Bretten brummte etwas in seinen Bart, das beim besten Willen nicht zu entschlüsseln war.
Krawczyk sagte: »Wenn ich dazu etwas sagen darf …«
Bretten warf ihm einen aufmunternden Blick zu.
»Wir haben bis aufs tz …«
»Das wie immer fehlt«, sagte einer der anderen Studenten.
Susanne Achter mußte lachen.
»… die Versuchsanlage aus Mallorca nachgebaut.«
»Aus oder auf Mallorca? Bei den großzügigen Drittmitteln, meine ich.« Das war erneut der vorlaute Student.
»Kann ich jetzt vielleicht mal den Bericht von Herrn Krawczyk zu Ende hören?« sagte Bretten.
»Ein Probebetrieb verlief problemlos. Wir wollen nun versuchen, ein Nanoteilchen ein Stückchen zu bewegen. Das Problem dabei ist, diese Bewegung nachvollziehbar im Bild festzuhalten. Sie wissen selbst, Professor Bretten, daß dazu eine hochempfindliche und hochauflösende Spezialkamera nötig ist, die wir bislang noch nicht haben, die aber beantragt ist, damit …«
»Danke«, sagte Bretten. »Sonst noch etwas?« Er sah auf die Uhr. »Ich muß gleich weg, zum Hauptbahnhof. Wien ruft. Dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder.« Er stand auf.
Krawczyk sah zu Susanne hinüber. »Hast du noch Zeit? Von mir aus können wir mit dem Experiment fortfahren.«
Susanne nickte, nahm ihre Tasche und stand auf.
Im vierten Stock des Hochhauses an der Wegelerstraße, das im Bonner Gründerzeitviertel seltsam fehl am Platz wirkte, lagen die Laborräume des Instituts für Angewandte Physik. Wenigstens sorgten die hohen Bäume an der Straße und im großen Hof der Universitätsanlage für ein bißchen Grün. Das wuchtige Gebäude erinnerte eher an ein Krankenhaus denn an einen modernen Lehr- und Lernkomplex. Auf der Rückseite befand sich, etwas versteckt, der Eingang zur Physik, da der Haupteingang von der Straße her dem Hochschulrechenzentrum vorbehalten war.
Die jungen Leute hatten ihre Laborkittel angezogen und waren mit der Justierung der Apparaturen beschäftigt. Ihre beiden MacBooks waren eingeschaltet und die Jalousien zum Flur heruntergezogen. Ein bißchen roch es, fand Krawczyk, wie in seinem Jugendzimmer, wenn seine elektrische Eisenbahn aufgebaut war – irgendwie nach Strom.
Susanne riß ihn aus seinen Gedanken. »Kannst du mir mal helfen?« Sie deutete auf ein kleines Kästchen mit zwei mechanischen Schiebereglern.
»Du willst doch nicht im Ernst statt der Quantenmechanik simple Mechanik einsetzen?« fragte Krawczyk.
»Doch, will ich. Nur aus Verrücktem entsteht Geniales – oder so ähnlich. Albert Einstein.«
Ihr Kommilitone lachte. »In seiner blauen Phase, meinst du, am Tresen?«
Susanne grinste.
Wenn man den beiden jungen Leuten nur zuhörte, würde man nie vermuten, daß sie mit der komplizierten Materie ihres Fachs mit Leichtigkeit umgingen, so alltäglich waren ihre Sprüche und gegenseitigen Frotzeleien. Kam es aber darauf an, waren sie hochkonzentriert. Meistens jedenfalls.
»Hier, halt mal«, sagte die junge Frau fröhlich.
»Glaubst du wirklich, daß wir beiden Physikusse, die wir nicht einmal aus dem akademischen Mittelbau stammen, höchstens aus dem Unterbau, etwas Einmaliges schaffen können?«
»Wenn nicht wir, wer dann?« Susanne fügte die Steckverbindungen zweier Kabel aneinander. »Aber stell dir das doch mal vor: Wenn es tatsächlich funktioniert, wenn wir irgendwann Materie bewegen können, welche fantastischen Möglichkeiten sich dann auftun, in allen Lebensbereichen.«
Krawczyk sah sinnierend aus dem Fenster. Unten standen vier farblich verschiedene Mülltonnen. Auf der schwarzen saß, kaum zu sehen, eine schwarze Katze, weil es dort wahrscheinlich am wärmsten war.
»Hörst du überhaupt zu?« fragte Susanne. Sie schaltete die Anlage ein. Ein intensives Summen erfüllte den Raum.
»Doch, doch. Wenn das mit dem Nanoteilchen klappt, dann müssen wir es mit Größerem probieren, dann irgendwann mit Lebewesen.«
»Genau, ein Goldfisch aus dem einen Goldfischglas ins nächste zu verpflanzen …«
»Nein, im Ernst. Wo hörst du auf, ethisch, meine ich? Bei Menschen? Wenn du sie teleportieren kannst, dann kannst du sie auch verschwinden lassen.« Er überlegte.
Susanne trat vor ihn. »Laß mal die Grübeleien. Wir beginnen mit etwas Handfestem, Herr Doktor.« Sie legte die Arme um ihn und begann, ihn zu küssen.
Krawczyk schloß seine Augen und erwiderte den Kuß. Mit dem Rücken stand er zur Versuchsanordnung. Ohne es zu merken, bewegte Susanne ihn näher an den Tisch heran. Sein Rücken berührte den kleinen Kasten mit den Schiebereglern.
Seine Freundin hatte inzwischen ihre Zunge zur Unterstützung genommen, was Krawczyk seinerseits dazu veranlaßte, Susanne noch näher zu sich zu ziehen. Fast lag er auf den Reglern, die dadurch allmählich bis zum Anschlag geschoben wurden.
Plötzlich gab es einen Knall, und Anlage wie Licht gingen aus.
»Mist«, sagte Susanne, löste sich von ihrem Freund und ging zum Schaltkasten. »Die Sicherungen sind draußen. Bei allen.« Sie lächelte.
Krawczyk sah wieder hinaus. Die Katze war weg.
R2D2
Samstag, 28. Mai 2016 – Bonn. »Ja, bitte?« Katharina war irritiert. Den letzten Polizeiwagen in ihrer Straße hatte sie gesehen, als Frau Weber von gegenüber nach einer Diebstahlsanzeige, zu der die alte Dame persönlich auf der Wache vorgesprochen hatte, wieder nach Hause gebracht worden war.
»Dürfen wir ’reinkommen?« fragte der ältere der beiden Beamten.
Katharina zögerte. Wenn sie nein sagte, war das bestimmt verdächtig. »Falls es nicht lange dauert; ich bin nachher noch verabredet.« Sie führte die beiden Polizisten in die Küche. »Im Fernsehen finden die Verhöre doch immer in der Küche statt, oder?«
»Das hängt davon ab, was es zu essen gibt.« Der jüngere Polizist versuchte, die Atmosphäre etwas aufzulockern. »Obwohl, ein Kaffee tut es auch.«
»Reicht auch ein Espresso?« fragte Katharina. Dann ist das Gespräch schneller wieder vorbei, dachte sie.
Die Beamten nickten und setzten sich ungefragt an den Küchentisch.
Katharina betätigte die Knöpfe der etwas teureren Maschine, die Jan unbedingt hatte kaufen wollen und die sie inzwischen auch zu schätzen gelernt hatte. Sie stellte zwei Tassen mit dem duftenden äthiopischen Bonga Forest Wildkaffee aus Hamburg vor die beiden Herren und nahm mit einer eigenen Tasse gegenüber Platz. »Was gibt es denn so Wichtiges am Samstagnachmittag, wenn eigentlich gleich die Bundesliga anfängt?«
Der junge Beamte hatte anscheinend den Eröffnungszug. »Das riecht ja großartig!« Er nahm einen kleinen Schluck, nachdem er drei Löffel Zucker hineingetan und ordentlich umgerührt hatte. »Ich bin einer von den Süßen«, fügte er überflüssigerweise hinzu. »Können Sie uns sagen, wie Ihr Verhältnis zu Ihren Nachbarn ist? Ach, vorher noch das Übliche – mein Name ist Roselski, Roman Roselski, und das ist mein Kollege Dieter Derenthal.« Daß sie im Polizeipräsidium R2D2 genannt wurden, verschwieg er.
»Warum fragen Sie?« wollte Katharina wissen. »Eigentlich sind die Nachbarn okay. Für die alte Frau Weber gegenüber kaufe ich manchmal ein; für Familie Hoffer nebenan nehme ich Pakete an; mit Familie Schmidt ein Haus weiter grillen wir einmal im Jahr.«
»Was ist mit Herrn Bachem auf der anderen Seite Ihres Hauses?« fragte Derenthal.
Katharina wurde blaß und hoffte, daß man das bei ihrer Gesichtsfarbe nicht unbedingt sehen konnte. »Wir reden nicht miteinander.«
»Nicht oder nicht mehr?« fragte Roselski.
»Nicht mehr«, war Katharina gezwungen zu antworten. Sie preßte die Lippen zusammen.
»Also keine gute Beziehung?« fragte Derenthal. Die beiden Beamten mußten wohl abwechselnd reden.
»Wenn ich ehrlich bin, gar keine.« Sie schwieg.
»Hat das Gründe?« fragte Roselski. »Oder haben Sie sich, nun, auseinandergelebt? Zu lange in einer Reihenhausreihe …«
»Roselski!« sagte Derenthal. »Wir sind aus ernstem Anlaß hier.« Er sah Katharina fast väterlich freundlich an. »Antworten Sie bitte meinem Kollegen.«
»Wir sind vor fast vier Jahren hierhin gezogen, das heißt, Jan ist zu mir gezogen. Vorher habe ich hier alleine gewohnt.«
»Wer ist Jan?« fragte Roselski.
»Mein Freund«, sagte Katharina.
»Ist er auch hier?«
»Nein; er mußte noch einmal in die Stadt.« Ob man ihr ansah, daß sie log? Sie hatte keine Ahnung, wohin Jan gefahren war – wahrscheinlich zu einem seiner Rockkumpel, entweder Achim in Düsseldorf, Frank in Essen oder … Sie wurde unterbrochen.
»Das Verhältnis zu Herrn Bachem«, erinnerte Derenthal.
»Dem paßten wir nicht. Ich nicht, weil ich einen Freund hatte – Herr Bachem lebt allein; Jan und ich nicht, weil wir auch mal mit Freunden im Garten sitzen und reden, im Sommer auch mal länger und auch mal lauter; Jan nicht, weil er seine Rockmusik manchmal voll aufdreht; weil …«
»Das ist doch alles Kleinkram«, sagte Roselski.
»Warum wollen Sie das überhaupt wissen?« fragte Katharina irritiert. »Soviel ich mitbekommen habe, ist Herr Bachem sowieso verreist.«
»Der wird auch nicht wiederkommen«, sagte Derenthal.
»Weil er nämlich tot ist«, ergänzte Roselski.
Katharina wurde noch blasser.
»Ist Ihnen nicht gut, Frau«, Derenthal mußte auf seinen Zettel sehen, »Markenbeck?«
»Doch, danke, es geht schon. Vielleicht erzählen Sie einfach mal der Reihe nach. Wenn Sie immer so unstrukturiert arbeiten …«
Roselski sah sie vorwurfsvoll an. »Wir haben schon unsere Gründe.« Man mußte ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen und lieber sein Gegenüber, gerade bei diesen Anwohnerbefragungen, auch mal aus der Reserve locken. »Also, Josef Bachem …«
»Ich wußte nicht einmal seinen Vornamen«, sagte Katharina. »Klingt nach Vorkriegszeit.«
»Nicht ganz«, sagte Derenthal und sah wieder auf seinen Zettel. »Josef Bachem ist Jahrgang 1944 und hat fast sein ganzes Leben in der Eifel verbracht, genauer gesagt, in Neukirchen.«
Auf Katharinas fragenden Blick hin fügte er hinzu: »Großraum Rheinbach / Bad Münstereifel. Er hatte dort von seinen Eltern einen Bauernhof geerbt, den er bis zur Rente selbst bewirtschaftet hat. An seinem 65. Geburtstag ist er nach Bonn gezogen. Warum ausgerechnet Bonn, wissen wir nicht. Verwandte hatte er wohl keine mehr.«
»Dann muß er kurz vor mir nebenan eingezogen sein«, sagte Katharina, die mitgerechnet hatte. »Aber warum sind Sie hier, wenn er doch tot ist?«
»Weil er ermordet worden ist«, sagte Roselski.
Katharina wurde noch blasser.
Gleich hat sie die Farbe, für deren künstliche Herstellung Villeroy & Boch viel Geld ausgeben, dachte Derenthal.
»Ich meine, wieso? Wer hat denn …« Sie verstummte wieder und sah ratlos aus.
»Wenn wir das wüßten, säßen wir nicht hier«, sagte Roselski.
»Nebenan?« fragte Katharina. »Ich meine, zu Tode gekommen oder wie man das nennt?«
»Nein, das hätten Sie sicher mitbekommen – Absperrung, Spurensicherung, Mordkommission – das volle Programm«, sagte Derenthal.
»Also woanders.« Katharina biß sich auf die Zunge. Das war ja nun eine dümmliche Feststellung.
»Ist auch kein Geheimnis, steht morgen sowieso in der Zeitung«, sagte Derenthal. Den strafenden Blick seines Kollegen bemerkte er nicht. »Man hat ihn heute vormittag erschlagen am Waldrand bei Merzbach gefunden, ein Dorf weiter. Aber vielleicht mögen Sie uns sagen, was genau das Verhältnis zwischen Ihnen und Herrn Bachem so«, der ältere Beamte suchte nach dem richtigen Wort, »so getrübt hat.«
»Das kann ich Ihnen genau sagen«, antwortete Katharina. »Bei seinen dummen Bemerkungen blieb es ja nicht. Irgendwann hat er angefangen, seinen Gartenmüll über den Zaun auf unser Grundstück zu werfen. Als wir vor zwei Jahren aus den Ferien zurückkamen, war ein frisch gepflanztes Bäumchen eingegangen. Völlig untypisch für die robuste Pflanze. Im Gartencenter hieß es, da habe wohl jemand kräftig nachgeholfen. Irgendwann war die Luft dann raus.« Katharina machte eine Pause und nippte an ihrem doppelten Espresso.
»Aus Ihnen beiden?« fragte Derenthal.
»Wie? Nein, aus den Reifen meines Autos.«
»Und Sie sind sicher, daß es Bachem war?«
»Wollen Sie die Aufnahmen sehen?«
»Sofort?«
»Kein Problem.« Katharina stand auf.
Roselski war dem Hin und Her des Gesprächs gespannt gefolgt. Jetzt sagte er: »Es reicht, wenn Sie uns eine Kopie hereinreichen.« Hereinreichen fand er immer gut; das klang nach vorgesetzter Behörde und nach Eingabe eines Untertanen.
Derenthal sagte: »Das hat wirklich Zeit. Erzählen Sie erst einmal zu Ende.«
Katharina setzte sich wieder. »Die nächste Stufe war dann das Eintreffen von Ware, die ich nicht bestellt hatte, von Amazon, Zalando und wie sie alle heißen.« Sie verschwieg allerdings, daß die Bestellungen von ihrer Freundin Anne getätigt worden waren, deren Mann davon nichts wissen sollte.
»Peanuts«, murmelte Roselski.
»Dann war Rattengift im Garten verstreut, wobei unsere Katze dran glauben mußte. Schließlich wollte er mich im Vordergarten zur Rede stellen, weil wir angeblich manchmal nachts bei offenem Fenster …« Katharina schwieg und wurde rot. Sie gab sich einen Ruck. »Er faßte mich am Arm, wie man das so macht, wenn man seinen Worten Nachdruck verleihen will. Ich habe ihn dann geschubst, wobei er in die Rosen fiel. Fand er nicht besonders lustig.«
»Das ist aber alles nichts Weltbewegendes«, sagte Derenthal. »Nur der Form halber: Wo waren Sie gestern nachmittag und abend, zwischen neunzehn und vierundzwanzig Uhr?«
Katharina tat, als müsse sie überlegen. »Gestern? Wieso?«
»Weil der Gerichtsmediziner sich noch nicht auf den genauen Zeitpunkt von Bachems Tod festlegen wollte, wahrscheinlich irgendwann vor Mitternacht.«
»Ich war im Kino«, sagte Katharina schnell.
»Wo denn?« fragte Roselski.
»Im Rex in Endenich.«
»Und was lief?«
»Ein Mann namens Ove«, sagte Katharina, die ohnehin vorhatte, den Film zu sehen. Die Buchvorlage hatte sich in ihrem Laden ganz gut verkauft. Mehrere Kunden hatten ihr geraten, das Buch zu lesen, wozu sie mangels Zeit noch nicht gekommen war. Wenn jetzt also Fragen zum Inhalt kamen – die konnte sie aufgrund der Besprechungen in den Tageszeitungen gut beantworten.
»Vielen Dank«, sagten Roselski und Derenthal einstimmig und standen auf. Sie verabschiedeten sich. Katharina schloß die Tür hinter ihnen und lehnte sich erleichtert gegen die Wand.
Draußen sagte der junge Beamte: »Hast du gemerkt, wie nervös sie war?«
»Und die Geschichte mit dem Film stimmt nicht«, sagte sein älterer Kollege. »Ich war am Freitag selbst in dem Kino. Erstens habe ich Frau Markenbeck nicht gesehen – muß ich ja auch nicht, die Vorstellung war ganz gut besucht –, aber das Wichtigere: Zweitens fing der Film schon um fünfzehn Uhr an. Und drittens: Um neunzehn Uhr, was der Rechtsmediziner als frühesten Todeszeitpunkt bezeichnet hat, war er längst zu Ende.«
Das Feuerwehrfest
Donnerstag, 19. Juli 1979 – Rheinbach-Neukirchen. »Willst du dir nicht auch was zu trinken holen? Alleine unter Alkohol zu stehen …«
Johanna lachte. »Okay, bin gleich wieder da.« Sie stand auf und ging ins Haus.
Gleich stimmte nicht ganz. Wie vorhin schon, kam sie auch jetzt fast sofort wieder aus der Gaststube zurück – mit einem leeren Bierglas und der dazugehörigen Flasche.
»Entschuldige, wolltest du auch noch etwas?«
Martin lachte. »Später. Jetzt erzähl mal.«
»Also, sind alles nur Gerüchte. Was man sich auf dem Dorf eben so erzählt.«
»Dorf, meinst du? Wo denn?« Martin sah sich um. Doch. Schräg gegenüber schienen hinter hohen Bäumen noch einige Häuser zu stehen. Jenseits der Kreuzung waren im Tal die Dächer einiger weiterer Behausungen zu sehen. Das war aber auch schon wieder alles.
Johanna lachte wieder, was Martin schon jetzt nicht oft genug hören konnte. »Du hast irgendwie recht. Wenn man unter Dorf eine Ansammlung von Häusern mit einem kleinen Dorfplatz, manchmal noch einem kleinen Teich, einer Hauptstraße und einer Kirche versteht, mußt du wohl wieder nach Rheinbach zurückfahren, obwohl das schon kein Dorf mehr ist, höchstens von der Mentalität her. Und von der Politik her. Änderungen mag man dort nicht. Seit dem Mittelalter gewinnt bei allen Wahlen immer die CDU.«
Martin grinste. »Nicht ablenken. Die Gerüchte.«
»Im Frühjahr, letztes Jahr, meine ich, ich habe das nur in der Zeitung gelesen, hat ein Aachener Ehepaar seinen in Bonn studierenden Sohn als vermißt gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte der hoffnungsvolle Sprößling sein Studium geschmissen, weil er lieber Bauer werden wollte – Landwirt ist wohl der richtige Ausdruck. Hinter dem Rücken seiner Eltern hat er sich dann eine Arbeit gesucht. Von der Pike auf, sozusagen.«
»Erst Knecht, dann Bauer. Und zwischendurch die Erbin des Hofs heiraten?«
»Genau«, sagte Johanna. »Nur hatte er sich leider den falschen Hof ausgesucht. Bachem soll mit seiner Schwester zusammenwohnen …«
»Die habe ich noch gar nicht gesehen«, sagte Martin.
»Kannst du auch nicht. Die ist nur ganz selten da, weil sie in einer großzügigen Villa in Köln lebt. Was sie genau macht, weiß ich nicht.«
»Aha.«
Martins Gesprächsbeiträge waren schon besser gewesen, fand Johanna. Sie fuhr fort. »Also keine Hoferbin. Aber Bachem, der seine Angestellten ausnutzen soll, wie man so hört, verschafft den Leuten andererseits eine solide Ausbildung, sagt mein Vater. Wenn er nicht wieder herumschreit und seinen Kummer am Quartalsende bei uns ersäuft. Jähzornig sei er, wird gemunkelt. Aus einer Mücke einen Elefanten machen, das könne er gut.«
»Hält sich eure Wirtschaft seinetwegen?« Martin konnte auch den Kopf schieflegen und lächeln. Dann sah er noch besser aus, fand Johanna.
»Dazu sage ich jetzt mal nichts. Jedenfalls war dieser Student aus Aachen bei ihm und arbeitete. Seinen Eltern machte er weis, daß er noch studiere. Physik, glaube ich. Irgendwann war Bachem wieder bei uns, ziemlich sauer. Mein Vater erzählte danach nur, daß der Student wohl übersehen habe, daß eine Kuh zu kalben begonnen hatte. Bachem war nicht da; er war nach Rheinbach gefahren, um beim Getreidehändler Küpper am Silo neben dem Bahnhof Futter zu holen. Als er zurückkam, war die Kuh tot. Also hat er den Studenten ’rausgeworfen.«
»Und dann?« Martin fühlte sich bemüßigt, auch verbal sein großes Interesse an der Geschichte zu demonstrieren.
»Irgendwann merkten die Eltern, daß ihr Junge abhanden gekommen war. Er wohnte in einer WG, aber seine Mitbewohner hatten ihn schon länger nicht mehr gesehen – logisch, er war ja nach Neukirchen gezogen. Die Polizei fand ihn auch nicht wieder. Er sei schließlich über achtzehn, könne sich aufhalten, wo er wolle, und so weiter. Also hat man die Angelegenheit zu den Akten gelegt, wie es so schön heißt.« Johanna trank einen großen Schluck Bier.
Martin schwieg und überlegte. Dann sagte er. »Vorhin hast du gesagt, in dem Dorf, wo alle paar Jahre … Sind denn mehrere Jungs weg?«
Johanna konnte nur nicken, weil sie den Mund noch voll Bier hatte. Sie setzte das Glas wieder auf den Tisch. »Jungs, Jugendliche, junge Männer – wann hört die Jugend auf, und wann fängt das Erwachsensein an?« Sie lächelte ihn an. »Also, soviel ich weiß, vor ungefähr zehn Jahren schon einmal.«
»Also insgesamt zwei?« fragte Martin. »Das reicht ja auch.«
»Der zweite beziehungsweise der erste – chronologisch, meine ich –, der erste junge Mann ist nach einem Feuerwehrfest in Neukirchen verschwunden.«
»Wie lange ist das denn her?«
»Habe ich doch gerade gesagt. Wahrscheinlich hast du nur mich angesehen, wie die anderen Gäste auch, und dann gar nichts mehr mitbekommen, oder?« Johanna zeigte wieder ihr schönes Lächeln.
Martin versuchte, nicht rot zu werden. »So ähnlich. Du bist auch kaum zu übersehen.«
Johanna lachte. »Danke. War das jetzt ein Kompliment? Ist auch egal. Warte mal, das war so um 1968 / 69. Mein Vater sammelt doch alte Zeitungsausschnitte …«
»Wie alt müssen die denn sein, damit er sie sammeln kann?« Martin grinste.
»Du weißt doch, was ich meine. Also, Zeitungsausschnitte von allen hier wichtigen Ereignissen: von dem Fund des alliierten Bombers nach Kriegsende im Wald bei Effelsberg, dem Besuch eines ausländischen Politikers in einem Dorf bei uns oder von dem Mord an einer Schülerin des Rheinbacher Mädchengymnasiums. Ist noch gar nicht lange her, war irgendwann in diesem Frühjahr. Jedenfalls – vielleicht hat mein Vater irgendwas über das Verschwinden des Jungen in Neukirchen aufgehoben.«
Johanna stand auf und ging ins Haus. Dieses Mal dauerte es etwas länger, bis sie wiederkam, im Schlepptau einen älteren Mann mit einer dieser Tresenschürzen, wohl ihr Vater. Er legte einen Aktenordner auf den Tisch und musterte Martin.
»Sie sind also der neue Handlanger bei Bachem? Dann viel Glück. Lernen werden Sie bestimmt etwas, aber Sie müssen ein dickes Fell haben. Mit dem Bauern ist nicht gut Kirschen essen.«
Martin grinste. »Mag ich sowieso nicht. Darf ich?« Er zeigte auf den Aktenordner.
Der Mann nickte, warf seiner Tochter einen undefinierbaren Blick zu – Warnung? Sorge? Ermutigung? – und ging wieder nach drinnen. Johanna setzte sich. Martin hatte den Ordner aufgeschlagen.
»Gib mal her.« Johanna wollte die Papiersammlung zu sich hinüberziehen, überlegte es sich aber anders. »Wir können auch zusammen hineingucken. Laß mich mal blättern.« Schnell hatte sie das Jahr 1969 gefunden. Akkurat beschriftete Trennblätter aus Karton hatten ihr die Arbeit erleichtert. »Gleich hab’ ich’s. Hier ist es schon.« Sie zeigte auf eine kleine Meldung aus dem Bonner General-Anzeiger vom 25. August 1969:
35 Jahre Freiwillige Feuerwehr NeukirchenMann verschwunden
Seit Jahrzehnten sichert die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen das Leben ihrer Mitbürger. Bereits am 22.8.1934 wurde von 27 jungen Männern der erste Löschzug im Rheinbacher Höhenortsteil Neukirchen ins Leben gerufen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die verdienstvolle Arbeit von den Frauen in Neukirchen fortgeführt, während die Männer an der Front kämpften. Standort der Feuerwehr Neukirchen war über lange Jahre die Volksschule am Ortseingang. Erst vor fünf Jahren konnte das Feuerwehrgerätehaus in Irlenbusch in Betrieb genommen werden. Am Wochenende beging der gesamte Ort unter der Teilnahme des ehemaligen Neukirchener Bürgermeisters, Franz Kurscheidt, des neuen Bürgermeisters der Stadt Rheinbach, Heinz Büttgenbach, und etlicher Vertreter des Stadtrats das fünfunddreißigjährige Jubiläum bei einem großen Fest, das mit einem sehenswerten Feuerwerk endete. Überschattet wurde das ansonsten fröhliche Ereignis allerdings vom Verschwinden des 18jährigen Helmut K. aus Neukirchen. Er wurde zuletzt gegen zehn Uhr abends bei einer lautstarken Auseinandersetzung vor dem Festzelt gesehen, zu der schließlich sogar die Polizei gerufen werden mußte. Als die Beamten allerdings eintrafen, war von den Streithähnen nichts mehr zu sehen. Beschrieben wird Helmut K. wie folgt …
Johanna sah Martin an. »Was ich vorhin sagte: wieder jemand in dem Dorf, der abhanden gekommen ist.«
»Kann doch ein Zufall sein, oder?«
»Latürnich.« Johanna hatte anscheinend auch Asterix gelesen.
Martin besaß alle Bände, auch den in diesem Jahr erschienenen Band 24 Asterix bei den Belgiern. Er verlor sich in Gedanken an seine Lieblingsszenen (»Mir auch zwei Wildschweine!«), bis ihn Johanna anstupste.
»Was meinst du dazu?«
»Wozu?«
»Ich meine, was du dazu meinst, daß du dich mal unauffällig in Neukirchen umhörst?«
Martin mußte an Bachem und dessen Beobachtungsgabe denken. Nun auch noch Johanna. War er hier von Amateurdetektiven umgeben?
»Ja, wäre doch toll, wenn wir nach der ganzen Zeit herausfinden würden …«
Martin hörte nicht weiter zu. Johanna hatte gerade »Wir« gesagt. Ein schöner Traum! Er mußte wieder an Ursula denken und an das ungeborene Kind.
Blinde Wut
Samstag, 23. August 1969 – Rheinbach-Neukirchen. Bachem trat ins Festzelt und sah sich um. Eigentlich mochte er Veranstaltungen in Zelten oder überfüllten Sälen nicht besonders. Auch hier begann fast sofort sein Kopf aufgrund der verbrauchten Luft zu schmerzen; eine unangenehme Mischung aus Zigarettenqualm, Schweiß, süßen Parfüms, verschwitzter Kleidung und dem heißen Wasser, in dem die Bockwürste am Eßstand kochten, erfüllte den Raum. Der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch, im Gegenteil: Gelächter wehte von den Biertischen herüber, und auf der Tanzfläche hatte sich die Dorfjugend versammelt, um sich bei wilden Verrenkungen zu verausgaben. Ein Klammerblues alle halbe Stunde ließ die Temperatur im Zelt weiter steigen.
Auf der Bühne hatte die Feuerwehrkapelle der Rheinbacher Kollegen nach einer Runde Marschmusik einer Horde langhaariger Jugendlicher und ihren elektrischen Instrumenten Platz gemacht. The Troop war auf der Bass Drum der Band zu lesen. Die Musiker lieferten sich bei jedem Stück einen Wettstreit, wer seiner Gitarre die verzerrteren Klänge entlocken konnte. Gerade heizte die Band mit dem Chuck-Berry-Song Johnny B. Goode dem Publikum ein.
Bachem warf der Band einen verächtlichen Blick zu. Wie die schon aussahen. Verschwitzte T-Shirts, Koteletten bis zum Kinn, Haare im Afrolook oder bis auf die Schultern – nichts für ihn. Er interessierte sich nicht für die Musik der Halbstarken, obwohl er mit seinen vierundzwanzig Jahren der gleichen Generation angehörte. Außerdem war sie ihm zu laut. Er überlegte, wie er aus dem Abend noch etwas machen konnte, und ließ seinen Blick durchs Zelt schweifen. Dann entdeckte er Maria, die er schon seit einigen Monaten im Auge hatte. Das wäre doch mal eine feine Freundin, dachte er – jetzt oder nie. Das Mädchen stammte aus Neukirchen und war eine regelmäßige Besucherin der samstäglichen Diskothek in der »OT«, wie die Jugendeinrichtung »Offene Tür« im Fachwerkhaus gegenüber der Rheinbacher Kirche nur abgekürzt genannt wurde. Dort war die Luft allerdings noch schlechter, so daß Bachem es bei einem einzigen Besuch belassen hatte. Süßliche Rauchschwaden hatten ihn damals nur darin bestärkt, die OT in Zukunft zu meiden; von Drogen hielt er nichts, und anders als sein Vater rauchte er auch nicht.
Die Band hatte inzwischen mit einer langsamen Nummer begonnen, und Maria hing am Hals eines jungen Mannes, der ebenfalls aus Neukirchen kam und den er trotz seiner langen Haare, die das Gesicht verdeckten, als Helmut Klein identifizierte. Bachem hatte von Helmuts Onkel mal einen großen Mähdrescher geliehen, war aber im Streit geschieden, als der Onkel angebliche Lackkratzer bei der Rückgabe monierte. Helmut sah gut aus, besaß dunkle, leicht gelockte Haare und fein geschnittene Züge, die ihn bei den Mädchen zu einem begehrten Junggesellen gemacht hatten. Allerdings war er zu schüchtern, um auf Avancen des weiblichen Geschlechts einzugehen. Wie es aussah, hatte Maria die Initiative ergriffen und Helmut erobert.
Bachem fluchte unterdrückt. Was konnte der Bauernsohn dem Mädchen denn schon bieten? Helmuts Familie besaß nur einen kleinen Hof, und die Mutter mußte dazuverdienen, um ihre Familie über Wasser zu halten. Er dagegen hatte von seinen Eltern, die früh verstorben waren, viel Land geerbt, das er teilweise verpachtet hatte, teilweise aber auch brachliegen ließ. Vielleicht war es möglich, die Grundstücke in Bauland umzuwandeln, wenn er irgendwann einmal im Rheinbacher Stadtrat saß.
Bachem gab sich einen Ruck. Tagträume waren ganz nett, aber um sie umzusetzen, benötigte er einen langen Atem. Nahziele waren wichtiger. Maria zum Beispiel. Entschlossen marschierte er auf die Tanzfläche.