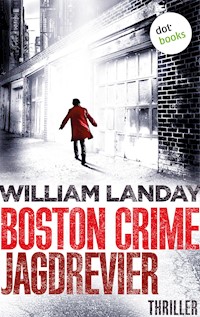
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wem kannst du noch trauen? Der packende Thriller »Boston Crime: Jagdrevier« von Bestsellerautor William Landay jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn dein Ehrgeiz zur tödlichen Gefahr wird … Ben Truman wollte nie in der Provinz versauern – trotzdem scheint ihm keine Wahl zu bleiben, als er den Posten seines Vaters als Polizeichef einer verschlafenen Kleinstadt in Maine übernehmen muss. Als dort die Leiche eines Bostoner Rechtsanwalts gefunden wird, gibt ihm dies endlich einen Grund, seinen Heimatort zu verlassen: Eine Spur führt Truman nach »Mission Flats«, das gefährlichste Viertel Bostons, in dem die Polizei schon längst keine Kontrolle mehr hat. Schnell fällt sein Verdacht auf den mächtigen Gang-Leader Braxton, der schon Jahre zuvor des Mordes an einem Polizisten angeklagt war – doch auch einige Bostoner Cops scheinen ein dunkles Geheimnis zu verbergen. Als Truman merkt, wie tief er sich selbst bereits in den Sumpf aus Hass und Gewalt begeben hat, scheint es bereits zu spät … »William Landays extrem starkes Debüt: clever gezeichnet und mit einem Ende, das man niemals erraten kann.« Sunday Telegraph Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Großstadtthriller »Boston Crime: Jagdrevier« von William Landay wird auch die Fans von Michael Robotham begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn dein Ehrgeiz zur tödlichen Gefahr wird … Ben Truman wollte nie in der Provinz versauern – trotzdem scheint ihm keine Wahl zu bleiben, als er den Posten seines Vaters als Polizeichef einer verschlafenen Kleinstadt in Maine übernehmen muss. Als dort die Leiche eines Bostoner Rechtsanwalts gefunden wird, gibt ihm dies endlich einen Grund, seinen Heimatort zu verlassen: Eine Spur führt Truman nach »Mission Flats«, das gefährlichste Viertel Bostons, in dem die Polizei schon längst keine Kontrolle mehr hat. Schnell fällt sein Verdacht auf den mächtigen Gang-Leader Braxton, der schon Jahre zuvor des Mordes an einem Polizisten angeklagt war – doch auch einige Bostoner Cops scheinen ein dunkles Geheimnis zu verbergen. Als Truman merkt, wie tief er sich selbst bereits in den Sumpf aus Hass und Gewalt begeben hat, scheint es bereits zu spät …
»William Landays extrem starkes Debüt: clever gezeichnet und mit einem Ende, das man niemals erraten kann.« Sunday Telegraph
Über den Autor::
William Landay wurde in Amerika geboren und absolvierte ein Jura-Studium an den Elite-Universitäten Yale und Boston Law School. Er arbeitet einige Jahre als Staatsanwalt und begann schließlich eine erfolgreiche Karriere als Thriller-Autor, wobei er immer wieder sein umfassendes juristisches Wissen unter Beweis stellt Für seinen ersten Roman »Boston Crime« gewann Landay den begehrten »Dagger Award« für das beste Krimi-Debüt. Heute lebt der Autor mit seiner Frau und seinen Kindern in Boston.
William Landay veröffentlichte bei dotbooks bereits »Verschwiegen«.
Die Website des Autors: williamlanday.com
***
eBook-Neuausgabe Januar 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Mission Flats« bei Delacorte Press, New York. Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Mission Flats« bei Bantam Books, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Jagdrevier« bei Heyne, ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2003 by William Landay
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Carlos Caetano, Pixel Power LLC
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-444-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Boston Crime« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
William Landay
Boston Crime: Jagdrevier
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Müller
dotbooks.
Für Susan
Prolog
Auf der Leinwand räkelt sich eine Frau auf einem Gummifloß. Das Gesicht ist der Sonne zugewandt, die Fingerspitzen streichen über die Wasseroberfläche. Das Floß hat die Form eines Doughnuts. Träge dreht es sich im Kreis. Links im Bild sieht man den Strand. Die Frau ist schwanger. Die weite Bluse aus Madras-Stoff, die sie über dem Badeanzug trägt, kann die Wölbung des Bauches nicht verbergen. Sie hebt den Kopf und schaut in die Kamera. Die Lippen formen die Worte: »Hör auf damit. Mach das Ding aus. Schau mich doch an.« Die Kamera wackelt, offenbar weil die Person dahinter lacht. Die Frau verdreht die Augen und schüttelt die Faust – die Stummfilmgeste für ohnmächtige Wut. Lautlos sagt sie in die Kamera: »Hi, Ben.« Dann fängt auch sie an zu lachen, legt den Kopf wieder zurück und lässt sich weiter treiben.
Die Frau ist meine Mutter und das Baby in ihrem Bauch bin ich. Es ist Frühsommer 1971. Ich werde einen Monat später geboren.
Dieser kurze Acht-Millimeter-Film (zwei oder drei Minuten, höchstens) lag meiner Mutter immer sehr am Herzen. Sie bewahrte ihn in einer gelben Kodak-Schachtel auf, unter Büstenhaltern und Strümpfen, in der obersten Schublade ihrer Kommode. Sie glaubte, dass Diebe da kaum suchen würden. Wir hatten nicht viele Diebe in unserer Stadt, und die wenigen, die wir hatten, waren an körnigen alten Filmen mit schwangeren Frauen nicht interessiert. Aber meine Mutter hielt ihn für so wertvoll, dass sie hin und wieder in die Schublade griff und die Schachtel berührte – man kann nie wissen. Wenn es regnete, holte sie den zwanzig Pfund schweren Bell & Howell-Projektor heraus und zeigte den Film auf der Wohnzimmerwand. Sie stand neben dem Bild, deutete auf ihren Bauch und verkündete in Worten, denen man den Bostoner Akzent noch anhörte: »Da drin, Ben! Das bist du!« Manchmal wurde sie wehmütig und ihr kamen die Tränen. In all den Jahren schauten wir uns den kurzen Streifen sicher hundertmal an. In meinem Kopf läuft er immer noch, er gehört zu mir, er ist mein ganz persönlicher Zapruder-Film. Warum meine Mutter ihn so geliebt hat, weiß ich nicht genau. Ich nehme an, dass er für sie einen Übergang dokumentierte, den Augenblick des Gleichgewichts zwischen Mädchenjahren und Mutterschaft.
Mir hat der Film allerdings nie gefallen. Er hat etwas Beunruhigendes. Er zeigt die Welt vor mir, die Welt ohne mich, eine vollkommene Welt. Meine Erschaffung erscheint mir bis jetzt weder notwendig noch unausweichlich. Niemand hat mich kennengelernt, niemand kennt mich. Ich existiere nicht. Eine Frau – nicht meine Mutter, sondern die Frau, die meine Mutter werden wird – winkt und ruft mich mit meinem Namen. Aber was ist das, wonach sie da ruft? Sie ist guter Hoffnung, in jeder Bedeutung des Wortes. Doch es ist eine zerbrechliche Hoffnung. Ereignisse verästeln, teilen, vervielfältigen sich, und sie und ich lernen uns vielleicht nie kennen. Und sie? Wer ist diese verstorbene Frau für mich? Sicher nicht meine Mutter, nichts derart Reales. Sie ist lediglich eine Vorstellung, ein Piktogramm an der Wohnzimmerwand. Sie ist meine Schöpfung von ihr.
Meine Mutter ist jetzt seit dreizehn Monaten tot, und ich habe noch nicht das Bedürfnis verspürt, nach der kleinen Spule in ihrem gelben Reliquienschrein zu suchen. Vielleicht finde ich sie und den Projektor eines Tages und schaue mir den Film noch mal an. Und dann ist sie wieder da. Jung und lachend, lebendig und ganz.
Ich nehme an, dass diese Stelle so passend ist wie jede andere, um mit der Geschichte anzufangen: mit der schwangeren, hübschen jungen Frau an einem heißen Sommertag am See. Schließlich gibt es für keine Geschichte den absoluten Anfang. Es gibt nur den Augenblick, an dem man anfängt, hinzuschauen.
Ein anderer Augenblick fünfeinhalb Jahre später. 11. März 1977. 1:29 Uhr morgens.
Ein Streifenwagen der Bostoner Polizei kriecht in einem Stadtviertel namens Mission Flats langsam die Mission Avenue entlang. Unter den Reifen knirschen Streusand und Eis. Hochbahngeleise hängen über der Straße. Der Streifenwagen hält vor einer Bar, dem Kilmarnock Pub, einem im Halbdunkel kauernden Gebäude mit Leuchtreklamen in den Fenstern.
Im Streifenwagen sitzt ein Polizist, sein Name spielt keine Rolle. Mit der Handkante wischt er an der Fahrerseite das Kondenswasser von der Scheibe und studiert die Leuchtreklamen. GUINNESS, BASS und ein unbekannteres Ale mit dem verlockenden Namen GOOD TIMES. Sperrstunde im Kilmarnock war vor neunundzwanzig Minuten. Normalerweise ist die Leuchtreklame um diese Zeit schon ausgeschaltet.
Stellen Sie sich den Polizisten vor. Wenn er nicht zufällig an dieser Bar vorbeifährt oder wenn ihm die Leuchtreklame nicht auffällt, dann würde nichts von dem Folgenden jemals geschehen. In diesem Augenblick kann er noch jede Richtung einschlagen, die eine andere Geschichte, hundert andere Geschichten zur Folge hätten. Er kann die Leuchtreklame einfach ignorieren und seine Streife auf der Washington Avenue fortsetzen. Schließlich gibt’s ja nichts wirklich Verdächtiges zu sehen? Oder ist es so außergewöhnlich, dass ein Barkeeper mal vergisst, zur Sperrstunde ein paar Lampen auszumachen? Der Beamte kann aber auch Verstärkung anfordern. Eine Bar um die Sperrstunde ist ein verlockendes Ziel für Räuber. Es wird bar gezahlt, die Kasse ist voll, die Türen sind noch nicht verschlossen. Keine Wachleute – nur Barkeeper und Betrunkene. Ja, vielleicht sollte er es so machen, vielleicht sollte er auf Verstärkung warten. Man darf eins nicht vergessen: Es handelt sich um Mission Flats, eine Gegend, in der sich Vorsicht auszahlt. Andererseits kommt ein Polizist auf Nachtschicht leicht auf fünfzig Läden, die er zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens kontrollieren könnte. Er kann nicht jedes Mal Verstärkung anfordern. Nein, in diesem Fall gibt es für unseren Polizisten keinen Grund, so zu verfahren. Er wird die richtige Entscheidung fällen und doch ... Wie soll man erklären, was dann folgt? Pech. Zufall. Zahllose zufällige Verästelungen und Abläufe haben ihn um diese Zeit an diesen Ort geführt. Sie bilden das Ende einer oder mehrerer Geschichten und den Anfang einer neuen oder mehrerer neuer Geschichten.
Bedenken Sie auch Folgendes. Während der Beamte unschlüssig vor dem Kilmarnock Pub mit seinem Funkgerät herumspielt und sich zu entscheiden versucht, was er tun soll, ob er überhaupt etwas tun soll, bin ich fünf Jahre alt und liege etwa dreihundert Meilen entfernt im westlichen Maine schlafend in meinem Bett.
Zurück zu unserem Polizisten. Er beschließt, in die Bar zu gehen und dem Barkeeper zu sagen, dass er den Laden dichtmachen soll. Vielleicht wird er ihm noch ein bisschen Dampf damit machen, die ABC zu benachrichtigen – die Alcoholic Beverages Commission, die für Vergabe der Alkohollizenzen verantwortlich ist. Keine große Sache. Er gibt seine Position an die Zentrale durch: »Bravo-vier-sieben-drei, ich schau mal eben ins Kilmarnock an der Mission Ave. Bravovier-sieben-drei, charlie-robert.« Keine Beunruhigung in der Stimme. Routine.
Dann marschiert der Polizist in einen bewaffneten Raubüberfall.
Im Kilmarnock hält ein hagerer Drogensüchtiger namens Darryl Sikes eine Neun-Millimeter Beretta an den Kopf des Polizisten. Sikes ist zugekokst, hat das High mit Amphetaminen zusätzlich gepuscht und es dann mit Jack Daniel’s wieder etwas besänftigt.
Der Polizist hebt gehorsam die Hände.
Bei dem Anblick bricht Sikes in brüllendes Gelächter aus. Hahahahahahahaha. Sein Hirn brummt buchstäblich. Er hört ein Geräusch, das einem brummenden Gitarrenverstärker ähnelt. Dreh auf, Mann! Dreh das Scheißding auf! Hahahahaha!
Sikes’ Partner ist ein Mann namens Frank Fasulo. Fasulo ist nicht so groß wie Sikes. Nicht annähernd. Frank Fasulo ist der Anführer. Er hält eine abgesägte Pumpgun im Arm. Er zielt auf den Polizisten und befiehlt ihm, sich auszuziehen. Dann fesselt Fasulo dem Beamten mit den Handschellen die Hände auf den Rücken und befiehlt ihm, sich hinzuknien.
Der Polizist zittert. Er ist nackt.
Frank Fasulo und Darryl Sikes feiern. Sikes hebt das Uniformhemd des Polizisten vom Boden auf und zieht es sich über sein Sweatshirt. Hahahahaha! Sie veranstalten einen kleinen Siegestanz durch die Bar. Sie kicken die Kleidung des Polizisten durch die Gegend. Die Kniestrümpfe, die urinfleckige Unterhose, die schwarzen Schuhe. Fasulo feuert mit der Pumpgun in die Decke, pumpt und feuert, pumpt und feuert.
Fasulo zwingt den Polizisten zur Fellatio. Im Augenblick des Orgasmus feuert Fasulo dem Polizisten in den Kopf.
Der Kilmarnock-Mord liegt jetzt neun Tage zurück, und es ist vier Uhr morgens in einer bitterkalten Winternacht. Der Wind peitscht über das untere Deck der Tobin Bridge. Die gefühlte Temperatur beträgt fünfzehn Grad minus.
Frank Fasulo tritt von der Brücke und segelt durch die Luft, träge Räder schlagend, Arme und Beine ausgestreckt. Es wird drei lange Sekunden dauern, bis er den fünfundvierzig Meter unter ihm fließenden Mystic River erreicht. Er wird mit etwa siebzig Meilen pro Stunde auf das Wasser aufschlagen. Bei dieser Geschwindigkeit ist der Unterschied zwischen dem Aufprall auf Wasser und dem Aufprall auf Beton nicht sehr groß.
Welche Gedanken gehen Fasulo während seines Sturzes durch den Kopf? Sieht er die Wasserwand, die ihm entgegenschießt? Denkt er an seinen Partner Darryl Sikes oder an den ermordeten Polizisten? Glaubt er, dass sein Selbstmord die Geschichte des Kilmarnock-Falles beendet?
Frank Fasulo weiß es nicht, aber er hat in den letzten neun Tagen die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Outlaw gelernt. Heute bezieht man das Wort auf jeden Verbrecher. Im alten englischen Recht wurde es präziser definiert. Wenn ein Gericht jemanden zum Outlaw erklärte, befand er sich buchstäblich außerhalb des Rechts. Das Recht bot keinen Schutz mehr. Man konnte einen Outlaw berauben oder sogar töten, ohne dafür bestraft zu werden. Nirgends in England fand er Schutz. Und so ergeht es jetzt Frank Fasulo. Das Boston Police Department hat kein Interesse an seiner Verhaftung und Verurteilung. Es will ihn tot. Und ohne eine Zuflucht.
Auf Darryl Sikes stießen sie schon zwei Tage nach dem Mord. Er hatte sich in der Nähe vom Boston Garden im alten Madison Hotel verkrochen. Vier Polizisten vom Boston Police Department stürmten das Zimmer und feuerten einundvierzig Kugeln in seinen Körper. Übereinstimmend beeidete das gesamte Team, das Sikes nach einer Waffe gegriffen habe. Es wurde nie eine gefunden.
Und jetzt ist Fasulo an der Reihe. Auf ihn sind sie noch schärfer. Schließlich war es Fasulo gewesen, der ... Die meisten von ihnen können es nicht mal aussprechen.
Wohin kann Fasulo schon fliehen? Auf ihn ist ein Haftbefehl wegen Mordes ausgestellt. Jede Strafverfolgungsbehörde der Welt wird ihn an die Bostoner Polizei ausliefern.
Also muss es so enden. Das ist das Einzige, dessen sich Frank Fasulo sicher ist. Während er fällt, in jenen drei Sekunden, in denen er seinen Körper immer schneller fallen spürt und der Wind ihm wie ein hilfsbereiter Gastwirt die Jacke von den Schultern zieht, kann er nur an eines denken: Es konnte nicht anders enden – irgendein Polizist hätte ihn früher oder später aufgespürt.
Zehn Jahre später. 17. August 1987. 2:25 Uhr morgens.
Wir sind wieder in Mission Flats. In einem jener Drei-Familien-Holzhäuser, die man ihn Boston triple decker nennt. Im Etagenflur des zweiten Stocks kauern acht Polizisten. Sie starren auf eine Tür und lauschen so angestrengt, als könnte die Tür jeden Moment zu ihnen sprechen.
Die Tür ist scharlachrot lackiert. Im Türrahmen etwas oberhalb Augenhöhe befinden sich zwei winzige Löcher, wo an kleinen goldenen Stiften mal eine Mesusa gehangen hat. Vor fünfzig Jahren lebten in diesem Viertel vorwiegend Juden. Die Mesusa hängt schon lange nicht mehr da. Jetzt dient die Wohnung als Drogenversteck für eine Gang namens Mission Posse.
Sicher war die Tür von innen zusätzlich gesichert. Höchstwahrscheinlich mit einem Balken, der im Fündundvierzig-Grad-Winkel zwischen Tür und im Boden verschraubten Holzblöcken klemmte. Um in die Wohnung zu gelangen, werden die Polizisten die Tür in Kleinholz verwandeln müssen. Das könnte fünfzehn Sekunden dauern oder aber mehrere Minuten – eine Ewigkeit. Lang genug, um im Klo Kokain hinunterzuspülen, um Kundenlisten zu verbrennen, um Waagen und kleine Plastikbeutel durch Löcher in den Wänden zu werfen. Zu lange. Eine moderne Metalltür konnte man einschätzen, man konnte voraussagen, was sie aushalten würde. Die dünnen geben nach, verbiegen sich und platzen schnell aus dem Türrahmen. Bei den dicken sieht man nur eine Beule; man hat nur die Wahl zwischen der Zerstörung der Scharniere, des Schlosses oder des ganzen Türrahmens. Aber diese alten Holztüren? Schwer zu sagen. Die hier sieht massiv aus.
Julio Vega gefällt ganz und gar nicht, was er da sieht. Er schaut seinen Partner an, einen Detective der Drogenfahndung aus Area A-3 namens Artie Trudell, und schüttelt den Kopf. Vegas Botschaft: Türen wie die gibt’s heute gar nicht mehr.
Trudell, ein riesiger Mann mit orangerotem Vollbart, lächelt Vega an und spannt seine Bizeps.
Vega und Trudell sind aufgeregt und nervös. Das ist ihre Premiere, die erste Razzia unter eigener Leitung. Das Objekt ist ein dicker Brocken: Die Mission Posse schlägt in diesem Teil der Stadt bei weitem das meiste Crack um. Der Durchsuchungsbeschluss, der sie ermächtigt, ohne Vorwarnung in die Wohnung einzudringen, ist auf ihre eigenen Untersuchungen zurückzuführen – zwei Wochen Überwachung plus haufenweise Informationen von einem speziellen Informanten von Martin Gittens höchstpersönlich. Ein hieb- und stichfester Durchsuchungsbeschluss.
Mit noch ein paar Treffern wie diesem könnte sich auch Detective Julio Vega hieb- und stichfest machen. Vega hat einen Plan. Im Herbst wird er die Prüfung zum Sergeant ablegen, danach noch ein paar Jahre Drogenfälle bearbeiten und sich dann um die Versetzung zur SIU – der für Sonderermittlungen zuständigen Special Investigations Unit – oder sogar ins Morddezernat bemühen. Weil sein Partner, der große Rotschopf Artie Trudell, seine ehrgeizigen Karrierepläne sowieso nicht verstehen würde, behält Vega sie für sich.
Trudell träumt nicht davon, sich ins Morddezernat oder sonstwohin versetzen zu lassen. Er ist zufrieden mit seinem Job bei der Drogenfahndung. Manche sind so. Sie bevorzugen Fälle ohne Opfer, Fälle mit Verdächtigen, die genauso professionell arbeiten wie ihre Gegenspieler von der Polizei. Ist übersichtlicher. Vega hat versucht, Trudells Ehrgeiz zu kitzeln. Hat ihm erklärt, dass er nur mit Fällen ohne Opfer nicht nach oben käme. Er hat sogar mal angedeutet, dass Trudell die Prüfung zum Sergeant ablegen sollte. Artie hat bloß gelacht. »Wie bitte?«, hat er gesagt. »Um das hier alles aufzugeben?« Damals saßen sie in einem verbeulten Ford Crown Vic in den Flats. Vor ihnen lag die Mondlandschaft der Mission Avenue – ein Block mit aschgrauen, heruntergekommenen Mietskasernen nach dem anderen. Was soll man so einem Kerl noch sagen?
Zur Hölle mit ihm, denkt sich Vega. Soll Artie bis in alle Ewigkeit in den Flats hinter Crackheads herhecheln. Soll er hier verrotten. Aber nicht Julio Vega. Vega ist ein Spieler. Er steigt auf. Und dann aus. Wenn, ja wenn ... Die Sache ist die: Detective Vega kann von morgens bis abends von Mordfällen oder der SIU träumen, aber erst muss er ein bisschen Wind machen. Muss ein paar Felle erbeuten, die er im Büro des Polizeichefs vorzeigen kann. Muss unbedingt diesen Treffer landen.
Vega und Trudell stehen wie Wachposten neben der Wohnungstür.
Die anderen Männer meiden den Bereich unmittelbar vor der Tür, so gut es geht. Der Etagenflur ist so schmal, dass sie auf die Treppe zum nächsten Stockwerk ausweichen müssen. Vier der Männer tragen Uniform. Die anderen, die von der Drogenfahndung, tragen Jeans, Sneakers und Kevlar-Westen. Lässig. Keine Spur von Kommandounternehmen-Outfit, das die anderen Einheiten bevorzugen. Man ist in den Flats. Die Burschen wissen, wie man durch Türen geht.
Ein paar Sekunden lang horchen die Männer auf Geräusche aus dem Innern der Wohnung. Kein Laut. Sie schauen Vega an und warten auf das Zeichen.
Vega ist in die Hocke gegangen und lehnt neben der Tür an der Wand. Mit einem Nicken gibt er Trudell das Zeichen.
Der stämmige Detective tritt vor die Tür. Die Temperatur in dem Gang beträgt über dreißig Grad. Trudell schwitzt unter seiner Weste. Sein T-Shirt ist fleckig. Die orangefarbenen Bartlocken unter seinem Kinn glänzen feucht. Der große Polizist lächelt – vielleicht aus Nervosität. Er stemmt ein eineinhalb Meter langes Stahlrohr in die rechte Armbeuge. Die Zeitungen werden das Rohr später als Rammbock bezeichnen. In Wahrheit war es nur ein mit Beton ausgegossenes Stück Wasserrohr, an das man zwei L-förmige Griffe geschweißt hat.
Vega hält fünf Finger hoch, dann vier, drei, zwei – bei eins zeigt er auf Trudell.
Trudell rammt das Rohr in die Tür. Das Treppenhaus hallt wider von einem Geräusch, das sich anhört wie eine Basstrommel.
Die Tür bewegt sich keinen Millimeter.
Trudell tritt einen Schritt zurück und rammt das Rohr ein zweites Mal in die Tür.
Die Tür zittert, hält aber stand.
Die anderen beobachten die Szene mit wachsender Unruhe. »Jetzt komm schon, Big Boy«, sagt Vega.
Der dritte Stoß. Das Geräusch einer Basstrommel.
Nummer vier – diesmal gefolgt von einem anderen Geräusch. Einem dumpf knackenden.
Ein Stück der oberen Türfüllung platzt in den Gang. Wie von innen herausgesprengt. Durch einen Schuss aus der Wohnung. Blut spritzt aus Trudells Stirn. Roter Sprühregen. Kopfhautfetzen. Trudell fällt auf den Rücken. Die Schädeldecke ein Krater mit zerrissenem Rand. Das Rohr schlägt dumpf auf den Boden.
Die Polizisten schrecken zurück, werfen sich auf den Boden, pressen sich dicht an dicht auf die Treppenstufen. »Artie!«, schreit einer.
Vega starrt Trudells Körper an. Das Blut ist überall: rote Tröpfchen verspritzt über der Wand, eine sich ausbreitende Lache unter Trudells Kopf. Das Rohr liegt direkt vor der Tür. Vega will es aufheben, aber er kann seine Beine nicht bewegen.
Teil eins
»Der Zivilisationsgrad eines Staates
lässt sich in hohem Maße an den Methoden
ablesen, die er zur Durchsetzung
seines Strafrechts anwendet.«
Miranda vs. Arizona, 1966
Kapitel 1
Einmal versuchte Maurice Oulette sich umzubringen, aber es gelang ihm nur, sich die rechte Seite des Unterkiefers wegzuschießen. Die Prothese, die ihm ein Arzt in Boston konstruiert hatte, war nicht ganz perfekt. Nach der Operation sah Maurice’ Gesicht wie geschmolzen aus. Er unternahm große Anstrengungen, um es zu verbergen. Als er noch jünger war (Maurice war neunzehn, als der Unfall passierte), band er sich wie die Bankräuber in alten Western ein Tuch vors Gesicht. Das verlieh ihm, der sonst eher ein unscheinbarer, unromantischer Typ war, ein verwegenes Aussehen, das er eine Zeit lang zu genießen schien. Schließlich hatte er die Bankräubermaske aber doch satt. Dauernd musste er sie anheben, wenn er mal frische Luft atmen oder etwas trinken wollte. Also nahm er das Ding eines Tages einfach ab. Seitdem hatte Maurice so wenig Selbstbewusstsein, wie man als Mann ohne Unterkiefer nur haben kann.
Die meisten Menschen in der Stadt nehmen Maurice’ Verunstaltung so, als sei ein fehlender Kiefer nicht ungewöhnlicher, als wenn man kurzsichtig wäre oder Linkshänder. Sie haben sogar ein Auge auf ihn und achten darauf, dass sie ihm ins Gesicht sehen und ihn mit Namen ansprechen. Wenn ihn im Sommer die Touristen anstarren, was unweigerlich sogar die Erwachsenen tun, dann kann man sicher sein, dass sich derjenige von Red Caffrey oder Ginny Thurler oder wer gerade zufällig dabeisteht einen eisigen Blick dafür einfängt, einen Blick, der besagt: Augen geradeaus, Mister. So gesehen ist Versailles eine nette Stadt. Früher habe ich den Ort als eine riesige Venusfliegenfalle gesehen, deren klebrig-schmierige Straßen und schnappende Flügel junge Menschen wie mich einfingen und so lange festhielten, bis es zu spät war, noch jemals irgendwo anders zu leben. Aber die Menschen haben zu Maurice gehalten, und sie haben auch zu mir gehalten.
Als ich vierundzwanzig war, haben sie mich zu ihrem Polizeichef gemacht. Für wenige Monate war ich, Benjamin Wilmot Truman, der jüngste Polizeichef der Vereinigten Staaten – zumindest hat man das hier in der Gegend behauptet. Doch meine Regentschaft war kurz. Noch im gleichen Jahr brachte USA Today eine Geschichte über einen Zweiundzwanzigjährigen, den sie irgendwo in Oregon zum Sheriff gewählt hatten. Der Ehrentitel hat mir allerdings nie gefallen. In Wahrheit wollte ich überhaupt nie Polizist werden, geschweige denn Polizeichef von Versailles.
Auf jeden Fall wohnte Maurice in dem weißen Schindelhaus seines verstorbenen Vaters und lebte von Sozialhilfeschecks und gelegentlichen Gratismahlzeiten der beiden konkurrierenden Diners am Ort. Das Geld vom Staat Maine erhielt er, weil die Sozialbehörde in der Zeit, nachdem er sich den Kiefer weggeschossen hatte, ihre Aufsichtspflicht verletzt hatte. Damit kam er gut über die Runden. Allerdings verließ er seit ein paar Jahren immer seltener das Haus. Keiner wusste warum. In der Stadt herrschte Einigkeit darüber, dass er ein wenig eigenbrötlerisch und vielleicht auch ein wenig verrückt geworden sei. Da er aber außer sich selbst nie jemanden verletzt hatte, war man sich ebenfalls einig, dass es niemanden etwas anging, was Maurice Oulette tat.
Im Prinzip war ich der gleichen Meinung. Mit einer Ausnahme. Alle paar Monate benutzte Maurice die Straßenlampen auf der Route 2 als Zielscheiben – zum großen Missfallen der Autofahrer, die zwischen Miller Falls, Mattaquisett und Versailles unterwegs waren. (Versailles wird übrigens nicht Ver-sei, sondern Ver-sails ausgesprochen.) In diesen Fällen hatte Maurice in der Regel etwas zu viel White Turkey intus, der wohl seine Urteilskraft und erst recht seine Zielgenauigkeit beeinträchtigte. An diesem Abend – es war der 10. Oktober 1997 – kam der Anruf gegen zehn Uhr. Peggy Butler beschwerte sich: »Mister Oulette schießt mal wieder auf Autos.« Ich versicherte ihr, dass Maurice nicht auf Autos, sondern auf Straßenlampen schösse, und dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Auto träfe, sehr gering sei. »Sehr lustig, du Witzbold«, sagte Peggy.
Ich fuhr gleich los. Als ich ein oder zwei Meilen von seinem Haus entfernt war, hörte ich schon die Schüsse. Ein scharfes Knallen, das von einem Gewehr stammte. In unregelmäßigen Abständen, etwa alle fünfzehn Sekunden. Unglücklicherweise gelangte ich nur über die Route 2 zu seinem Haus, was bedeutete, dass ich durch Maurice’ Fadenkreuz musste. Ich stellte die Warnblinkanlage an, die Lichtorgel auf dem Dach, die Suchscheinwerfer, jede Birne, die der Wagen hatte. Wahrscheinlich sah er aus wie ein Mardi-Gras-Festwagen. Die Botschaft lautete: Ich bin’s, Maurice, die Polizei, würdest du wohl für eine Minute das Feuer einstellen.
Ich fuhr den Bronco mit zwei Rädern auf den Rasen und ließ ihn mit voller Beleuchtung stehen. An der hinteren Hausecke rief ich: »Maurice? Ich bin’s, Ben Truman.« Keine Antwort. »Hey, Rambo, kannst du mal kurz aufhören zu schießen?« Wieder keine Antwort. »Also gut, ich komme jetzt«, rief ich laut. »Nicht schießen, Maurice.«
Der Garten hinter dem Haus war ein kleines Rechteck aus stoppeligem Gras, Sand und Kiefernadeln. Überall Krempel und Schrott: das Skelett eines Wäscheschirms, ein Straßenhockeytor, eine Milchkiste. Im hintersten Eck lag ein alter gestrandeter Chevy Nova, dessen Reifen schon vor Jahren an eine andere Chevy-Nova-Rostlaube montiert worden waren. Aber er hatte noch sein Nummernschild aus Maine, das das Bild eines Hummers und das Staatsmotto VACATIONLAND zierte.
Maurice stand mit dem Gewehr in der Armbeuge am Rand des Rechtecks. Seine Haltung ließ an einen Gentleman-Jäger auf Wachteljagd denken, der sich gerade ein paar Minuten Pause gönnt. Er trug Stiefel, eine ölverschmierte Arbeitshose, eine rote Flanelljacke und eine tief ins Gesicht gezogene Baseballkappe. Den Kopf hielt er gesenkt, was nicht ungewöhnlich war. Man gewöhnte sich daran, mit der Kappe zu sprechen.
Ich tastete ihn mit dem Strahl meiner Taschenlampe ab. »Abend, Maurice.«
»Abend, Chief«, sagte die Kappe.
»Was ist hier los?«
»Schieß nur’n bisschen.«
»Das sehe ich. Du hast Peggy Butler zu Tode erschreckt. Kannst du mir vielleicht sagen, worauf zum Geier du schießt?«
»Die Lampen da drüben.« Ohne aufzuschauen, deutete Maurice mit dem Kopf in Richtung Route 2.
Einen Augenblick lang standen wir da und nickten uns gegenseitig an.
»Was getroffen?«
»Nix.«
»Was mit dem Gewehr nicht in Ordnung?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Lass mich mal einen Blick drauf werfen, Maurice.«
Er gab mir das Gewehr. Es war eine alte Remington, die ich schon mindestens ein Dutzend Mal konfisziert hatte. Ich vergewisserte mich, dass eine Patrone in der Kammer steckte, und feuerte auf einen Metallpfosten des Gartenzauns. Die Kugel prallte klirrend ab. »Gewehr ist okay«, sagte ich. »Muss an dir liegen.«
Maurice kicherte leise.
Als ich seine Jackentaschen abklopfte, fühlte ich die Patronenschachtel. Ich griff in die Tasche, wo meine Finger in ein Knäuel zerknüllter Kleenex-Tücher eintauchten, die Maurice anscheinend sammelte wie Haselnüsse. »Herrgott, Maurice, schmeißt du die Dinger nie weg?« Ich zog die Patronenschachtel heraus und steckte sie ein. Ich klappte die Marlboro-Schachtel auf und schob sie ihm wieder in die Tasche. »Was dagegen, wenn ich mich mal ein bisschen umschaue bei dir?«
Schließlich hob er doch noch den Kopf. Das transplantierte Hautgewebe an seinem nach innen gewölbten Kieferknochen glänzte silbern im Licht meiner Taschenlampe. »Bin ich verhaftet?«
»Nein.«
»Dann ist’s okay.«
Ich ging durch die Hintertür ins Haus. Maurice rührte sich nicht vom Fleck. Wie bei einem ausgeschimpften Kind klebten seine Arme an den Hosennähten.
Die Küche stank nach gekochtem Gemüse und Schweiß. Auf dem Tisch stand eine halb leere 0,75er Flasche Jim Beam. Bis auf eine uralte Packung Natriumbikarbonat war der Kühlschrank leer. In den Küchenschränken fand ich ein paar Büchsen (Spaghetti O, Green-Giant-Mais), ein paar Tütensuppen und ein winziges Loch, durch das die Holzameisen ein und aus gingen.
»Maurice«, rief ich nach draußen. »Hat dein Betreuer vom Sozialamt in letzter Zeit mal vorbeigeschaut?«
»Weiß nicht.«
Mit dem Lauf von Maurice’ Gewehr stieß ich die Badezimmertür auf und ließ den Lichtstrahl durch den Raum gleiten. Die Wanne und die Kloschüssel waren von einer gelblichen Schmutzschicht überzogen. Zwei Zigarettenkippen schwammen im Klo. Das Loch in der durchgefaulten Wand unter dem Waschbecken war mit einem Stück Spanplatte zugenagelt worden. Durch die Ritzen über und unter dem Brett konnte man nach draußen sehen.
Ich machte alle Lichter aus und verschloss die Türen.
»Weißt du noch, was Schutzhaft bedeutet, Maurice?«
»Ja.«
»Und? Was?«
»Das ist, wenn Sie mich einsperren, aber ich bin nicht verhaftet.«
»Genau. Und weißt du noch, warum ich das tun muss?« fragte ich weiter.
»Um mich zu schützen, nehm ich an. Deshalb heißt es ja so.«
»Exakt. Und genau das machen wir jetzt, Maurice. Wir nehmen dich in Schutzhaft, damit du bei deiner Rumballerei auf die Straßenlampen niemanden umbringst.«
»Ich habe keine getroffen.«
»Tja, Maurice, das beruhigt mich ganz und gar nicht. Wenn du nämlich treffen würdest, worauf du zielst, dann ...«
Er schaute mich mit leerem Blick an.
»Pass auf, Maurice, du darfst nicht auf die Lampen schießen, sie sind Eigentum der Gemeinde. Außerdem: Was ist, wenn du ein Auto triffst?«
»Ich habe noch nie ein Auto getroffen.«
Die Gespräche mit Maurice endeten immer an diesem Punkt. So auch heute. Es war nicht ganz klar, ob Maurice nur langsam oder ob er ein bisschen verrückt war. Wie auch immer, diese Zurückgebliebenheit hatte er sich verdient. Den Mahlstrom von Emotionen, den er überlebt hatte, konnte sich kein Außenstehender auch nur vorstellen. Und er trug die Narben, die das bewiesen. Er schaute mich an. Der Mondschein ließ seine rechte Seite im Dunkeln, sodass sein Gesicht fast normal aussah. Es war ein für diese Gegend alltägliches Gesicht: schmal mit dunklen Augen. Das Gesicht eines Waldläufers oder Holzfällers auf einem alten Sepiafoto.
»Hast du Hunger, Maurice?«
»Bisschen.«
»Hast du schon was gegessen?«
»Gestern.«
»Sollen wir auf einen Sprung ins Owl?«
»Ich dachte, Sie sperren mich ein.«
»Tu ich auch.«
»Krieg ich mein Gewehr wieder?«
»Nein. Das muss ich einziehen. Du könntest jemanden erschießen damit. Mich zum Beispiel.«
»Ich würde Sie nie erschießen, Chief Truman.«
»Danke, nett von dir. Ich muss es aber trotzdem einkassieren. Du bist nämlich – und das meine ich nicht abwertend, Maurice –, du bist nicht gerade der beste Schütze unter der Sonne.«
»Der Richter gibt’s mir sicher zurück. Ich hab nämlich einen Waffenschein.«
»Bist du jetzt unter die Anwälte gegangen?«
Maurice kicherte wieder sein Kichern, das sich anhörte wie ein Seufzer. »Sieht ganz so aus.«
Die wenigen Gäste im Owl saßen alle am Tresen, tranken alle Bud aus der Flasche und schauten alle in den Fernseher unter der Decke, wo ein Eishockeyspiel lief. Phil Lampier, der Besitzer und außerhalb der Saison einzige Barkeeper, stand auf die Ellbogen gestützt am Ende des Tresens und las Zeitung. Maurice und ich setzten uns auf zwei Barhocker an den kürzeren Teil des kleinen, L-förmingen Tresens. Die anderen saßen am längeren Teil.
Alle brummten »Hallo, Ben«, nur Diane Harned begrüßte mich ein paar Sekunden später mit »Chief Truman«. Sie bedachte mich mit einem kurzen spöttischen Lächeln und schenkte ihre Aufmerksamkeit dann wieder dem Fernseher. Früher war Diane mal eine gut aussehende Frau gewesen, der jedoch inzwischen alle Farbe abhanden gekommen war. Ihr Blondschopf war nicht mehr gelb, sondern strohfarben, und unter ihren Augen hatten sich dunkle Waschbärenringe gebildet. Trotzdem trug sie immer noch die Hochnäsigkeit des hübschen Mädchens zur Schau – und das will ja auch schon was heißen. Egal, wir hatten ein paar Verabredungen gehabt, Diane und ich, und später noch ein paar Versöhnungen. Wir kamen miteinander aus.
Maurice bestellte einen Jim Beam, den ich sofort wieder abbestellte. »Zwei Cokes«, sagte ich zu Phil, der daraufhin die Nase rümpfte.
Jimmy Lownes fragte: »Hast du unsern Al Capone verhaftet?«
»Nein. Die Heizung ist ausgefallen in seinem Haus. Bis sie wieder läuft, kommt er mit zu mir auf die Wache. Aber erstmal brauchen wir was zu essen.«
Diane schaute ihn zweifelnd an, sagte aber nichts.
»Zahl ich für das Essen etwa mit meinen Steuern?«, stichelte Jimmy.
»Nein, geht auf mich.«
»Auch das sind Steuern, Ben«, sagte Bob Burke. »Technisch gesehen. Schließlich kriegst du dein Gehalt von unsern Steuern.«
»Du auch«, sagte Diane wie aus der Pistole geschossen. »Technisch gesehen.«
Burke war als städtischer Angestellter für die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude verantwortlich. Er war ein Trottel, gegen den ich mich auch ohne Dianes Hilfe zur Wehr setzen konnte.
»Die paar Dollar, die ihr für mein Gehalt braucht«, sagte ich. »Außerdem: Sobald die einen andern für den Job gefunden haben, lieg ich euch nicht mehr auf der Tasche. Dann hauen wir ab aus dem Kuhdorf, mein Arsch und ich.«
Diane schnaubte verächtlich. »Und wohin?«
»Hab mir überlegt, dass mir vielleicht ein bisschen Reisen ganz gut tun würde.«
»Schau einer an. Und wohin soll’s gehen?«
»Prag.«
»Prag.« Sie sprach das Wort aus, als würde sie sich zum ersten Mal daran versuchen. »Ich weiß nicht mal, wo das liegt.«
»In der Tschechoslowakei.«
Diane rümpfte wieder geringschätzig die Nase.
Bobby Burke schaltete sich ein. »Jetzt heißt das Tschechische Republik. Bei der letzten Olympiade hat’s geheißen: Tschechische Republik.« Wenn es um derlei Quiz-Show-Wissen ging, war Burke der König. Der Mann schlug sich durchs Leben, indem er in der Grundschule die Böden aufwischte, aber er kannte die Namen aller First Ladys, aller Präsidentenattentäter und aller acht Staaten, die an Missouri grenzen. Männer wie er können Konversationen killen.
Diane hakte nach. »Warum zum Teufel willst du nach Prag?« In ihrer Stimme lag ein scharfer Unterton. Jimmy Lownes stupste sie an und sagte »Oha«, als wolle er andeuten, dass Diane eifersüchtig sei. Aber das war es nicht.
»Warum ich nach Prag will? Weil es schön da ist.«
»Und wenn du mal da bist, was machst du dann?«
»Mich umschauen, nehme ich an. Werd mir die Sehenswürdigkeiten anschauen.«
»Du willst dahin, bloß um dich ein bisschen umzuschauen?«
»Klar, so hab ich’s zumindest geplant.«
Zugegeben, einen Plan hatte ich eigentlich nicht. Aber ich hatte inzwischen das Gefühl, dass ich schon viel zu lange plante und auf die große Gelegenheit wartete. Ich war schon immer der Typ gewesen, der lange nachdachte, der langsam handelte, der jede Idee mit Zweifeln und Bedenken erstickte. Es war an der Zeit, das alles abzuschütteln. Ich rechnete mir aus, dass ich es mindestens bis Prag schaffen müsste, bevor mich meine grüblerische Ader wieder einholte. In Versailles, Maine, würde ich auf jeden Fall nicht verrotten.
»Und Maurice, nimmst du den mit?«, fragte Jimmy.
»Und ob. Was ist, Maurice? Kommst du mit nach Prag?«
Maurice schaute auf und lächelte mit geschlossenem Mund sein scheues Lächeln.
»Vielleicht komme ich auch mit«, verkündete Jimmy.
»Na sicher.« Diane schnaubte erneut.
»Herrgott noch mal«, sagte Jimmy. »Warum denn nicht?«
»Warum denn nicht? Schaut euch doch an.«
Wir schauten uns an, sahen aber nichts.
»Ihr seid einfach keine ... keine Menschen für Prag.«
»Was soll das denn jetzt heißen, ›keine Menschen für Prag‹?« Jimmy Lownes hätte zwar Prag auf der Karte auch dann nicht gefunden, wenn man ihm eine Woche Zeit gelassen hätte, aber seine Entrüstung war doch ehrlich. »Wir sind Menschen, oder etwa nicht? Wir brauchen also bloß nach Prag zu fahren, und schon sind wir Menschen für Prag.«
»Also, jetzt mal ehrlich, Jimmy: Was würdest du in Prag machen?« Diane ließ nicht locker.
»Das Gleiche wie Ben. Mich umschauen. Vielleicht gefällt’s mir ja. Vielleicht bleib ich ja da. Vielleicht bin ich der geborene Mensch für Prag.«
»Die haben gutes Bier«, warf Bob Burke ein. »Pilsener.«
»Na also, gefällt mir jetzt schon.« Jimmy reckte seine Flasche Bud in die Höhe. Allerdings war nicht ganz klar, ob er auf Prag oder auf Bobby Burke oder nur auf Bier ganz allgemein anstoßen wollte.
»Warum kommst du nicht auch mit, Diane«, sagte er. »Vielleicht gefällt’s dir ja auch.«
»Ich hab eine bessere Idee. Ich geh einfach nach Hause und verbrenn mein Geld gleich hier.«
»Also dann«, sagte ich. »Abgemacht. Ich, Maurice und Jimmy. Prag. Nur der Tod entschuldigt.«
Maurice und ich stießen an und besiegelten den Plan.
Aber Diane konnte einfach nicht aufhören. Das Thema ›Abhauen‹ traf immer einen Nerv bei ihr. »Du hast wirklich nur Scheiße im Kopf, Ben«, sagte sie. »Schon immer. Nirgendwo fährst du hin, und das weißt du ganz genau. Mal ist es Kalifornien, mal New York und heute ist eben Prag dran. Und wohin geht’s als Nächstes? Nach Timbuktu? Sollen wir wetten? In zehn Jahren sitzt du hier auf deinem Hocker und blubberst noch den selben Scheiß über Prag oder sonst eine Stadt.«
»Lass gut sein, Diane«, sagte Phil Lamphier. »Wenn Ben nach Prag oder sonstwohin will, warum soll er nicht? Gibt keinen Grund?«
An meinem Gesichtsausdruck muss Diane erkannt haben, dass sie einen Schritt zu weit gegangen war. Sie schaute zur Seite und fummelte an ihrer Ziagrettenschachtel herum, damit sie mir nicht in die Augen schauen musste. »Jetzt komm schon, Ben«, sagte sie. »Ich hab doch nur Spaß gemacht.« Sie zündete sich eine Zigarette an und versuchte dabei, wie Barbara Stanwyck auszusehen. Es sah allerdings mehr nach Mae West aus. »Sind wir noch Freunde?«
»Nein«, sagte ich.
»Vielleicht sollte ich heute Nacht auch auf die Wache kommen. Bei mir zu Hause wird’s auch nicht mehr so richtig heiß.«
Lownes und Burke brüllten los. Hinter dem Schild seiner Kappe johlte sogar Maurice mit.
»Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten ist ein Verbrechen, Diane.«
»Na gut. Dann verhafte mich.« Sie streckte die Arme aus in Erwartung der Handschellen. Wieder Grölen.
Maurice und ich blieben noch etwa eine Stunde im Owl. Phil schob für uns zwei tiefgefrorene Fleischpasteten in die Mikrowelle. Maurice schlang seine so schnell hinunter, dass ich schon befürchete, er würde auch noch die Gabel verputzen. Ich bot ihm die Hälfte von meiner an, doch er lehnte ab. Den Rest der Pastete nahm ich mit auf die Wache, wo er sie dann aß. Maurice schlief in der Arrestzelle. Die Zelle hat eine Matratze, und die Nacht war für ihn sicher nicht unbequemer als in seinem zugigen Haus. Die Zellentür ließ ich unverschlossen, damit er im Gang auf die Toilette konnte. Allerdings setzte ich mich vor der Tür auf einen Stuhl und schlief mit ausgestreckten Beinen. Maurice konnte also nicht aus der Zelle, ohne mich zu wecken. Die Gefahr bestand natürlich nicht darin, dass Maurice jemand anderen verletzte, sondern darin, dass er sich selbst verletzte, während er betrunken in Schutzhaft saß. Man hat schon Pferde kotzen sehen.
Bis weit nach drei saß ich wach auf meinem Stuhl und hörte Maurice zu. Der Mann machte schlafend mehr Lärm als die meisten Menschen im Wachzustand. Er brabbelte, schnarchte und furzte. Doch eigentlich waren es andere Dinge, die mich wach hielten. Ich musste raus aus Versailles. Ich musste endlich die große Venus-Fliegenfalle abschütteln, die sich an meine Fußknöchel klammerte. Ich musste raus, gerade jetzt.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen stand ich vor der Rufus King Elementary School und passte auf, dass die Kinder sicher über die Route 2 kamen. Ich begrüßte jedes mit Namen – darauf legte ich Wert. Eins nach dem andern quäkte »Hi, Chief Truman.« Ein Junge fragte: »Was ist mit Ihren Haaren passiert?« Er zog das Wort in die Länge – Haaaren. Was mit den Haaren passiert war? Ich hatte auf der Wache mit dem Kopf an der Wand geschlafen. Ich schaute das Bürschchen streng an und drohte ihm mit Verhaftung, worauf er kichernd weiterging.
Danach fuhr ich zum Acadia County District Court, um zu überprüfen, ob es in den Nachbargemeinden Verhaftungen gegeben hatte. Das Gericht befindet sich in Miller Falls, mit dem Auto etwa zwanzig Minuten entfernt. Obwohl ich selbst keine Verhaftungen zu melden hatte, fuhr ich hin. Für den täglichen Klatsch und Tratsch mit den Angestellten und Polizisten. Das Gerücht ging, dass ein Bursche an der Highschool Marihuana verkaufte, das er in seinem Spind bunkerte. Gary Finbow, der Polizeichef von Mattaquisett, hatte sogar schon einen Antrag für einen Durchsuchungsbeschluss für den Spind aufgesetzt. Er wollte, dass ich den Antrag auf Fehler durchsah. Ich überflog das Papier, strich ein paar Rechtschreibfehler an und riet ihm, mit den Eltern zu sprechen und das Ganze zu vergessen. »Willst du dem Jungen wegen ein paar Joints die Möglichkeit aufs College versauen?« Er schaute mich komisch an, worauf ich das Thema fallen ließ. Bei Typen wie Gary kann man sich die Mühe von Erklärungen sparen. Genauso gut könnte man einer Dänischen Dogge den Hamlet erklären wollen.
Also zurück zur Wache. Schon jetzt überkam mich das zersetzende Gefühl von Langeweile und Übermüdung. Dick Ginoux, mein ranghöchster Untergebener, saß hinter dem Schreibtisch am Eingang und las die USA Today vom Vortag. Er hielt die Zeitung mit ausgestreckten Armen von sich und lugte über den Rand seiner Brille. Als ich hereinkam, zuckten seine Augen nur für einen Augenblick zur Seite. »Morgen, Chief.«
»Was gibt’s Neues, Dick?«
»Demi Moore hat sich den Schädel rasiert. Für’n Film, nehme ich an.«
»Ich meine hier.«
»Oh.« Dick ließ die Zeitung sinken und schaute sich in dem leeren Büro um. »Nichts.«
Dick war in den Fünfzigern und hatte ein längliches Pferdegesicht. Sein einziger Beitrag zum lokalen Gesetzesvollzug bestand darin, mit seiner Zeitung den Schreibtisch des Diensthabenden in Beschlag zu nehmen. Er war in etwa so nützlich wie eine Topfpflanze.
Er nahm seine Brille ab und schaute mich auf gruselig väterliche Art an. »Alles in Ordnung, Ben?«
»Bisschen müde, das ist alles.«
»Sicher?«
»Ja.« Ich ließ meinen Blick durchs Büro schweifen. Dieselben drei Schreibtische. Derselbe Akenschrank. Dieselben schmutzigen zwei mal zwei Meter großen Fenster. Plötzlich und ziemlich heftig graute mir vor der Vorstellung, hier den Rest des Morgens verbringen zu müssen. »Weißt du was, Dick, ich werd mich draußen ein bisschen umsehen.«
»Umsehen? Wo?«
»Weiß noch nicht.«
Dick schob die Unterlippe vor und setzte ein besorgtes Gesicht auf, sagte aber nichts.
»Sag mal, Dick ... Hast du schon mal dran gedacht, irgendwann Chief zu werden?«
»Wieso sollte ich?«
»Weil du sicher einen guten Chief abgeben würdest.«
»Tja, wir haben doch einen Chief, Ben. Du bist der Chief.«
»Schon. Aber wenn ich nicht mehr da wäre.«
»Wie, wenn du nicht mehr da wärst. Versteh ich nicht. Wo willst du denn hin?«
»Nirgendwohin. Nur so. Für den Fall.«
»Für welchen Fall?«
»Für den ... Lass gut sein.«
»Alles klaro, Chief.« Dick setzte sich die Brille auf und widmete sich wieder der Zeitung. »Klaro, klaro.«
Ich sagte mir, dass ich die Hütten am See überprüfen könnte, eine Aufgabe, die ich schon seit Wochen vor mir herschob. Vorher würde ich aber noch zu Hause vorbeischauen und mich waschen.
Mein Vater war sicher da. Vielleicht war das ja der eigentliche Grund für den Zwischenstopp: meinem Vater mitzuteilen, was ich vorhatte. Im Nachhinein ist es schwer, sich an seine eigenen Gedanken zu erinnern. Mein Vater und ich waren in letzter Zeit nicht sonderlich gut miteinander ausgekommen. Meine Mutter war acht Wochen vorher gestorben, und in dem folgenden Chaos hatten wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Meine Mutter war immer das Verbindungsglied zwischen uns gewesen. Sie hatte gedolmetscht, erklärt und richtiggestellt. Sie hatte den Groll immer wieder aufgebrochen. Im Augenblick brauchten wir sie nötiger denn je.
Er stand in der Küche am Herd. Claude Truman war immer ein stämmiger, breitschultriger Mann gewesen. Selbst jetzt noch, mit seinen siebenundsechzig Jahren, hatte er eine kraftvolle Ausstrahlung. Er stand breitbeinig da, so als könnte der Herd ihn attackieren und er wäre gezwungen, das Ding mit Gewalt zurück an seinen Platz an der Wand zu schieben. Er drehte sich um, als ich die Küche betrat, sagte aber nichts.
»Was kochst du?«
Keine Reaktion.
Ich schaute ihm über die Schulter. »Eier. Die Dinger nennt man Eier.«
Mein Vater sah fertig aus. Das verdreckte Flanellhemd hing ihm aus der Hose. Er hatte sich seit Tagen nicht rasiert.
»Was war los letzte Nacht?«, fragte er.
»Hab auf der Wache geschlafen. Musste Maurice in Schutzhaft nehmen, sonst wäre er in seiner Bude erfroren.«
»Die Wache ist doch kein Hotel«, grummelte er. Er kramte in dem schmutzigen Geschirr im Spülbecken herum, bis er einen einigermaßen sauberen Teller für die Eier fand. »Du hättest anrufen können.«
Mein Vater schaffte sich auf dem Esstisch Platz für den Teller. Dabei schob er auch eine 1,2-Liter-Flasche Miller Beer zur Seite.
Ich hob die leere Flasche hoch. »Was zum Teufel ist das?«
Er warf mir einen hasserfüllten Blick zu.
»Vielleicht hätte ich ja dich in Schutzhaft nehmen sollen«, sagte ich.
»Kannst es ja mal versuchen.«
»Wo hast du das her?«
»Was spielt das für eine Rolle? Das ist ein freies Land. Gibt kein Gesetz dagegen, dass ich ein Bier trinke.«
Ich schüttelte den Kopf, so wie es meine Mutter immer getan hatte, und warf die Flasche in den Mülleimer. »Nein. Ein Gesetz gibt’s nicht dagegen.«
Er besiegelte seinen kleinen Sieg, indem er mir einen finsteren Blick zuwarf. Dann wandte er sich seinen Eiern zu. Er zerteilte das Dotter und schmierte es über das Eiweiß.
»Ich geh zum See und schau mir mal die Hütten an.«
»Also dann.«
»Also dann? Das ist alles? Hast du mir nicht noch was zu sagen, bevor ich gehe?«
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel, was das mit dem Bier soll. Ist vielleicht nicht gerade der passende Tag heute.«
»Geh einfach und tu, was du tun musst, Ben. Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
Er stocherte in den Eiern herum. Sein Gesicht war fast so grau wie sein Haar. Er war also auch nur ein alter Mann, der sich den Kopf darüber zerbrach, was er mit sich selbst anfangen, womit er seine letzten Tage zubringen sollte. Wie allen Söhnen, die über ihre Väter nachdachten, kam auch mir der Gedanke: War ich wie er? Ist das der Mann, der ich mal werden würde? Ich hatte mich immer als Abkömmling der mütterlichen, nicht der väterlichen Linie betrachtet; als einen Wilmot, nicht einen Truman. Aber ich war auch sein Sohn. Ich hatte seine großen Hände, wenn auch nicht sein rabaukenhaftes Temperament. Was genau war ich diesem alten Mann schuldig?
Ich ging nach oben, um mich zu waschen. Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, war klein. Es hatte im ersten Stock zwei kleine Schlafzimmer und ein Badezimmer. Weil mein Vater seine Klamotten nicht regelmäßig wusch, roch es ein wenig streng. Ich spritzte mir eiskaltes Wasser ins Gesicht und zog mir ein frisches Uniformhemd an. Um das Oberarmabzeichen mit der Aufschrift VERSAILLES POLICE herum war der Stoff etwas faltig. Auch das Stärkespray vor dem Bügeln half nichts. Ich stand vor dem Spiegel im Schlafzimmer meiner Eltern und versuchte die Unebenheit zu glätten.
Rechts unten im Rahmen des Spiegels klemmte ein altes Foto von meinem Vater. Er trug genau die gleiche Uniform wie ich und schaute mit verbissenem Gesichtsausdruck in die Kamera. Das war der echte Claude Truman. Der Chief. Die geballten Fäuste in die Hüften gestemmt, der mächtige Brustkorb, der brettebene Bürstenschnitt, die lächelnde Grimasse. »Ein Mann wie ein Baum« – so sah er sich selbst. Der Schnappschuss musste Anfang der Achtziger aufgenommen worden sein, etwa um die Zeit, als meine Mutter den Alkohol ein für alle Mal aus dem Haus verbannte. In jener Nacht war ich neun und glaubte, dass es meine Schuld war. Zumindest teilweise. Wegen mir büßte mein Vater das Recht zum Trinken ein.
In jener Nacht kam er in düsterer Stimmung nach Hause und ließ sich in seinen Sessel vor dem Fernseher fallen. Unter Alkohol war mein Vater immer in übler Verfassung. Er wurde sehr still, und die bedrohlichen Schwingungen, die er aussandte, glichen dem Brummen einer Hochspannungsleitung. Ich wusste genug, um mich von ihm fernzuhalten. Aber der Pistole, die er zusammen mit seiner Brieftasche und den Schlüsseln auf den Tisch legte, konnte ich nicht widerstehen. Die große 38er blinkte normalerweise von seiner Wäschekommode herunter oder versteckte sich unter seiner Jacke. Jetzt lag sie offen vor mir. Fasziniert ging ich langsam auf sie zu – ich wollte sie nur berühren, wollte nur meine Sehnsucht nach der öligen Stahloberfläche und dem geriffelten Knauf stillen. Ich streckte einen Finger aus. Dann explodierte mein Ohr. Ein unerträglicher- Schmerz schoss vom Trommelfell ins Kopfinnere: Er hatte mir mit der flachen Hand aufs Ohr geschlagen, weil er wusste, dass das die meisten Schmerzen verursachte, ohne äußere Spuren zu hinterlassen. Weit entfernt hörte ich mein eigenes Schreien. Jenseits des Dröhnens in meinem Ohr hörte ich eine Stimme. »Hör auf mit der Flennerei!« und »Willst du dich umbringen?« Dann: »Das wird dir eine Lehre sein!« Wenn mein Vater gewalttätig wurde, dann immer zu einem höheren Zweck.
Meine Mutter war fuchsteufelswild. Sie kippte jede Flasche aus und warnte ihn davor, »ihr Haus« jemals wieder mit einer Flasche Alkohol oder auch nur mit einer Fahne zu betreten. Er brüllte zwar herum, widersetzte sich aber nicht. Stattdessen reagierte er seinen Zorn an den Küchenwänden ab. Ich lag oben im Bett und spürte die Wände beben, als seine Faustschläge den Putz und die Gipskartonplatten bis zu den dahinterliegenden, groben Holzbalken aufrissen.
Allerdings musste auch er gespürt haben, dass es an der Zeit war, mit dem Trinken Schluss zu machen. Seine Sauferei und seine Wutanfälle waren kein Geheimnis. Ich bin sicher, dass der übertriebene Respekt, die Wertschätzung und Freundschaft, die die Leute dem Law-und-Order-Polizeichef bezeugten, der falsche Tribut war, den sie dem Rabauken zollten.
Bis zum Tod meiner Mutter achtzehn Jahre später blieb er trocken. Der Ruf der Gewalttätigkeit blieb ihm zwar, doch die Bürger von Versailles gewöhnten sich allmählich an, seine Wutanfälle genauso zu sehen wie er selbst: Die meisten, die er verprügelte oder anbrüllte oder anderweitig attackierte, hatten es wahrscheinlich nicht anders verdient.
Ich steckte das alte Foto wieder an den Spiegel. Das war jetzt alles Geschichte.
Ich nahm für meinen Vater ein sauberes Hemd mit nach unten und hängte es an den Haken an der Küchentür. Als ich ging, stocherte er mit der Gabel in den Resten seiner Spiegeleier herum.
Der Lake Mattaquisett hat ungefähr die Form einer Sanduhr. Er erstreckt sich entlang einer Nord-Süd-Achse über die Länge von etwa einer Meile. Wenn die Leute vom Lake Mattaquisett sprechen, meinen die meisten die Südseite, obwohl sie der kleinere Teil ist. An der Südspitze befindet sich die ehemalige »Fischerhütte« der Familie Whitney aus New York. Der rustikale Blockhausstil verkörpert das, was vor der Weltwirtschaftskrise die besseren Kreise Manhattans für naturnah hielten. Das große Haus, das jetzt einer Familienstiftung gehört, beherrscht diesen Teil des Sees. Ein leicht abfallender Weg führt vom Haus durch das düstere Grün des Kiefernwaldes und endet eine Viertelmeile später am Ufer des Sees in hellem, glitzerndem Licht. Außer im August, wenn die Moskitos nicht gar so lästig sind, ist das Haus unbewohnt. Die anderen, bescheideneren Häuser, die sich an diesem Teil des Sees befinden, halten keinen Vergleich mit dem Haus der Whitneys stand. Als wären sie sich ihrer Minderwertigkeit bewusst, liegen sie etwas weiter von der Straße weg und können nur vom Wasser aus gesehen werden. Der nördliche Teil des Sees ist weniger erschlossen und weniger vornehm. Hier gibt es nur Fertigbauhütten, die auf kurzen Betonpfeilern stehen. Sie werden zwischen Memorial Day und Labor Day wochenweise an die arbeitende Bevölkerung aus Boston oder Portland vermietet. An Leute von außerhalb. Wir nennen sie Sportsfreunde oder Flachländer. Touristen, der Lebenssaft der Gegend.
Ich legte Wert darauf, der einen Seeseite die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen wie der andern. Nicht weil mir die Arbeitertypen sympathischer waren, sondern weil man öfter in die kleinen Hütten einbrach als in die größeren Häuser. Die Hütten lockten die einheimischen Halbwüchsigen an, die nach passenden Örtlichkeiten für ihre Partys suchten. Man brauchte nur die mit einem Vorhängeschloss verriegelte Türangel aufzustemmen. Mit einem Montiereisen ging das ruckzuck. Also überprüfte ich sie alle paar Wochen, rief die Besitzer an, wenn man eingebrochen hatte, und kümmerte mich darum, dass demolierte Scharniere und Fensterrahmen repariert wurden. Ich räumte sogar die leeren Bierflaschen, die Marihuana-Kippen und die gebrauchten Kondome weg.
Die Hütte, in der die Leiche lag, war die vierte, die ich an diesem Morgen kontrollierte.
Ich hätte einfach vorbeifahren können, hätte gar nicht aussteigen müssen, denn ich konnte auch vom Wagen aus deutlich sehen, dass das Äußere der Hütte unversehrt war. Die Holzläden vor den Fenstern waren mit Vorhängeschlössern verriegelt und die Tür war unversehrt. Aber da war dieser Geruch, zunächst schwach, dann immer stärker, je näher ich kam – ein beißender Ammoniakgestank, der unverwechselbare Geruch von Verwesung. Ich kannte den Geruch von der Route 2 oder der Post Road, wenn Autos einen Hirsch angefahren hatten. Auch das hätte ein großes Tier, ein Hirsch oder sogar ein Elch sein können, der irgendwo in der Nähe tot im Wald lag. Doch der Geruch kam zweifelsfrei aus der Hütte, und ich hatte noch nie von einem Elch gehört, der im Bett gestorben war.
Ich holte hinten aus dem Bronco ein Stemmeisen und brach die Tür auf.
Fliegen summten.
Der Geruch war überwältigend. Meine Halsmuskeln verkrampften sich. Ich hatte kein Taschentuch dabei, um mir wie die Polizisten im Film die Nase zuzuhalten. Also drückte ich mein Gesicht in die Beuge meines Ellbogens. Keuchend stand ich in der Tür und tastete mit dem Lichtstrahl meiner Taschenlampe den dunklen Raum ab.
Was zunächst wie ein Berg Wäsche auf dem Boden aussah, entpuppte sich als Körper. Ein Mann, der gekrümmt auf der Seite lag. Er trug nur Khaki-Shorts und T-Shirt. Die nackten, geschwollenen Beine waren eierfarben mit rosa leuchtenden Tupfern, wo die Haut den Boden berührte. Das T-Shirt war hoch gerutscht und entblößte einen aufgedunsenen, weißen Bauch. Rotes Haar kräuselte sich hinauf zum Nabel. Das linke Auge schaute in meine Richtung. Wo vorher das rechte war, klebte ein trockener Klumpen Blut. Darüber klaffte ein Riss in der Kopfhaut, aus dem Gehirnmasse gequollen war. Um den zerschmetterten Kopf bedeckte ein weiter, halbmondförmiger Strahlenkranz aus getrocknetem Blut den Holzboden. Im Lichtstrahl der Taschenlampe sah der Fleck schwarz aus. Neben dem Kopf lag die linke Hälfte einer Brille.
Der Raum begann sich zu drehen. Ich keuchte abgehackt in die Falten meines Jackenärmels. Die Hütte war leer. Die Kommodenschubladen waren halb herausgezogen, die Matratzen waren zusammengerollt und mit einer Schnur zusammengebunden.
Ich ging hinein. Neben der Leiche war eine Brieftasche. Ein zerknittertes Bündel Geldscheine lag auf dem Boden. Vielleicht fünfzig Dollar. Ich kniete mich hin und klappte mit der Spitze meines Kugelschreibers die Brieftasche auf. Sie enthielt einen goldenen fünfzackigen Stern mit den eingravierten Worten Robert M. Danziger * stv. Bezirksstaatsanwalt * Sussex County.
Kapitel 3
Die übliche Leier ist, dass wir Gewalt gegenüber abgestumpft seien, dass wir uns durch Kino und Fernsehen daran gewöhnt hätten. Wir haben die Hyperrealität der Gewalt auf der Leinwand gesehen, also schockieren uns wirkliche Gewalttaten und Verletzungen nicht mehr. In Wahrheit trifft genau das Gegenteil zu. Filmische Gewalt mit seinen platzenden Blutbeuteln, verrenkten Toten und Schauspielern, die den Atem anhalten, der ganze kunstvolle Realismus, er verstärkt nur den Schock, den eine wirkliche Leiche hervorruft. Der urzeitliche Schrecken eines toten Körpers, so stellt sich heraus, liegt gerade in seiner Realität – in seiner sperrigen, widersinnigen Vertrautheit.
Die Leiche von Robert Danzinger entsetzte mich. Sie attackierte die Sinne. Der glänzende Spalt in der Kopfhaut, der aufgedunsene, verfärbte Rumpf. Die gummiartige, straffe Haut über den geschwollenen Knöcheln. Der überwältigende Gestank, der wie Rauch in den Nasennebenhöhlen hing. Ich schaffte es ein gutes Stück von der Hütte weg in den Wald hinein, bevor ich mich übergeben musste. Aber selbst danach war mir noch schwindelig. Ich legte mich auf die Kiefernadeln und schloss die Augen.
Der Nachmittag gehörte der Bundespolizei von Maine und den stellvertretenden Generalstaatsanwälten, die aus Portland und sogar aus Augusta gekommen waren. Der die Untersuchung leitende Beamte für die Staatsanwaltschaft war ein aalglatter Karrierehengst namens Gregg Cravish. Er hatte das wächserne, künstliche Aussehen eines Game-Show-Moderators. Selbst die Krähenfüße an seinen Schläfen sahen aus, als seien sie dort mit Absicht appliziert worden, um dem zu hübschen Gesicht etwas Tiefe zu verleihen. Gravish erklärte mir, dass die Staatspolizei die Ermittlungen durchführen werde. In Maine fielen Mordfälle unter die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft. »Standardprozedere«, versicherte der Game-Show-Moderator und drückte mir leicht die Schulter. »Natürlich werden wir noch Ihre Hilfe benötigen.«
Also trat ich zur Seite und schaute zu.
Ein Techniker-Team der Staatspolizei sezierte die Hütte und den sie umgebenden Grund wie Archäologen eine Ausgrabungsstätte. Der Game-Show-Moderator steckte zwar gelegentlich den Kopf in die Hütte, lehnte aber die meiste Zeit mit gelangweiltem Gesicht an einem Auto.
Man bat mich, die Zufahrt zur Hütte zu sperren. Ansonsten – so stellte sich schnell heraus – bestand meine Arbeit darin, nicht im Weg herumzustehen. Ich postierte einen Beamten etwa eine Meile nördlich von der Hütte, die aus Süden kommenden Fahrzeuge übernahm ich selbst: Beamte der Staatspolizei, noch mehr Game-Show-Moderatoren, der Leichenbeschauer, der den toten Körper abholte. Sie winkten mir zu, und ich winkte zurück, bevor ich mich mit Spucke und Kleenex-Tüchern wieder der Kotze auf meinen Schuhe widmete. Die Übelkeit ließ zwar nach, aber dafür bekam ich Kopfschmerzen. Mir wurde klar, dass ich nicht einfach warten konnte. Ich musste etwas tun. Im Augenblick hatte ich zwei Möglichkeiten: die Untersuchung ohne mich weiterlaufen zu lassen, was ja schon der Fall war, oder mich irgendwie einzuklinken. Ersteres – das Ganze an mir vorbeirauschen zu lassen – kam nicht wirklich in Frage. Wenn auch ohne mein Zutun, so war ich doch schon betroffen. Ich konnte den Fall nicht einfach ignorieren, es handelte sich schließlich um einen Mord in meiner eigenen Stadt.
Es war schon nach Mittag, als ich zur Hütte zurückkehrte. Ich war fest entschlossen, meinen rechtmäßigen Platz bei dieser Untersuchung einzunehmen. Cravish und sein Team packten schon ihre Ausrüstung zusammen und luden die Kisten in die Vans. Das gesammelte Material und die Fotos würden sie eine Weile beschäftigen. Mit dem gelbem Absperrband rundherum sah die Hütte aus wie ein großes Weihnachtsgeschenk. Um Neugierige fernzuhalten, führte ein zweites, an Holzpflöcken befestigtes Band in größerem Radius um die Hütte herum. Ich konnte unbehelligt am Tatort herumspazieren. Für den Game-Show-Moderator war ich Luft.
Die zusammengekrümmte Leiche lag offen auf einer Stahltrage – als hätte man sie vergessen. In der frischen Luft hatte sich der Geruch zumindest so weit verflüchtigt, dass mir nicht mehr schwindelig wurde. Fasziniert ging ich auf die Leiche zu. Es ging eine unheimliche Anziehungskraft von ihr aus. Die nackten Gliedmaßen waren geschwollen, bleich, unbehaart. Die tödliche Verletzung hatte das Gesicht entstellt. Der Körper schien nichts Menschliches mehr an sich zu haben: eine Schnecke, die ihr Haus abgeworfen hatte und nun schutzlos der brennenden Sonne ausgesetzt war.
Ich betrachtete die Leiche, als Cravish und ein anderer Mann von der anderen Seite an die Trage herantraten. Der Neue war klein, hatte aber den starren, kämpferischen Blick eines Gockels. Cravish stellte ihn als Edmund Kurth vom Morddezernat Boston vor.
»Boston?«, sagte ich.
Kurth aus Boston schaute mich an. Er schien mich auf Anzeichen ländlicher Tumbheit zu überprüfen. Ich sollte von vornherein klarstellen, dass Ed Kurth mich beunruhigte, schon bei diesem ersten Zusammentreffen. Er war die Sorte Mensch, vor der man am liebsten sofort wieder Reißaus nimmt. Er hatte ein ernstes, kantiges Gesicht, das von einer schmalen Nase und zwei dunklen Augen dominiert wurde. Die Haut war mit Aknenarben bedeckt. Die buschigen Augenbrauen verliehen dem Gesicht einen permanent verärgerten Ausdruck – als hätte ihm gerade jemand in den Rücken geboxt.
»Das Opfer war Staatsanwalt in Boston«, sagte Cravish. Der Blick, den er Kurth zuwarf, sagte: Sehen Sie jetzt, mit was für Leuten ich es hier zu tun habe?
»Boston«, wiederholte ich, ohne einen der beiden anzusehen.
Kurth beugte sich über den Körper und inspizierte ihn mit der gleichen teilnahmslosen Schärfe wie mich. Er streifte sich Gummihandschuhe über und stupste den Körper mit einem Finger an – als wollte er ihn wecken. Ich beobachtete sein Gesicht, als er sich mit der Nase bis auf einen Zentimeter Bob Danzigers Überresten näherte. Ich wartete auf eine Reaktion, auf ein Zucken. Kurths Gesicht blieb reglos. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hätte man nur schwer sagen können, ob er in die verwüstete Augenhöhle eines toten Menschen schaute oder in seinem Handschuhfach nach der Straßenkarte suchte.
»Vielleicht ist er deshalb getötet worden«, sagte ich vorsichtig. Ich wollte ihnen meinen Spürsinn beweisen. »Weil er Staatsanwalt ist.«
Kurth reagierte nicht.





























