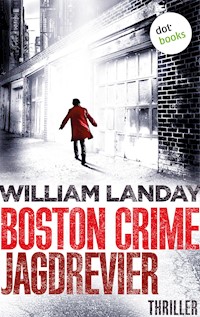4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie weit gehst du für deinen eigenen Sohn? Der packende Psycho-Thriller »Verschwiegen« von William Landay jetzt als eBook bei dotbooks. Eine Kleinstadt nahe Boston wird von einer schrecklichen Tat erschüttert, als man den 14-jährige Ben Rifkin tot im Park findet, brutal mit einem Messer erstochen. Staatsanwalt Andrew Barber wird mit dem Fall betraut – doch der entpuppt sich als schrecklicher Albtraum, als sein Sohn Jacob zum Hauptverdächtigen wird. Bald schon weiß Andrew nicht mehr, was und wem er glauben soll: Niemals könnte sein eigenes Kind ein brutaler Mörder sein … aber wie kommt die Tatwaffe ausgerechnet in Jacobs Zimmer? Und welche dunklen Geheimnisse zwingen den Teenager dazu, sich immer weiter von seiner Außenwelt abzuschotten? Während Andrew alles daran setzt, die Unschuld seines Sohnes zu beweisen, beginnt der Fall bereits, seine Familie zu zerreißen. Und schließlich muss er sich die alles entscheidende Frage stellen: Wie weit wird er gehen, um Jacob zu beschützen? »Raffiniert, subtil und spannend. William Landay fängt in seinem Roman sowohl die Komplexität als auch die unglaubliche Zerbrechlichkeit eines Familienlebens ein«, urteilt Bestsellerautor Lee Child. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Spannungsroman »Verschwiegen« von William Landay – ein eiskaltes Lesevergnügen für alle Fans von Karin Slaughter, das als Vorlage für die gleichnamige TV-Serie diente. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine Kleinstadt nahe Boston wird von einer schrecklichen Tat erschüttert, als man den 14-jährige Ben Rifkin tot im Park findet, brutal mit einem Messer erstochen. Staatsanwalt Andrew Barber wird mit dem Fall betraut – doch der entpuppt sich als schrecklicher Albtraum, als sein Sohn Jacob zum Hauptverdächtigen wird. Bald schon weiß Andrew nicht mehr, was und wem er glauben soll: Niemals könnte sein eigenes Kind ein brutaler Mörder sein … aber wie kommt die Tatwaffe ausgerechnet in Jacobs Zimmer? Und welche dunklen Geheimnisse zwingen den Teenager dazu, sich immer weiter von seiner Außenwelt abzuschotten? Während Andrew alles daran setzt, die Unschuld seines Sohnes zu beweisen, beginnt der Fall bereits, seine Familie zu zerreißen. Und schließlich muss er sich die alles entscheidende Frage stellen: Wie weit wird er gehen, um Jacob zu beschützen?
Über den Autor:
William Landay wurde in Amerika geboren und absolvierte ein Jura-Studium an den Elite-Universitäten Yale und Boston Law School. Er arbeitete einige Jahre als Staatsanwalt und begann schließlich eine erfolgreiche Karriere als Thriller-Autor, wobei er immer wieder sein umfassendes juristisches Wissen unter Beweis stellt. Für seinen ersten Roman »Boston Crime« gewann Landay den begehrten »Dagger Award« für das beste Krimi-Debüt. Heute lebt der Autor mit seiner Frau und seinen Kindern in Boston.
Die Website des Autors: williamlanday.com
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Verschwiegen« und »Boston Crime: Jagdrevier«.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2012 unter dem Originaltitel »Defending Jacob« bei Delacorte Press, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2012 by William Landay
Copyright © der deutschen Erstausgabe carl’s books, München, in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/yalana, Rald Geithe
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-508-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Verschwiegen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
William Landay
Verschwiegen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Sylvia Spatz
dotbooks.
Erster Teil
»Lassen Sie uns in unseren Erwartungen an das Strafrecht realistisch sein ... Wir müssen uns nur vorstellen, dass wir durch einen Trick in die Vergangenheit versetzt werden und unserem allerersten Vorfahren Adam, sozusagen dem Urmann, begegnen. Klein, dicht behaart, seit Kurzem im aufrechten Gang, durchstreifte er vor ungefähr drei Millionen Jahren die afrikanische Savanne. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir für dieses kluge, kleinwüchsige Wesen so viele Gesetze erfinden können, wie wir wollen. Und doch wäre es immer noch keine gute Idee, es zu streicheln ...«
Reynard ThompsonA General Theory of Human Violence (1921)
Kapitel 1
Vor der Grand Jury
Mister Logiudice: Nennen Sie uns bitte Ihren Namen.
Zeuge: Andrew Barber.
Mister Logiudice: Welchen Beruf üben Sie aus?
Zeuge: Ich war zweiundzwanzig Jahre lang Staatsanwalt in diesem Verwaltungsbezirk.
Mister Logiudice: Das waren Sie. Und welchem Beruf gehen Sie zurzeit nach?
Zeuge: Ich bin gewissermaßen arbeitslos, das wäre wahrscheinlich die zutreffende Formulierung.
Im April 2008 wurde ich von Neal Logiudice endlich vor die Grand Jury, die Anklagejury, geladen. Viel zu spät. Ganz sicher zu spät für diesen Fall, aber auch für Logiudice selbst. Sein Ruf war da bereits schwer angeschlagen und mit ihm seine gesamte Karriere. Eine Zeit lang kann ein angeschlagener Staatsanwalt weitermachen, aber seine Kollegen belauern ihn wie Wölfe, und am Ende wird er dem Wohl des Rudels geopfert. Ich habe das schon viele Male erlebt: An einem Tag ist ein Staatsanwalt noch unersetzbar, am nächsten ist er weg vom Fenster.
Irgendwie hat mir Neal Logiudice immer gefallen (ausgesprochen wird er la-JOO-dis). Er kam vor zwölf Jahren zur Staatsanwaltschaft, gleich nach dem Studium. Damals war er neunundzwanzig, sein Haar lichtete sich schon, und er hatte einen kleinen Bauch. Aufgrund seiner schiefen Zähne hatte er Mühe, seinen Mund zu schließen, und trug deshalb immer einen säuerlich verkniffenen Gesichtsausdruck zur Schau. Immer wieder machte ich ihn darauf aufmerksam, seine Miene vor den Geschworenen zu kontrollieren – wer wird schon gerne unfreundlich angesehen –, aber es war etwas Unwillkürliches. Er hatte die Angewohnheit, kopfschüttelnd und mit geschürzten Lippen wie ein Priester oder Oberlehrer vor die Geschworenen zu treten, worauf bei allen sofort der geheime Wunsch aufkam, gegen ihn zu stimmen. Innerhalb der Staatsanwaltschaft verhielt sich Logiudice etwas intrigant und manipulativ. Man ärgerte ihn gern. Die anderen Staatsanwälte nahmen ihn fortwährend auf den Arm, doch kriegte er auch einiges von anderen Seiten ab, sogar von Leuten, die gar nicht direkt mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiteten – Polizisten etwa, Büroangestellte, Sekretärinnen, also alles Leute, die mit ihrer Antipathie gegenüber Staatsanwälten normalerweise hinter dem Berg halten. Milhouse nannte man ihn, nach einem Blödmann in der Simpsons-Fernsehserie, und sein eigentlicher Name erfuhr endlose Varianten: LoFoolish, LoDoofus, Sid Vicious und so weiter. Aber ich fand Logiudice so weit in Ordnung. Er war einfach naiv. In bester Absicht zerstörte er Leben und schlief trotzdem gut.
Denn schließlich war er hinter Übeltätern her. Die typische Selbsttäuschung der Staatsanwälte: Wenn ich jemanden strafrechtlich verfolge, dann muss die Person ein Übeltäter sein. Und Logiudice war nicht der Erste, der ihr erlag. Ich sah ihm seine Selbstgerechtigkeit nach. Ich mochte ihn sogar. Seine Ecken und Kanten hatten es mir angetan, sein unaussprechlicher Name, seine krummen Zähne (jeder seiner Altersgenossen hätte die mit einer von Mummy und Daddy spendierten Spange richten lassen), sogar sein nackter Ehrgeiz. Etwas an ihm zog mich an. Die Dickfelligkeit, mit der er die ihm entgegengebrachte Gehässigkeit aufnahm und einsteckte. Er kam unübersehbar aus der Arbeiterschicht, entschlossen, das für sich zu erkämpfen, was anderen auf dem Silbertablett serviert worden war. In dieser Hinsicht, aber auch nur in dieser, war er wie ich.
Jetzt, zwölf Jahre nach seiner Ankunft, hatte er trotz seiner Absonderlichkeiten erreicht, was er wollte. Neal Logiudice war Staatsanwalt, genauer gesagt, er war im Verwaltungsbezirk Middlesex die Nummer zwei, die rechte Hand des Bezirksstaatsanwalts und Hauptanklägers. Er hat diesen Job von mir übernommen, ausgerechnet er, der irgendwann mal zu mir gesagt hatte: »Andy, du bist genau der Mann, der ich werden will.« Ich hätte es ahnen müssen.
Die Stimmung in dem Saal, in dem die Geschworenen sich an jenem Morgen versammelt hatten, war gedrückt. Da saßen sie, ungefähr dreißig Männer und Frauen, die nicht schlau genug gewesen waren, sich vor ihrer Berufung zu drücken, in Schulstühle mit tränenförmigen Schreibflächen anstelle von Armlehnen gezwängt. Mittlerweile waren sie alle einigermaßen mit ihrer Aufgabe vertraut. Die Grand Jury, also die Anklagejury, tagt monatelang, und die Geschworenen haben schnell heraus, worum es geht: jemanden beschuldigen, mit dem Finger auf ihn zeigen, ihn als Bösewicht identifizieren.
Das Verfahren vor einer Grand Jury ist kein Gerichtsverfahren. Es sind weder Richter noch Vertreter der Verteidigung anwesend. Es ist die Stunde des Staatsanwalts. Es ist eine Vernehmung und theoretisch auch ein Test für die Macht des Staatsanwalts, denn die Grand Jury entscheidet am Ende, ob die Beweise für eine Anklage ausreichen. Erst wenn sie die Anklage billigt, kann der Staatsanwalt den Fall vor Gericht bringen. Wenn nicht, dann zeigt sie die Rote Karte, und das Verfahren ist abgeschlossen, bevor es überhaupt eröffnet wurde. In der Praxis sind negative Entscheidungen selten. Die meisten Grand Jurys stimmen für eine Anklage. Warum auch nicht? Sie kriegen ja nur eine Seite der Geschichte zu hören.
Doch in diesem Fall wussten die Geschworenen Bescheid, nehme ich an. Logiudice hatte nichts vorzuweisen. Diesmal nicht. Mit Beweisen, die so veraltet und fehlerhaft waren, würde man nicht auf die Wahrheit stoßen. Nicht nach allem, was geschehen war. Das alles lag nun schon ein Jahr zurück. Es waren mehr als zwölf Monate vergangen, seitdem man den Leichnam eines Vierzehnjährigen gefunden hatte, mit drei Stichwunden in der Brust, die aussahen wie von einem Dreizack. Aber das alleine war es nicht, es gab noch viele andere Gründe. Es war vorbei, und die Grand Jury war sich im Klaren darüber.
Auch ich war mir im Klaren darüber.
Nur Logiudice blieb unbeirrt. Er schürzte in der für ihn typischen seltsamen Weise die Lippen. Er ging seine Aufzeichnungen auf seinem gelben Notizblock durch und überlegte die nächste Frage. Er tat genau das, was ich ihm beigebracht hatte. Die Stimme in seinem Kopf war meine: Egal, wie sehr dein Fall auf Sand gebaut ist, halt dich an die Spielregeln. Spiel das alte, über fünfhundert Jahre alte Spiel. Nutze die alte miese Technik des Kreuzverhörs – reizen, in die Enge treiben, fertigmachen.
Er fragte: »Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie zum ersten Mal von dem Mord an dem jungen Rifkin erfahren haben?
»Ja.«
»Bitte schildern Sie uns das.«
»Ich bekam einen Anruf, ich glaube zuerst von der CPAC, das ist die bundesstaatliche Polizei. Dann kamen unmittelbar danach noch zwei weitere, einer von der lokalen Polizei in Newton und einer vom diensthabenden Staatsanwalt. Vielleicht bringe ich die Reihenfolge durcheinander, aber auf jeden Fall klingelte unaufhörlich das Telefon.«
»Wann war das?«
»Am Donnerstag, den 12. April 2007, so gegen neun Uhr, kurz nachdem man den Leichnam gefunden hatte.
»Warum wandte man sich an Sie?«
»Ich war der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt. Ich wurde über jeden Mord im Verwaltungsbezirk informiert. Das war Routine.«
»Aber Sie haben nicht jeden Fall selbst übernommen, oder? Sie haben nicht in jedem Mord, der gemeldet wurde, ermittelt und ihn vor Gericht gebracht?«
»Nein, selbstverständlich nicht. Dazu hätte ich gar keine Zeit gehabt. Ich habe nur wenige Mordfälle selbst übernommen. Die meisten habe ich anderen Staatsanwälten zugewiesen.«
»Aber diesen Mord haben Sie selbst übernommen?«
»Ja.«
»Haben Sie das sofort entschieden oder erst später?«
»Ich habe das praktisch sofort entschieden.«
»Warum? Warum ausgerechnet diesen einen Fall?«
»Es gab eine Übereinkunft mit der Bezirksstaatsanwältin Lynn Canavan, dass ich bestimmte Fälle persönlich übernehmen würde.«
»Welche Fälle?«
»Besonders wichtige Fälle.«
»Und warum ausgerechnet Sie?«
»Ich war der dienstälteste Staatsanwalt. Sie wollte sichergehen, dass wichtige Fälle entsprechend behandelt würden.«
»Und wer entschied, welche Fälle besonders wichtig waren?«
»In erster Instanz ich. Natürlich in Abstimmung mit der Bezirksstaatsanwältin, aber am Anfang entwickeln sich die Dinge meist recht schnell. Da bleibt keine Zeit für eine Sitzung.«
»Sie haben also eigenmächtig entschieden, dass der Mord an Rifkin von besonderer Wichtigkeit war?«
»Selbstverständlich.«
»Und warum?«
»Weil es um Mord an einem Kind ging. Ich glaube, wir gingen auch davon aus, dass der Fall bald eine eigene Dynamik entwickeln und die Medien interessieren würde. Das Verbrechen passte genau ins Muster: eine reiche Stadt, ein reiches Opfer. Wir hatten schon ein paarmal ähnliche Fälle gehabt. Am Anfang tappten wir im Dunkeln. Irgendwie sah es so aus wie Tötung an einer Schule, wie damals das Columbine-Massaker in Littleton. Wir hatten so gut wie keine Anhaltspunkte, und gleichzeitig schien der Fall nicht ohne. Hätte ich dann bemerkt, dass dem nicht so war, hätte ich ihn in der Folge abgegeben. Aber in diesen ersten Stunden musste ich dafür sorgen, dass die Dinge ihren richtigen Gang nahmen.«
»Haben Sie die Bezirksstaatsanwältin darüber informiert, dass Sie möglicherweise befangen sein könnten?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil das nicht der Fall war.«
»War Ihr Sohn Jacob nicht ein Schulkamerad des toten Jungen?«
»Doch, aber ich kannte das Opfer nicht. Und soweit ich wusste, Jacob ebenfalls nicht. Nicht einmal der Name des toten Jungen war mir geläufig.«
»Sie kannten den Jungen nicht. Meinetwegen. Aber Ihnen war bekannt, dass er und Ihr Sohn dieselbe Schulstufe in derselben Schule in ein und derselben Stadt besuchten?«
»Ja.«
»Und sind Sie immer noch der Meinung, dass es da keinen Konflikt gab? Dass Ihre Objektivität infrage gestellt werden könnte, ist Ihnen nicht in den Sinn gekommen?«
»Nein, selbstverständlich nicht.«
»Sogar im Rückblick nicht? Sie bestehen darauf ... Sogar im Rückblick haben Sie immer noch nicht den Eindruck, dass die Umstände so etwas wie Befangenheit nahelegten?«
»Nein, es war daran absolut nichts Widerrechtliches. Nicht einmal etwas Ungewöhnliches. Ich lebte in der Stadt, wo der Mord geschehen war. Na schön. In kleineren Bezirken lebt der Staatsanwalt oft in der Gemeinschaft, in der das Verbrechen geschieht, und ihm sind die Betroffenen oft bekannt. Und? Das spornt ihn bestenfalls an, den Mord aufzuklären. Das ist doch kein Interessenkonflikt. Wissen Sie, ich habe mit Mördern grundsätzlich einen Interessenkonflikt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist genau mein Job. Es war ein furchtbares Verbrechen geschehen, und es war meine Pflicht, etwas zu unternehmen. Und genau das wollte ich tun.«
»Okay.« Logiudice blickte auf einen Notizblock. Es hat keinen Sinn, die Aussagen des Zeugen gleich am Anfang anzuzweifeln. Aber er würde sicher später noch einmal darauf zurückkommen, wenn ich müde war. Im Augenblick hieß es, den Ball flach zu halten.
»Ihnen ist bekannt, dass Sie das Recht haben, die Aussage zu verweigern?« »Selbstverständlich.«
»Und Sie machen keinen Gebrauch davon?«
»Offenbar, denn ich sitze ja hier. Und ich sage aus.«
Gekicher vonseiten der Grand Jury.
Logiudice legte seinen Block zur Seite und mit ihm vorgeblich für einen Augenblick auch seinen Schlachtplan. »Mister Barber, Andy, darf ich Sie etwas fragen? Warum machen Sie keinen Gebrauch davon? Warum schweigen Sie nicht einfach?« Die nächsten Worte sagte er nicht laut: Ich an Ihrer Stelle würde genau das tun.
Eine Sekunde lang hielt ich das für Taktik, für Show. Doch Logiudice schien es ernst zu meinen. Er fragte sich besorgt, ob ich etwas im Schilde führte, und wollte nicht aufs Glatteis geführt werden, wollte nicht als Idiot dastehen.
»Ich möchte nicht schweigen. Ich möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt«, antwortete ich.
»Um jeden Preis?«
»Ich habe Vertrauen in die Justiz, genau wie Sie, genau wie jeder der hier Anwesenden.«
Na ja, eigentlich stimmte das nicht. Ich habe kein Vertrauen in das Gerichtswesen, auf jeden Fall ist es nicht besonders hilfreich, wenn es um das Feststellen der Wahrheit geht. Wir alle haben zu viele Irrtümer erlebt und zu viele Fehlurteile. Das Urteil der Geschworenen ist eine Annahme – eine in bester Absicht geäußerte Annahme, aber man kann Fakten von Fiktion nicht aufgrund einer Abstimmung trennen. Doch all dem zum Trotz setze ich Vertrauen in das Ritual, die religiösen Symbole, in die schwarzen Roben, in die Gerichtsgebäude mit ihren marmornen Säulen, die an griechische Tempel erinnern. Wenn wir zu Gericht sitzen, ist es, als würden wir eine Messe feiern. Wir alle beten dann, dass wir das Richtige tun und Gefahren abwenden, und das ist den ganzen Aufwand wert, gleichgültig, ob man unsere Gebete irgendwo erhört oder nicht.
Natürlich glaubte Logiudice nicht an derartiges Zeug. Er lebte in der schwarz-weißen Gedankenwelt eines Staatsanwalts – jemand ist schuldig oder unschuldig –, und er war entschlossen, mich festzunageln.
»Sie haben Vertrauen in die Justiz«, schniefte er. »Meinetwegen, Andy, dann lass uns gleich weitermachen. Lass die Justiz ihre Arbeit machen.« Er warf den Geschworenen einen vielsagenden Klugscheißerblick zu.
Neal, braver Junge! Lass nicht zu, dass der Zeuge die Geschworenen auf seine Seite zieht, das ist dein Job. Schmeiß dich an sie ran, kuschele dich an sie und lass den Zeugen im Regen stehen. Ich grinste. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich jetzt aufgestanden und hätte Beifall geklatscht, denn genau das hatte ich ihm alles beigebracht. Warum nicht ein bisschen Vaterstolz empfinden? So schlecht kann ich nicht gewesen sein – Neal Logiudice hatte sich schließlich zu einem ganz ordentlichen Staatsanwalt gemausert.
»Na, nun mach schon weiter, Neal, hör auf mit dem ganzen Zirkus und fang an«, sagte ich mit einem komplizenhaften Nicken in Richtung Geschworene.
Er warf mir einen gereizten Blick zu, nahm seinen gelben Block wieder zur Hand und überflog seine Aufzeichnungen, um den Anschluss zu finden. Ich konnte gleichsam hören, wie es in seinem Gehirn ratterte: reizen, in die Enge treiben, fertigmachen. »Okay«, meinte er. »Also, was geschah nach dem Mord?«
Kapitel 2
Unsere Kreise
Zwölf Monate zuvor: April 2007
Als die Rifkins die Türen ihres Hauses für die Schiwa, das siebentägige Trauerritual der Juden, öffneten, kam, so schien es, die ganze Stadt. Die Familie sollte nicht alleine trauern: Die Ermordung des Jungen war eine öffentliche Angelegenheit und deshalb auch die Trauer um seinen Tod. Das Haus war voller Leute, und hin und wieder schwoll der allgemeine Geräuschpegel derart an, dass die Veranstaltung Partycharakter annahm, bis alle mit einem Mal gleichzeitig ihre Stimmen senkten, so als ob jemand die Lautstärke gedämpft hätte.
Ich zwängte mich zwischen den Leuten hindurch, setzte eine Miene des Bedauerns auf und entschuldigte mich nach allen Seiten.
Man sah mich mit merkwürdigen Blicken an. Jemand sagte: »Das ist er, das ist Andy Barber«, aber ich blieb nicht stehen. Der Mord lag vier Tage zurück, und jedermann wusste, dass ich den Fall übernommen hatte. Natürlich hätte man mich gerne ausgefragt, nach Verdächtigen, Hinweisen und so weiter, aber niemand wagte es. Die Einzelheiten der Ermittlungen spielten im Augenblick keine Rolle, nur die Tat selbst. Ein unschuldiger Junge war ermordet worden!
Ermordet! Die Nachricht war wie ein Schlag in die Magengrube. In Newton gab es so gut wie keine Verbrechen. Gewalt kam in den Nachrichten und in Fernsehserien vor. Gewaltverbrechen war Sache von Städtern, einer städtischen Unterschicht, von Asozialen. Natürlich lagen die Leute damit falsch. Sie wären auch weniger schockiert gewesen, wenn es sich um den Mord an einem Erwachsenen gehandelt hätte. Dass ein Kind aus unserer Stadt das Opfer war, machte diesen Mord zu einem Frevel. Das Image der Stadt hatte in den Augen der Bürger Newtons Schaden genommen. Eine Zeit lang hatte in der Stadtmitte ein Schild geprangt mit der Aufschrift »Eine Gemeinschaft für Familien, eine Familie für Gemeinschaften«, und sehr oft hörte man den Satz, dass Newton ein guter Ort sei, um Kinder großzuziehen. Das stimmte. An jeder Ecke gab es Angebote für Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, Karateschulen und samstägliche Fußballspiele. Vor allem junge Eltern hielten das Ideal von Newton als einem Paradies für Kinder hoch. Viele von ihnen hatten das schicke, betriebsame Stadtleben hinter sich gelassen, um hier zu wohnen; hatten gewaltige Ausgaben, tödliche Langeweile und ein mulmiges Gefühl der Enttäuschung über ihre Anpassung an ein konventionelles Lebensmodell auf sich genommen. Das Vorstadtleben hatte nur deswegen einen Sinn, weil man dort gut Kinder großziehen konnte. Darauf hatten sie alles gesetzt.
Während ich die Räume durchschritt, ging ich an verschiedenen Gruppen von Leuten vorbei. Die Jugendlichen, die Freunde des toten Jungen, hatten sich im vorderen Teil des Hauses versammelt. Sie sprachen leise und starrten mich an. Bei einem Mädchen hatten die Tränen die Wimperntusche verschmiert. Mein Sohn Jacob lümmelte in einem niedrigen Sessel, schlaksig und ungelenk und abseits von den anderen. Er starrte sein Handydisplay an, die Gespräche um ihn herum interessierten ihn nicht.
Die trauernde Familie befand sich nebenan im Wohnzimmer, Großmütter, Kleinkinder.
In der Küche stieß ich endlich auf die Eltern der Kinder, die zusammen mit Ben Rifkin Newtons Schulen durchlaufen hatten. Das war unser Bekanntenkreis. Wir kannten einander, seit unsere Kleinen neun Jahre zuvor zum ersten Mal im Kindergarten erschienen waren. Wie oft waren wir morgens zusammengekommen, wenn wir die Kinder zur Schule brachten, und nachmittags, wenn wir sie wieder abholten, bei zahllosen Fußballspielen und Wohltätigkeitsveranstaltungen, bei einer denkwürdigen Schulaufführung von Die zwölf Geschworenen. Von ein paar wenigen engen Freundschaften abgesehen, kannten wir einander nicht besonders gut. Es gab ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, aber keine wirkliche Nähe. Die meisten Bekanntschaften würden den Highschool-Abschluss unserer Kinder nicht überdauern. Doch in jenen ersten Tagen nach dem Mord an Ben Rifkin gab es so etwas wie ein Wir-Gefühl. Es war, als ob die Mauern zwischen uns gefallen wären.
In der geräumigen Küche der Rifkins (ausgestattet mit teurem Markenherd, Markenkühlschrank, Arbeitsfläche aus Granit und vanillefarbenen Schränken) standen die Eltern in Grüppchen herum und gestanden einander Schlaflosigkeit, Trauer und unermessliche Angst. Immer wieder riefen sie sich das Columbine-Schulmassaker in Erinnerung und den 11. September und dass sie sich nach Bens Tod an ihre Kinder klammerten. Die außergewöhnliche Gefühlslage jenes Abends wurde durch das warme Licht der Hängelampen mit Schirmen in dunklem Orange noch verstärkt. Als ich den Raum betrat, waren die Eltern gerade dabei, sich dem Luxus persönlicher Offenbarungen hinzugeben.
Toby Lanzman, eine der Mütter, arrangierte an der Kücheninsel Vorspeisen auf einer Platte. Sie hatte ein Handtuch über die Schulter geworfen, und beim Anrichten waren die Muskeln an ihren Oberarmen gut sichtbar. Toby war die beste Freundin meiner Frau Laurie und eine der wenigen engeren Bekanntschaften, die wir hier gemacht hatten. Als sie bemerkte, wie ich mich suchend nach meiner Frau umsah, zeigte sie in eine Ecke des Raums.
»Sie bemuttert die anderen Mütter«, meinte Toby.
»Ja, das sehe ich.«
»Na ja, wir können im Augenblick alle ein wenig Bemutterung gebrauchen.«
Ich brummte etwas, warf ihr einen perplexen Blick zu und ging meiner Wege. Toby war eine einzige Herausforderung, ich sah bei ihr keine andere Verteidigungsmöglichkeit, als den Rückzug anzutreten.
Laurie stand bei einem Grüppchen von Frauen. Ihr dichtes, schwer zu bändigendes Haar hatte sie zu einem losen Knoten am Hinterkopf zusammengefasst und mit einer großen Spange aus Schildpatt befestigt. Gerade drückte sie tröstend den Oberarm einer Freundin. Die neigte sich Laurie entgegen wie eine Katze, die gerade gestreichelt wird.
Als ich dazukam, legte Laurie ihren linken Arm um meine Taille. »Hallo, mein Liebster.«
»Zeit zu gehen.«
»Andy, das sagst du nun schon, seit wir hier angekommen sind.«
»Das stimmt nicht. Ich hab’s gedacht, aber nicht gesagt.«
»Nun, man sieht es dir an.« Sie seufzte. »Ich wusste es, wir hätten mit zwei Autos kommen sollen.«
Sie musterte mich einen Augenblick lang. Sie hatte keine Lust zu gehen, aber sie wusste, dass ich mich nicht wohlfühlte und das Gefühl hatte, alle Blicke auf mich zu ziehen. Außerdem bin ich kein großartiger Gesellschafter – Small Talk in überfüllten Räumen ermüdet mich schnell –, und alle diese Erkenntnisse wollten gegeneinander abgewogen sein. Wie in jeder anderen Organisation geht es auch in der Familie nicht ohne Management.
»Du kannst schon gehen«, entschied sie dann. »Ich fahre mit Toby nach Hause.«
»Wirklich?«
»Wirklich. Warum nicht? Nimm Jacob mit.«
»Bist du sicher?« Ich neigte mich zu ihr hinab – Laurie ist einen Kopf kleiner als ich – und flüsterte hörbar: »Ich würde zu gerne noch bleiben.«
Sie lachte. »Geh, bevor ich’s mir noch anders überlege.«
Die trauernden Frauen starrten mich an.
»Nun geh schon. Dein Mantel ist oben im Schlafzimmer.«
Ich ging nach oben und fand mich in einem langen Flur wieder. Der Lärm war hier oben angenehm gedämpft. Noch immer tönte das Echo der Gespräche in meinen Ohren. Ich fing an, nach den Mänteln zu suchen. In einem der Räume, offensichtlich das Kinderzimmer der kleinen Schwester des toten Jungen, lag ein Haufen Mäntel auf dem Bett, meiner war aber nicht darunter.
Die Tür zum nächsten Raum war geschlossen. Ich klopfte, öffnete, steckte den Kopf durch die Tür und warf einen Blick ins Zimmer.
Der Raum war schwach beleuchtet. Licht kam nur von einer Stehlampe aus Messing in der hinteren Zimmerecke. Darunter saß der Vater des toten Jungen in einem Lehnstuhl. Dan Rifkin war klein, gepflegt, zart. Wie immer wurde sein Haar durch Lack in Form gehalten. Er trug einen teuer aussehenden Anzug. An einem Aufschlag war ein fünf Zentimeter langer Riss, Symbol für ein gebrochenes Herz. Ein teurer Anzug, welch eine Verschwendung, fuhr es mir durch den Kopf. Im Dämmerlicht wirkten seine Augen eingesunken, bläulich umrandet wie die Augenpartie eines Waschbären.
»Hallo, Andy«, sagte er.
»Entschuldigen Sie. Ich war gerade auf der Suche nach meinem Mantel. Ich wollte Sie nicht stören.«
»Überhaupt nicht, setzen Sie sich doch.«
»Nein, nein, ich wollte nicht einfach so hereinplatzen.«
»Bitte setzen Sie sich, nehmen Sie Platz. Ich möchte Sie etwas fragen.«
Ich fühlte, wie ich schwach wurde. Ich habe die Leiden der Angehörigen von Mordopfern miterlebt. Meine Arbeit zwingt mich dazu. Die Eltern von ermordeten Kindern haben es am schwersten, die Väter meiner Meinung nach noch mehr als die Mütter. Denn von ihnen verlangt man, dass sie sich zusammenreißen, ihren Mann stehen. Untersuchungen haben ergeben, dass Väter von ermordeten Kindern oft nur wenige Jahre nach der Tat sterben, oft aufgrund von Herzversagen. In Wahrheit gehen sie an ihrer Trauer zugrunde. Irgendwann wird einem als Staatsanwalt klar, dass man diese Art von Schmerz ebenfalls nicht überleben wird. Man darf sich von den Vätern nicht anstecken lassen. Und so konzentriert man sich ganz auf die technischen Aspekte des Jobs. Man verwandelt ihn in ein Handwerk wie jedes andere. Der Trick besteht darin, sich das Leid der anderen vom Hals zu halten.
Doch Dan Rifkin war hartnäckig. Er winkte mit seinem Arm wie ein Verkehrspolizist, der Autofahrer zum Weiterfahren auffordert, und als ich sah, dass ich keine Wahl hatte, schloss ich leise die Tür und setzte mich auf den Stuhl neben ihm.
»Was zu trinken?« Er hielt einen Schwenker mit kupferfarbenem, edlem Whiskey hoch.
»Nein.«
»Gibt es was Neues, Andy?«
»Ich fürchte, nein.«
Er nickte und wandte sichtlich enttäuscht seinen Blick ab.
»Ich mochte dieses Zimmer immer. Ich komme hierher, wenn ich nachdenken will. Wenn etwas passiert wie das jetzt, dann verbringt man viel Zeit mit Nachdenken.« Er lächelte dünn: Mach dir keine Sorgen, alles in Ordnung.
»Das ist bestimmt wahr.«
»Ich frage mich nur die ganze Zeit: Warum hat dieser Typ das gemacht?«
»Dan, Sie sollten nicht ...«
»Nein, hören Sie mir zu. Ich brauche, ich brauche wirklich niemanden, der mir die Hand hält. Ich bin rational veranlagt, das ist alles. Ich habe Fragen. Nicht, was die Einzelheiten angeht. Wenn wir, Sie und ich, uns bislang miteinander unterhalten haben, ging es immer nur um Einzelheiten: Beweise, gerichtliche Abläufe. Aber ich bin rational veranlagt, okay? Ich bin rational veranlagt, und ich habe Fragen. Andere Fragen.«
Ich sank auf meinen Stuhl zurück und fühlte, wie sich meine Schultern entspannten und ich ruhiger wurde.
»Ben war ein so netter Junge, wissen Sie. Das ist wichtig. Natürlich hat kein Kind einen solchen Tod verdient. Aber Ben war wirklich ein sehr netter Junge. Und noch ein Kind. Du lieber Himmel, er war gerade mal vierzehn! Hat nie Ärger gemacht. Nie, nie, nie. Also warum? Was war das Motiv? Ich rede nicht von Wut, Eifersucht, Habgier, diese Motive meine ich nicht. In diesem Fall kann es kein gängiges Motiv geben. Das kann nicht sein, das ergibt keinen Sinn. Wer könnte eine derartige Wut auf Ben gehabt haben, wie kann man eine solche Wut auf irgendeinen Jungen haben? Das alles ergibt einfach keinen Sinn.« Rifkin massierte mit der rechten Hand leicht seine Stirn. »Was ich mich frage, ist Folgendes: Was unterscheidet solche Leute von anderen? Denn natürlich habe auch ich schon diese Gefühle gehabt, diese sogenannten Motive, wie Wut, Habgier, Eifersucht, auch Sie werden sie schon empfunden haben, wie jeder von uns. Aber wir haben deswegen niemanden umgebracht. Verstehen Sie? Dazu wären wir gar nicht in der Lage. Aber bei manchen ist das anders, sie sind in der Lage dazu. Warum?«
»Keine Ahnung.«
»Sie müssen doch eine Ahnung haben, warum.«
»Nein, wirklich nicht.«
»Aber Sie sprechen mit Mördern, Sie treffen sich mit ihnen. Was sagen die dazu?«
»Die meisten von ihnen reden nicht viel.«
»Haben Sie jemals nachgefragt? Nicht, warum sie die Tat begangen haben, sondern wieso sie dazu überhaupt in der Lage waren?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil sie darauf nicht antworten würden. Ihre Anwälte würden sie nicht antworten lassen.«
»Anwälte!« Er schüttelte den Kopf.
»Und dann würden die meisten von ihnen ohnehin nicht wissen, was sie darauf antworten sollen. Diese philosophisch veranlagten Mörder – mit Chianti, Favabohnen und diesem Unsinn –, das ist alles dummes Zeug. So was gibt’s nur im Film. Diese Typen sind völlig durchgeknallt. Wenn man sie wirklich zu einer Antwort zwingen würde, dann würden sie was von einer schlimmen Kindheit erzählen. Sie machen sich zu Opfern. Das ist immer das Gleiche.«
Er nickte kurz, um mich zum Weiterreden zu bewegen.
»Dan, Sie dürfen sich nicht fertigmachen, indem Sie nach einem Grund forschen. Es gibt keinen. Es geht nicht um Logik. Jedenfalls nicht bei dem, worüber wir hier gerade reden.«
Rifkin rutschte in seinem Sessel ein wenig nach unten, er konzentrierte sich, so als ob er über das Ganze noch einmal nachdenken müsse. Seine Augen glänzten, aber seine Stimme klang normal und kontrolliert. »Stellen auch andere Eltern Fragen dieser Art?«
»Sie fragen alles Mögliche.«
»Treffen Sie die Eltern manchmal, wenn der Prozess vorbei ist?«
»Manchmal.«
»Ich meine, Jahre danach.«
»Manchmal.«
»Und sind sie ... wie geht es ihnen? Gut?«
»Manchen von ihnen geht es gut.«
»Manchen aber nicht.«
»Manchen nicht.«
»Wie machen die das, ich meine die, denen es gut geht? Was ist das Wichtigste? Da muss es doch ein paar Grundregeln geben. Was ist die richtige Strategie, was sind die besten Methoden? Was hat für sie funktioniert?«
»Sie holen sich Hilfe. Bei ihren Familien, bei ihrer sozialen Umgebung. Es gibt Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene, dort suchen sie Unterstützung. Wir können Sie mit einer Gruppe in Kontakt bringen. Sie sollten sich an eine Beratungsstelle für Opfer von Gewaltverbrechen wenden. Auch dort wird man Ihnen weiterhelfen. Alleine schaffen Sie es nicht, das sollten Sie wissen. Denken Sie daran, dass es dort draußen andere gibt, die das Gleiche durchgemacht haben und die begreifen, was Sie gerade durchmachen.«
»Und die anderen, die Eltern, die es nicht geschafft haben, was ist mit denen? Was ist mit denen, die sich nie wieder von dem Schlag erholen?«
»Zu denen werden Sie nicht gehören.«
»Aber was ist, wenn doch? Was passiert mit ihnen, mit uns?«
»Das werden wir nicht zulassen. Daran wollen wir keinen Gedanken verschwenden.«
»Aber es kommt vor. Das stimmt doch, oder? Es kommt vor.«
»Das trifft auf Sie nicht zu. Ben würde das nicht wollen.«
Schweigen.
»Ich kenne Ihren Sohn«, meinte Rifkin. »Jacob.«
»Ja.«
»Ich habe ihn in der Schule gesehen. Scheint ein netter Junge zu sein. Ein großer hübscher Junge. Sie sind sicher stolz auf ihn.«
»Bin ich.«
»Er sieht Ihnen ähnlich, finde ich.«
»Ja, das hat man mir schon öfter gesagt.«
Er holte tief Luft. »Wissen Sie, mir gehen immer wieder die Jungen in Bens Klasse durch den Kopf. Ich fühle mich ihnen verbunden. Ich will, dass sie weiterkommen, wissen Sie? Ich war dabei, als sie groß wurden, sie liegen mir am Herzen. Ist das ungewöhnlich? Halte ich die Nähe zu den anderen Jungen aufrecht, weil ich mich Ben so vielleicht näher fühle? Denn danach sieht das doch aus, oder? Es wirkt vielleicht seltsam.«
»Dan, machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie etwas aussieht. Die Leute denken das, was sie denken wollen. Lassen Sie sie einfach! Darüber sollten Sie jetzt nicht nachdenken.«
Er massierte weiter an seiner Stirn herum. Sein innerer Schmerz hätte nicht deutlicher sein können. Ich wollte ihm helfen. Zugleich wollte ich mich aus dem Staub machen.
»Es würde mir weiterhelfen, wenn ich endlich wüsste ... wenn der Fall gelöst wäre. Es wird mir helfen, wenn Sie den Fall gelöst haben. Denn diese Unsicherheit macht einen fertig. Das stimmt doch, es hilft weiter, wenn ein Fall endlich gelöst ist? Sie haben das auch bei anderen Fällen beobachtet, oder? Dass es den Eltern weiterhilft?«
»Doch, das glaube ich schon.«
»Ich will keinen Druck auf Sie ausüben. So sollte das nicht klingen. Ich glaube nur, dass es mir weiterhilft, wenn der Fall gelöst ist und der Typ – hinter Schloss und Riegel sitzt. Ich weiß, Sie werden das schaffen. Ich vertraue Ihnen, selbstverständlich vertraue ich Ihnen. Ich zweifle nicht an Ihnen, Andy. Ich wollte nur sagen, dass es mir weiterhilft. Mir, meiner Frau, allen anderen. Ich glaube, das brauchen wir. Dass der Fall gelöst ist. Da zählen wir auf Sie.«
In jener Nacht lagen Laurie und ich lesend im Bett.
»Ich finde trotzdem, dass es ein Fehler ist, die Schule so schnell wieder zu öffnen.«
»Laurie, wir haben das bereits besprochen.« Meine Stimme klang gelangweilt. Das hatten wir doch schon alles. »Jacob ist in Sicherheit. Wir bringen ihn zur Schule und begleiten ihn bis zum Eingang. Es wird dort von Polizisten nur so wimmeln. Wenn er irgendwo sicher ist, dann dort.«
»Das kannst du nicht wissen. Woher willst du das so genau wissen? Niemand hat eine Ahnung, wer dieser Typ ist, wo er sich befindet und was er als Nächstes vorhat.«
»Irgendwann müssen sie die Schule wieder aufmachen. Das Leben geht weiter.«
»Andy, du liegst falsch.«
»Wie lange sollte man dann deiner Meinung nach damit warten?«
»Bis sie den Typen haben.«
»Das kann eine Weile dauern.«
»Und? Was passiert schlimmstenfalls? Für die Kinder fallen ein paar Schultage aus. Na und? Wenigstens sind sie in Sicherheit.«
»Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Die Welt da draußen ist groß. Groß und gefährlich.«
»Na, dann eben eine neunzigprozentige.«
Ich legte das Buch auf meinem Bauch ab, wo es liegen blieb wie ein kleines Dach.
»Laurie, wenn man die Schule geschlossen hält, dann ist das die falsche Nachricht an die Kinder. Die Schule sollte kein gefährlicher Ort sein, sie sollten keine Angst haben, sich dort aufzuhalten. Die Schule ist für sie wie ein zweites Zuhause. Sie verbringen den größten Teil ihres Tages dort. Sie wollen dort sein, sie wollen mit ihren Freunden zusammen sein und nicht zu Hause herumsitzen und sich unter dem Bett verstecken, damit der böse Mann sie nicht findet.«
»Einen von ihnen hat der böse Mann bereits gefunden. Genau das macht ihn zum bösen Mann.«
»Einverstanden, aber du verstehst, was ich sagen will.«
»Klar verstehe ich, was du sagen willst, Andy. Du liegst nur falsch, das ist alles. Am wichtigsten ist, die physische Unversehrtheit der Kinder zu gewährleisten. Sie können dabei mit ihren Freunden zusammen sein oder was sonst auch immer. Bis sie diesen Typen nicht dingfest gemacht haben, kannst du mir nicht garantieren, dass die Kinder in Sicherheit sind.«
»Brauchst du eine Garantie?«
»Ja.«
»Wir werden ihn kriegen«, sagte ich. »Ich gebe dir mein Ehrenwort.«
»Und wann?«
»Bald.«
»Bist du dir da sicher?«
»Ich rechne damit. Wir kriegen sie immer.«
»Nein, nicht immer. Erinnerst du dich an den Typen, der seine Frau umgebracht hat und sie in eine Decke eingewickelt hinten in den Saab legte?«
»Wir haben ihn trotzdem gekriegt. Wir konnten ihn nur nicht ... also gut, meistens. Wir kriegen sie meistens. Und diesen Typen werden wir kriegen, das verspreche ich dir.«
»Und was ist, wenn du dich irrst?«
»Wenn ich mich irre, dann wirst du mir das sicher immer wieder vorhalten.«
»Nein, ich meine, was ist, wenn du dich irrst, und ein Junge kommt zu Schaden?«
»Das wird nicht passieren, Laurie.«
Sie runzelte ihre Stirn und gab auf. »Mit dir kann man nicht streiten. Es ist, als würde man mit dem Kopf gegen eine Wand anrennen.«
»Wir streiten auch nicht, wir führen eine Diskussion.«
»Du bist Anwalt und kennst den Unterschied nicht. Für mich ist es ein Streit.«
»Also, was willst du hören, Laurie?«
»Ich will gar nichts Bestimmtes hören. Ich möchte, dass du zuhörst. Weißt du, Zuversicht zu haben bedeutet nicht, dass man auch recht hat. Überleg doch mal: Vielleicht bringen wir unseren Sohn in Gefahr.« Sie legte eine Fingerspitze an meine Schläfe und drückte ein wenig dagegen, halb im Scherz und halb im Unmut. »Denk einfach mal nach.«
Sie wandte sich ab und legte ihr Buch auf den wackeligen Stapel auf ihrem Nachttisch. Dann drehte sie mir ihren Rücken zu und zog die Beine an, ein Kind im Körper einer Erwachsenen.
»Nun komm schon«, meinte ich. »Rück zu mir.«
Sie rutschte mit hüpfenden Bewegungen ihres ganzen Körpers zu mir herüber, bis sie ihren Rücken gegen meinen schmiegen konnte und meine Wärme oder meine Körperkraft spürte, oder was immer sie in jenem Augenblick suchte. Ich streichelte über ihren Oberarm.
»Es wird alles gut.«
Sie antwortete mit einem Brummen.
Dann: »Ich nehme mal an, Sex zur Wiederherstellung des häuslichen Friedens kommt nicht infrage.«
»Ich dachte, wir hätten uns nicht gestritten.«
»Ich nicht, aber du schon. Und du sollst wissen, dass ich dir verzeihe.«
»Haha! Na, vielleicht, wenn du sagst, dass es dir leidtut.«
»Es tut mir leid.«
»Das klingt nicht gerade überzeugend.«
»Es tut mir sehr, sehr leid. Wirklich.«
»Jetzt musst du sagen, dass du falschliegst.«
»Falsch?«
»Sag, dass du falschliegst. Willst du nun oder nicht?«
»Meinetwegen. Ich muss also nur sagen, dass ich falschliege, und eine schöne Frau wird mich leidenschaftlich vögeln?«
»Von Leidenschaft war nicht die Rede, nur von vögeln.«
»Meinetwegen, also: Ich sage also, dass ich falschliege, und eine schöne Frau wird mich vögeln, ohne jede Leidenschaft, aber technisch nicht schlecht. Ist das so richtig?«
»Technisch nicht schlecht?«
»Technisch überwältigend.«
»Ja, genau, Herr Staatsanwalt, genau so ist es.«
Ich legte mein Buch, Trumans Biografie von einem Autor namens McCullough, auf den rutschigen Stapel von Hochglanzmagazinen auf meiner Bettseite und löschte das Licht. »Vergiss es – ich liege nicht falsch.«
»Egal, du hast eben gesagt, ich sei schön. Also habe ich gewonnen.«
Kapitel 3
Wieder in der Schule
Am nächsten Morgen, es war noch dunkel, drang ein Laut aus Jacobs Zimmer, es klang wie Stöhnen. Bevor ich richtig wach war, hatte sich mein Körper aus dem Bett bewegt, auf die Füße gestellt und schlurfte bereits um das Bettende. Schlaftrunken verließ ich das Halbdunkel des Schlafzimmers, durchquerte den dämmrigen Flur und tauchte in das Dunkel von Jacobs Zimmer.
Ich betätigte den Wandschalter und dämpfte das Licht mit dem Dimmer. In Jacobs Zimmer lagen seine riesigen, unförmigen Turnschuhe herum, daneben sein mit Stickern übersätes MacBook, ein iPod, Schulbücher, Taschenbücher, Schuhschachteln bis zum Rand voll mit Baseball-Sammelkarten und Comicbänden. In einer Ecke lag eine Xbox, die an einen alten Fernseher angeschlossen war. Die entsprechenden DVDs, zumeist kriegerische Rollenspiele und ihre Hüllen, waren daneben aufgestapelt. Natürlich lag überall schmutzige Wäsche herum, aber es gab auch zwei Stapel mit sauberer, die Laurie ordentlich gefaltet und bereitgelegt hatte. Jacob lehnte es ab, saubere Wäsche in seinen Schrank zu räumen; es war einfacher, neue Sachen gleich aus dem Stapel zu ziehen. Auf einem niedrigen Regal standen ein paar Trophäen aus Jacobs Zeit beim Kinderfußball. Er war kein besonderes Talent gewesen, aber jedes Kind hatte am Ende eine Auszeichnung bekommen, und er hatte sie einfach dort stehen lassen. Die Trophäen standen herum wie kleine Reliquien, er ignorierte sie, er nahm sie gar nicht mehr wahr. An einer Wand hing ein altes Filmplakat zu dem Kampffilm Five Fingers of Death aus den siebziger Jahren. Ein Mann durchschlug mit seiner sorgfältig manikürten, zur Faust geballten Hand eine Wand aus Ziegelsteinen. (»Ein meisterhafter Kampfsportfilm! Unübertroffene Folge von Kämpfen! Der verbotene Einsatz der stählernen Faust wird Sie erschüttern! Feuern Sie den jungen Kämpfer an, der sich dem Bösen im Kampfsport stellt!«) Das Durcheinander hatte gigantische Ausmaße angenommen, aber Laurie und ich hatten es schon längst aufgegeben, uns mit Jacob über das Aufräumen zu streiten. Wir ignorierten das Chaos einfach. Laurie hing der Theorie an, dass es Jacobs Befindlichkeit widerspiegle, gleichsam ein Abbild seiner chaotischen Teenagerseele sei und es deshalb keinen Sinn habe, ihn immer wieder zu ermahnen. Das hat man davon, wenn man die Tochter eines Psychiaters heiratet, glauben Sie mir. Jedes Mal, wenn ich das Zimmer betrat, hätte ich schreien können.
Jacob lag reglos auf der Bettkante. Er hatte seinen Kopf nach hinten gereckt, sein Mund stand offen, wie bei einem heulenden Wolf. Er schnarchte nicht, aber sein Atem rasselte etwas, er schlug sich seit einiger Zeit mit einer leichten Erkältung herum. Zwischen verschnupften Atemzügen stammelte er immer wieder: »Nnnein ... nein, nein.«
»Jacob«, flüsterte ich und strich leicht über seinen Kopf. »Jake.«
Wieder rief er, seine Augen flatterten hinter den Lidern.
Draußen ratterte ein Zug vorbei, der erste nach Boston auf der Riverside-Verbindung, er fuhr jeden Tag um 6.05 Uhr vorbei.
»Es ist nur ein Traum«, sagte ich leise.
Ich spürte, wie mich ein Wohlgefühl durchströmte, als ich meinen Sohn beruhigte, es war ein situationsbedingtes, für Eltern typisches Aufwallen von Nostalgie, eine schwache Erinnerung an den kleinen drei oder vier Jahre alten Jake und unser Spiel beim Zubettgehen: »Wer liebt den kleinen Jacob«, hatte ich ihn immer gefragt, worauf er antwortete: »Mein Papa.« Es waren immer unsere letzten Worte abends vor dem Einschlafen gewesen. Doch war es nicht Jake, der damals diese Versicherung brauchte. Ihm war niemals in den Sinn gekommen, dass Papas einfach verschwinden könnten, jedenfalls nicht seiner. Ich war es, der ein Bedürfnis nach diesem kurzen Frage- und Antwortspiel hatte. Als Kind hatte ich keinen Vater an meiner Seite gehabt. Ich hatte ihn kaum gekannt. Und so beschloss ich, dass es meinen Kindern anders ergehen sollte, sie sollten nicht erfahren, was es heißt, vaterlos aufzuwachsen. In ein paar Jahren würde Jake mich verlassen, ein merkwürdiges Gefühl. Er würde auf irgendein College gehen, und meine Zeit als aktiver, allzeit bereiter Vater würde auslaufen. Ich würde ihn immer seltener sehen, und dann irgendwann nur ein paarmal im Jahr, in den Ferien oder an Wochenenden. Ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. In erster Linie war ich der Vater von Jacob.
Dann kam mir ein anderer Gedanke, der sich unter den Umständen aufdrängte: Zweifellos hatte Dan Rifkin seinen Sohn ebenso beschützen wollen wie ich meinen, und zweifellos war er genauso wenig wie ich darauf vorbereitet gewesen, von ihm Abschied zu nehmen. Doch Ben Rifkin lag in einem Kühlfach in der Gerichtsmedizin, mein Sohn in seinem warmen Bett. Ein Umstand, der nur einem glücklichen Zufall zu verdanken war. Ich gestehe und schäme mich dafür, dass ich dachte: Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass er sein Kind zu sich genommen hat und nicht meines. Ich würde diesen Verlust nicht überleben, davon war ich überzeugt.
Ich ging neben dem Bett in die Knie, umschlang Jacob mit meinen Armen und legte meinen Kopf an seinen. Als kleiner Junge war er jeden Morgen verschlafen über den Flur in unser Bett zum Kuscheln gekommen. In meinen Armen fühlte er sich jetzt mit einem Mal unglaublich groß, knochig und unhandlich an. Er war vierzehn, sah gut aus, mit dunklen Locken und einer gesunden Gesichtsfarbe. Im Wachzustand hätte er eine Umarmung niemals zugelassen. In den letzten Jahren war er mürrisch und verschlossen geworden und ziemlich unerträglich. Manchmal schien es, als hätte man einen Fremden im Haus, noch dazu einen besonders unfreundlichen. Typisches Teenagerverhalten, meinte Laurie. Er sei gerade dabei, verschiedene Persönlichkeiten auszuprobieren und die Kindheit endgültig hinter sich zu lassen.
Ich war überrascht, als meine Berührung Jacob tatsächlich beruhigte und seinen Albtraum offenbar verscheuchte. Er atmete einmal tief ein und rollte dann auf die andere Seite. Sein Atem wurde flacher und dann regelmäßig, und er sank in einen tiefen Schlaf, einen Zustand, den ich nicht mehr kenne. (Im Alter von einundfünfzig Jahren schien ich das Schlafen verlernt zu haben. Ich wachte nachts mehrmals auf und kam selten auf mehr als vier oder fünf Stunden Schlaf.) Die Vorstellung, dass ich ihn hatte beruhigen können, gefiel mir, aber wer weiß? Vielleicht hatte er meine Anwesenheit nicht einmal bemerkt.
Wir waren alle drei gereizt an jenem Morgen. Die Wiedereröffnung der McCormick-Schule gerade mal fünf Tage nach dem Mord ließ keinen von uns kalt. Wir folgten unserer üblichen Routine: duschen, Kaffee und Bagels zum Frühstück, ein Blick in den Computer für E-Mails und die letzten Sportergebnisse. Doch waren wir angespannt und übellaunig. Zwar waren wir schon um halb sieben auf den Beinen, aber wir trödelten und waren schließlich spät dran, was unsere Nervosität nur noch steigerte.
Vor allem bei Laurie lagen die Nerven blank. Sie hatte nicht nur um Jacob Angst, glaube ich. Der Mord hatte sie nachhaltig erschüttert und verunsichert. Sie glich einem Gesunden, der zum ersten Mal ernsthaft erkrankt ist. Man hätte annehmen können, dass Laurie, die seit Jahren mit einem Staatsanwalt zusammenlebte, besser auf eine solche Situation vorbereitet wäre als unsere Nachbarn. Sie hätte wissen müssen, dass das Leben tatsächlich weitergeht (meine hartherzigen und gefühllosen Worte von letzter Nacht). Selbst die krudeste Gewalt führt am Ende zu Gerichtsroutine: ein Aktenstapel, ein paar Beweisstücke und ein Dutzend schwitzender, stammelnder Zeugen. Die Welt wendet sich anderen Dingen zu, und warum auch nicht? Menschen sterben, einige von ihnen gewaltsam – stimmt, das ist tragisch, aber irgendwann verliert es seinen Schrecken, wenigstens für einen altgedienten Staatsanwalt. Laurie hatte diese Abläufe an meiner Seite viele Male miterlebt, und doch hatte sie dieser Einbruch von Gewalt in ihr Leben völlig verstört. Das war abzulesen an ihren Bewegungen, an ihrem gekrümmten Rücken, ihrer gedämpften Stimme. Sie bemühte sich, Haltung zu bewahren, und tat sich schwer damit.
Jacob starrte in sein MacBook und kaute schweigend an einem zähen Tiefkühlbagel, den er in der Mikrowelle aufgetaut hatte. Wie so oft versuchte Laurie seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber er ließ sie abblitzen.
»Wie findest du das, dass es heute wieder losgeht, Jacob?«
»Weiß nicht.«
»Bist du nervös? Machst du dir Gedanken? Wie ist das für dich?«
»Weiß nicht.«
»Wie kannst du das nicht wissen? Wer sonst, wenn nicht du?«
»Ich habe gerade keine Lust zu reden, Mom.«
Das war die höfliche Floskel, die er benutzen sollte, anstatt uns Eltern einfach links liegen zu lassen. Aber mittlerweile setzte er dieses »ich habe gerade keine Lust zu reden« so oft und so mechanisch ein, dass von Höflichkeit keine Rede mehr sein konnte.
»Kannst du mir nur sagen, ob es dir gut geht, damit ich mir keine Sorgen machen muss.«
»Ich habe doch gesagt: Ich habe gerade keine Lust zu reden.«
Laurie warf mir einen entnervten Blick zu.
»Deine Mutter hat dich etwas gefragt. Eine Antwort wird dich nicht umbringen.«
»Mir geht’s gut.«
»Ich glaube, deine Mutter war an ein paar Einzelheiten interessiert.«
»Dad, bitte ...« Er wandte sich wieder voll und ganz seinem Computer zu.
Ich zuckte mit den Achseln, während ich Laurie ansah.
»Der Junge meint, es geht ihm gut.«
»Das habe ich auch verstanden. Vielen Dank.«
»Keine Sorge, Mutter. Alles klar und tschüss.«
»Und wie geht’s dir, Ehemann?«
»Mir geht’s gut. Ich habe gerade keine Lust zu reden.«
Jacob warf mir einen ärgerlichen Blick zu.
Laurie lächelte wider Willen. »Ich brauche eine Tochter, damit hier ein bisschen Ausgleich ist und ich jemanden zum Reden habe. Mit euch beiden hab ich das Gefühl, mit zwei Grabsteinen unter einem Dach zu leben.«
»Du brauchst eine Ehefrau.«
»Daran hatte ich auch schon gedacht.«
Wir brachten Jacob gemeinsam zur Schule. Die meisten Eltern taten das Gleiche, und um acht sah es vor der Schule aus wie auf einem Jahrmarkt. Vor uns stauten sich Honda-Minitransporter, Familienkutschen und Sportwagen. In der Nähe parkten einige Kleintransporter, bestückt mit Antennen, Satellitenschüsseln und Kisten. Die Polizei hatte beide Zufahrten des Rondells gesperrt. In der Nähe des Schuleingangs hatte sich ein Polizist aufgestellt, ein anderer wartete in einem Streifenwagen. Die Schüler bahnten sich ihren Weg durch diese Hindernisse und liefen Richtung Schuleingang, den Rücken unter der Last der Rucksäcke gebeugt. Die Eltern blieben auf den Gehwegen stehen, manche begleiteten ihre Kinder bis kurz vor die Eingangstür.
Ich parkte unseren Minivan einen Häuserblock entfernt, und wir saßen da und glotzten.
»Wow«, meinte Jacob leise.
»Wow«, pflichtete Laurie ihm bei.
»Wahnsinn.« Wieder Jacob.
Laurie sah mitgenommen aus. Ihre Linke baumelte von der Armlehne herab, ihre langen Finger, ihre wohlgeformten blanken Nägel. Sie hatte schon immer schöne, elegante Hände gehabt. Ich dachte an die Waschfrauenhände meiner Mutter mit den plumpen Fingern. Ich langte hinüber, nahm ihre Hand und verschränkte meine Finger in ihren, sodass unsere beiden Hände zu einer Faust verschmolzen. Der Anblick ihrer Hand in meiner rührte mich. Ich warf ihr einen aufmunternden Blick zu und bewegte spielerisch unsere verschränkten Hände. Für meine Verhältnisse war das eine geradezu überschwängliche Gefühlsäußerung, und Laurie antwortete dankbar mit einem Druck ihrer Hand. Dann wandte sie ihren Blick wieder der Straße zu. Ihr dunkles Haar war von grauen Strähnen durchzogen. An ihren Augen- und Mundwinkeln wurde ein Netz von Fältchen sichtbar. Doch als sie zur Seite blickte, kam es mir vor, als sähe ich irgendwie immer noch ihr junges, glattes Gesicht.
»Was gibt’s?«
»Nichts.«
»Du starrst mich an.«
»Ich bin mit dir verheiratet, ich darf dich anstarren.«
»Ist das rechtlich zulässig?«
»Ja. Anstarren, angaffen, anmachen, alles, was mir einfällt. Glaub mir, ich bin Jurist.«
Jede gute Ehe ist eine lange Kette von Erinnerungen. Ein Wort, eine Geste, eine bestimmte Stimmlage kann unendlich viele gemeinsame Augenblicke ins Gedächtnis rufen. Laurie und ich flirteten seit mehr als dreißig Jahren miteinander, genau seit dem Tag, als wir uns im College begegneten und sofort verrückt nacheinander waren. Natürlich war das heute nicht mehr ganz so. Im Alter von einundfünfzig gerät die Liebe in stillere Fahrwasser. Gemeinsam drifteten wir durch die Zeit. Doch erinnerten wir uns beide noch daran, wie alles angefangen hatte, und selbst heute, in der Mitte meines Lebens, empfinde ich, wenn ich an dieses junge strahlende Mädchen denke, immer noch jenes Glücksgefühl ersten Verliebtseins. Es ist immer noch da, flackernd wie eine Zündflamme.
Wir gingen den kleinen Hügel zur Schule hinauf auf das Gebäude zu.
Jacob latschte zwischen uns. Er trug eine verwaschene braune Kapuzenjacke, Jeans, die an ihm herunterhingen, und Markenturnschuhe. Seinen Rucksack hatte er über eine Schulter geworfen. Sein Haar war etwas zu lang. Es hing ihm über die Ohren und verdeckte seine Stirn bis über die Augenbrauen. Ein Junge mit mehr Mut hätte dieses Erscheinungsbild auf die Spitze getrieben und sich als Goth oder Hipster oder irgendeine andere Ikone präsentiert, doch war das nicht Jacobs Art. Er wagte nicht mehr als einen Hinweis auf sein Unangepasstsein. Er lächelte leicht und etwas verwundert. Anscheinend gefiel ihm die ganze Aufregung, die auf jeden Fall die Langeweile des Schulalltags durchbrach.
Als wir den Gehsteig gegenüber der Schule erreicht hatten, nahm uns eine Gruppe von Müttern in Empfang, deren Kinder alle mit Jacob in einer Klasse waren. Die Energischste, Lebhafteste und natürliche Anführerin der Gruppe war Toby Lanzman, der ich anlässlich der Schiwa bei den Rifkins begegnet war. Sie trug eine glänzende schwarze Trainingshose, ein eng sitzendes T-Shirt und eine Baseballmütze, durch deren Loch sie ihren Pferdeschwanz gezogen hatte. Toby war fitnesssüchtig. Ihr schlanker Körper und das magere Gesicht verrieten ihre Leidenschaft für das Joggen. Auf die Väter wirkte ihre Durchtrainiertheit zugleich aufregend und einschüchternd, auf jeden Fall wirkte sie belebend. Meiner Meinung nach war sie die herausragendste Persönlichkeit hier. Sie war genau die Freundin, die man in einer schwierigen Situation zur Seite haben möchte. Jemand, der zu einem hält.
Während Toby die Gruppe von Müttern anführte, war Laurie ihr emotionales Zentrum – ihr Herz und vermutlich auch ihr Verstand. Laurie war jedermanns Vertraute. Wenn irgendetwas schieflief, wenn eine von ihnen ihren Job verlor oder der Ehemann auf Abwege geriet oder ein Kind in der Schule Probleme hatte, wandte man sich an Laurie. Zweifellos fühlten sie sich von der gleichen Eigenschaft angezogen wie ich: Laurie besaß Empathie, eine warmherzige Intelligenz. Manchmal überkam mich das unbestimmte Gefühl, dass diese Frauen meine Rivalinnen waren, dass sie genau das Gleiche von ihr wollten wie ich (Zuwendung, Liebe). Und als ich sie so versammelt sah, gleichsam als Abbild einer Familie, mit Toby in der Rolle des gestrengen Vaters und Laurie als warmherzige Mutter, konnte ich nicht umhin, mich ein wenig eifersüchtig und ausgeschlossen zu fühlen.
Toby nahm uns in den kleinen Kreis auf dem Gehsteig auf und begrüßte jeden von uns dreien nach einem Protokoll, das ich niemals ganz verstanden habe: für Laurie eine Umarmung, einen Kuss auf die Wange für mich – mwah, flüsterte sie in mein Ohr – und einfaches Hallo für Jacob. »Ist das alles nicht furchtbar?« Sie seufzte.
»Ich stehe unter Schock«, gestand Laurie, froh, sich im Kreis ihrer Freundinnen zu befinden. »Ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.« Ihr Gesicht drückte mehr Verwirrung als Trauer aus. Sie vermisste in dem Geschehen jeden Sinn.
»Und du, Jacob?« Toby wandte ihren Blick Jacob zu, fest entschlossen, den Altersunterschied zu überspielen. »Wie geht’s dir?«
Jacob zuckte mit den Schultern. »Gut.«
»Wieder bereit für die Schule?«
Er ging über die Frage mit einem weiteren, noch ausgiebigeren Schulterzucken hinweg – er zog die Schultern ganz weit nach oben und ließ sie dann einfach fallen –, um ihr zu zeigen, dass ihm klar war, dass sie ihn wie einen kleinen Jungen behandelte.
»Du machst dich besser auf den Weg, Jake, sonst kommst du zu spät. Du musst auch noch durch die Sicherheitskontrollen, vergiss das nicht«, mahnte ich.
»Okay, alles klar.« Jacob verdrehte die Augen, als ob diese ganze Aufregung um die Sicherheit der Kinder nichts als ein weiterer Beweis für die unendliche Dummheit der Erwachsenen wäre. Hatten die denn nicht begriffen, dass es dafür längst zu spät war?
»Jetzt geh schon«, forderte ich ihn mit einem verständnisvollen Lächeln auf.
»Keine Waffen, keine scharfen Gegenstände?«, feixte Toby. Sie zitierte eine Anweisung der Schulleitung, die per E-Mail herausgegangen war und verschiedene neue Sicherheitsmaßnahmen für die Schule aufführte.
Mit seinem Daumen zog Jacob seinen Rucksack ein paar Zentimeter von der Schulter. »Nur Bücher.«
»Alles klar. Und jetzt los, lern was.«
Jacob winkte den Erwachsenen zu, die ihm mit einem gutmütigen Lächeln antworteten, und trottete dann durch die Polizeiabsperrung hindurch zu den anderen Schülern, die auf dem Weg zum Eingang waren.
Als er uns verlassen hatte, fiel von allen die falsche Fröhlichkeit ab, Beklemmung machte sich breit. Sogar bei Toby. »Hat sich jemand um Dan und Joan Rifkin gekümmert?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte Laurie.
»Das sollten wir tun. Nein, das müssen wir.«
»Diese armen Leute. Unvorstellbar.«
»Uns allen fehlen die Worte, nehme ich an.« Das kam von Susan Frank, der einzigen Frau in der Gruppe in Berufskleidung, in dem für Anwältinnen typischen grauen Wollkostüm. »Was soll man auch sagen? Was um Himmels willen kann man jemandem nach einem derartigen Schlag sagen? Das ist zu niederschmetternd.«
»Nichts«, pflichtete Laurie bei. »Mit Worten kann man nichts lindern. Aber es spielt auch keine Rolle, was man sagt, es ist wichtig, dass man sich um sie kümmert.«
»Sie sollen nur wissen, dass man an sie denkt«, wiederholte Toby in anderen Worten. »Das ist alles, was man tun kann, sie wissen lassen, dass man an sie denkt.«
Zuletzt meldete sich Wendy Seligman zu Wort und fragte mich: »Was meinen Sie, Andy? Sie beschäftigen sich doch die ganze Zeit mit derartigen Dingen. Sie reden doch nach solchen Ereignissen mit den Angehörigen.«
»Meistens sage ich gar nichts. Ich halte mich an den Fall, alles andere lasse ich außen vor. Denn da kann ich nicht viel ausrichten.«
Wendy nickte enttäuscht. Sie hielt mich für einen Langweiler, für einen dieser Ehemänner, die man eben in Kauf nehmen muss, als die schlechtere Hälfte des Paars sozusagen. Laurie hingegen lag sie zu Füßen. Sie schien in jeder der drei unterschiedlichen Rollen, welche diese Frauen zu erfüllen hatten – als Ehefrau, als Mutter und nicht zuletzt als sie selbst – zu glänzen. Und wenn Laurie mich anziehend fand, dann musste ich versteckte Qualitäten haben, die ich nicht offenbaren wollte, dachte Wendy. Vielleicht weil ich sie langweilig und der Mühe einer richtigen Unterhaltung nicht wert fand. Wendy war geschieden, sie war die einzige Geschiedene oder Single in diesem Grüppchen und nahm nur allzu leicht an, dass andere Fehler an ihr suchten.
Toby versuchte die Stimmung aufzulockern. »Die ganzen Jahre über haben wir versucht, unsere Kinder von Spielzeugwaffen, Gewaltsendungen im Fernsehen und Gewaltvideos fernzuhalten. Bob und ich haben den Kindern nicht einmal Wasserpistolen erlaubt, wenn sie nicht aussahen wie etwas völlig anderes. Und dann haben wir sie auch nicht Pistolen genannt, sondern Wasserspritzen oder so ähnlich, so als ob die Kinder keine Ahnung hätten. Und jetzt das. Es ist ...« In komischer Verzweiflung hob sie die Hände.
Doch der Witz kam nicht an.
»Die reine Ironie«, stimmte Wendy düster zu, damit Toby nicht meinte, man hätte ihr nicht zugehört.
»Stimmt genau«, seufzte Susan, ebenfalls um Toby einen Gefallen zu tun.
»Ich glaube, wir überschätzen unseren Einfluss als Eltern«, meinte Laurie. »Dein Kind ist so, wie es ist. Du musst nehmen, was du bekommst.«
»Dann hätte ich den Kindern diese blöden Wasserpistolen in die Hand drücken sollen?«
»Vermutlich. Ich weiß nicht. Was Jacob angeht ... Ich frage mich manchmal, ob all die Dinge, die wir mit ihm angestellt haben, alle unsere Bedenken am Ende wirklich so viel bewirkt haben. Er war immer schon so, wie er jetzt ist, nur in einer kleineren Ausgabe. Das ist mit allen unseren Kindern so. Keines von ihnen ist völlig anders als zu der Zeit, als es noch ganz klein war.«
»Schon, aber unsere Erziehungsmethoden haben sich auch nicht geändert. Vielleicht bringen wir ihnen einfach immer noch die gleichen Dinge bei.«
Und Wendy darauf: »Ich habe keine bestimmte Methode bei der Erziehung. Ich entscheide aus dem Bauch heraus.«
Susan: »Ich auch. Das machen wir doch alle so. Alle außer Laurie. Du hast wahrscheinlich einen bestimmten Erziehungsstil, Laurie. Toby, du auch.«
»Das stimmt nicht!«
»Doch, das stimmt schon! Du hast wahrscheinlich Ratgeber gelesen.«
»Ich nicht.« Laurie hob ihre Hände in einer Geste der Unschuld. »Wie auch immer, ich glaube, wenn wir behaupten, dass wir unsere Kinder formen, damit sie so oder anders werden, dann machen wir uns etwas vor. Das meiste ist angeboren.«
Die Frauen warfen sich Blicke zu. Vielleicht war das bei Jacob so, aber bei ihren Söhnen nicht. Auf jeden Fall nicht so wie bei Jacob.
Wendy fragte: »Hat irgendjemand von euch Ben gekannt?« Sie meinte Ben Rifkin, das Mordopfer. Sie hatten ihn alle nicht gekannt. Sie nannten ihn beim Vornamen, um ihm näher zu sein.
Toby: »Nein. Dylan war niemals mit ihm befreundet. Und Ben hat auch nie Sport gemacht oder so was.«
Susan: »Er war ein paarmal mit Max in derselben Klasse, da habe ich ihn gesehen. Wirkte wie ein netter Junge, aber was wissen wir schon?«
Toby: »Die Kids haben ihr eigenes Leben. Die haben bestimmt auch ihre Geheimnisse.«
Laurie: »Genau wie wir. In dem Alter waren wir auch so.«
Toby: »Ich war ein braves Mädchen. In dem Alter hatten meine Eltern keine Probleme mit mir.«
Laurie: »Ich war auch brav.«
Ich schaltete mich ein: »So brav nun auch wieder nicht.«
»Doch, bis ich dir begegnet bin. Du hast mich verdorben.«
»Ach ja? Na, dann bin ich darauf ziemlich stolz. Das muss in meinen Lebenslauf.«
Doch Scherze waren unangebracht, wurde mir dann klar, gerade war der Name des toten Jungen gefallen. Ich kam mir vor den Frauen, die so viel sensibler waren als ich, ungehobelt und taktlos vor.
Es folgte kurzes Schweigen, dann platzte Wendy heraus: »Mein Gott, diese armen, armen Leute! Die Mutter! Und uns fällt nichts Besseres ein als ›das Leben geht weiter, auf zur Schule‹, und ihr Sohn wird niemals wiederkommen.« Tränen traten in Wendys Augen. Dieser Schrecken: Eines Tages, wenn auch nicht durch unsere Schuld ...
Toby trat vor, um ihre Freundin zu umarmen, und Laurie und Susan streichelten ihren Rücken.
Ich stand noch einen Augenblick da, ausgeschlossen und mit einer nicht sehr intelligenten und freundlichen Miene. Und bevor die ganze Situation noch bedrückender wurde, verabschiedete ich mich, um nachzusehen, was an der Sicherheitskontrolle vor dem Schuleingang los war. Wendys Trauer um einen Jungen, den sie kaum gekannt hatte, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Für mich war sie einfach ein weiterer Beweis für die emotionale Verfassung von Frauen. Und dass Wendy meine Worte von der vorhergehenden Nacht wie ein Echo in den Mund genommen hatte – »das Leben geht weiter« –, machte sie in einer Auseinandersetzung, die wir gerade beigelegt hatten, zu einer Verbündeten von Laurie. Genau der richtige Augenblick für einen Rückzug.
Ich machte mich zur Sicherheitskontrolle auf, die im Foyer der Schule eingerichtet worden war. Er bestand aus einem langen Tisch, auf dem Mäntel und Rucksäcke von Polizisten aus Newton per Hand durchsucht wurden, und außerdem gab es noch einen Bereich, in dem je zwei männliche und zwei weibliche Polizisten die Kids mit einem Metalldetektor absuchten. Jake hatte recht gehabt: Die Veranstaltung war einfach lächerlich. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass irgendjemand eine Waffe mit zur Schule bringen würde oder dass der Mörder überhaupt in irgendeiner Verbindung zur Schule stand. Man hatte den Jungen nicht einmal auf dem Schulgelände gefunden. Die ganze Show fand nur für die verängstigten Eltern statt.